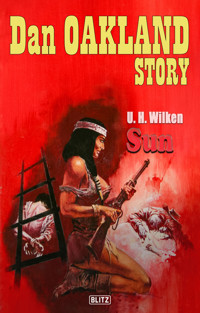Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Sie kommen ohne Pferd, einzeln und lautlos – graue Schatten in der Nacht. Sie sehen einander nicht, können sich nicht mehr durch Zeichen verständigen. Jeder ist auf sich allein gestellt. Jeder ist bewaffnet. Jeder hält Dynamitstangen in der Faust. Die bewaffneten Posten patrouillieren nach festem Wachplan. Das flackernde Licht der zwei Stalllaternen fällt auf die staubbedeckten blauen Uniformen. Die Schritte reiben durch den Sand. Manchmal fällt ein leises, dumpfes Wort. Wie ein Klotz steht das Depot am Ende der Straße. Hier lagert Schießpulver für schwere Kanonen, stehen Lebensmittel für die weit im Südosten kämpfenden Unionstruppen bereit, wartet eine Unmenge von Munition auf den Abtransport. Licht fällt auf die Straße. Dort drüben lärmt es, stehen viele gesattelte Pferde vor den Häusern, bewegen sich mehr als hundert Yankees. Eine schicksalhafte Nacht im Hinterland des Feindes. Und sie kommen näher. Die lautlosen Schatten der Männer wischen über den Boden, verharren, gleiten weiter. Fünf Männer, die Pflicht, Aufopferung und kalten Hass nicht mehr voneinander trennen können. Eine kleine Gruppe von verwegenen Männern, die den Tod verachten und doch für ihr Land, für den Süden, leben wollen. Während dieser erbarmungslose und größte aller Bruderkriege das Land im Osten und Süden zerstört, während Feuer den einst fruchtbaren Boden ausglüht und Tausende von Frauen, Kindern und Verwundeten immer weiter nach Süden fliehen, handeln diese fünf Männer im Rücken der Nordstaaten-Armeen, riskieren Kopf und Kragen und nähern sich immer mehr dem Depot des Nordens, der dieses Land besetzt hat. Tagelang haben Cash Sharkey und seine Männer das Depot beobachtet, haben die kleinen Truppenbewegungen gesehen, die
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 141 –Die Verwegenen
U.H. Wilken
Sie kommen ohne Pferd, einzeln und lautlos – graue Schatten in der Nacht. Sie sehen einander nicht, können sich nicht mehr durch Zeichen verständigen. Jeder ist auf sich allein gestellt. Jeder ist bewaffnet. Jeder hält Dynamitstangen in der Faust. Die bewaffneten Posten patrouillieren nach festem Wachplan. Das flackernde Licht der zwei Stalllaternen fällt auf die staubbedeckten blauen Uniformen. Die Schritte reiben durch den Sand. Manchmal fällt ein leises, dumpfes Wort.
Wie ein Klotz steht das Depot am Ende der Straße. Hier lagert Schießpulver für schwere Kanonen, stehen Lebensmittel für die weit im Südosten kämpfenden Unionstruppen bereit, wartet eine Unmenge von Munition auf den Abtransport.
Licht fällt auf die Straße. Dort drüben lärmt es, stehen viele gesattelte Pferde vor den Häusern, bewegen sich mehr als hundert Yankees.
Eine schicksalhafte Nacht im Hinterland des Feindes.
Und sie kommen näher. Die lautlosen Schatten der Männer wischen über den Boden, verharren, gleiten weiter.
Fünf Männer, die Pflicht, Aufopferung und kalten Hass nicht mehr voneinander trennen können. Eine kleine Gruppe von verwegenen Männern, die den Tod verachten und doch für ihr Land, für den Süden, leben wollen.
Während dieser erbarmungslose und größte aller Bruderkriege das Land im Osten und Süden zerstört, während Feuer den einst fruchtbaren Boden ausglüht und Tausende von Frauen, Kindern und Verwundeten immer weiter nach Süden fliehen, handeln diese fünf Männer im Rücken der Nordstaaten-Armeen, riskieren Kopf und Kragen und nähern sich immer mehr dem Depot des Nordens, der dieses Land besetzt hat.
Tagelang haben Cash Sharkey und seine Männer das Depot beobachtet, haben die kleinen Truppenbewegungen gesehen, die Zeiten der Postenablösung festgehalten und sich ihre Chance ausgerechnet.
Und nun, in dieser Nacht, da Wolken über den Himmel ziehen, sind sie bis auf wenige Yards ans Depot herangekommen.
Jeder weiß, was er zu tun hat. Jeder ist bereit, das höchste Opfer zu bringen.
Cash Sharkey erreicht als Erster die Wand des Depots, kauert sich nieder und schiebt Dynamitstangen unter die hölzerne Wand des großen Lagers. Rechts und links von ihm gleiten die Männer ans Depot heran. Messer schaben leise, bohren Löcher unter die Wand. Dynamitstangen liegen bereit.
Sharkey löst in fieberhafter Eile ein paar Bretter, zwängt sich hindurch, klemmt Dynamit unter ein Pulverfass, rollt die Zündschnur aus, wirft das Ende ins Freie. Vorn ertönt eine Stimme. Ein anderer Posten antwortet. Höchste Zeit zu verschwinden, denn gleich wird ein Posten nach hinten kommen. Ihm wird ein zweiter in kurzem Abstand folgen.
Noch einmal blickt Sharkey forschend umher. Er sieht die Pulverfässer, die Munitionskisten, Tonnen mit Reis und noch viele andere Dinge, die eine kämpfende Armee braucht. Von der Straße sickert schwaches Licht durch ein paar Bretterfugen. Ein großer leerer Frachtwagen steht dicht vor dem breiten Tor.
Er verzieht das magere Gesicht. Die Yankees sind allzu leichtsinnig. Sie wiegen sich in Sicherheit und vertrauen ihrer Macht und Stärke. Niemand aus dem niedergeworfenen Volk dieses Südstaates wird es riskieren, auch nur einen Blaurock anzuspucken – geschweige denn, ein bewaffnetes Depot in die Luft zu jagen.
Doch genau das werden Cash Sharkey und seine Männer tun. Sie haben den Auftrag, alle wichtigen Schienenstränge hochzujagen, die auf ihrem Weg ins Ungewisse liegen, alle Depots zu vernichten, wenn sie eine Chance dazu haben.
Denn auf den Schienen rollen die Waggons, kommt der Nachschub für die Fronten im Osten und Süden – und jeder Transport wird später vielen Südstaatlern das Leben kosten.
Es gilt, die Nachschubwege des Nordens zu zerstören, und die Transporte zu lähmen.
Es sind fünf Männer, die jeden Tag, jede Nacht und jede Sekunde mit dem Tod rechnen müssen.
Männer, die tapfer und einsam sind, einsam inmitten der Yankee-Truppen, die das Land besetzt halten.
Und nun, in dieser Nacht, hat Cash Sharkey seinen Männern und sich selber den Befehl gegeben, das Depot hochzujagen.
Er horcht.
Einer der Posten geht schon los, um die vorgeschriebene Runde ums Depot zu machen.
Sharkey zwängt sich wieder ins Freie. Ein leiser Zischlaut ertönt. Flammen flackern auf. Zündschnüre beginnen zu glimmen. Sharkeys Leute ziehen sich zurück.
In diesem Moment kommt der Posten um die Ecke. Sharkey steht dicht vor ihm, wie aus dem Boden gewachsen. Ehe der Posten einen warnenden Schrei ausstoßen kann, schlägt Sharkey auch schon zu, fängt den Bewusstlosen auf und zerrt ihn mit. Er verliert Zeit. Die Zündschnüre zischen leise. Das Feuer frisst sich schnell unter der Wand hindurch.
Nur noch Sekunden bis zur Detonation.
»Captain!«
Leise und scharf ist die Stimme. Einer der Männer ruft Sharkey. Sie können sich in der Nacht kaum sehen. Sharkey lässt den Posten zu Boden fallen und läuft geduckt los.
Vier Sekunden, drei, zwei …
Bäume tauchen auf, ein paar alte Ställe. Sharkey wirft sich hin. Hinter ihm fliegt das Depot mit ohrenbetäubendem Krach in die Luft, ein Feuerblitz erhellt die Nacht, es knallt, kracht, faucht und jault wild. Schreie gellen durch die Nacht. Schüsse peitschen plötzlich. Im Nu ist die Hölle los. Die Pulverfässer gehen hoch, die Munition beginnt zu knattern, Holzteile wirbeln durch die Luft, Feuerschlangen zucken umher.
Sharkey kriecht auf allen vieren unter die Bäume, springt dann auf und hetzt weiter.
Vor ihm laufen seine Leute, vier Mann, Soldaten des Südens wie er, tollkühn und besessen, dem Krieg die große Wende zu geben, damit der Süden doch noch gewinnt.
Nacheinander gehen immer neue Pulverfässer hoch. Das Depot ist zusammengebrochen. Feuerbälle durchstoßen die brennenden Trümmer und jagen hoch empor.
Im zuckenden Feuer erkennt Sharkey, wie die Nordstaaten-Soldaten in ihrem Camp umherhasten und die Pferde einfangen.
Er keucht vom schnellen Lauf. Endlich sieht er ihre Pferde vor sich. Er schwingt sich in den Sattel. Seine Leute sind schon auf den Pferden. Durch die Bäume zuckt es grell und rot. Es riecht nach verbranntem Pulver und Holz.
Wild stampfen die Pferde.
Die rauen Männer sehen Sharkey an.
Da ist Jimmy Boyd, der jüngste Mann. Er ist blass. Schweiß glänzt auf seinem schmalen Gesicht, in dem die erbarmungslose Zeit ihre Spuren hinterlassen hat. Seine Augenlider flattern wie im Fieber.
Dann Tom Coldwell, ein paar Jahre älter, schwarzhaarig, Sohn eines Texaners und einer Mexikanerin. Steif sitzt er im Sattel und hält ein Gewehr.
Etwas hinter ihm hockt der bullige Frank Burnett auf dem Pferd. Sein Vater, einst Fährmann auf dem Big Muddy, ist gefallen. Frank hasst die Yankees wie sonst nichts auf der Welt.
Der vierte Mann heißt Jesse Lane. Er ist in diesem Land groß geworden. Er kennt hier jedes Nest. Als Freiwilliger ist er in die Armee eingetreten. Der Auftrag hat ihn nun wieder nach Missouri geführt. Sein Arm steckt in einer Schlinge. Die Schulter ist blutverkrustet. Sharkey hat ihm vor zwei Tagen, als Jesse sich auf Erkundungsritt befand und von Yankees angeschossen wurde, die Kugel herausgeholt. Es geht ihm nicht gut.
Sie alle wissen, wohin sie zu reiten haben. Jeder wird allein reiten und sich durchzuschlagen versuchen.
Sharkey blickt kurz zurück. Sein scharfes Profil hebt sich vor dem flammenden Rot deutlich ab. Er nickt, sieht die Männer an und sagt mit heiserer Stimme: »Viel Glück, Männer!«
»Viel Glück, Captain«, murmelt Frank Burnett.
Irgendwo klopft dumpfer Hufschlag.
Die Yankees suchen.
»Reitet«, sagt Sharkey rau. »Schlagt euch durch. Ich will jeden von euch wiedersehen.«
Sie nicken stumm, reißen die Pferde herum und jagen los, jeder nimmt einen anderen Weg.
Ihre Wege verlaufen im weiten Land.
*
Lynn Harpers horcht. Ihr dunkles fein geschnittenes Gesicht befindet sich im Lichtschein des Kerzenständers. Das schwarze Haar schimmert seidig und weich, fließt auf die bloßen Schultern und berührt das Abendkleid.
Draußen rollt ein Wagen vorbei. Die Achsen quietschen und ächzen. Jemand flucht verhalten.
Lynn braucht nicht hinauszusehen, um zu wissen, wie es auf der nächtlichen Straße aussieht.
Überall lümmeln Horden von Farbigen. Schwarze, die mit ihrer jäh gewonnenen Freiheit nichts anzufangen wissen. Yankees prägen das Gesicht dieser kleinen Stadt, die vor dem Krieg vergessen schien. Am Rande der Stadt steht das Zeltcamp der Soldaten. Am Ende der Straße stehen zwei Galgengerüste. Die Erhängten sind vor ein paar Tagen heruntergeholt worden. Der neue Stadtkommandant, ein Yankee, hat mit jenen Männern, die selbst noch kämpfen, als Missouri längst besetzt war, kurzen Prozess gemacht und sie öffentlich hängen lassen. Nun duckt sich diese kleine Stadt in Angst, und kein Einwohner wagt sich in die Saloons, wo die Yankees lärmen. Die Besitzer der Saloons, des Stores und des Frachtwagenhofes sind enteignet worden. Es sieht schlimm aus in dieser Stadt, die so weit von der Front im Osten und Süden entfernt ist.
Lynn Harpers ist allein im Haus.
Ihr Vater ist im Krieg, ihre Mutter arbeitet im Hause des Stadtkommandanten, weil es ihr befohlen worden ist.
Sie kann nicht klagen, es geht ihr gut. Sie wird von den Yankees mit Respekt behandelt, und ein Yankee-Offizier macht ihr sogar den Hof. Er hat sie für heute Abend eingeladen. Es soll ein Tanz stattfinden, drüben im großen Gemeindehaus. Lynn weiß längst, dass sie dieser Einladung folgen muss. Und es ist auch etwas Seltsames mit ihr geschehen, sie kann den jungen Yankee-Offizier nicht hassen. Sie fühlt eine Zuneigung, die sie selber erschreckt, die selbst den Hass zwischen Nord und Süd überbrückt.
Vielleicht liebt sie den jungen Offizier sogar. Sie wehrt sich immer wieder gegen ihre Gefühle, doch sobald sie ihn sieht, hat sie nur Augen für ihn, für sein offenes und braun gebranntes Gesicht – und sie sieht die blaue Uniform nicht mehr.
Und sie horcht immer wieder und glaubt manchmal, seine Schritte vor dem Haus zu vernehmen.
Aus der Nacht kommt ein Reiter. Er sitzt zusammengesunken im Sattel und starrt vor sich hin. Zwischen den Häusern ist Licht. Dunkel liegen die Hinterhöfe im Schatten der Häuser.
Stimmengewirr schlägt ihm entgegen. Mühsam richtet er sich auf, zieht den schweren Revolver und hält ihn krampfhaft in der Faust.
Leise schlagen die Hufe des abgetriebenen Pferdes auf den trockenen Boden. Kaum hörbar rasselt das Zaumzeug.
Der Reiter hütet sich, ins Licht zu kommen. Er nähert sich von hinten den Häusern. Zwischen den Zelten flackern Feuer. Leute brüllen und johlen, Yankees.
Dann liegt ein Hof vor ihm. Er lenkt das Pferd an den alten windschiefen Stall heran und sitzt ab, fällt schwer mit dem Rücken gegen die Bretterwand und atmet rasselnd. Er kneift die Augen zusammen, strafft sich und geht am Stall entlang, stolpert über einen leeren Eimer und kann sich gerade noch auffangen. Es scheppert laut. Er erstarrt, hat den Revolver gepackt und horcht.
Lynn Harpers ist beim Scheppern des Eimers zusammengefahren. Sie hat das Geräusch nur schwach vernommen. Starr blickt sie in den Spiegel. Plötzlich verlässt sie den Raum und tastet sich den schmalen Gang zur Hintertür entlang.
Vorsichtig öffnet sie die Tür und späht hinaus. Dunkel liegt der Hof vor ihr. Niemand ist zu sehen. Sie tritt ins Freie und bewegt sich langsam über den Hof. Da gleitet das Stalltor knarrend auf. Sie erschrickt. Dunkel gähnt das offene Stalltor. Kein Laut ertönt.
»Ist da jemand?«, ruft sie leise und mit einer ihr selbst fremden Stimme.
Keine Antwort.
Langsam nähert sie sich dem Stall, versucht hineinzusehen.
Plötzlich knackt es drinnen, irgendwer fällt schwer gegen die Box, und ein Pferd schnauft dumpf.
Und eine leise, gepresste Stimme ruft: »Lynn!«
Sie schluckt mühsam. Sollte es doch William Tayer sein? Ist er auf dem Weg hierher niedergeschlagen worden? Hat er sich vielleicht bis in den dunklen Stall schleppen können?
Nein. Er würde nicht mit einem Pferd kommen.
»Lyon, komm her!«, krächzt eine Stimme. »Keine Angst, Lynn. Ich bin es, Jesse Lane.«
»Jesse!« Fast ist es ein Schrei. Sie stürzt in den Stall und sieht einen Mann, der sich an der Box festhält. Er stöhnt leise auf und versucht, sich aufzurichten. Sie berührt ihn am Arm. Er zuckt zusammen.
»Nicht, Lynn, der Arm …«
Sie lässt sofort los. Ihr Atem geht schnell. Das Herz schlägt ihr bis zum Hals.
»Mein Gott, Jesse Lane«, flüstert sie. »Was ist geschehen? Ich dachte, du seiest im Krieg, irgendwo im Osten?«
Er verzieht das schweißnasse Gesicht.
»Ich war im Krieg, Lynn. Ich war überall und habe für unser Land gekämpft. Jetzt ist Schluss damit. Ich bin wieder hier.«
»Himmel, bist du geflohen, Jesse?« Ihre Stimme schlägt um, sie tritt etwas zurück.
»Nein, nein, sie waren hinter mir her, Yankees. Ich konnte nicht mehr zurück. Du musst mir helfen, Lynn. Mein Arm ist dick angeschwollen. Die Wunde ist verdreckt. Ich brauche heißes Wasser, Lynn.«
Sie hat sich wieder gefasst. Ihre Gedanken wandern den langen Weg in die Vergangenheit zurück. Als der Krieg ausbrach, verließ Jesse Lane das Haus seiner Eltern. Auch sein Vater musste wenig später zur Waffe greifen. Jesse Lanes Elternhaus steht leer, aber schon bald werden sich Yankees dort eingenistet haben.
»Dein Vater ist noch nicht zurück, Jesse.«
Er nickt stumm. Er fragt nicht nach seiner Mutter, aber sie erkennt doch in seinen Augen die quälenden Zweifel.
»Deine Mutter ist tot, Jesse. Sie starb, als du davongeritten warst. Es tut mir sehr leid, Jesse.«
Er starrt zu Boden. In seinem Gesicht zuckt es einmal.
»Sie war schon lange krank, Lynn«, sagt er dumpf. »Sie quälte sich. Sie bekam keine Luft. Ich hätte noch bleiben sollen. Aber ich wollte mit dabei sein, wenn wir die Yankees …« Er bricht ab und sieht sie fragend an.
Sie nickt langsam.
»Überall sind die Yankees schon, Jesse. Wohin du auch siehst, überall. Sie haben unser Land besetzt. Sie hatten es leicht mit Missouri. Sie stießen kaum auf Widerstand. Nur ein paar alte stolze Einwohner stellten sich ihnen entgegen. Ein paar von ihnen sind aufgehängt worden.«
»Und dein Vater, Lynn?«
Sie zuckt die Achseln.
»Er ist noch nicht zurück. Und Mutter arbeitet im Haus des Stadtkommandanten. Sie muss es tun. Aber es geht ihr nicht schlecht. Wir haben keine Not zu leiden.«
»Bring mich ins Haus, Lynn.«
Sie zögert.
»Was ist los, Lynn?«, fragt er heiser. »Willst du mir nicht helfen?«
»Doch, Jesse. Sag nicht so etwas, hörst du? Aber wir haben Yankees in der Stadt. Heute ist Tanz. Man wird mich gleich holen.«
Er sieht sie ernst und prüfend an.
»William ist ein netter Kerl«, sagt sie sofort, als müsste sie sich verteidigen. »Nicht jeder Yankee ist ein Lump, Jesse. Auch die Yankees kämpfen, so wie du und die anderen.«
»Verstehe.«
»Nichts verstehst du, nichts. Warum siehst du mich so an, Jesse Lane? Hattest du erwartet, dass ich mit der Waffe gegen die Yankees kämpfen würde?«
»Lynn«, seine Stimme ist schwer und schleppend. »Lynn, weißt du noch, dass du mich einmal heiraten wolltest?«
»Es ist lange her, Jesse, über drei Jahre, ich habe dir nichts versprochen.«
»Ja, ich weiß. Aber wenn du diesen Yankee liebst, Lynn, dann will ich sofort wieder weg, verstehst du?«
»Sei kein Narr, Jesse Lane. Komm, gehen wir ins Haus.«
Er presst die Lippen zusammen, nickt etwas schwach und folgt ihr ins Freie. Sie überqueren den Hof. Lynn geht voraus. Im kleinen Küchenraum setzt er sich auf den harten Stuhl. Er beobachtet sie, wie sie Feuer macht und den Kessel mit Wasser auf die Herdstelle rückt. Sie dreht sich um und sieht ihn seltsam an.
»Du siehst sehr schön aus, Lynn«, murmelt er.
Sie streicht mit fahriger Bewegung über das hübsche Kleid, sagt aber kein Wort.
»Du wirst mächtig viel Chancen bei den Yankees haben«, fügt er hinzu.
»Hör auf«, sagt sie leise.
»Doch, und du wirst die Chancen auch nutzen. Vielleicht bin ich in deinen Augen ein Deserteur, Lynn. Vielleicht auch ein tapferer Kerl. Wer weiß. Aber du wirst mir irgendwann sagen, dass es besser sei, wieder zu verschwinden.«
In ihren Augen flammt der Zorn auf.
»Muss ich mir das anhören, Jesse Lane?«, fragt sie scharf. »Bist du nur gekommen, um mich zu beleidigen? Oh, du hast noch immer nicht begriffen, was in diesem Land geschehen ist. Die Yankees sind hier, Jesse Lane. Sie bestimmen, was getan wird. Sie verlangen Gehorsam. Ich muss auch an meine Mutter denken. Ihr geht es nur so gut, weil ich mit diesem Yankee-Offizier gehe. Willst du mir das vorwerfen, Jesse Lane?«
Er senkt den Blick.
»Lassen wir das, Lynn«, murmelt er dunkel. »Wir wollen uns nicht gegenseitig anklagen. Ich werde bald wieder verschwinden. Ich will dir nicht im Weg stehen.«
»Du stehst mir nicht im Weg, Jesse«, erwidert sie leise. »Diese schlimme Zeit wird vorübergehen. Es wird auch einmal wieder eine bessere Zeit für uns geben.«
Sie schweigen.
Draußen ertönen Stimmen. Schritte kommen am Haus vorbei. Lynn wird ein wenig unruhig. Das Wasser beginnt zu summen.
»Zeig deinen Arm, Jesse.«
Er reißt das zerfetzte Hemd am Arm vollends herunter und löst den Verband.
Beim Anblick der Wunde wird Lynn etwas blass. Der Arm ist dick angeschwollen, und verkrustetes Blut bedeckt ihn völlig.
»Eine Yankee-Kugel«, knurrt er grimmig.
»Ist sie raus?«
»Ja. Du musst die Wunde sauberwaschen, Lynn. Wirst du es schaffen?«
Sie nickt beherzt.
Dann macht sie sich an die Arbeit. Er verzieht kaum das Gesicht. Sie merkt, dass er sie betrachtet. Vorsichtig säubert sie die vereiterte Wunde. Er sitzt ruhig auf dem Stuhl. Er zeigt nicht seinen Schmerz. Sie macht es sehr sorgfältig und legt schließlich einen sauberen Verband an.
»Du hast Glück gehabt, Jesse.«
»So schnell bringt mich nichts von den Beinen, Lynn.«
Sie räumt alles weg und wirft den alten Verband ins Feuer. In diesem Moment klopft es draußen an die Haustür. Lynn sieht Jesse Lane starr an. Er kommt langsam vom Stuhl hoch.