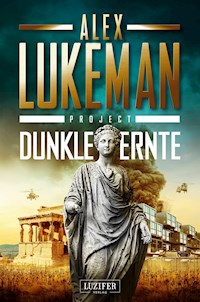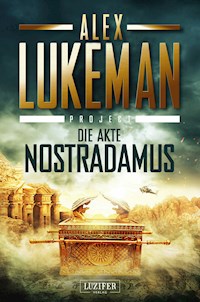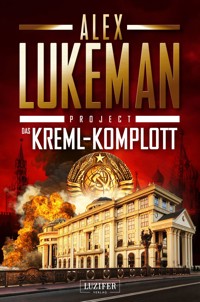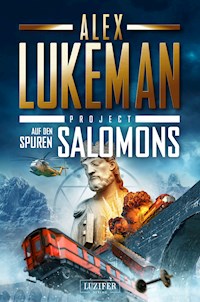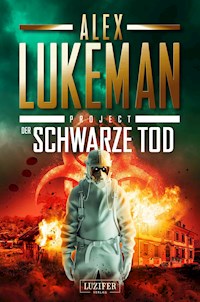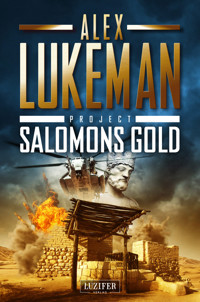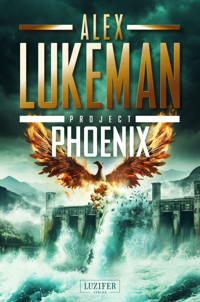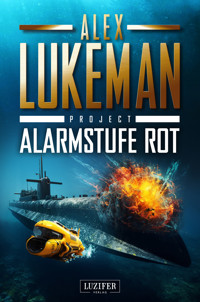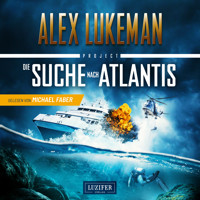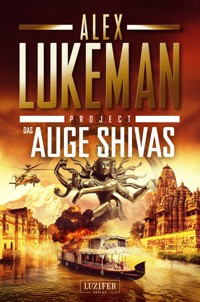
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Project
- Sprache: Deutsch
Verschollene Reliquien, mystische Schätze und geheimnisvolle Artefakte – begeben Sie sich zusammen mit der streng geheimen Regierungsorganisation PROJECT auf die weltumspannende Jagd nach den letzten Rätseln der Menschheit. Während einer Mission auf den Philippinen stoßen Nick Carter und das PROJECT im Lager von Terroristen auf mysteriöse antike Goldmünzen. Durch diese Entdeckung gerät das PROJECT-Team ins Visier eines gnadenlosen Terroristenführers, der von der Errichtung eines islamischen Kalifats in Indien träumt. Offenbar gehören die Münzen zu einem legendären Schatz, der im 18. Jahrhundert aus Indien geraubt wurde. Unter diesen gestohlenen Artefakten befindet sich auch ein sagenumwobener Juwel – das Auge Shivas. Doch ein dem Tode geweihter Spion hat es sich zur letzten Aufgabe gemacht, diesen zu finden, denn der Legende nach birgt er die Macht, die Feinde Indiens zu vernichten … "Alex Lukeman schreibt mit einem sicheren Gespür für filmische Atmosphäre. Seine fesselnden Romane mit ihren griffigen Plots sind einfach absolute Hits." - MCSFilm Review Team
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Das Auge Shivas
Project – Band 8
Alex Lukeman
übersetzt von Peter Mehler
Copyright © 2017 by Alex Lukeman
Dieses Werk ist Fiktion. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln vervielfältigt, verbreitet oder übertragen werden, außer nach vorheriger und ausdrücklicher Genehmigung des Autors. (Dieses Werk ist Fiktion.) Namen, Charaktere, Organisationen, Orte, Ereignisse und Vorfälle sind entweder vom Autor frei erfunden oder als fiktives Element verwendet. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen lebenden oder toten Personen ist rein zufällig.
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: THE EYE OF SHIVA Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Peter Mehler Lektorat: Manfred Enderle
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-630-6
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis
»I am created Shiva, the Destroyer, Death, the shatterer of worlds.«
– aus der Bhagavad-Gita
Kapitel 1
Regen aus dem Südchinesischen Meer prasselte in einem monotonen Rhythmus auf das Blätterdach des Dschungels über ihnen. Nick Carter presste sich seine MP5 fester an die Brust und wünschte, er würde endlich aufhören. Das Wasser fiel in satten Strömen durch die Blätter hinab und rann ihm den Rücken hinab.
Der Regenwald stank nach Fäulnis und Matsch und Hitze. Vor ihm bewegten sich Soldaten des philippinischen Special-Forces-Regiments lautlos durch eine scheinbar endlos zwielichtig grüne Welt. Weitere folgten ihm. Der Pfad unter Nicks Füßen hatte sich in einen matschigen Brei verwandelt, rutschig und durchzogen mit trügerischen Wurzeln und Ranken, die nur darauf warteten, ihn stolpern zu lassen.
Aber die Wurzeln und Ranken waren noch seine geringsten Probleme. Wenn man über eine Wurzel stolperte, konnte man sich im schlimmsten Fall den Knöchel verstauchen. Trat er aber auf eine Mine oder löste eine Sprengfalle aus, würde das sein letzter Schritt sein.
Der Zielort war eine verlassene Kautschukplantage auf Mindanao, die von der Abu Sayyaf übernommen worden war – einer brutalen dschihadistischen Terrorgruppe, die quer über die Insel eine Spur aus kopflosen Leichen und ausgebombten Marktplätzen hinterließ. Alle anderen islamistischen separatistischen Bewegungen auf der Insel hatten kürzlich einem Friedensabkommen mit der Regierung zugestimmt. Die Antwort der Abu Sayyaf an Manila bestand darin, ihre Terroranschläge noch zu intensivieren.
Die Terroristen verfügten über eine Menge Geld und benutzten es, um sich die modernsten Waffen zu kaufen. Es gab Gerüchte, dass sie eine Allianz mit den Taliban eingegangen waren. Wenn diese Geschichten stimmten, würde das einem internationalen Terrorbündnis aus der Hölle gleichkommen. Eben diese Gerüchte und die unbekannte Geldquelle waren der Grund, weshalb sich Nick nun durch den philippinischen Regenwald kämpfte.
Offiziell war er nicht hier. Wenn etwas schieflief, würde es keine posthumen Medaillen oder Ansprachen über Heldenmut geben, wenn sie begruben, was immer von ihm noch übrig sein würde.
Der Anführer der Filipinos war ein kleiner, muskulöser Mann namens Rafael Gabuyo. Captain Gabuyo hatte das Army Ranger Training in Fort Benning absolviert und wusste, was er tat, was für Nick eine Sache weniger bedeutete, um die er sich Sorgen machen musste. Zuvor hatte Gabuyo seinen Sergeant vorausgeschickt, um den Zielort auszukundschaften. Nick sah, wie der Mann zurückkehrte. Der Captain gab das Zeichen zum Halt und winkte Nick nach vorn. Die drei Männer standen zusammen auf dem Pfad. Wasser tropfte von den Krempen ihrer tarnfarbenen Kopfbedeckungen. Nicks grüne Tarnuniform war vom Schweiß und dem Regen bereits dunkel angelaufen.
Mit über eins-achtzig und neunzig Kilo ließ Nick die Filipinos winzig erscheinen. Die Hitze und Feuchtigkeit des Dschungels wickelte sich wie eine feuchte Faust um ihn. Die Art, wie sich das Geräusch des Regens veränderte, der auf die Blätter traf, signalisierte ihnen, dass der Regen langsam nachließ.
Man muss Gott auch für Kleinigkeiten danken, dachte Nick.
»Wir sind ganz nah«, erklärte Gabuyo.
Seine Stimme klang sanft, gedämpft von der schwülwarmen Luft. Er zog ein zusammengefaltetes schwarz-weißes Satellitenfoto aus seinem Uniformhemd und klappte es auseinander. Es zeigte die Überreste der Plantage. Ein großes Haus, welches einmal das Wohnquartier des Aufsehers und seiner Familie gewesen war, befand sich noch immer am Rand des Dschungels. Der Regenwald holte sich das Land zurück, aber das Haus und ein weiter, offener Bereich davor waren noch immer sichtbar. Gleichmäßige Reihen vergessener Kautschukbäume zogen sich ins dichte Unterholz zurück. Neben dem Gebäude parkten Fahrzeuge. Ein gewundener, schmaler Pfad führte von dem Haus zu dem mehrere Meilen entfernt liegenden nächsten Highway.
Gabuyo fuhr mit dem Finger über das Foto und hielt am Rand der Freifläche inne.
»Der Pfad, auf dem wir uns nähern, endet hier«, sagte er. »Ein paar hundert Meter von hier entfernt.«
»Wachen?«, fragte Nick.
»Sergeant Ramirez meldete nur eine.« Er deutete auf den Punkt, wo der Pfad auf die Lichtung führte.
»Ich sah noch zwei weitere Männer vor dem Gebäude herumlaufen«, sagte der Späher. »Sie trugen Kalaschnikows bei sich. Ich kann nicht sagen, wie viele sich in dem Gebäude befinden. An der Seite des Hauses stehen zwei Land Rover. Außerdem gibt es noch einen Toyota Pick-up mit einem schweren, auf die Ladefläche montierten Maschinengewehr. Der parkt vor dem Haus.«
»Die Lieblingskutsche jedes Terroristen«, sagte Nick. »Wie wollen Sie es angehen, Captain?«
Gabuyo sah auf die Uhr. »Es wird bald dunkel. Von vorn können wir uns nicht nähern, das Gelände ist zu offen. Der Dschungel ist bis nahe an die Rückseite des Gebäudes herangewachsen. Wir schalten den Wachposten auf dem Pfad aus und pirschen uns von der Rückseite heran, dann werfen wir ein paar Granaten durch die Fenster. Danach sollte es ein Kinderspiel sein.«
Nick dachte darüber nach. Hübsch einfach, nicht zu kompliziert. Einfach war gut. Das sollte klappen. Aber er wusste, dass, wenn der Angriff begonnen hatte, selbst einfache Pläne schnell kompliziert werden konnten.
»Geben Sie den anderen Bescheid«, sagte Gabuyo. »Wir ziehen in fünf Minuten weiter.«
»Ja, Sir.« Der Sergeant verschwand.
Gabuyo sah Nick an. »Wenn wir reingehen, will ich Sie nur als Rückendeckung dabei haben. Das ist eine philippinische Operation. Sie sind als Beobachter hier. Ihre Anwesenheit ist sekundär.«
Nick hatte nichts anderes erwartet. Er hatte nichts dagegen, dass zur Abwechslung mal andere den Kopf bei einem Angriff hinhalten mussten.
»Verstanden, Captain.«
Gabuyo nickte knapp. »Gut«, sagte er. »Gehen wir.«
Sie folgten dem Pfad und Nick spürte den Adrenalinschub. Sein Körper vibrierte von plötzlicher Energie. Er war nur ein Beobachter, aber das wussten die Terroristen nicht. Es gab nichts, was dem Adrenalinkick vor einem Feuergefecht gleichkam, so süchtig machend wie eine Droge. Sein Mund war ausgetrocknet und er nahm tiefe Atemzüge, während er lief, um sich zu beruhigen. Zu viel des Guten würde ihn umbringen.
Das Signal zum Halt drang bis zu ihm zurück, und er kauerte sich auf den Boden und wartete. Das Geräusch des Regens hatte zu einem entfernten Plätschern von Tropfen auf den Blättern nachgelassen. Ein Vogel sang in der Ferne, dann ein weiterer. Ein silberner Nebel begann, vom Boden des Dschungels aufzusteigen.
Sie setzten sich wieder in Bewegung, vorbei an der Leiche des Wachmannes, der mit weit offenen, starren Augen am Rand des Weges lag. Seine Kehle war weit und tief aufgeschnitten worden und seine Brust mit Blut besudelt.
Eine Minute später erspähte Nick die Lichtung. Das alte Plantagenhaus war ein langes, aus Baumstämmen errichtetes Rechteck mit einer überdachten Veranda auf der Vorderseite. Das Dach war an einem Ende eingefallen. Das Fundament bröckelte und das Gebäude hatte bereits begonnen, sich zu neigen. Rauch stieg aus einem Schornstein in der Mitte des Dachs auf. Er sah die geparkten Land Rover und den bewaffneten Toyota. Auf der Veranda war niemand zu sehen.
So weit, so gut, dachte er, sie sind alle drin.
Gabuyos Männer huschten wie lautlose Gespenster durch die Bäume. Der Captain begab sich an die Rückseite des Hauses und entsicherte eine Granate.
Dann lief etwas schief.
Eine Automatiksalve drang aus dem Haus und traf den Filipino in die Brust. Gabuyo wurde zurückgerissen. Die Granate flog ihm aus der Hand und detonierte. Zwei seiner Männer wurden von der Explosion erfasst und gingen zu Boden.
Weitere Schüsse drangen aus dem Gebäude. Kugeln peitschen mit dem Geräusch von zerreißendem Papier durch das Laub über Nicks Kopf. Die Filipinos erwiderten das Feuer. Die Geräusche des Dschungels gingen im Bellen der Sturmgewehre unter.
An das, was danach geschah, konnte er sich später nur noch undeutlich erinnern.
Er sprintete aus der Deckung, rannte zur vorderen Ecke des Hauses und sprang auf die Veranda. Ein Mann mit einer Kalaschnikow kam aus dem Haus. Nick erschoss ihn und stürmte zur Eingangstür. Er zog den Stift aus einer Granate, warf sie durch die geöffnete Tür und brachte sich in Sicherheit.
Die Granate schleuderte Rauch und Trümmer aus der Tür. Nick lehnte sich zur Tür hinein und erschoss die erste Person, die er erblickte. Kugeln schlugen dicht an seinem Kopf in den hölzernen Türrahmen ein und ließen Holzsplitter auf ihn herabregnen. Ein bärtiger Mann in einem losen weißen Hemd und Baggy Pants schoss mit einer Pistole auf ihn. Nick feuerte eine Dreischusssalve ab, die sein weißes Hemd rot verfärbte, den Schützen zurücktrieb und dann zusammensinken ließ. Seine Pistole schlitterte über den Boden. Nick rannte durch den Raum bis zu einem bogenförmigen Durchgang und spähte von dort in den nächsten Raum hinein. Leichen lagen am Boden. Zwei Männer feuerten durch ein offenes Fenster auf die Filipinos. Einer von ihnen wirbelte herum und gab eine Salve ab, die Nick mit Holzsplittern und Putz eindeckte.
Er duckte sich zurück und warf eine Granate in den Raum. Die Explosion ließ das gesamte Gebäude erzittern und brachte einen Teil des Dachs zum Einsturz.
Er riskierte noch einen Blick. Es sah aus, als hätte jemand eine Bombe in einem Schlachthaus gezündet. Die weiß getünchten Wände waren mit Blut und Fleischfetzen überzogen.
Auf engstem Raum konnte eine Granate eine furchtbare Waffe sein.
Das war das letzte Zimmer in dem Haus. Nick ließ sein Gewehr sinken. Draußen ebbte das Geräusch der Schüsse ab.
»Gesichert«, rief er. Dann blickte er sich um.
Ein Essen hatte auf der Feuerstelle im Hauptraum vor sich hin gekocht. Der Topf war in die Flammen übergelaufen und der Geruch von verbranntem Essen erinnerte Nick daran, wie hungrig er war.
Gabuyos Sergeant kam mit zwei seiner Männer in das Gebäude und ließ seinen Blick über die verstreut herumliegenden Leichen wandern. Dann wandte er sich Nick zu.
»Dafür brauchte es Cojones«, sagte er. »Ich glaube, Sie sind ein bisschen verrückt, aber danke.«
»Kein Problem. Das mit ihrem Captain tut mir leid.«
»Ja. In zwanzig Minuten sind wir wieder verschwunden. Weshalb auch immer Sie hier sind – Sie sollten besser mit der Suche beginnen. Wenn wir gehen, werden wir hier alles abfackeln.«
»Verstanden«, erwiderte Nick.
Nick begann, die Leichen um ihn herum zu durchsuchen, fand aber nichts von Wert. Er lief in den Hauptraum. Ein großer Tisch lag dort auf der Seite. Eine Zigarrenkiste war von dem umgestürzten Tisch gefallen und hatte seinen Inhalt auf dem Boden verteilt. Im rauchigen Licht des Feuers schimmerte etwas und Nick beugte sich hinunter, um es näher in Augenschein zu nehmen.
Gold.
Ein Dutzend Goldmünzen lag über den Boden verstreut. Nick fragte sich, wann er das letzte Mal außerhalb eines Münzgeschäfts echte Goldmünzen gesehen hatte. Die Antwort war einfach.
Nie.
Er hob eine von ihnen auf. Sie war rund, etwas unregelmäßig geformt, und sah alt aus. Arabische Schriftzeichen bedeckten beide Seiten. Er hob auch die restlichen Münzen auf und verstaute sie in einem Sammelbeutel. Dann begann er, die Leichen der toten Terroristen zu durchsuchen, suchte nach Handys, Briefen, allem, was nützlich sein konnte. Er fand ein Wegwerftelefon und steckte es in seine Tasche. Ein paar Dokumente ließ er ebenfalls in einen Sammelbeutel wandern. Dann trat er zu der Leiche des Mannes mit der Pistole und dem weißen Hemd und begann, auch ihn zu durchsuchen.
Der tote Mann trug eine Kippa und einen ungepflegten Vollbart, der ihm bis über die Brust reichte. Er war groß und sah nicht nach einem Filipino aus, eher wie ein Pakistani oder Afghane.
Vielleicht ist an den Gerüchten um die Zusammenarbeit der Taliban mit der Abu-Sayyaf-Gruppe ja etwas dran, dachte Nick.
Ein Stoffsäckchen hing an einem geflochtenen Riemen um den Hals des bärtigen Mannes. Nick riss es ab und öffnete es. Darin befand sich eine weitere Goldmünze. Nick steckte sie zurück und schob sich das Säckchen in die Tasche mit dem Handy. Das meiste von dem, was er gefunden hatte, würde er den Filipinos übergeben, aber wollte, dass sich Harker eine der Münzen selbst ansehen konnte.
Der tote Mann besaß ein modernes Satellitentelefon. Nick steckte auch dieses ein, um es mit zurück nach Virginia zu nehmen. Er zog eine Kamera hervor und begann, die Gesichter der toten Terroristen zu fotografieren. Wenn sich einer von ihnen in der Computerdatenbank zu Hause befand, konnten sie ihn identifizieren. Es war immer gut, zu wissen, welche ihrer Feinde keine Probleme mehr verursachen würden.
Er war hierhergekommen, weil die bösen Jungs eine Menge Geld für schicke Waffen ausgaben und jeder wissen wollte, woher das Geld stammte. Nun besaß er zwar etwas von dem Geld, aber ansonsten war er genauso klug wie zuvor, was die Quelle anbelangte. Nick war nicht sicher, wie viel eine der Münzen wert war, aber es musste eine Menge sein.
Der Sergeant kam zur Tür herein. Nick hörte das Geräusch eines Hubschraubers, der sich näherte.
»Zeit, aufzubrechen«, sagte der Filipino.
Nick sah sich ein letztes Mal um. »Ich bin hier fertig«, erwiderte er.
Als der Hubschrauber abhob, war das alte Plantagengebäude bereits von Flammen umgeben. Nick sah zu, wie der Schein des Feuers langsam in der Dunkelheit unter ihm verschwand. Der Adrenalinrausch war verschwunden, und die übliche darauffolgende Müdigkeit hatte eingesetzt. Ein tiefer und starker Schmerz steckte ihm in den Knochen. Es fiel ihm immer schwerer, sich von diesen Missionen zu erholen, oder sich dafür zu motivieren.
Du wirst langsam zu alt dafür, dachte er bei sich. Das ist ein Spiel für junge Leute.
Manchmal sehnte er sich nach einem Ort, wo ihn niemand kannte oder sich nicht für ihn interessierte. Zum vielleicht tausendsten Mal rief er sich ins Gedächtnis, dass das, was er tat, etwas bewirkte. Das glaubte er immer noch.
Er musste es einfach glauben.
Kapitel 2
»Ein Jahr, mehr oder weniger.«
Doktor Singh legte den Umschlag mit den Testresultaten beiseite und sah Ashok Rao nicht ohne Mitgefühl an. Die Hintergrundgeräusche Neu-Delhis drangen durch ein geöffnetes Fenster herein.
Seltsam, dachte Singh. Der Mann zeigt keinerlei Reaktion.
»Und Sie sind absolut sicher?«, erkundigte sich Rao. »Ein Fehler ist ausgeschlossen?«
»Ich fürchte ja. Der Tumor ist inoperabel. Die Kopfschmerzen werden nun häufiger auftreten. Schließlich werden sie immer wieder das Bewusstsein verlieren.«
»Wird es schmerzhaft werden?«
»Ja, und dazu Übelkeit. Orientierungslosigkeit. Wie bei einer Migräne. Ich werde Ihnen Medikamente verschreiben. Die Symptome werden in ein paar Monaten stärker. Mit der Zeit werden Sie immer mehr Probleme damit bekommen, richtig zu funktionieren. Sind Sie verheiratet?«
»Nein.«
»Dann schlage ich vor, Sie treffen die notwendigen Vorbereitungen, solange Sie dazu noch in der Lage sind.«
»Vorbereitungen?«
»Für die Sterbebegleitung.« Singh besaß genug Anstand, um sich dabei unwohl zu fühlen.
Rao hörte Singh zu, wie dieser sein Todesurteil verkündete, und widerstand dem Drang, die Arme nach ihm auszustrecken und ihn zu erwürgen. Nach außen hin ließ er sich nichts von seiner Wut anmerken. Er hatte schon vor langer Zeit gelernt, seine wahren Gefühle zu verbergen. Zurückhaltung bedeutete Sicherheit.
Rao war der Leiter des Büros für Sondereinsätze im Research and Analysis Wing der indischen CIA. Er führte ein Netzwerk aus Spionen, Informanten und Militäreinheiten an, die gezielte Attentate, Operationen unter falscher Flagge und Einsätze zur Terrorismusbekämpfung ausführten. In Indien war Rao ein mächtiger Mann. Doch selbst diese Macht konnte den wachsenden Krebs in seinem Gehirn nicht aufhalten.
Rao hörte Singh kaum zu, während dieser die folgenden Termine und Tests erläuterte. Er wusste, dass er den lieben Doktor nie wiedersehen würde.
Wenn die Nachricht von Raos Erkrankung die Agency erreichte, würde man ihn ins Abseits schieben und zwingen, den Dienst zu quittieren. Die Tests und Unterlagen liefen auf einem falschen Namen und Doktor Singh war der Einzige, der wusste, wie Rao aussah. Um Doktor Singh würde er sich also kümmern müssen.
Ein paar Minuten später stand Rao auf dem Gehsteig vor Singhs Gebäude. Am liebsten hätte er die vorbeihastenden Menschen angeschrien. Seht mich an! Ich lebe! Aber das tat niemand. Hätte es jemand von ihnen getan, hätte er nur einen weiteren ältlichen Beamten in einem zerknitterten Anzug erblickt. Rao war 61 Jahre alt. Für sein Alter, so glaubte er, war er noch in bester Verfassung. Dann, vor ein paar Monaten, hatten die Kopfschmerzen begonnen. Und nun das.
Er winkte sich ein Taxi heran, einen glänzenden schwarz-gelben Ambassador.
»Zum Shiva-Tempel in der Nähe des Marktes an der Peshwa-Road. Kennen Sie ihn?«
»Klar kenne ich ihn«, antwortete der Taxifahrer.
Zwanzig Minuten später zog Rao seine Schuhe aus und stellte sie vor dem Tempeleingang ab, bevor er ihn betrat. Der Tempel an der Peshwa Road war nicht einer der größten Tempel in Neu-Delhi, aber er beherbergte eine Shiva-Statue, die unter den vielen tausenden in der Stadt einzigartig war. Im Inneren des Tempels war es dämmrig und ruhig, ein Kontrast zu dem grellen Licht und dem Lärm draußen. Der Boden unter seinen Füßen bestand aus kühlem Stein, glatt gerieben von den Füßen der Gläubigen, die seit Jahrhunderten zum Gebet hier einkehrten. Über ihm stieg die Decke in einer perfekten stufigen Pyramide in den Himmel auf. Die Luft war schwer von dem intensiven, süßen Duft tausender Blumen.
Das Herz des Tempels bestand aus einer uralten Statue Shivas in seiner erzürnten Gestalt, jenem Gott, der aus seinem dritten Auge göttliches Feuer und karmische Vergeltung entfesseln konnte. Die Figur thronte auf den zerschmetterten Leibern erschlagener Dämonen. Vier Arme schwangen furchterregende Waffen. Ein Gürtel aus Schädeln war um Shivas Hüfte geschlungen und giftige silberne Schlangen wanden sich um seinen Hals.
In Shivas Stirn war eine leere Einfassung für das dritte Auge gemeißelt worden. Vor Jahrhunderten war dieses Loch mit einem riesigen Rubin gefüllt gewesen. Das Juwel war im sechzehnten Jahrhundert von einem muslimischen Herrscher gestohlen und dann während der Plünderungen Delhis im Jahre 1739 aus der Schatzkammer des Herrschers entwendet worden. Seither galt er als verschollen.
Rao kam oft in diesem Tempel, um das Abbild der Gottheit zu betrachten und sich an den Verrat der Moslems zu erinnern. Für Rao war das Auge ein Symbol für das Herz Indiens, geschändet von den Muslimen, die das Land auseinandergerissen hatten, um die Monstrosität Pakistan zu schaffen. Eine Prophezeiung kündete vom Untergang der Feinde Indiens, wenn das Auge an seinen Platz zurückkehrte. In den letzten Jahren war Rao immer mehr davon besessen, das verlorene Juwel zu finden.
Rao kniete sich vor die Statue. Er wollte gerade mit seiner Meditation beginnen, als er spürte, dass er beobachtet wurde. Er drehte sich um und sah einen gutgekleideten Inder regungslos in der Nähe stehen.
Die knorrigen Hände des Mannes ruhten auf dem goldenen Griff eines Gehstocks aus poliertem Rosenholz. Sein Hemd war in einem perfekten weichen Cremeton gehalten. Goldene Manschettenknöpfe zierten seine Handgelenke. Darüber trug er einen teuren grauen Anzug. Seine Haut war von einem hellen Braun. Er war dünn, mit hohen Wangenknochen und dunklen Augen, und sein Gesicht von den Jahren zerfurcht. Rao hatte den Mann noch nie zuvor gesehen. Er wäre ihm aufgefallen, wenn er ein regelmäßiger Besucher des Tempels gewesen wäre.
»Viele suchen Shiva auf.« Die Stimme des Mannes war leise, aber machtvoll. »Aber nur wenige träumen davon, das Auge an seinen rechtmäßigen Platz zurückzubringen.«
»Woher wissen Sie das?« Rao war entsetzt. Er hatte niemandem von seiner Obsession berichtet.
»Ich weiß eine Menge über Sie, Direktor Rao.«
Raos Herz begann, in seiner Brust zu hämmern. Er stand auf und spähte zu dem Eingang viele Meter entfernt. Nur wenige Menschen wussten, wo er sich gerade befand. Rao hielt nach der verräterischen Beule einer Waffe unter der maßgeschneiderten Anzugjacke Ausschau, konnte aber keine entdecken. Die Hände des Mannes ruhten auf seinem Gehstock. Außerdem war er zu alt, um ein Attentäter zu sein. Von ihm schien keine Gefahr auszugehen.
»Sie wissen, wer ich bin, und haben mir daher etwas voraus«, sagte Rao. »Wer sind Sie? Was wollen Sie?«
»Mein Name ist Krivi. Und ich will dasselbe wie Sie. Ich repräsentiere eine Organisation, die Ihnen gern dabei helfen würde.«
Rao lachte, aber es lag keine Heiterkeit darin. »Was für eine Organisation? Sie wissen doch gar nicht, was ich will.« Er musste an Doktor Singh denken. »Und davon abgesehen gibt es nicht mehr viel, was mir noch helfen kann.«
»Oh, aber das tut es«, antwortete der Mann im Anzug. »Wir wissen um Ihren Gesundheitszustand. Es stimmt, wir können Sie nicht heilen, aber wir können die schlimmsten Folgen noch für einige Zeit aufhalten und Ihnen die Schmerzen nehmen. Unsere Expertise auf medizinischem Gebiet liegt weit über den üblichen Möglichkeiten. Das wird Ihnen die nötige Zeit verschaffen, das zu vollbringen, wonach Sie sich so sehr sehnen.«
Rao konnte nicht glauben, dass dieser Mann von seiner Krankheit wusste. Niemand wusste davon. Er selbst hatte es erst vor einer Stunde herausgefunden.
»Und was ist es, wonach es mich Ihrer Meinung nach verlangt?«
»Die Zerstörung Pakistans. Rache für den Tod Ihrer Familie.«
Rao war sprachlos. Das stimmte. Raos Frau und Sohn waren vor Jahren gestorben, während eines Anschlags muslimischer Terroristen mit dem Ziel, Indien aus Kaschmir zu vertreiben. Die Operation war mit dem Segen der ISI geplant und durchgeführt worden, Pakistans Inter-Services Intelligence Agency. Rao verabscheute Pakistan. Er verabscheute alle Muslime, ganz besonders die Dschihadisten.
Schließlich fand er seine Stimme wieder. »Eine Organisation will mir helfen? Wieso mir? Welche Organisation?«
»Wir sind eine Gruppe von Patrioten, die mit den Maßnahmen unserer Regierungen bezüglich Islamabad unzufrieden sind. So wie Sie, Ashok. Wir beabsichtigen, etwas dagegen zu unternehmen. Es ist unsere Intention, einen Krieg mit Pakistan zu provozieren. Unser Ziel ist es, Indien wieder zu vereinen und uns das Land zurückzuholen, das uns während der Teilung gestohlen wurde.«
Rao sah sich um. Es war niemand in der Nähe, der ihre Unterhaltung hören konnte.
»Das ist Verrat. Ich könnte Sie dafür verhaften lassen.«
Krivi lachte. »Verrat ist relativ. Wir beide wissen, dass Sie mich nicht festnehmen lassen werden. Sie fragten, wer wir sind.« Er deutete auf die Statue. »Wir nennen uns Das Auge Shivas. Wir sind ein Instrument der Rache Indiens.«
Rao betrachtete den feinen Anzug, den polierten Gehstock und die teuren Schuhe, alles deutliche Anzeichen für Wohlstand. In Indien, wie beinahe überall, bedeutete Wohlstand Macht. Krivi war ein ernsthafter Mann.
»Sie haben mir noch nicht verraten, was Sie als Gegenleistung wollen.«
»Sie sind in der einzigartigen Position, uns helfen zu können«, sagte Krivi. »Sie verfügen über ein weitverzweigtes Netzwerk aus Agenten. Sie kennen die Geheimnisse dieser Regierung, was sie tut, was sie plant. Sie können beinahe jeden ausfindig machen und verfolgen. Das sind alles nützliche Werkzeuge. Als Gegenleistung können wir ihnen weitere sechs Monate geben, vielleicht mehr. Bevor Ihre Zeit abgelaufen ist, werden Sie sich gerächt haben. Sie werden der Held eines neuen Indiens sein.«
Krivi bot ihm etwas an, wovon jeder hinduistische Nationalist in Indien träumte. Zu schön, um wahr zu sein, dachte Rao.
»Woher weiß ich, dass es Ihnen ernst ist? Wieso sollte ich Ihnen glauben?«, fragte Rao.
»Eine gute Frage. Ich kann verstehen, dass Sie skeptisch sind. Ich nehme an, dass sie nicht besonders glücklich über den Umstand sind, dass Doktor Singh Sie identifizieren kann?«
Rao schwieg.
»Dann habe ich wohl recht«, fuhr Krivi fort. »Als Geste des guten Willens werden wir uns für Sie um diese kleine Unannehmlichkeit kümmern.«
Er reichte Rao eine weiße Visitenkarte aus schwerem Leinenpapier. Das Einzige, was sich auf der Karte befand, war eine Telefonnummer, in eleganten schwarzen Lettern eingeprägt.
»Rufen Sie diese Nummer an, wenn Sie bereit sind. Benutzen Sie ein verschlüsseltes Telefon.«
Ray sah auf die Karte hinunter und dachte nach. Als er wieder aufblickte, war Krivi bereits am Eingang des Tempels.
»Warten Sie«, rief Rao.
Als Rao die Straße erreichte, stieg Krivi in das hintere Ende einer silbernen Mercedes-Limousine mit getönten Scheiben ein. Der Wagen fuhr davon. Das Nummernschild war nicht zu erkennen.
Am nächsten Tag las Rao in der Zeitung von einem Feuer in Doktor Singhs Gebäude. Das Haus war völlig ausgebrannt und sechs Menschen dabei gestorben, unter ihnen Doktor Singh. Krivi hatte Wort gehalten. Wer immer er auch sein mochte – seine Organisation war skrupellos und effizient. Rao wusste Skrupellosigkeit und Effizienz zu schätzen.
Rao rief die Nummer auf der Karte an.
»Treffen Sie mich im Bhuta Jayanti Park«, sagte Krivi. »Kennen Sie den Pavillon neben dem Tempel?«
»Ja«, antwortete Rao.
»Dann sehen wir uns morgen. Vierzehn Uhr.«
Rao steckte sein Telefon ein.
Auf der anderen Seite von Neu-Delhi, im obersten Stockwerk eines der neuen Kommerztempels, die überall in der Stadt aus dem Boden schossen, legte Krivi sein Handy auf dem polierten Konferenztisch ab und wandte sich zu dem Mann, der ihm gegenübersaß.
Johannes Gutenberg trug einen maßgeschneiderten italienischen Anzug aus einem Material, welches dem durchschnittlichen Kunden nicht zugänglich war. Das Jackett passte perfekt über seine schmale Brust und schuf den Eindruck eines größeren, noch mächtigeren Mannes. Gutenberg gehörte eine der ältesten und größten Banken Europas. Mit dem Erfinder des Buchdrucks hatte er nichts gemein, obwohl er zu schätzen wusste, dass man mit Gutenbergs Erfindung milliardenweise frische, saubere Euro- und Dollarscheine produzieren konnte.
»Rao hat einem Treffen zugestimmt«, sagte Krivi.
»Gut. Dann hat er Ihnen die Geschichte über eine Gruppe von Patrioten abgekauft?«
»Es ist das, was er hören wollte. Er nimmt an, dass wir indische Nationalisten sind, so wie er. Wahrscheinlich hätte er seine Meinung geändert, wenn er ihr europäisches Gesicht gesehen hätte.«
Gutenberg lachte. »Sie sind ja ein verkappter Rassist, Krivi.«
Krivi zuckte mit den Schultern. »Wie die meisten.«
»Die Menschen treffen ihre Annahmen immer basierend auf dem, was sie hören wollen«, sagte Gutenberg. »Glauben Sie, dass er einen Weg findet?«
»Vielleicht müssen wir ihm ein paar Vorschläge unterbreiten, aber ja, ich denke, das wird er. Er ist motiviert.«
Gutenberg nickte. »Möglicherweise wird er davor zurückschrecken, die Raketen abzufeuern, wenn der Zeitpunkt gekommen ist.«
»Das ist möglich, aber wir haben einige Zeit damit zugebracht, seine Psychologie zu verstehen. Er wird es tun. Zuerst werden wir ihn etwas Staub aufwirbeln lassen. Wenn die Dinge in Bewegung geraten sind, wird es leichter sein.«
»Wenn er seinen Job richtig macht, wird es die Regierung für ihn übernehmen.«
»Das ist richtig«, sagte Krivi, »aber ich überlasse die Dinge ungern dem Zufall. Rao ist unsere erste Wahl.«
»Jeder weiß, dass indische Raketen ungenau sind«, sagte Gutenberg. »Wenn einige von ihnen in China landen, wird man es auf fehlerhafte Technik schieben.«
»Die Raketen werden dort landen, wo sie sollen«, sagte Krivi. »Die Lektion wird schmerzhaft sein. Peking wird Jahre brauchen, um sich davon zu erholen.«
»Wir haben sie gewarnt«, sagte Gutenberg abfällig und mit einer Spur Verachtung. »Sie glauben, sie könnten ihren eigenen Weg gehen und sich in das Finanzsystem einmischen. Sie verstehen nicht, mit wem sie es zu tun haben. Es wird allerhöchste Zeit, dass sie lernen, wer das Sagen hat.«
»Auf gewisse Weise kann ich es ihnen auch nicht verübeln. Wir haben unsere Existenz sehr lange geheim gehalten«, sagte Krivi. »Es ist bedauerlich, dass ihre Führer nicht hören wollten.«
Gutenberg sah auf seine Uhr, eine Patek-Phillipe. »Ich muss zurück nach Genf.«
»Werden Sie die anderen unterrichten?«
»Selbstverständlich.«
Gutenberg stand auf. Krivi erhob sich ebenfalls.
»Es war schön, Sie wiedergesehen zu haben, Johannes.«
»Ebenfalls. Sie sollten endlich wieder nach Hause kommen.«
»Ich werde kommen, bevor der Krieg beginnt. Sagen Sie Marta, dass ich das Essen ihres Kochs vermisse.«
Die beiden Männer schüttelten sich die Hände. Nachdem Gutenberg gegangen war, musste Krivi an Martas Desserts und die feine, reichhaltige Schweizer Schokolade denken.
Er liebte Schokolade.
Kapitel 3
Selena Connor hielt sich nicht für stur. Eher entschlossen. Und bestand ein Unterschied zwischen stur und entschlossen, oder etwa nicht? Im Fitnessraum in der unterirdischen Ebene des PROJECT-Hauptquartiers war es dank der Klimaanlage kühl, aber Selenas Körper glänzte schweißnass.
Seit der Verletzung in Mexiko, die sie beinahe umgebracht hatte, versuchte sie, wieder ihr Fitnesslevel vor der Operation zu erreichen. Die Kugel hatte einen Rückenwirbel gestreift und sie beinahe für den Rest ihres Lebens in einen Rollstuhl verdammt. Es hatte Monate gedauert, bevor sie ein erstes leichtes Training riskieren durfte. Ihr Rücken schmerzte immer noch jeden Abend, egal, was sie dagegen unternahm.
Ihre Stärke war zurück, der Teil von ihr war wieder in Ordnung. Was sie jedoch nervte, war, dass sie noch immer nicht die Höhe und Schnelligkeit erreichte, die sie für die tödlichen Tritte ihrer Martial-Arts-Übungen benötigte.
Sie zielte einen Tritt auf den von der Decke hängenden Dummy, dorthin, wo sich die Kehle eines Angreifers befinden würde. Ihr Fuß landete fünfzehn Zentimeter darunter. Sie fluchte in sich hinein und wiederholte den Tritt, mit dem gleichen Ergebnis. Der schwere Sandsack zitterte und schwang von dem Treffer herum. Sie hätte ihren Gegner damit einmal quer durch den Raum befördert, aber darum ging es ihr nicht. Worum es ihr ging, verdammt noch mal, war, ihren Fuß an ihrem Ziel genau dorthin zu platzieren, wohin sie ihn haben wollte.
Selena fuhr sich mit dem Arm über die Stirn und strich eine Haarsträhne beiseite.
Am anderen Ende des Fitnessraums trainierte Nick an einer der Nautilus-Maschinen. Die Narben an der Seite seiner Brust warfen Falten, während er die Gewichte der Maschine zusammenschob. Er grunzte vor Anstrengung. Er brachte die Maschine in die Ausgangsstellung zurück und wischte sich mit einem Handtuch den Schweiß von der Stirn.
»Wie wäre es mit einer Pause?«, schlug er vor. Er war vor zwei Tagen von den Philippinen zurückgekehrt, hatte ihr aber immer noch nicht gesagt, was sie hören wollte.
Selena visierte den Sandsack für einen weiteren wütenden Tritt an. Nach zwei Jahren schwieriger Beziehung hatte Nick ihr schließlich einen Antrag gemacht. Aber nun schien es ihr, als würde er kalte Füße bekommen. Er konnte sich nicht für einen Hochzeitstermin entscheiden. Er konnte sich nicht dazu durchringen, ihr einen Hochzeitsring zu kaufen. Das fing an, sie zu nerven. Sie holte zu einem furiosen Tritt gegen den Dummy aus und verfehlte ihr Ziel nur um etwa fünf Zentimeter. Besser, dachte sie, aber noch nicht gut genug.
Nick lief zu der Bank an der Wand, holte zwei Flaschen Wasser und kam zu ihr. Mit neununddreißig und straff auf die Vierzig zugehend fiel ihm das Training zunehmend schwerer. Aber das würde er vor Selena nie zugeben.
Er nahm einen Schluck Wasser. »Wieso gönnst du dem Sandsack nicht eine Pause und suchst dir jemanden, der zurücktreten kann?«, fragte er.
Sie bedachte ihn mit einem gefährlichen Lächeln. Selena besaß die Art von Gesicht, nach dem sich die Leute auf der Straße umdrehten. Ihre Augen waren manchmal tiefblau, manchmal auch violett – eine ungewöhnliche Färbung wie aus einem Gemälde von van Gogh oder Picasso. Die Farbe wurde von ihrem rötlich-blonden Haar komplementiert. Einer ihrer Wangenknochen saß ein wenig höher als der andere. Sie hatte einen Schönheitsfleck direkt über der rechten Seite ihrer Oberlippe. Selena war eine attraktive Frau.
»Du lernst es nie, was?«, fragte sie. »Du weißt, dass ich dich über die Matratze treten kann.«
»Du kannst es zumindest versuchen«, antwortete Nick.
»Wie geht es deiner Hand?«, erkundigte sie sich.
Die letzten beiden Finger seiner linken Hand waren ihm vor ein paar Monaten von einem von Fidel Castros sadistischen Polizisten gebrochen worden. Sie waren verheilt, aber immer noch steif, und schmerzten. Er besaß nicht mehr die Beweglichkeit in ihnen wie zuvor. Und manchmal juckten die Finger.
»Das wird schon wieder«, sagte er. »Mach dir deswegen keine Sorgen.«
Selena seufzte und schüttelte den Kopf. »Ich verspreche dir, dass ich nicht Ich-hab’s-dir-ja-gesagt sagen werde, wenn wir fertig sind. Nach dir.« Sie deutete auf eine große, quadratische Matte, die sie für ihr gemeinsames Training nutzten.
Sie stellten sich auf der Matte gegenüber, verbeugten sich, und begannen. Nick war größer und schwerer als sie, aber bei jemandem wie Selena war das kein Vorteil. Was Kampfsportkünste anbelangte, war sie ihm haushoch überlegen. Sie praktizierte diese seit über zwanzig Jahren mit einem koreanischen Meister.
Die nächste halbe Stunde kämpften sie gegeneinander. Nachdem Nick zum achten oder neunten Mal mit dem Rücken auf der Matte gelandet war und ein gutes Dutzend Treffer gegen seine Rippen, die Hüfte und Beine hatte einstecken müssen, gab er sich geschlagen. Hätte sie die Schläge mit voller Kraft ausgeführt, würde er jetzt im Krankenhaus liegen, oder in der Leichenhalle. Aber das hier war nur Training. Nick hatte gesehen, wozu sie in der Lage war, wenn es darauf ankam.
»Ich gebe auf«, sagte er auf dem Boden liegend.
»Sagte ich doch.«
»Du hast versprochen, genau das nicht zu sagen.«
»Na und? Dann hab ich eben gelogen.« Sie hielt ihm ihre Hand hin und half ihm auf.
Nick sah zu der Uhr an der Wand. »Wir sollen uns in zehn Minuten mit Harker treffen.«
»Dann sollten wir uns besser frischmachen.«
Sie zogen sich aus und liefen gemeinsam unter die Dusche. Nick beobachtete sie, wie sie vor ihm lief, und musste an die Nacht denken, in der er um ihre Hand anhielt. Zu dem Zeitpunkt schien es richtig gewesen zu sein, etwas ganz Natürliches in dieser romantischen, tropischen Nacht, bei Mondlicht und dem Duft von Blumen, der durch das offene Fenster ihres Schlafzimmers hereinwehte.
Er hatte ihr noch immer keinen Ring besorgt. Auf der einen Seite wollte er sie damit überraschen. Auf der anderen Seite war es aber auch vielleicht keine schlechte Idee, wenn sie ihn gemeinsam aussuchen würden. Auch einen Termin für die Hochzeit hatten sie noch nicht festgelegt. Er war nicht sicher, wieso er das vor sich herschob, aber er war der Ansicht, dass der Ring als Erstes an der Reihe war. Danach konnten sie den nächsten Schritt angehen.
Unter dem fließenden Wasser zog er sie eng an sich heran und küsste sie.
»Hast du keine Angst, dass jemand hereinkommen könnte?«, fragte sie.
»Es ist doch nur ein Kuss.«
»Und dann noch einer, und du weißt ja, was dann passiert.«
Verdammt, es war so schwer, sauer auf ihn zu bleiben. Sie blickte an ihm hinunter und lächelte. »Siehst du, was ich meine?«
Er küsste sie noch einmal, dann lief er zu einem anderen Duschkopf und drehte das kalte Wasser auf.
Kapitel 4
Elizabeth Harker war eine kleine Frau. Mehr als ein aufgeblasener Politiker oder General hatten lernen müssen, sie deswegen nicht unterschätzen zu dürfen. Die meisten Menschen schätzten sie auf etwa fünfzig Jahre, aber es war schwer zu sagen. Die Belastungen ihres Berufes hatten vorzeitige weiße Strähnen in ihrem schwarzen Haar hinterlassen.
Harker trug eine ihrer Lieblingskombinationen, einen maßgeschneiderten schwarzen Anzug von Prada und eine leuchtend weiße Bluse mit Stehkragen. Eine schmetterlingsförmige, smaragdgrüne Anstecknadel gesäumt von kleinen Diamanten ruhte auf ihrer linken Brust. Die Brosche und zwei ebenfalls smaragdgrüne Ohrringe brachten die grüne Farbe ihrer Augen zur Geltung.
Harker leitete das PROJECT, eine kleine Geheimorganisation, die im Verborgenen operierte. Elizabeths Einheit bildete die versteckte Spitze des Schwertes des Präsidenten. Unsichtbar im Vergleich zu den Giganten in Fort Meade oder Langley, operierte das PROJECT unter dem Radar und daher außerhalb konventioneller Regeln. Die freie Hand, die ihr der Präsident überließ, hatte sie in der hart umkämpften Welt der Washingtoner Geheimdienste unbeliebt gemacht. Nick und sein Team taten Dinge, die niemand anderes tun konnte, aber diese Freiheit hatte auch ihren Preis. Alles, was Harker und ihre Einheit taten, ließ sich abstreiten. Wenn die Dinge schiefliefen, würde ihr Kopf auf dem Schafott landen. Mehr als genug ihrer Kollegen hätten sie mit Freuden dort enden sehen.
Von außen betrachtet sah das PROJECT-Hauptquartier wie ein teures Farmhaus aus. Die Ranch war nach dem Kalten Krieg von einem Millionär über einer stillgelegten Nike-Raketen-Abschussbasis errichtet worden. Die Computer, die Waffenkammer, der Fitnessraum, die Notfallwohnquartiere und das Einsatzzentrum befanden sich unter der Erde. Es gab dort sogar einen Swimmingpool. Harkers Büro befand sich im Erdgeschoss. Es war ein großer, angenehmer Raum, der auf einer Seite aus kugelsicheren Fenstern und einer Terrassentür bestand. Die Doppeltür führte auf eine Steinterrasse mit Blick über einen grünen Rasen und Blumenbeete hinaus. Ein großer Flachbildschirm hing an der Wand gegenüber von Elizabeths Schreibtisch. Eine Reihe von Uhren, die die verschiedenen Zeitzonen anzeigten, waren direkt darüber befestigt worden. Vor dem Tisch waren eine komfortable Ledercouch und zwei Sessel angeordnet.
Ein riesiger orangefarbener Kater namens Burps schlief auf dem Rücken auf der Couch, die Pfoten in die Luft gestreckt. Er schnarchte und sabberte. Nick hatte ihn aus Kalifornien mit nach Virginia gebracht.
Nick und Selena kamen herein und setzten sich. Nicks Haare waren vom Duschen noch nass. Er rieb sich sein linkes Ohr, wo eine chinesische Kugel ihm den Großteil des Ohrläppchens weggerissen hatte. Er besaß graue, goldgefleckte Augen und ein Gesicht, das Frauen wohl als hart und zerfurcht empfunden hätten. Wer ihn sah, wäre keineswegs auf die Idee gekommen, jemanden vor sich zu haben, der von 9 bis 17 Uhr in einem Büro saß.
Selena hatte sich Jeans und ein lockeres, blaues Top angezogen. Ihre Sig-Pistole neigte sich in dem Holster an ihrer Hüfte etwas nach vorn. An ihr wirkte selbst eine Waffe wie ein modisches Accessoire.
»Ich habe die Zusammenfassung der Philippinen-Operation«, sagte Harker. Sie deutete auf eine Akte auf ihrem Schreibtisch.
»Wer war der Kerl mit dem Bart?«, wollte Nick wissen. »Er gehörte nicht zu Abu Sayyaf.«
»Sein Name war Abu Khan«, erklärte Elizabeth, »und Sie haben recht, er gehörte nicht der Abu Sayyaf an. Er war zweiter Kommandant einer Terrorgruppe namens ISOK.«
»Ei-Sock?«
»Die Kurzform für Islamic State of Kashmir. Sie stammen aus Pakistan.«
»Kaschmir ist eine ganze Ecke von Mindanao entfernt. Wieso hing er mit ein paar philippinischen Terroristen ab?«
»Genau das versuchen wir herauszufinden. Wenn es eine Allianz zwischen der ISOK und Abu Sayyaf gibt, bedeutet das Ärger. Was immer sie vorhaben, kann nichts Gutes hervorbringen.«
»Ich habe schon von der ISOK gehört«, sagte Selena. »Vor ein paar Jahren ließen sie ein paar Bomben in Srinagar hochgehen. Diese Angriffe waren mithilfe des pakistanischen Geheimdienstes möglich gemacht worden. Der Streit konnte mit etwas Überredungskunst und Diplomatie beigelegt werden, aber es gab einige, die damit nicht besonders glücklich waren. Es gibt Fraktionen sowohl in Indien als auch Pakistan, die keinen Frieden wollen und es braucht nicht viel, um einen weiteren Krieg auszulösen. Dafür hassen sich beide Seiten zu sehr.«
»Und beide verfügen über Atomsprengköpfe«, sagte Nick.
Elizabeth nickte. »Das ist richtig. Atomsprengköpfe und die Raketen, sie abzuschießen.«
»Himmel«, stöhnte Nick, »wieso können wir nicht alle einfach nur Freunde sein?«
Selena rollte mit den Augen.
Elizabeth griff in ihrer Schreibtischschublade nach der Goldmünze, die Nick dem Toten abgenommen hatte. Sie reichte sie Selena. »Was halten Sie davon?«
Selena war einer der führenden Expertinnen für alte Sprachen auf der Welt, speziell aus dem Fernen Osten. Bevor sie dem PROJECT beigetreten war, hatte sie an Universitäten gelehrt und als Beraterin der NSA gearbeitet. Sie sprach mehr als ein Dutzend Fremdsprachen. Ihre Fähigkeiten waren für Elizabeth von unschätzbarem Wert.
Selena untersuchte die Münze, drehte sie zwischen den Fingern herum. Sie schwieg dabei, konzentrierte sich. Nach einer gefühlten Ewigkeit sagte sie schließlich: »Faszinierend.«
Elizabeth nahm ihren Montblanc-Kugelschreiber auf und begann, damit ungeduldig auf ihren Tisch zu trommeln.
»Was genau ist denn so faszinierend? Würden Sie uns vielleicht einweihen?«
»Entschuldigung«, sagte Selena. »So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Sie stammt aus Indien. Die Inschrift ist eine Form des Arabischen, wie sie zur Zeit der Mogulkaiser gesprochen wurde. Es ist die Schahāda, das Bekenntnis zu Allah als alleinigen Gott und Mohammed als seinen Propheten. Das würde erklären, wieso ein Moslem sie trug.«
»Wie kommt ein indischer Terrorist an eine antike Goldmünze als Glücksbringer?«, fragte Nick. »Und wer genau waren die Mogulkaiser?«
»Woher er die Münze hat, kann ich nicht sagen, aber die Mogule herrschten vor über dreihundert Jahren in Indien«, sagte Selena. »Einer von ihnen ließ das Taj Mahal erbauen.«
»Und was geschah dann?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Das Übliche. Einige schwache Herrscher, verlorene Kriege, Niedergang. Ihre Zeit endete schließlich, als die Briten 1857 den letzten Herrscher vereinnahmten.«
Sie betrachtete wieder die Münze. »Seltsam, so etwas in einem Terroristenlager zu finden.«
»Es gab noch mehr«, sagte Nick. »Die Filipinos haben sie mitgenommen.«
»Noch mehr? Eine ist schon ungewöhnlich genug. Aber so viele ist unvorstellbar. Eine Münze wie diese dürfte allein tausende Dollar wert sein.«
Ronnie Peete betrat den Raum. Er trug ein Hawaiihemd mit Abbildungen des Kilauea, der in leuchtendem Rot und Gelb ausbrach.
»Tut mir leid, dass ich zu spät bin«, sagte er.
Ronnie war ein Navajo-Indianer und im Reservat geboren und aufgewachsen. Er hatte gelogen, was sein Alter betraf, sich mit siebzehn dem Corp angeschlossen und sich zwanzig Jahre später mit den Streifen eines Gunnery Sergeants in den Ruhestand begeben. Er hatte breite Schultern und schmale Hüften und war etwa fünf Zentimeter kleiner als Nick. Seine Augen waren von einem verträumten Dunkelbraun. Er und Nick hatten in der gleichen Marine-Recon-Einheit gedient.
»Schön, dass Sie uns noch beehren«, sagte Elizabeth.
Ronnie schien es nicht peinlich zu sein, sich verspätet zu haben. Er setzte sich auf die Couch. »Was habe ich verpasst?«
»Selena erzählte uns von den Mogulen«, sagte Nick.
»Mogule? Klingt wie der Titel eines Films. Ihr wisst schon, Die Nacht der Mogule oder so.«
Nick lachte. »Sie herrschten vor langer Zeit in Indien. Selena glaubt, dass die Goldmünze, die ich von den Philippinen mitbrachte, aus dem Mogulreich stammt.«
»Die Münzen würden den plötzlichen Geldfluss für Waffen erklären«, sagte Elizabeth.
»Wo könnten sie die Münzen herhaben?«, fragte sich Selena. »Sie sind sehr selten.«
»Ich hoffe, dass Abu Khans Handy uns mehr verraten wird. Der Speicherchip war verschlüsselt. Stephanie arbeitet bereits daran.«
Stephanie Willits war Elizabeths Stellvertreterin und Computerspezialistin des PROJECT. Elizabeth hatte sie von der NSA abgeworben. Steph war noch nie ein Computer oder Chip untergekommen, den sie nicht hacken konnte. Manchmal dauerte es nur ein wenig länger.
»Wann wird sie damit fertig sein?«
»Fragen wir sie einfach«, sagte Elizabeth. Sie drückte einen Knopf ihrer Sprechanlage. »Steph, könnten Sie bitte zu uns kommen?«
Einen Moment später kam Stephanie zur Tür herein.
Selena war der Ansicht, dass Stephanie zurzeit blendend aussah. Sie war in Lucas Monroe verliebt, einem Agenten der CIA. Er war auf dem besten Wege, Leiter des National Clandestine Services zu werden, einer der vier wichtigsten Direktionen in Langley.
Steph besaß ein unauffälliges Gesicht, dem man nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt hätte, wenn man auf der Straße an ihr vorbeigelaufen wäre. Ihr Haar war voll und von einem leuchtenden Dunkelbraun. Ihre Augen besaßen die gleiche Färbung wie ihr Haar. Sie liebte lange Ohrringe. Heute waren es riesige, goldene Reifen.
»Nick wollte wissen, wie weit Sie mit Khans Handy gekommen sind«, sagte Elizabeth.
»Das war eine harte Nuss«, sagte Steph. »Das Telefon ist so gut wie die, die wir benutzen. Es war eine echte Herausforderung, die Verschlüsselung zu knacken. Es gab drei Anrufe in seiner Liste. Zwei gingen an ein Wegwerfhandy irgendwo im Quiapo District in Manila. Das ist mitten in der Stadt, wo die meisten Muslime leben. Das bringt uns nicht weiter.«
»Und der dritte Anruf?«
»Kam von einer Nummer, die der amerikanischen Botschaft in Manila gehört.«
»Wer sollte aus einer unserer Botschaften einen Terroristen anrufen?«, fragte Ronnie.
»Wer immer es war … ich glaube nicht, dass sie über eine Aufenthaltsgenehmigung sprachen«, sagte Elizabeth.
»Sie müssen einen Spitzel in der Botschaft haben«, überlegte Nick. »Einen Einheimischen und Mitglied der Abu Sayyaf.«
»Das wissen wir nicht«, sagte Elizabeth.
»Was sollte es sonst sein?«
»Es würde uns helfen, wenn wir wüssten, was gesprochen wurde. Können Sie die Anrufe aus der Datenbank ziehen, Steph? Die NSA schneidet alles aus dem Ausland mit. Sie müssen irgendwo liegen.«
»Ich habe schon danach gesucht, aber sie bislang nicht gefunden. Haben Sie eine Ahnung, wie viele Anrufe es in dieser Datenbank gibt?«
»Wieso sollten sich die Abu Sayyaf mit der ISOK zusammentun?«, wunderte sich Selena. »Die Philippinen haben mit Kaschmir doch nichts zu tun?«
Harkers Kuli hämmerte ein unsichtbares Tattoo in den Schreibtisch. Sie sah auf ihn hinunter und legte ihn beiseite.
»Die ISOK wird von einem Dschihadisten namens Abdul Afridi angeführt. Er ist Inder, unternimmt jedoch nichts ohne ausdrückliche Erlaubnis des Pakistan Intelligence Service. Was immer er mit den Abu Sayyaf vorhat – der ISI steckt dahinter. Das bedeutet auf jeden Fall Ärger.«
»Was sollen wir also tun?«, fragte Nick.
»Alles, was wir haben, sind ein Anruf und Spekulationen«, sagte Harker. »Ich werde die Informationen an Langley weitergeben und sie die Sache verfolgen lassen. Steph, wenn Sie die Anrufe in der NSA-Datenbank überprüft haben, möchte ich, dass Sie mehr über diese Münze herausfinden.«
Sie reichte sie Stephanie. »Gibt es noch etwas anderes?«
»Wann kommt Lamont zurück?«, fragte Steph.