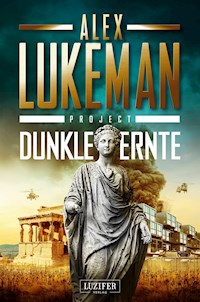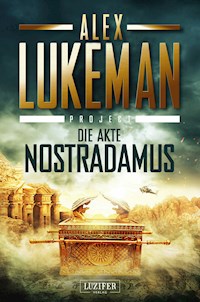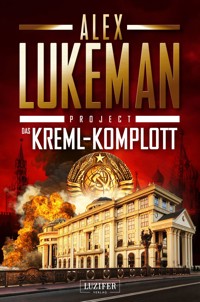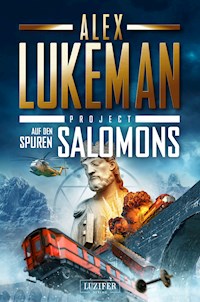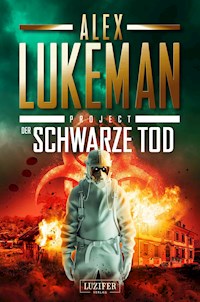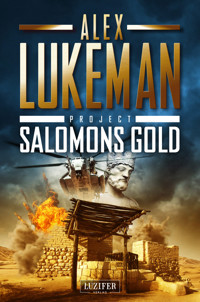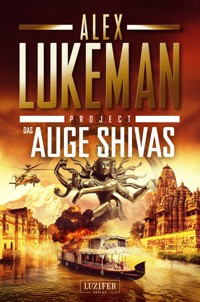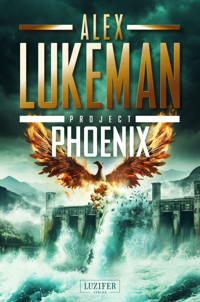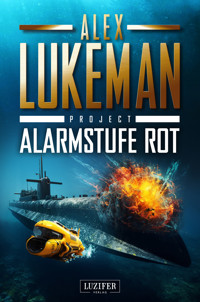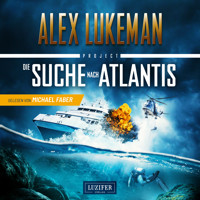Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Project
- Sprache: Deutsch
Verschollene Reliquien, mystische Schätze und geheimnisvolle Artefakte – begeben Sie sich zusammen mit der streng geheimen Regierungsorganisation PROJECT auf die weltumspannende Jagd nach den letzten Rätseln der Menschheit. Das PROJECT wurde aufgelöst. Selena Connor vermisst die Aufregung und Abenteuer der Vergangenheit. Als man sie bittet, ein verschlüsseltes Dokument der Tempelritter aus dem dreizehnten Jahrhundert zu übersetzen, ist sie sofort Feuer und Flamme. Und tatsächlich enthält das Dokument Hinweise auf den Verbleib des legendären Schatzes der Templer. Selena und Nick Carter folgen den Spuren nach Portugal. Ihr Plan ist es, die Suche nach dem Schatz mit einem kleinen Urlaub zu verbinden. Doch der Ausflug verwandelt sich in einen Albtraum und katapultiert das Team erneut in einen Wettlauf gegen die Zeit. Denn der Schatz birgt ein finsteres Geheimnis, welches auf keinen Fall in die Hände der Schwarzen Templer fallen darf … ★★★★★ »Alex Lukeman schreibt mit einem sicheren Gespür für filmische Atmosphäre. Seine fesselnden Romane mit ihren griffigen Plots sind einfach absolute Hits.« - MCSFilm Review Team
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Copyright © 2022 by Alex Lukeman
Dieses Werk ist Fiktion. Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln vervielfältigt, verbreitet oder übertragen werden, außer nach vorheriger und ausdrücklicher Genehmigung des Autors. (Dieses Werk ist Fiktion.) Namen, Charaktere, Organisationen, Orte, Ereignisse und Vorfälle sind entweder vom Autor frei erfunden oder als fiktives Element verwendet. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen lebenden oder toten Personen ist rein zufällig.
Deutsche Erstausgabe
Titel der Originalausgabe: THE BLACK TEMPLAR
Copyright Gesamtausgabe © 2025 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd.
Kontaktinformation: [email protected]
LUZIFER Verlag Cyprus Ltd.
House U10, Toscana Hills, Poumboulinas Street, 8873 Argaka, Polis, Cyprus
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Umschlaggestaltung: Michael Schubert | Luzifer-Verlag
Übersetzung: Peter Mehler
ISBN: 978-3-95835-902-4
eISBN: 978-3-95835-903-1
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2025) lektoriert.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
ANMERKUNGEN
DANKSAGUNGEN
Kapitel 1
Der Regen prasselte in Strömen gegen die uralten Befestigungsanlagen der Burg, die auf das graugrüne Gewässer der Irischen See hinausblickte. Im Inneren der Burg stand ein silberhaariger Mann nachdenklich am Fenster und betrachtete das trübe Wetter draußen.
Geoffrey Payne war mit einem grauen Anzug aus feinster englischer Wolle aus einem der exklusiven Geschäfte auf der Savile Row bekleidet. Sein Gesicht erinnerte an das zerklüftete und verwitterte Kliff, auf dem die Burg errichtet war. Seine Augen waren von einem wässrigen Blau, seine Iriden von weißen Kreisen umrandet und seine Augenlider entzündet. Es waren die Augen eines Mannes, der sich dem Ende seines Lebens näherte.
Ein plötzlicher Windstoß fegte einen Regenschwall gegen die Scheiben der Fenster der Bibliothek.
Payne wandte sich ab und durchquerte den Raum zu einer Kommode aus dem siebzehnten Jahrhundert aus dunklem Holz, auf der auf einem Silbertablett eine Kristallkaraffe mit einem Single-Malt-Whisky und vier Gläsern warteten. Er hob die Karaffe an und goss etwas der bernsteinfarbenen Flüssigkeit in ein Glas. Am anderen Ende des Raumes knackte und loderte ein Feuer in einem breiten, steinernen Kamin. Payne nippte an seinem Drink, lief zu einem Ledersessel in der Nähe des Feuers und setzte sich.
Die Bibliothek war lang und schmal, mit einer hohen Gewölbedecke. Antike Teppiche waren über den Steinboden verteilt. Die Wände waren mit dunklen Walnussbrettern vertäfelt, die man aus einem der großen Anwesen im Süden Englands herausgerissen hatte. Es war ein eleganter Raum, der Geschmack und Wohlstand widerspiegelte.
Eine der Wände der Bibliothek war mit Buchregalen verdeckt, von denen viele Hunderte Jahre alt waren. Die oberen Regalfächer konnten nur über eine Leiter erreicht werden, die vor dem Regal entlanggerollt werden konnte. Gegenüber den Fenstern wurde eine schwere Eichentür in die Bibliothek von zwei Rüstungen flankiert, die über die Zeit ihren Glanz verloren hatten. Über der Tür hing ein Wandteppich aus dem sechzehnten Jahrhundert. Er zeigte eine Gruppe mittelalterlicher Ritter, die das Templerkreuz trugen und sich auf den Hängen Jerusalems versammelt hatten.
Die vierte Wand wurde von dem Kamin und einigen ausgestellten mittelalterlichen Waffen dominiert. Abgesehen von den Büchern hätte sich ein Adliger aus der Zeit der Kreuzzüge wie zu Hause gefühlt.
Wenn sich jemand in dem örtlichen Pub bei einem Glas Guinness nach dem Mann erkundigte, der in der Burg lebte, so hätte er erfahren, dass es sich bei ihm um einen wohlhabenden Witwer handelte, der für sich allein lebte, einem alten Familiengeschlecht angehörte und sein Geld mit dem Verkauf von tiefgekühlten Torten erworben hatte. Nach dem zweiten Glas hätte man erfahren, dass er nur selten in dem Dorf gesehen wurde und dass die Torten nicht besonders gut waren.
Hätten die Dorfbewohner Geoffrey Paynes Gedanken lesen können, wären sie geschockt gewesen. Denn hinter der Fassade eines zurückgezogenen Landadels verbarg sich ein Mann, der davon besessen war, den verlorenen Schatz der Tempelritter zu finden.
Der Schatz war im Jahre 1307 von der Bildfläche verschwunden und seither nicht mehr aufgetaucht.
Am 13. Oktober 1307 hatte König Philipp IV. von Frankreich die Anführer des Tempelordens und viele Ordensbrüder festnehmen lassen. Man hatte ihnen die Anbetung einer satanischen Statue, das Abhalten von Sexorgien und obszöne Opferpraktiken vorgeworfen. Viele von ihnen wurden hingerichtet, die Anführer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Der Orden der Tempelritter wurde zerschlagen, seine Ländereien und Burgen beschlagnahmt.
Historiker gingen davon aus, dass Philipp diese Anschuldigungen nur erfand, um an das Vermögen und die Ländereien der Templer zu gelangen, aber hier irrten die Historiker. Eine geheime Gruppe innerhalb der Templer hatte sich tatsächlich dieser Vorwürfe schuldig gemacht. Siebenhundert Jahre später existierte die Gruppe immer noch.
Und Geoffrey Payne war ihr Großmeister.
Einer der Männer, der dem Scheiterhaufen entfliehen konnte, war ein Vorfahre Paynes gewesen, ein bösartiger und geheimnisvoller Mann. Er hatte ein verschlüsseltes Dokument hinterlassen, von dem behauptet wurde, dass es den Schlüssel zum Auffinden des Golds der Tempelritter enthielt. Es war von den Männern der Familie von Generation zu Generation weitergegeben worden, bis es schließlich in die Hände von Payne gelangte, dem letzten seiner Blutlinie. Er war entschlossen, dessen Geheimnisse zu lüften.
Das Gold der Templer kümmerte ihn nicht. Der Schatz enthielt jedoch noch etwas sehr viel Wertvolleres als Gold. Und um es zu finden, musste er das Dokument lesen können, welches sein Vorfahre ihm vererbt hatte.
Wie alle wohlhabenden Männer hatte Payne andere, um die Dinge zu tun, die er nicht tun wollte oder konnte. Er bezahlte sie für ihre Dienste gut und erwartete im Gegenzug absoluten Gehorsam. Einige wenige von ihnen waren Mitglieder des Ordens, darunter ein Professor für mittelalterliche Literatur an der Universität von Cambridge. Payne hatte ihn damit beauftragt, jemanden zu finden, der den Code entschlüsseln und das Dokument entziffern konnte. Letzte Nacht hatte Dubois angerufen und erklärt, jemanden gefunden zu haben, der genau das tun könnte.
Payne leerte seinen Drink und lauschte dem abgehackten Geräusch, das unablässig und mit dem Knacken des Feuers wetteifernd gegen die Scheiben prasselte, und dachte daran, dass ihm die Zeit davonlief.
Payne starb. In einem Jahr würde er tot sein, sofern er nicht herausfand, wo der Schatz der Templer verborgen lag. Dann würde sich alles ändern.
Und er würde für immer leben.
K
Kapitel 2
Nick Carter blickte auf die Lichter eines auf dem Potomac vorüberfahrenden Lastkahns hinab, sechs Stockwerke unterhalb seines Lofts. Er hielt eine dampfende Tasse Kaffee in der Hand und dachte darüber nach, wie viel sich in den letzten Monaten verändert hatte. Eine der Veränderungen war der Fakt, dass er ein Vater geworden war.
Im Moment schliefen die Zwillinge, ein seltener Moment der Ruhe. Selena war in ihrem Arbeitszimmer, wo sie über der Lektüre einer Fachzeitschrift eingeschlafen war. Die Babys waren erst vier Monate auf der Welt, und keiner von ihnen bekam viel Schlaf ab. Der Kater lag auf seinem üblichen Platz auf der Couch, die Pfoten in die Luft gereckt, und schnarchte.
Alles in Nicks Leben war genauso, wie es sein sollte. Das einzige Problem bestand darin, dass er sich zu Tode langweilte.
Die letzte Mission in Argentinien hatte einen gewichtigen diplomatischen Zwischenfall ausgelöst, und der neue Präsident war dafür unter Beschuss geraten. Das war genau der Vorwand, nach dem er gesucht hatte, um das PROJECT zu beenden. Das Team war aufgelöst worden und jeder von ihnen eigene Wege gegangen.
Lamont befand sich auf den Florida Keys, um zu angeln. Ronnie war nach Hause in das Indianerreservat zurückgekehrt, um traditionelle Heilungsriten seines Onkels kennenzulernen, dem letzten lebenden Menschen, der diese alten Riten noch beherrschte. Harker schrieb an einem Buch, Stephanie half ihr dabei.
Jeder hatte etwas zu tun, außer ihm. Ohne das PROJECT wusste Nick nicht, was er mit sich anfangen sollte. Zum ersten Mal in über zwanzig Jahren musste er sich nicht auf eine Mission irgendwo auf der Welt vorbereiten.
Nur wenige Monate zuvor hatte er darüber nachgedacht, den Job an den Nagel zu hängen. Dann war ihm diese Wahl abgenommen worden, aber anders, als er es erwartet hätte. Er redete sich ein, dass es so besser für ihn war, für Selena und auch für seine Kinder.
Aber das änderte nichts.
In dem Raum nebenan kündigte ein Klingelton auf Selenas Handy einen eingehenden Anruf an. Er blickte auf seine Kaffeetasse hinab und beschloss, einen Schuss Jameson hinzuzugeben. Irischer Kaffee auf die richtige Art, ohne Baileys und Schlagsahne.
Selena kam aus dem Nebenzimmer und gähnte. Zum tausendsten Mal sagte er sich, wie viel Glück er hatte, mit ihr zusammenzusein. Sie war schöner als je zuvor. Ihr Gesicht war schlanker geworden, was ihre hohen Wangenknochen wieder zur Geltung brachte. Ihre intensiven violetten Augen hatten eine neue Tiefe gewonnen, als ob durch die Geburt ihrer Zwillinge eine Art uralter Weisheit in sie übergegangen wäre.
Sie strich sich eine Haarsträhne aus ihrem Gesicht und rieb sich die Augen.
»Ich hatte einen wunderschönen Traum, und dann hat das Handy mich geweckt.«
»Wer war der Anrufer?«, fragte Nick.
»Du kennst ihn nicht. Sein Name ist Alan Dubois. Er ist ein Bekannter, den ich vor Jahren nach einer Präsentation in Cambridge in England kennenlernte. Er arbeitet dort als Professor für mittelalterliche Literatur. Er ist gerade in der Stadt, um einen Gastvortrag in Georgetown zu halten, und ist im Besitz eines Dokumentes, welches ich mir einmal anschauen soll.«
»Was für ein Dokument?«
»Eine Seite aus einem Tagebuch in mittelalterlichem Französisch. Er kennt die Sprache, aber sie ist in einem ungewöhnlichen Dialekt gehalten. Er möchte, dass ich sie mir ansehe, um herauszufinden, ob ich sie übersetzen kann. Ich dachte mir, dass er das Dokument morgen hier vorbeibringen könnte. Dann muss ich die Zwillinge nicht allein lassen.«
»Klingt, als wäre das genau dein Ding.«
Etwas in seiner Stimme bewirkte, dass sie ihn ansah.
»Du langweilst dich, nicht wahr?«
»Das kann man so sagen.«
Nick lief zu der Küchenanrichte und stellte seine Kaffeetasse neben dem Babyfon ab. Er öffnete einen Schrank, nahm die Flasche Jameson heraus und goss etwas davon in seinen Kaffee.
»Ich kann auch auf die Zwillinge aufpassen, falls du diesen Typen lieber in der Stadt treffen willst.«
»Ich möchte im Moment so viel Zeit wie möglich mit ihnen verbringen. Ich habe überlegt, ein Kindermädchen anzuheuern, aber dafür ist es noch zu früh. Vielleicht in ein paar Monaten.«
»Es wäre schön, etwas freie Zeit zu haben. Seitdem sie da sind, haben wir nichts mehr unternommen.«
»Das ist seltsam, oder?«
»Was meinst du?«
»Dass das PROJECT nicht mehr der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Ich weiß, dass es nicht leicht für dich ist. Ich habe Jason und Katrina, die mich auf Trab halten.«
»Mich auch.«
»Ja, aber für dich fühlt es sich anders an.«
Sie schwieg für einen Moment.
»Ich habe nachgedacht. Vielleicht sollten wir eine Sicherheitsberatungsfirma gründen. Etwas, wo wir auf deine Erfahrung zurückgreifen können.«
»Ich bin gut, wenn ich im Einsatz bin. Ich bin nicht sicher, ob ich einen guten Berater abgeben würde.«
»Du wärest ein wunderbarer Berater. Du besitzt jahrelange praktische Erfahrung. Du warst erfolgreich, wo andere gescheitert wären.«
Nick lächelte. »Du meinst, ich habe überlebt, wo andere gestorben wären.«
»Du kannst es so sehen, aber so habe ich es nicht gemeint. Ich meine es ernst. Es gibt genügend Leute, die deine Erfahrung brauchen könnten. Es gibt einen riesigen Markt für so etwas.«
»Unsere Erfahrung, meinst du. Du hast genauso wie ich viele dieser Situationen überlebt.«
»Na ja …«
Nick sah sie an und lächelte.
»Wem willst du eigentlich etwas vormachen? Ich sehe doch, was hier läuft. Du vermisst es auch, nicht wahr? Die Action. Den Rausch. Du bist ein Adrenalinjunkie, genau wie ich.«
»Und das hast du gerade erst herausgefunden? Verstehe mich nicht falsch, ich will damit nicht sagen, dass wir wieder da rausgehen und auf uns schießen lassen sollten.«
»Hört sich aber ganz danach an. Um auch nur ansatzweise gut in dem zu sein, was du vorschlägst, müssten wir wieder dahin gehen, wo die Action ist. Man kann keine Sicherheitskonzepte ausarbeiten, ohne sich die Umgebung anzusehen.«
»Das können wir auch tun, ohne beschossen zu werden. Die meiste Zeit über würdest nur du vor Ort sein. Wenn wir beide gehen müssten, könnten wir uns jemanden suchen, der auf die Zwillinge aufpasst.«
»Bei dir hört sich das so leicht an.«
»Elizabeth kennt eine Menge Leute. Wir könnten sie einbeziehen. Stephanie ebenfalls. Wir könnten einen Thinktank gründen, einen Beraterstab für Leute mit kniffligen Sicherheitsproblemen. Das könnte Spaß machen.«
»Und als Nächstes willst du noch Ronnie und Lamont wieder ins Boot holen.«
»Wieso nicht? Das ist gar keine so schlechte Idee, auch wenn ich nicht daran dachte, das PROJECT wieder aufleben zu lassen. Aber du musst zugeben, dass wir gemeinsam ziemlich viele Bereiche abdecken würden. Geld spielt dabei keine Rolle. Ich kann alles, was wir brauchen, erst einmal finanzieren, bevor sich die Sache rentiert. Was meinst du?«
»Es wäre eine Idee.«
Aus dem Babyfon war ein Weinen zu hören.
»Klingt nach Jason«, sagte Selena. »Ich sehe mal nach.«
»Ich habe immer noch keine Ahnung, wie du sie anhand eines einzigen Schreis auseinanderhalten kannst.«
Selena lachte. Ein zweites Weinen stimmte ein.
»Der Chor ist aufgewacht«, sagte Nick.
»Ich meine es ernst«, sagte sie. »Denk über das nach, was ich gesagt habe. Das könnte Spaß machen.«
Nick nippte an seinem Kaffee und sah ihr nach, wie sie in den angrenzenden Raum lief.
Das ist wirklich keine schlechte Idee, dachte er. Immer noch besser, als den ganzen Tag hier herumzusitzen. Das könnte funktionieren.
Kapitel 3
Am nächsten Morgen öffnete Nick die Tür und sah sich einem hochgewachsenen, dünnen Mann gegenüber, der einen großen, braunen Lederkoffer umklammerte. Nick schätzte ihn auf um die fünfzig. Alan Dubois trug einen maßgeschneiderten braunen Anzug und eine rotbraune Seidenkrawatte. Er hatte dunkle, unstete Augen, die von seinen dicken Brillengläsern noch vergrößert wurden. Schütteres, von ersten grauen Strähnen durchzogenes braunes Haar wich aus seiner hohen Stirn zurück und stand leicht an den Seiten ab. Seine Nase war spitz. Seine Füße schienen für seine Statur zu klein zu sein und steckten in glänzenden schwarzen Oxfords.
Er erinnerte Nick an einen nervigen Vogel.
»Sie müssen Professor Dubois sein. Kommen Sie herein, Selena erwartet Sie bereits. Ich bin Nick.«
»Ich danke Ihnen.«
Ein Brite, dachte Nick.
Dubois sah sich um.
»Sehr schön haben Sie es hier.«
Die Tage, als das Loft noch eine Fabrik war, in der Maschinenteile hergestellt wurden, waren lange vorüber. Die Eichendielen waren abgeschliffen und dann so lasiert worden, dass es den warmen Holzton hervorhob. Eine Reihe von Fenstern mit Blick auf den Potomac nahm eine der Wände ein. Der Architekt, der die Räume neu konzipiert hatte, hatte geschickt das natürliche Licht genutzt, das durch die Fenster und die Oberlichter fiel. Das Ergebnis war ein wundervolles Apartment, hell und geräumig.
Selena kam aus dem Kinderzimmer, mit einer Tüte schmutziger Windeln in der Hand. »Hallo, Professor. Bitte entschuldigen Sie mich kurz, ich bringe die nur schnell weg.«
Sie warf die Windeln in einen Mülleimer, wusch sich im Spülbecken die Hände ab und trocknete sie sich mit einem Handtuch ab.
»Ich wusste nicht, dass Sie Kinder haben«, sagte Dubois.
»Sie sind neu hinzugekommen. Setzen wir uns doch.«
»Soll ich auf die kleinen Monster aufpassen?«, bot Nick an.
»Ihnen geht es gut. Die Babyfone sind an. Wir werden hören, wenn wir zu ihnen müssen.«
Sie deutete auf den Esstisch. Bis vor Kurzem war er kaum benutzt worden. Bevor die Zwillinge auf die Welt kamen, hatten sie für gewöhnlich an dem Küchentresen gegessen. Nun aßen sie an dem Tisch, die Zwillinge zwischen ihnen.
»Ich bin mir sicher, dass Sie dieses Dokument höchst interessant finden werden, Doktor Connor«, sagte Dubois. »Ich habe das Original nicht bei mir, aber eine sehr gute Kopie.«
»Ich hatte gehofft, das Original sehen zu können. Ich bekomme ein anderes Gespür für die Übersetzung, wenn ich mir das Original ansehen kann.«
»Das verstehe ich«, antwortete Dubois. »Einem Original haftet immer etwas an, was eine Kopie nicht reproduzieren kann. Beinahe so, als könne man die Absicht desjenigen erspüren, der es verfasste.«
Er öffnete den Lederkoffer, nahm die Kopie heraus und legte sie vor Selena auf den Tisch.
»Wie interessant«, sagte sie.
Als Nick das letzte Mal diesen Ausdruck auf ihrem Gesicht gesehen hatte, jagten sie am Ende der Bundeslade nach.
»Für gewöhnlich habe ich keine Probleme damit, Französisch aus dieser Ära zu übersetzen, aber ich muss zugeben, dass mich dieses Dokument ratlos zurücklässt«, erklärte Dubois. »Aber dann erinnerte ich mich an einen Vortrag, den Sie in Cambridge über mittelalterliche französische Ausdrücke und Wendungen hielten. Ich dachte, Sie könnten vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen. Der einzige Teil, den ich lesen kann, ist die lateinische Textzeile am Anfang.«
Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini tuo da gloriam.
Selena übersetzte es.
»Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre! Ist das nicht die Losung der Tempelritter?«
Dubois nickte. »Als ich das sah, war ich ziemlich aus dem Häuschen. Die Templer sind mein Fachgebiet. Ich habe über die Jahre einige Vorträge über die Tempelritter gehalten.«
»Woher stammt dieses Dokument?«, erkundigte sich Nick.
»Es wurde über Jahrhunderte hinweg in der Familie des Eigentümers vererbt. Ich besitze eine gewisse Reputation als Experte, was die Templer anbelangt. Der Eigentümer kontaktierte mich, möchte aber anonym bleiben. Aber es wurde festgelegt, dass er der Universität eine Spende von 100.000 Dollar zukommen lassen würde, sollte das Dokument übersetzt werden.«
»Dann muss er das Dokument für sehr wichtig halten, wenn er bereit ist, so viel Geld dafür aufzuwenden.«
Dubois nickte. »Ich denke, davon ist auszugehen.«
Selena nahm die Kopie zur Hand, studierte sie einen Moment lang, dann legte sie sie wieder auf den Tisch zurück.
»Ich sehe das Problem«, sagte sie. »Es ist nicht nur in einem Dialekt gehalten, sondern auch in einer Art Code. Ich kann die einzelnen Worte lesen, aber sie ergeben keinen Sinn. Was ich sagen kann, ist, dass die Worte und die Struktur typisch für die Sprache während des dreizehnten Jahrhunderts sind, vielleicht auch etwas später. Wer immer das verfasste, war für diese Zeit sehr gebildet.«
»Das würde zu dem Motto ganz zu Anfang passen. Die Tempelritter waren gebildete Männer. Wahrscheinlich wurde es von einem von ihnen verfasst.«
»Ich kann es nicht übersetzen, aber ich kenne jemanden, der vielleicht dazu in der Lage wäre. Wir haben bis vor Kurzem noch zusammengearbeitet.«
»Du denkst an Stephanie?«, fragte Nick.
»Ja, und an Freddie. Sie hat noch immer Zugriff auf ihn.«
»Freddie?«, fragte Dubois. »Freddie wer? Kenne ich ihn?«
»Das glaube ich nicht«, antwortete Selena. »Kaum jemand kennt ihn.«
»Wie schnell können Sie mit dieser Person sprechen?«
»Noch heute.«
»Ich lasse Ihnen diese Kopie hier«, sagte Dubois. »Ich habe noch eine weitere in meinem Koffer.«
»Perfekt.«
Dubois sah auf seine Uhr und stand auf.
»Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich das zu schätzen weiß. Sie rufen mich an, sobald Sie etwas in Erfahrung bringen konnten?«
»Natürlich.«
Er nahm eine Visitenkarte aus seiner Tasche und schrieb eine Nummer auf deren Rückseite.
»Das ist meine Karte. Die Nummer auf der Rückseite gehört zu meinem Handy. Ich werde noch eine Woche in Washington sein. Sie können mich zu jeder Zeit anrufen.«
Nick wartete, bis Dubois die Tür hinter sich geschlossen hatte.
»Ich mag ihn nicht. Vielleicht wegen seiner Knopfaugen, aber irgendetwas an ihm kommt mir seltsam vor.«
»Er ist ein Akademiker«, antwortete Selena. »Viele Leute in diesem Beruf sind etwas seltsam. Soziale Umgangsformen sind nicht unbedingt ihre Stärke.«
»Da hast du wohl recht.«
»Ich werde Stephanie anrufen. Es wäre schön, sie und Elizabeth wiederzusehen. Ich vermisse die tägliche Interaktion mit ihnen.«
»Ja«, stimmt Nick zu. »Wir waren schon wirklich ein tolles Team.«
Mit der Hand rieb er sich über sein Gesicht.
Ich habe vergessen, mich zu rasieren.
Er lief ins Schlafzimmer und zog sein Hemd aus. Er spritzte immer versehentlich Wasser auf sein Hemd, wenn er sich rasierte. Im Schlafzimmer seifte er sein Gesicht ein und dachte über Dubois und sein Templer-Dokument nach. Die Bewegungen seines Rasierers, mit dem er den weißen Schaum und die Bartstoppeln entfernte, hatten etwas Beruhigendes. Eines musste man diesen vermeintlich banalen Ritualen des Alltags lassen – sie erzeugten die Illusion von Stabilität. Rasieren war so vorhersehbar wie der Sonnenaufgang. Und Vorhersehbarkeit war etwas Gutes nach so vielen Jahren des Chaos. Das Gesicht, das unter dem Schaum zum Vorschein kam, sah müde aus. Tiefe, dunkle Schatten lagen unter seinen Augen. Die Augen selbst waren eine neugierige Mischung aus Grau und Gold. Selena hatte ihm einmal erzählt, dass sie wie die Augen eines Wolfes aussahen.
Mit Ende vierzig sah sein Gesicht nicht mehr jung aus. Es zeigten sich zunehmend die Auswirkungen der vielen Jahre, die er in unwirtlichen Gegenden mit wenig oder gar keinem Schutz vor Sonne und Wetter zugebracht hatte. Er war nie wirklich gutaussehend gewesen, was immer das auch heißen mochte. Das Netteste, was Leute über sein Aussehen sagten, war, dass er »hart« wirkte. Aber es interessierte ihn kaum, was die Leute über sein Aussehen sagten. Das ließ sich nicht ändern.
Nachdem er seine Rasur beendet hatte, spülte er seinen Rasierer ab und wischte sich die Überreste des Schaums mit einem Handtuch ab.
Dann musterte er sein Spiegelbild und tastete nach der violetten, aufgeworfenen Narbe auf seiner Brust, wo er vor Jahren eine Kugel abbekommen hatte. Das hatte einigen Schaden angerichtet und verflucht wehgetan, aber ihn nicht umgebracht.
Der Blick in Selenas Gesicht, als sie das Templer-Dokument gesehen hatte, hatte ihm einiges verraten. Seine Intuition ließ seine Alarmglocken schrillen. Wenn dieses Dokument wirklich mit dem verschollenen Goldschatz der Tempelritter in Verbindung stand, würden die Dinge kompliziert werden.
Und zwar recht schnell.
Kapitel 4
Stephanie Willits tat sich schwer damit, sich an ihr Leben nach dem PROJECT zu gewöhnen. Die Auflösung der Einheit hatte aber zumindest eine gute Sache bewirkt – zwischen ihr und Lucas liefen die Dinge nun besser. Sie war wieder schwanger, mit einer potenziellen Schwester oder einem Bruder für den kleinen Matthew. Sie war sich nicht sicher, wieso die Dinge besser liefen, und war einfach nur froh, dass es so war.
Sie sah besser aus und fühlte sich auch besser. Sie schlief besser, nun, da sie sich nicht mehr dem Stress ausgesetzt sah, sich um den unablässigen Strom von Feinden kümmern zu müssen, die Amerika zerstören wollten, oder sich um die konstante Bedrohung ihres Lebens sorgen zu müssen. Und doch war es schwer, mit der Gewohnheit zu brechen, immer wieder über die Schulter zu schauen, wenn sie das Haus verließ.
Stephanie war nicht die Art von Frau, nach der man sich umdrehte, aber sie war auf ihre Weise attraktiv. Sie besaß ein freundliches und herzliches Gesicht, was den Menschen das Gefühl gab, dass man ihr vertrauen konnte. Sie hatte langes, glänzendes, rotbraunes Haar. Manchmal flocht sie es zu einem Zopf, manchmal band sie es zu einem Pferdeschwanz zusammen. Sie machte sich nicht viel aus Schmuck, abgesehen von den goldenen Ringen, die sie gern an ihrem linken Handgelenk trug. Diese Armreifen gehörten zu den wenigen Dingen, die sie sich leistete, zusammen mit den großen goldenen Ohrringen.
Stephanie verbrachte die meisten Nachmittage der Woche in Elizabeths Wohnung in Georgetown und half ihr dabei, Notizen und Kapitel für das Buch zu sortieren und zu editieren, das Elizabeth über ihre Zeit als Leiterin des PROJECTS schrieb. Steph war für diese Aufgabe wie gemacht, gehörte sie doch seit dem ersten Tag dem PROJECT an. Manchmal half sie Elizabeth dabei, Erinnerungslücken aufzufüllen, oder fügte Details aus ihrer eigenen Erinnerung hinzu.
Es war nicht wie zu den guten alten Zeiten im PROJECT-Hauptquartier, aber besser, als zu Hause zu sitzen und sich zu fragen, was sie mit sich anstellen sollte. Als Selena anrief, war das eine willkommene Abwechslung. Sie hörte Selena zu, die ihr von dem Dokument berichtete.
»Ich hatte gehofft, dass wir Freddie einen Blick darauf werfen lassen könnten.«
»Ich bin bei Elizabeth. Wieso kommst du nicht vorbei? Sie würde sich freuen, dich zu sehen.«
»Und du bist sicher, dass ich nicht störe?«
»Natürlich nicht. Elizabeth wird dich gerne wiedersehen wollen. Und Freddie ebenfalls, in gewisser Weise.«
»Ich vermisse seine dröhnenden Zwischenrufe, wenn wir in Elizabeths Büro saßen und eine Mission planten.«
Stephanie lachte.
»Es wird schwer werden, aus einem mickrigen Laptop-Lautsprecher zu dröhnen.«
»Nick kann auf die Zwillinge aufpassen«, sagte Selena. »Es gibt da außerdem noch etwas, das ich Elizabeth gern vorschlagen würde.«
»Irgendwie tue ich mich schwer damit, mir Nick als Babysitter vorzustellen.«
Selena lachte. »Ich habe vielleicht ein Kindermädchen für die beiden gefunden. Sie wurde mir von Freunden empfohlen, also werde ich sie mir einmal ansehen. Aber im Moment muss Nick das tun. Ich bin in einer halben Stunde da.«
Stephanie lief in den angrenzenden Raum. Elizabeth Harker starrte auf ihren Computer und trommelte mit ihren Fingern auf den Tisch.
Elizabeth trug Jeans, Hausschuhe und eine lange grünschwarze Flanellbluse, die locker über ihrem zierlichen Körper hing. Das war ein gewaltiger Unterschied zu den maßgeschneiderten Hosenanzügen, die sie trug, als sie noch eine wichtige Größe in der gnadenlosen Welt der US-Geheimdienste war. Ihr Haar war schwarz, mit silbernen Strähnen, das seitlich ihr Gesicht wie Rabenflügel umrahmte. Ihre milchig-weiße Haut war leicht errötet. Sie war vielleicht nicht mehr die Leiterin einer der wichtigsten amerikanischen Anti-Terror-Einheiten, aber das hatte das Feuer in ihren smaragdgrünen Augen nicht erlöschen lassen.
Und es gab noch mehr Dinge, die sich nicht geändert hatten. Über die Jahre hatte sie sich viele Feinde gemacht. Deshalb bewahrte sie eine geladene Pistole in Reichweite auf. Eine Sig 229, geladen mit Kaliber-40-Munition, lag griffbereit auf ihrem Schreibtisch.
»Du siehst aus, als könntest du eine Pause gebrauchen«, sagte Stephanie. »Selena kommt vorbei. Sie hat etwas, das sie Freddie gern zeigen würde, und sie will mit dir reden.«
»Wundervoll. Vielleicht löst das hier ein paar von meinen Blockaden.« Elizabeth tippte sich an die Schläfe und deutete dann auf den Computermonitor. »Ich stecke gerade an der Stelle fest, wo ich etwas über die Vorgänge in Korea schreiben will. Ich muss vorsichtig sein, nicht in Schwierigkeiten zu geraten.«
»Viele der Entscheider sind bereits tot«, sagte Stephanie. »Das sollte nicht allzu schwierig werden.«
»Wahrscheinlich hast du recht. Aber wenn man über solche Dinge schreibt, gibt es immer irgendwo einen Anwalt, der das schnelle Geld wittert, und einen wegen Rufmord oder noch Schlimmerem anzeigt.«
Elizabeth stand auf. »Ich könnte einen Kaffee gebrauchen. Wie steht es mit dir?«
»Du kannst Gedanken lesen.«
Während der Kaffee durch die Maschine lief, fragte Elizabeth: »Worüber will Selena mit mir sprechen?«
»Das sagte sie nicht.«
»Mmm.«
Zwanzig Minuten später traf Selena in Elizabeths Stadtvilla in Georgetown ein. Die Sicherheitskameras zeigten sie auf der Veranda. Sie winkte in die Kameras.
Elizabeth öffnete die Tür.
»Selena, du hast mir den Tag gerettet!«
Sie umarmten sich. Selena trat ein.
»Hi Steph.«
»Hi.«
Eine weitere Umarmung, dann führte Elizabeth die beiden in die Küche.
»Wir haben gerade eine frische Kanne Kaffee aufgesetzt. Willst du auch eine Tasse?«
»Gern. Es wird langsam frostig draußen. Wie geht es mit dem Buch voran?«
»Ganz gut, nur nicht heute.«
Die drei Frauen unterhielten sich für einige Minuten.
Dann sagte Elizabeth: »Steph meinte, du wolltest mit mir über etwas sprechen?«
»Ja. Ich habe eine Idee, die ich dir vorstellen wollte.«
Selena erzählte ihr von der Idee, eine Beraterorganisation, spezialisiert auf schwierige Sicherheitslagen, zu gründen.
»Das klingt ganz so, als wolltest du das PROJECT reaktivieren«, sagte Elizabeth.
»Nein, nicht wirklich. Der Unterschied ist, dass wir nicht mehr aktiv hinter den bösen Jungs her wären, sondern nur andere darin beraten, wie sie mit ihnen fertig werden können.«
»Was soll ich bei der Sache tun?«, fragte Elizabeth. »Ich bin nicht mehr die Leiterin.«
»Du bist vielleicht nicht mehr die Leiterin, aber du weißt eine Menge und hast die besten Verbindungen. Die Idee ist, dass wir weiter als Team zusammenarbeiten und kreative Lösungen für die Probleme anbieten könnten, mit denen wir uns herumschlagen mussten. Nur dass wir dieses Mal andere den schweren Teil übernehmen lassen.«
»Den schweren Teil?«
»Du weißt schon, den, wo ständig jemand versuchte, uns umzubringen.«
»Ah, dieser Teil.« Sie lachten.
»Aber es ist lustig, dass du das erwähntest«, sagte Elizabeth. »Ich bekam schon einige diskrete Anfragen nach meiner Meinung in einigen kniffligen Fällen. Ich habe immer noch meine Sicherheitsfreigabe.«
»Siehst du? Genau das meine ich. Und indem wir nicht mehr für die Regierung arbeiten, hätten wir viel mehr Freiheiten.«
»Das hat aber auch einen Haken«, gab Stephanie zu bedenken. »Wir haben vielleicht mehr Freiheiten, aber auch keinen offiziellen Schutz oder Rückhalt mehr.«
»Der Schutz war von jeher zu vernachlässigen«, sagte Elizabeth. »Fast alles, was wir taten, ließ sich abstreiten. Auch wenn es natürlich Vorzüge hatte, einen Hubschrauber oder Jet anzufordern, wenn man einen brauchte.«
»Ihr beide wisst, wie viel Geld mein Onkel mir vermachte, als er starb«, sagte Selena. »Es ist mehr, als ich je ausgeben könnte. Ich kann uns jede Art von Rückhalt kaufen, wenn es nötig werden sollte. Außerdem sprechen wir hier nicht von Missionen, wie wir sie gewöhnt sind. Es gibt keinen Grund, uns weiterhin zur Zielscheibe zu machen. Und ich könnte das Start-up finanzieren. Wir könnten die Firma als LLC anmelden.«
Vielleicht, dachte Stephanie.
»Wie geht es Freddie?«, fragte Selena. »Ich hätte da etwas, das er sich einmal ansehen könnte. Es könnte sich als Herausforderung erweisen.«
»Er könnte die Herausforderung gebrauchen. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass er sich langweilt. In Langley ist er einfach nur ein weiterer Computer. Sie verstehen dort sein eigentliches Potential nicht. Sie lassen ihn Dinge tun, die weit unter seinen Fähigkeiten liegen.«
»Ich hätte gedacht, dass DCI Hood wissen würde, wie man ihn optimal einsetzt?«
»Langley ist eine einzige Bürokratie«, erklärte Elizabeth. »Clarence kann nicht sich nicht um jede Einzelheit kümmern. Ich fürchte, die Leute im Directorate of Science and Technology verstehen nicht, wozu Freddie in der Lage ist.«
»Hast du irgendwelche Probleme, auf ihn zuzugreifen?«
»Noch nicht. Ich benutze ihn, um sicherzustellen, dass einige der Fakten in meinem Buch korrekt sind. Aber ich mache mir Sorgen um die Zukunft. Solange Steph und ich noch unsere Sicherheitsfreigaben haben, gibt es kein Problem. Aber ich bin nicht sicher, was passieren wird, wenn man sie uns abnimmt.«
»Ich weiß, ich habe gerade erst die Idee präsentiert, eine Beraterfirma zu gründen, aber wenn Freddie mit uns zusammenarbeiten könnte, würde uns das einen enormen Vorteil verschaffen. Was, wenn ich ihm ein neues Zuhause kaufe?«
»Hast du eine Ahnung, wie viel einer von diesen großen Crays kostet?«, fragte Stephanie.
»Geld spielt keine Rolle«, antwortete Selena.
»Und wo sollen wir den Computer unterbringen?«
»Es gibt genügend freie Büroflächen in Virginia. Wir könnten ein Bürogebäude mieten oder kaufen und ihn dort installieren.«
»Ich muss darüber nachdenken«, sagte Elizabeth. »Aber die Idee ist interessant.«
»Es wäre nicht wie früher«, gab Selena zu. »Eine Beraterfirma ist nicht das Gleiche wie das PROJECT. Aber mit unseren Kontakten hätten wir mehr zu tun, als wir schaffen würden.«
»Das stimmt«, sagte Elizabeth. »In gewisser Weise ist es genau das, was man von uns erwarten würde. Viele Leute scheiden aus dem Regierungsdienst aus und werden auf die eine oder andere Weise Berater.«
»Wir würden nur für uns arbeiten«, sagte Selena. »Wir könnten uns unsere Klienten heraussuchen. Das könnte Spaß machen.«
»Was wolltest du Freddie zeigen?«, wechselte Stephanie das Thema.
»Ich habe ein Dokument, eine Kopie von etwas, das im dreizehnten Jahrhundert verfasst wurde. Es ist ein Code. Ich wollte ihn einen Blick darauf werfen lassen und sehen, ob er es übersetzen kann.«
Stephanie startete ihren Computer und gab den Code ein, mit dem sie auf Freddie zugreifen konnte. Elizabeths Wohnung verfügte über eine schnelle Glasfaserleitung, die sie mit Langley und dem Rest der Geheimdienstwelt verband. Sie war installiert worden, als sie noch das PROJECT leitete. Wann immer Stephanie auf Freddie zugriff, war die Verbindung abgesichert.
»Guten Morgen, Freddie. Wie geht es dir heute?«
Guten Morgen, Stephanie. Mir geht es immer gleich. Wie geht es dir?
Selena war daran gewöhnt, dass Freddies Stimme aus den Lautsprechern in Elizabeths Büro im PROJECT-Hauptquartier dröhnte. Jetzt fiel es ihr schwer, die blecherne Stimme, die aus Stephanies Computer drang, mit der leistungsstarken künstlichen Intelligenz übereinzubringen, die Freddie darstellte.
»Mir geht es gut. Selena ist hier und würde gern mit dir sprechen.«
»Hallo Freddie.«
Hallo Selena. Ich habe unsere Interaktionen vermisst. Wie geht es dir heute?
»Mir geht es gut, Freddie. Es ist schön, wieder deine Stimme zu hören.«
Hast du deine Kinder mitgebracht?
Überrascht antwortete Selena: »Nein, das habe ich nicht.«
Wann werde ich sie kennenlernen?
»Ich wusste nicht, dass du sie kennenlernen willst.«
Ich würde sie sehr gern kennenlernen.
»Ich bin sicher, dass sich die Gelegenheit ergeben wird, Freddie. In der Zwischenzeit hätte ich ein anspruchsvolles Problem für dich.«
Ich würde mich gern einem anspruchsvollen Problem widmen. Die Programmierer hier in Langley geben mir nur selten etwas Interessantes zu tun.
»Ich habe ein Dokument, das du dir einmal ansehen könntest.«
Was für eine Art von Dokument?
»Es ist eine Kopie eines Pergaments, das Hunderte von Jahren alt ist, hauptsächlich in mittelalterlichem Französisch verfasst. Das wäre normalerweise kein Problem, aber dieser Text ist in einem Code verfasst. Niemand kann ihn lesen.«
Was soll ich tun?
»Ich möchte, dass du deine Datenbank angleichst und versuchst, ob du den Code knacken und den Text übersetzen kannst. Er ist von historischer Wichtigkeit. Er wurde vielleicht von einem der Tempelritter geschrieben, vor Hunderten von Jahren.«
Es gibt mehrere Organisationen, die sich selbst Tempelritter nennen. Von welcher sprechen wir?
»Dem originalen Orden, der 1120 von Hugh de Payns gegründet wurde.«
Du beziehst dich demnach auf den Orden der Armen Ritterschaft Christi und des salomonischen Tempels zu Jerusalem?
»Das ist korrekt, Freddie.«
Bitte scanne das Dokument für mich ein.
Selena reichte Stephanie die Kopie. Stephanie scannte sie ein und übermittelte sie an Freddie.
Ich habe das Dokument bekommen. Die erste Zeile ist die lateinische Version der Losung der Tempelritter.
»Das wissen wir bereits, Freddie«, antwortete Selena. »Es ist der Rest des Textes, der uns interessiert.«
Verarbeite.
»Er wird mich wissen lassen, wenn er fertig ist«, sagte Stephanie.
»Ich hoffe, es dauert nicht zu lange, bis er etwas herausgefunden hat«, sagte Selena.
»Es könnte auch nur ein Brief sein oder ein Antrag für etwas, das der Verfasser für sein Pferd brauchte.«
»Das wäre möglich. Aber warum sollte man etwas derart Mondänes verschlüsseln? Und auch wenn es ein Relikt der Tempelritter ist – wieso sollte jemand so viel Geld bezahlen wollen, um herauszufinden, was dort geschrieben steht?«
»Wie viel Geld?«
»Einhunderttausend Dollar.«