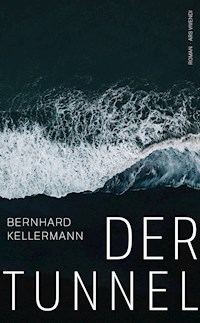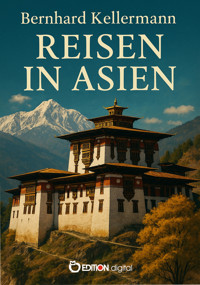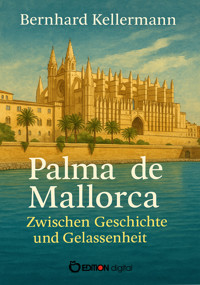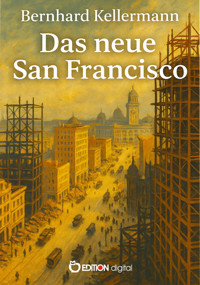8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mit der „Cosmos“, dem größten und modernsten Ozeandampfer seiner Zeit, sticht eine illustre Gesellschaft in See: Industrielle, Künstler, Journalisten – und Menschen mit Geheimnissen. Hinter dem Glanz der luxuriösen Jungfernfahrt flackern Macht, Ehrgeiz, Rivalitäten und Sehnsüchte. Während die Maschinen donnern und das Schiff Kurs auf New York nimmt, entfaltet sich ein Panorama menschlicher Träume und Abgründe. Bernhard Kellermann verbindet in seinem Roman Das blaue Band mitreißende Erzählkunst mit präziser Beobachtungsgabe: ein spannendes Zeitdokument über Fortschritt, Technikglauben und menschliche Hybris – und eine Geschichte, die an die Jungfernfahrt der Titanic angelehnt ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Bernhard Kellermann
Das blaue Band
ISBN 978-3-68912-581-3 (E-Book)
Erschienen im Verlag Volk und Welt, Berlin 1969, 5. Auflage 1982.
Die Erstausgabe erschien 1938.
© 2025 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Godern
Tel.: 03860-505 788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
Historische Anmerkung
Am 14. April 1912, um 11 Uhr 40 nachts, stieß der englische Dampfer „Titanic“ von der White-Star-Linie auf der Fahrt nach New York im Nordatlantik mit einem Eisberg zusammen und sank. Von den 3 547 Personen an Bord ertranken 1 517. Die Untersuchung über die Katastrophe ergab, dass die „Titanic“ nur für 1 178 Personen Rettungsboote mitführte – das war noch die doppelte Zahl dessen, was ein veraltetes Gesetz damals vorschrieb – und dass ein mitfahrender Direktor der White-Star-Linie Einfluss auf die Schiffsleitung genommen hatte. Diese historischen Fakten wurden, wie in manchen anderen romanhaften Darstellungen des Unterganges der „Titanic“, für „Das Blaue Band“ als sachlicher Hintergrund benutzt. Dass der Autor diesen Roman im Übrigen in einer anderen Zeit und mit von ihm völlig frei erfundenen Gestalten und Vorgängen spielen lässt, beruht auf der selbstverständlichen Freiheit seiner Fantasie. Nach dem Untergang der „Titanic“ wurden die Bestimmungen über Rettungsboote und Funkdienst und so weiter in allen Ländern überprüft und verschärft, so dass eine Wiederholung des tragischen Geschehens nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen ist.
Erster Teil
1
Die Sirene der „Cosmos“ brüllte. Zuerst waren es nur Erschütterungen der Luft, dann war es ein hohles Surren, und daraus kam ein dumpfes Dröhnen, das mehr und mehr anschwoll und augenblicklich den Lärm des Hafens und die Stimmen der Menschen verschlang.
Das war die Stimme der „Cosmos“. Und da lag sie selbst, größtes Schiff der Welt und vielleicht das schönste, das Menschen je gebaut hatten. Eine Festung aus schwarzen Panzerplatten, acht Stockwerke hoch, mit Hunderttausenden von Nieten bedeckt, noch umprasselt vom Lärm der elektrischen Niethämmer. Oben die Decks, wimmelnd von Passagieren, eine weiße Märchenstadt aus blitzendem Kristall, und darüber drei dicke, rote, kurze Türme, die schwarzen, dicken Qualm ausstießen. In wenigen Minuten sollte sie zu ihrer ersten Reise nach New York in See gehen.
Der ferne Ton eines Trompetensignals drang aus der Festung aus schwarzen Panzerplatten, und Arbeiter rollten den hohen Treppenturm zur Seite. Nun war der Dampfer mit dem Land nur noch durch einen breiten Laufsteg verbunden, der vom Kai zur Schiffspforte führte.
Autos schossen über den Kai, die Motorräder der Depeschenboten knatterten. Vor einer Minute waren noch drei riesige Postautos angekommen, förmliche Möbelwagen, bis oben hinauf mit Säcken angefüllt. Große Netze sanken von irgendwo da oben aus einer zischenden Dampfwolke herab, um die Postsäcke an Bord zu nehmen. Es waren Säcke mit den Farbstreifen aller Länder Europas. Dreitausend Postsäcke hatte die „Cosmos“ bereits geladen.
Immer noch kamen verspätete Passagiere. Eine Dame in einem schweren Wagen rollte heran, den Pelz lässig um die Schultern gelegt, den Arm voll fleischroter Rosen. Ihr Gesicht war gerötet von Erregung und dem frischen Aprilwind, der über den Kai blies. Der Wagen stand noch nicht still, da stürzten sich schon die Fotografen auf sie und begannen ein wahres Schnellfeuer. Einer sprang auf das Trittbrett und hielt ihr den Apparat wie eine Pistole direkt vors Gesicht, ein Kurbelkasten tauchte über den Köpfen auf. Die Dame aber schien das ganz in Ordnung zu finden, sie lachte gut gelaunt. In diesem Augenblick eilte Herr Pape, der Chefsteward mit dem bleichen, etwas gedunsenen Gesicht, feierlich herbei, und einige Stewards in weißen Kitteln ergriffen das Handgepäck, das der Chauffeur ihnen aus dem Auto reichte. Die Dame mit den Blumen sandte ein Lächeln ihrer strahlenden, stahlblauen Augen in die Höhe und folgte dem Chefsteward, der sie zum Laufsteg komplimentierte. Die Meute der Fotografen stürzte hinter ihr her.
Mitten im Gewimmel von aufgeregten, hin und her eilenden Passagieren stand auf dem untersten Promenadendeck, hochgewachsen, elegant und ohne Tadel, den eisengrauen Scheitel peinlich gezogen, die „Primadonna der Linie“, Direktor und Propagandachef Henricki. Er befand sich im Gespräch mit einem kleinen, sehr würdevollen Herrn mit dünnem, weißem Bart, der ein etwas hartes, sehr rasches Französisch schnatterte. Direktor Henricki lächelte höflich, nur zuweilen flog seine eine Braue nervös in die Höhe. Ein Steward trat in diesem Augenblick an ihn heran, und sofort trat Direktor Henricki einen Schritt zurück. „Verzeihung, Exzellenz“, sagte er. „Eine Sekunde.“
Direktor Henricki eilte durch das Gewimmel der Passagiere das Deck entlang und näherte sich mit großer Würde und mit dem Ausdruck tiefster Verehrung jener Dame, die, den Pelz lässig um die Schultern geworfen, einen großen Strauß fleischroter Rosen im Arm trug.
„Direktor Henricki!“ Er machte der Dame eine respektvolle, vollendete Verbeugung. „Es ist mir eine ganz besondere Freude und Ehre, Frau Königsgarten“, sagte er, fast feierlich, „Sie im Namen der Linie begrüßen zu dürfen!“ Er verbeugte sich nochmals und bat Frau Königsgarten um die Ehre, sie persönlich zu ihrer Kabine begleiten zu dürfen. Er hoffe, sie werde zufrieden sein – die Linie habe natürlich alles darangesetzt, um einen so illustren Gast zufriedenzustellen.
Frau Königsgarten lächelte verlegen, sie verstand kaum, was er sagte, und erwiderte ein paar höfliche, nichtssagende Worte. Wenn die Menschen sie nur mit ihren Phrasen in Ruhe ließen! Sie sprach auffallend stark Wiener Dialekt.
„Bitte, jetzt nach links, gnädige Frau. Es ist schwer, sich auf dem neuen Schiff zurechtzufinden. Selbst für mich.“
„Ein herrliches Schiff! Ein ganz wundervolles Schiff!“
Direktor Henricki lächelte geschmeichelt. „Wir haben uns diesmal alle Mühe gegeben, Gnädigste“, sagte er und komplimentierte die Königsgarten in einen vernickelten, blitzenden Lift. „Sie wohnen noch zwei Etagen höher.“ Im Lift erst wagte er es, die Sängerin aufmerksamer zu betrachten. Ihr Gesicht war leicht gerötet, und zwar von jenem Rot, mit dem Ziegelsteine abfärben. Auf ihrer heftig geschwungenen, trotzigen Lippe standen dünne, blonde Härchen und ein paar winzige Schweißperlen. Er hatte dieses Gesicht auf der Bühne gesehen – als Isolde, Tosca –, umwogt von Musik und in magisches Licht getaucht, da schien es von innen heraus zu leuchten. Die ungeheure Einfachheit und Offenheit dieses Gesichts, das er nun so nahe sah, verwirrte ihn. Ein prachtvolles Weib war sie, ohne Zweifel, ein Vollweib! „Sie haben gestern Abend noch in Brüssel gesungen, wie ich las?“, sagte er, als die Königsgarten aufblickte.
„Ich komme soeben von Brüssel.“
Ein Rudel von Journalisten sei an Bord, die schon auf sie lauerten, fuhr Henricki mit der gleichen Beredsamkeit fort, während sie durch einen endlosen feierlichen Korridor schritten, und New York erwarte sie bereits in großer Erregung. „Aber hier sind wir ja, Frau Königsgarten, darf ich bitten?“
Die Königsgarten hatte eine Kabine erster Klasse gebucht, aber die Linie hatte ihr zu ihrer Überraschung ein Appartement zur Verfügung gestellt. Es bestand aus einem Salon, einem Schlafzimmer und einem Bad. Im Salon befand sich sogar ein funkelnagelneuer Stutzflügel. Auf dem Flügel standen einige Blumensträuße, und daneben lagen Karten und Briefe.
Frau Königsgarten dankte.
Am meisten freute sie sich über diesen kleinen Flügel hier, weil er so anheimelnd aussah. „Wie reizend! Das war wirklich ein sehr liebenswürdiger Einfall von Ihnen, Direktor!“, sagte sie und blickte mit dem naiven Staunen eines Kindes Henricki mit ihren stahlblauen Augen an. Henricki fragte, ob Frau Königsgarten noch irgendwelche Wünsche habe. Eine Erfrischung vielleicht? Aber nein, sie hatte keinerlei Wünsche mehr, und Direktor Henricki bat, sich verabschieden zu dürfen, gesellschaftliche Verpflichtungen …
Die Königsgarten ließ sich in einen Sessel fallen und gähnte herzhaft. „Gott sei Dank, dass er fort ist!“, sagte sie und lachte belustigt vor sich hin. „Marta! Marta, bist du da?“, rief sie, heiser vor Müdigkeit.
In der Tür zum Badezimmer erschien eine ältere Frau mit leicht gekrümmtem Rücken und ländlichen, harten Zügen, einfach gekleidet wie eine Zofe. Ihr Gesicht, wie aus Wurzelholz geschnitten, war von großer Hässlichkeit, aber ihre schönen, großen, braunen Augen leuchteten bis in die Tiefe, als sie die Königsgarten erblickte, ganz, als wären sie jahrelang getrennt gewesen.
„Gott sei Dank, dass du da bist, Eva“, sagte Marta, und sie meinte es aufrichtig. Sie war schon in Unruhe gewesen, Eva könnte den Dampfer versäumen, und da hätte sie ganz allein nach New York fahren müssen.
Die Königsgarten lachte. „Nun, du siehst ja, da bin ich wieder. Wie geht es dir?“ Sie war glücklich, dieses vertraute Gesicht wiederzusehen. Schon fühlte sie sich zu Hause.
Marta musterte Eva und schüttelte unzufrieden den Kopf. „Müde siehst du aus, Eva, müde! Nein, dieses Leben, diese Menschen werden dich noch zu Tode hetzen!“
„So rede nun nicht, Marta; hast du Kaffee?“
„Ja, ich habe das Wasser schon aufgestellt!“
„Aber stark, hörst du, sehr stark muss er sein!“
Und wieder gähnte die Königsgarten und klopfte sich dabei auf den Mund.
2
Die Netze mit den Postsäcken steigen noch immer in die Höhe. Ob sie es bis zwölf Uhr schaffen werden?
Noch immer liegt die Kommandobrücke der „Cosmos“, hoch wie ein sechsstöckiges Haus, leer und verödet, aber zehn Minuten vor zwölf sieht man vom Kai aus plötzlich da oben in dem Glashaus geschäftige Köpfe an den Scheiben.
Der große Weißhaarige, der wie ein Landpfarrer aussieht, das ist der Kommandant des Dampfers, Terhusen. Er nimmt die Mütze ab und bewegt sich winkend an der Scheibe hin und her. Er winkt seiner Frau und seinen beiden schlankaufgeschossenen Töchtern, die unten auf dem Pier, etwas abseits vom Gedränge, in hellen, wehenden Mänteln stehen.
Die Offiziere auf der Brücke nehmen die Telefonhörer ab, und die qualmenden Schleppdampfer setzen sich in Bewegung. Jetzt wird es Ernst. Die Matrosen stehen bereit, den schweren Steg, der das Schiff noch mit dem Kai verbindet, wegzufieren. Aber da rollt noch eine Autodroschke heran.
Aus der Droschke klettert eilig ein Herr in einem hellgrauen Überzieher. Er vergisst in der Aufregung, die Droschke zu bezahlen. Dann aber bleibt er noch eine Weile stehen und blickt an der Wand des Dampfers in die Höhe, mit einem unentschlossenen Gesichtsausdruck, als ob er am liebsten wieder umkehren möchte. Ein Steward eilt ihm entgegen, um seine Handtaschen in Empfang zu nehmen.
„Darf ich bitten, sich beeilen zu wollen, mein Herr“, sagt der Steward, „der Laufsteg wird im Augenblick weggenommen.“ Und im Schiff winkt er einen Pagen heran. „Der Herr hat Kabine 312, Deck C.“
3
Es war nur ein Glück, dass Warren Prince, Vertreter der Universe-Press, New York, schon heute Morgen an Bord kam. Seine Schreibmaschine rasselte. In Hemdsärmeln saß er in der Kabine, die schwarze Hornbrille auf der Nase. Er hatte feuerrote Backen vor Erregung. Sein Bericht musste fertig sein, wenn der Pilot von Bord ging. Warren Prince kannte die „Cosmos“ in- und auswendig. Er hatte die Stewards gesprochen, die Offiziere, Direktor Henricki, den Erbauer des Dampfers, Schellong, Ingenieure, Heizer, Passagiere. Stundenlang war er mit dem Lift acht Stockwerke auf und ab gefahren.
Die Maschine hämmert. Prince lacht, und häufig deklamiert er seinen Text, so berauscht ist er. Er gehörte zu jenen Menschen, die sich für Schiffe begeistern können, und die „Cosmos“ begeisterte ihn. Die Welt war um ein Wunder reicher, und dieses Wunder hieß „Cosmos“.
Die Staaten waren an Bord glänzend vertreten, ein Dutzend bedeutender Vermögen hatten für die Jungfernreise der „Cosmos“ gebucht. Mrs. Sullivan und Tochter (Kitty!), Gardener, Harper, Hopsen, Rice.
,J. P. Gardener, Pittsburg!“, deklamierte Prince. „Kehrt auf schnellstem Weg zurück, um den Streik in Barrenhills beizulegen.“ Auch Harper junior ist an Bord, noch braun von der Sonne Afrikas.
Europa sandte einige seiner ersten Prominenzen: Professor Rüdiger, den berühmten Physiker, Dr. Fuchs, ersten Spezialisten der Welt in der Krebsforschung, Berlin, Eva Königsgarten, die große Sängerin, die zu ihrem Gastspiel an der Metropolitan fährt. „Ihr Korrespondent hatte Gelegenheit, sich mit dem musikalischen Instruktor der Sängerin, dem berühmten Pianisten und Gesangspädagogen Professor Reifenberg zu befreunden. Zu befreunden, Punkt!“
Zweihundert Eisenbahnzüge Kohlen hat die „Cosmos“ an Bord, fünf Millionen Dollar an Gold in Barren, dreitausend Säcke Post, einen berühmten Velázquez für eine halbe Million Dollar, für das Museum in Chicago. Drei Särge. Die Särge sind ganz tief unten im Schiff verstaut, die abergläubischen Passagiere dürfen nichts davon wissen. Einer dieser Särge birgt die irdischen Reste von Mrs. Robinson, der Gattin des amerikanischen Attachés in Rom, die sich vor einigen Wochen wegen des bekannten Skandals vergiftete. Beinahe hätte er den berühmten Asienforscher Russell vergessen, der in Amerika Vorträge halten wird über seine letzten Forschungsreisen in Turkestan und Tibet. Dann war anwesend der frühere Ministerpräsident eines Balkanstaates, Leukos, der in Begleitung seiner Nichte reiste, Mademoiselle Georgette Adonard, Schauspielerin und Tänzerin der Comédie Francaise, Paris. Hatte er den alten Bernhard Schwab schon erwähnt, den Herausgeber des „New York Standard“? Ferner waren da Hochstapler, Falschspieler, Detektive – aber davon nichts – ein Scherz. Prince lacht.
Dann und wann stürzte Prince aus der Kabine, um einen Blick hinaus auf den Kai zu werfen. Vielleicht konnte er eine interessante Einzelheit erspähen, die Kolorit gab. Der Kai wimmelte von Menschen, die Niethämmer der fernen Werften prasselten, Rauch qualmte aus hundert Dampfern, ein Windstoß wirbelte den Staub über den Kai. Stimmen schrien in der Luft.
„Die ,Cosmos‘ legt soeben ab. Schenkeldickes Haltetau schlägt drei Hafenarbeiter zu Boden. Die Tender sind so groß wie Möbelwagen und müssen mit Kranen bewegt werden. Lärm der Werften. Stimmen schreien in der Luft.“
Prince war mit seinem Bericht zufrieden. Die Sache mit den drei Särgen war ohne Zweifel gut. Er sah die Schlagzeilen vor sich: Late Mrs. Robinson returns to her country! Keiner der anderen Journalisten hatte von den Särgen eine Ahnung! Und die drei Mädchen Holl waren an Bord – „the Holl girls“ –, eine Reise würde das werden, eine Reise, Prince! Ja, das Leben ist eine große, wundervolle Sache!
„Kabine 312“, sagte der Steward zu dem Herrn mit dem hellen Überzieher, der im letzten Moment an Bord gekommen war.
Der Herr zerknitterte die Stirn. Eine Schreibmaschine klapperte in der Kabine! Er stand einen Augenblick unentschlossen. Ja, er wich sogar einen kleinen Schritt zurück.
„Man hat mir in der Agentur versichert, dass ich eine Einzelkabine haben werde.“
Der Steward zuckte bedauernd die Achseln. „Ein Irrtum offenbar, mein Herr. Das Schiff ist schon seit Monaten ausverkauft.“
Er pochte an die Tür und trug die Reisetaschen des Herrn in die Kabine.
„Bett C, dieses hier, bitte, mein Herr!“, sagte er.
Prince hörte auf zu schreiben und wandte hastig den Kopf.
„Ich bedaure, wenn ich störe!“, sagte der Herr im grauen Überzieher mit kühler Höflichkeit. Er stand unschlüssig da und blickte Prince mit hilfloser, ja nahezu unglücklicher Miene an. Er hatte ein gelbliches, langes Gesicht.
Prince sprang auf und schüttelte sich mit einem Ruck die Locken aus der Stirn. Er hatte eine sehr schöne, hohe Stirn, auf die er nicht wenig stolz war.
„Bitte, bitte. Ich bin soeben fertig geworden“, rief er und raffte hastig seine Papiere zusammen. Er schlüpfte in seinen Rock und stürzte zur Tür hinaus. „He, Steward, Steward!“, schrie er. „Wann geht der Pilot von Bord?“
4
Wieder brüllt die „Cosmos“. Die Decks sind bis hoch hinauf schwarz von Passagieren, und irgendwo hoch oben verweht das Spiel der Kapelle, man hört sie kaum. Die Leute am Kai schwingen Hüte und Tücher, die Sirenen der Dampfer im Hafen heulen auf, und ehe man es sich versieht, haben die qualmenden Schlepper den Dampfer zehn, zwanzig Meter vom Kai abgeschleppt. In seiner ganzen Größe und seinen majestätischen Linien liegt er da, und seine drei dicken roten Schornsteine stoßen ungeduldigen Qualm aus, wie die Krater eines Vulkans vor dem Ausbruch. Der Maschinentelegraf klingelt fern, und augenblicklich zerschlagen die Schiffsschrauben das Wasser zu kochendem Marmor, und der Dampfer zieht langsam davon.
Immer noch steht die Gattin des Kommandanten mit ihren beiden schlanken Mädchen auf dem Kai, ihre hellen Mäntel flattern im Wind. Sie sehen dem Dampfer nach, der, eingehüllt in eine rostig-braune Rauchwolke, hinter dem Wald von Schornsteinen und Masten verschwindet.
Das rote Feuerschiff rollt auf der Dünung. Es zerrt an seinen Ankerketten, und die Gischtfahnen zischen empor. Der Motorkutter des Lotsen kommt heran, der Pilot geht von Bord.
Warren Prince hat gerade noch Zeit, seine letzte Post mitzugeben. Der Maschinentelegraf klingelt – und schon geht ein Zittern und Beben durch den Koloss, und schon tanzt der Motorkutter des Piloten weit und klein dahinten. Fern und nichtig pendelt das rote Feuerschiff auf der Dünung. Die „Cosmos“ ist unterwegs.
Der Wind war plötzlich heftiger geworden. Warren Prince wischte sich einen Schweißtropfen, den ihm der Wind über das Gesicht blies, ab. Du hast es geschafft, Warren! sagte er sich befriedigt, Bell wird diesmal die Augen aufreißen! Dieser Bell, William Percival Bell, war der Boss der Universe-Press (vierhundert Zeitungen!).
Dünn und aufgeschossen steht Prince da, seine Locken flattern. Er sieht aus wie ein Student; noch kann man sich gut vorstellen, wie er als Knabe aussah, und schon kann man erkennen, wie er in zwanzig Jahren aussehen wird, wenn er einmal Vorlesungen an einer kleinen Universität im Westen hält. Warren Prince ist dreiundzwanzig Jahre alt, kaum von der Universität abgegangen, ohne einen Cent Vermögen. Er unterhält seine Mutter, die monatlich hundertfünfzig Dollar Minimum braucht, er ist ehrgeizig, begeisterter Journalist – er wird einst seine eigene Zeitung haben!
Heute Abend, wenn sie Bishops Rock passierten, wollte er noch ein Telegramm schicken, und dann mochten ihm Bell und die Universe-Press vierundzwanzig Stunden lang gewogen bleiben. Vierundzwanzig Stunden! In erster Linie wirst du nun die Holl girls aufsuchen, dachte er. Violet, Ethel, Mary, so hießen sie.
Er begab sich in die Bar, um einen Drink zu nehmen. Er war der erste Gast.
„Hello, Barkeeper!“, sagte er. „Ich bin Warren Prince von der Universe-Press, New York. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie wissen, dass ich stets für Neuigkeiten Interesse habe.“
„All right, Sir.“
Frau Königsgarten saß noch immer abgespannt in ihrem Sessel, als Marta wiederkam und ihr den Kaffee brachte. So müde war sie, dass sie nichts denken konnte. Sie hatte gestern Abend in Brüssel nicht gut gesungen, und das bedrückte sie etwas. Ach, sie war übermüdet und abgearbeitet, und zu viele Dinge gingen ihr zurzeit durch den Kopf. Trotzdem war der Erfolg groß gewesen – ein Glück nur, dass Reifenberg nicht zugegen war!
„Hoffentlich ist er dir stark genug, Eva“, sagte Marta.
„O danke, meine Liebe“, antwortete Eva und begann hastig den heißen Kaffee zu schlürfen. Augenblicklich wurde sie munter, und plötzlich war ihr alles gegenwärtig. „Es ist lieb, dass du alles schon ausgepackt hast, Marta“, sagte sie. „Ist das große Gepäck an Bord? Ja? Sage, hat sich Reifenberg schon sehen lassen?“
„Nein, Professor Reifenberg habe ich noch nicht gesehen.“
„Wenn er kommen sollte, so sage ihm, dass ich sehr müde bin.“
„Ja, Eva“, erwiderte Marta und fügte hinzu, dass Herr Gardener hier war. Er habe dieses Paketchen abgegeben und lasse grüßen.
Eva schrie erfreut auf. „Gardener?“
„Ja, er war hier, vor einer halben Stunde etwa.“
Gardener! Eva war beglückt bei dem Gedanken, dass der alte Gardener an Bord war. Sie freute sich auf seine Gesellschaft. Er war ein wahrer Freund, sein stilles Gesicht und seine Ruhe taten ihr immer so wohl.
Die Freude belebte sie, sie erhob sich. Zuerst öffnete sie Gardeners Paket. Ein Karton mit kandierten Früchten. Darauf lag ein Zettel: „Welcome, Baby!“ Und nun ging sie zu den Blumen, von einem Strauß zum andern, mit weich wiegenden hohen Hüften, und las Karten und Briefe. Auf ihrem Gesicht spiegelte sich jede Regung ihres Herzens, sie lächelte kindlich erfreut, steckte die Nase in den Duft der Rosen, sie verzog mit einem Achselzucken den Mund und lachte.
Plötzlich fiel ihr etwas ein. „Marta!“, rief sie erschrocken aus. „Ich habe ja Seppl ganz vergessen. Wie geht es denn Seppl? Warst du bei ihm?“ Seppl, das war Evas kleiner Dackel.
Natürlich war Marta bei Seppl gewesen. Sie hatte ihn ja selbst in das Hundequartier hinaufgebracht. Marta ging ins Badezimmer, um das Wasser einzulassen.
Die Königsgarten sah noch einmal alle Briefe und Telegramme durch und warf sie nachlässig auf den Flügel zurück. Zuletzt zeigte sich Unzufriedenheit auf ihren Wangen. Sie stand still, und ihre Wangen wurden flach vor Enttäuschung.
„Höre, Marta“, rief sie laut, so dass Marta sie nebenan hören konnte. „Außer Gardener hat sich niemand sehen lassen?“
„Nein, außer ihm niemand.“
Nichts, wahrhaftig nichts! Er hätte ihr wenigstens einen Gruß senden können, wenn seine Reise nach New York nicht möglich war. Die letzten Blumen bekam sie nach Brüssel gesandt. Wo sind sie? fragte sie sich plötzlich erschrocken. Sie waren nirgends zu sehen. „Marta, wo sind die hellen Rosen, die ich mitgebracht habe? Oder habe ich sie im Zug liegenlassen?“
„Sie stehen neben dem Bett, Eva.“
Ja, da standen sie wirklich, wie töricht sie doch war. Und Eva kehrt zu ihren alten Gedanken zurück, während sie noch einmal die Briefe und Telegramme durchsieht. Nicht eine Zeile, nicht ein Telegramm? Nicht ein winziges Telegramm?
Plötzlich ist Eva müde und mutlos. Sie geht in ihr Schlafzimmer, streift die Schuhe ab und ringelt sich, so wie sie ist, auf dem Bett zusammen. Sie verkriecht sich in sich selbst. Marta kommt, um zu melden, dass das Bad fertig sei. Aber die Königsgarten wendet nicht einmal den Kopf. „Lass mich schlafen, Marta“, murmelt sie, „und gib acht, dass mich niemand weckt, wer auch immer kommt. Ich will nicht gestört werden.“
„Jawohl, Eva.“ Und schon ist Eva eingeschlafen.
5
Als Prince in die Kabine zurückkehrte, war der Raum vom Geruch von Parfums und Essenzen erfüllt. Der Herr von Bett C war soeben damit beschäftigt, seine etwas abgeschabten und armseligen Handtaschen auszupacken.
„Ich hoffe, dass mein Benehmen von vorhin Ihnen nicht unhöflich erschien?“, sagte Prince. „Aber ich hatte große Eile, ich musste dem Lotsen meine letzte Post mitgeben.“ Mit einer leichten Verbeugung gegen den Herrn von Bett C fügte er hinzu: „Warren Prince, von der Universe- Press, New York.“
Der Herr mit dem gelblichen, langen Gesicht streifte Prince mit einem flüchtigen Blick. „Kinsky!“, erwiderte er mit gleichgültiger und undeutlicher Stimme, so dass Warren ihn kaum verstand, obschon er die Ohren scharfmachte.
Prince legte Rock und Kragen ab und begann höchst ungeniert in seinem Waschbecken zu plätschern.
„Entschuldigen Sie mich“, wandte er sich erneut an den Herrn von Bett C. „Aber ich bin förmlich in Schweiß gebadet. Zwei volle Stunden bin ich auf diesem Dampfer hin und her gelaufen, um schließlich gegen tausend Worte Kabel niederzuschreiben. Ein höllischer Beruf!“ Warren lachte. „Ein wahrhaft höllischer Beruf!“, wiederholte er, da er keine Antwort erhielt. Er war bemüht, mit diesem unbekannten Herrn, den ihm das Schicksal zum Reisegefährten bestimmt hatte, ins Gespräch zu kommen, wie er aus gänzlich unverdorbener und angeborener Neugierde mit allen Menschen, die ihm begegneten, Gespräche anknüpfte. Ja, wie sollte man anders die Menschen kennenlernen? Alles konnte man auf den Schulen lernen, nur über den Menschen selbst gab es keine Lehrbücher.
Für Warren Prince mit seinen dreiundzwanzig Jahren war alles ein Abenteuer, dessen Bedeutung man niemals voraussehen konnte; in jedem neuen Menschen erblickte er eine neue Möglichkeit zur Erforschung des Menschen. Der Sinn des Lebens schien ihm, soweit er bis heute überhaupt einen Sinn erkennen konnte, der zu sein, die Wahrheit über den Menschen zu ergründen.
Warren lauschte durch die Brause hindurch, doch er hörte nur, dass dieser Herr von Bett G ein Flakon entkorkte und sich die Hände einrieb. Er roch Eau de Cologne. Aber als er schon gar nicht mehr auf eine Antwort hoffte, sagte der Herr, der sich Kinsky oder ähnlich nannte: „Sie haben recht! Es muss allerdings ein geradezu schrecklicher Beruf sein!“ Er sagte es nachdenklich und, wie es schien, mit Überzeugung.
Warren fuhr erstaunt herum. Sein Kopf, seine Locken waren wie ein dicker Ballen von Seifenschaum. Er sah in diesem Augenblick ungeheuer komisch aus. „Aber das meinen Sie doch nicht ernsthaft?“, fragte er mit ungläubigem Lächeln, fast erschrocken.
Doch Kinsky nickte, ohne Warren anzusehen.
„Wie? Wie?“ Nein, dann hatte ihn der Herr gründlich missverstanden. Und Warren erklärte, dass er seinen Beruf leidenschaftlich liebe, leidenschaftlich! Ja, es schien ihm, als sei der Beruf des Journalisten heutzutage der einzige Beruf, den ein Gentleman ergreifen konnte. Und während er sich abseifte, fügte er hinzu, dass die Journalisten heute das seien, was in früheren Jahrhunderten die Abenteurer und Entdecker gewesen, die Kolumbus, Vasco da Gama, Cook. Ja, das waren heute sie. Abenteurer, Forscher, immer auf der Jagd nach dem Neuen. Sie waren die Avantgarde, die vor der Zeit hermarschierte.
Kinsky streifte Warren mit einem spöttischen, aber nachsichtigen Blick. Es war der Blick eines Menschen, der rasch und scharf beobachtet. Er hatte graue, etwas matte Augen, argwöhnisch und etwas hochmütig. Etwas wie ein mitleidiges Lächeln spielte um seinen schmalen Mund. Welch eine Überheblichkeit! schien sein Lächeln zu sagen.
„Hoffentlich haben Sie mir meine Offenheit nicht verübelt. Es lag natürlich keineswegs in meiner Absicht, Ihnen Ihren Beruf verleiden zu wollen.“
Warren hielt den Kopf unter die Brause und trocknete sich ab. „O bitte, bitte! Reden Sie offen, reden Sie stets offen mit mir, ich bitte Sie darum“, rief er aus. Sein Gesicht war vom Waschen gerötet, und er sah jetzt mit den nassen, dunklen Locken, die sich um seine Stirn ringelten, noch jünger aus, fast wie ein Knabe, ein Schüler, der etwas in die Höhe geschossen war. Es war nicht so leicht, ihm, Warren Prince, den Beruf zu verleiden, er wusste recht gut, was er tat.
Er setzte seine Hornbrille vor die kurzsichtigen Augen, und nun sah er diesen Herrn Kinsky, der so herabsetzend über seinen Beruf sprach, zum ersten Male wirklich.
Es war in der Tat ein ungewöhnliches Gesicht. Es war das Gesicht eines Asketen, lang, sehr hager, und wenn er den Kopf zur Seite wandte, so sah man eine auffallend stark ausgebildete Adlernase. Die Augen lagen tief und hatten einen abwesenden, düsteren Ausdruck, wie Asche, unter der nur noch etwas Glut ist, es waren fast die Augen eines grüblerischen und fanatischen Mönches. Ja! An Savonarola erinnerte dieses Gesicht. Aber je länger Warren dieses Gesicht betrachtete, während er sprach, desto mehr wurde ihm bewusst, dass er dieses Gesicht schon einmal gesehen hatte! Irgendwo, irgendwann!
Diese Nase, diesen auffallend kleinen Mund! Ohne Zweifel!
Herr Kinsky war sorgfältig gekleidet und gepflegt, seine Kleidung schien allerdings etwas altmodisch und abgetragen. Seine offenbar sehr früh ergrauten Haare waren peinlich gescheitelt. Er hatte schmale Hände und auffallend kleine Füße. Beste europäische Rasse, stellte Warren fest. Aristokrat? Künstler?
Kinsky, der Warrens indiskrete Musterung fühlte, hob plötzlich das Auge zu ihm, und Warren sagte etwas hastig, während er lächelte: „Alles in allem – Sie schätzen die Presse offenbar nicht? Das kann ich wohl sehen.“
Kinsky schüttelte den Kopf.
„Nein, nein, ich schätze sie keineswegs in dem Maße“, erwiderte er verächtlich, „wie Sie es wohl erwarten, Herr Prince. Im Übrigen gestehe ich Ihnen, dass ich nur sehr selten Zeitungen lese.“
Wie, hier war ein Mensch, der keine Zeitungen las – in einer Zeit, da man die Wälder Kanadas und Neufundlands abholzte, um das nötige Papier zu schaffen? Nun sah Warren wirklich verblüfft aus.
„Nehmen Sie an, mein Herr“, sagte er eifrig, „Messina wird von einem Erdbeben zerstört, ein Dampfer zerschellt, der Krebsbazillus wird entdeckt. Das alles interessiert Sie nicht?“
„Der Krebsbazillus wird nur selten entdeckt“, sagte Kinsky mit einem feinen ironischen Lächeln, das Warren sympathisch berührte. Dann fuhr er fort: „Natürlich – natürlich – ich weiß sehr wohl – aber es handelt sich um eine prinzipielle Einstellung. Verstehen Sie mich, Herr Prince?“
„Eine prinzipielle Einstellung?“
„Ja, ich lehne alle Dinge und Einrichtungen ab, die geeignet sind, die Menschen zu nivellieren. Zu diesen Einrichtungen gehört die Presse. Ich lehne sie ebenso ab, wie ich den Film, das Grammophon und das Radio ablehne. Grammophon und Radio hasse ich in Wahrheit.“ Er errötete leicht, als er dies sagte, und Prince ahnte, dass dieser Mann die Fähigkeit zu hassen besaß, wenn es sein musste.
Prince stand mit offenem Mund. Er bewegte hilflos die runden, etwas fleischigen Lippen, brachte aber kein vernünftiges Wort heraus. „Oh – oh“, stammelte er nur. „Auch das Grammophon – auch den Film?“
Kinsky wandte ihm das Gesicht zu, und zum ersten Male sah ihn Prince wirklich lächeln. „Sie werden mich für altmodisch und rückständig halten“, sagte er. „Und von Ihrem Standpunkt aus mit Recht.“
Prince schüttelte den Kopf. „Nein, nein – aber Sie werden zugeben, dass Sie damit eine Reihe unserer kulturellen Errungenschaften verwerfen.“
Nun wurde der Ton des Herrn Kinsky spöttisch, als er antwortete: „Sie belieben, diese Einrichtungen kulturelle Errungenschaften zu nennen? Ich möchte sie ganz anders bezeichnen.“
Prince verstummte. Was sollte er darauf erwidern? Ein Mensch aus einer anderen Welt! Ein Antipode, seht an! Aber er fand diesen Herrn nicht uninteressant als Erscheinung. Er würde ihn aushorchen und in einem seiner dicken Notizbücher festhalten, für die Romane, die er einmal schreiben wollte.
„Ihre Auffassung ist nicht uninteressant, mein Herr, aber Sie werden mir doch einige Einwendungen erlauben müssen“, entgegnete er, in der Absicht, das Gespräch fortzusetzen und seinen Gegner zu stellen.
Aber Kinsky winkte ab. „Ein andermal, verzeihen Sie“, sagte er. „Ich bin müde, ich leide an Schlaflosigkeit Wir werden ja, hoffe ich, noch öfter Gelegenheit haben, zu plaudern.“
Er kramte nach irgendetwas in seinem Jackett und zog ein Zigarettenetui heraus. „Ich weiß freilich nicht, ob es erlaubt ist, in der Kabine zu rauchen?“, fragte er, aber in verändertem Ton, vertrauter, „ich fahre zum ersten Male auf einem solchen Schiff.“ Er betrachtete Prince mit einem gewissen Wohlwollen. Er sah keineswegs mehr so unglücklich und verzweifelt aus wie in dem Augenblick, da er in die Kabine trat. Dieser Prince schien ihm ein sympathischer junger Mann zu sein, mit dem es sich gut auskommen ließ. Er war fast noch ein Knabe, warm vor Begeisterung über dieses großartige Leben, das unendlich und verlockend und gleisnerisch vor ihm lag. Bei aller jugendlichen Überheblichkeit zeigte er eine gewisse Bescheidenheit in den Manieren, die angenehm wirkte.
Prince wurde unter den Blicken Kinskys unsicher und errötete. Er strich sich die feuchten Locken aus der Stirn. „Natürlich ist es strengstens verboten. Aber ich rauche stets in der Kabine, und alle Welt raucht“, sagte er. Er lachte, und im gleichen Augenblick hatte er seine Unsicherheit überwunden.
Das Etui, das ihm Kinsky reichte, war ein auffallend kostbares Stück. Es war aus Lapislazuli, in Silber gefasst. Auf der Vorderseite befand sich eine kleine silberne Krone. Oh! Sagte ich es nicht – ein Aristokrat! Warren hatte wieder Gelegenheit, seinen Scharfsinn zu bewundern.
„Ich hoffe, wir werden uns auf der Reise nicht allzu sehr stören, Herr Prince“, sagte Kinsky leichthin.
Warren legte Kragen und Binde an, und während er in den Spiegel blickte, dachte er darüber nach, wann und wo er dieses Gesicht schon gesehen hatte. Denn er hatte es gesehen, das wusste er: diese scharfen Schläfen der hohen Stirn, diesen kleinen eingekniffenen Mund, diese große Nase – er konnte sich unmöglich täuschen. Nebenher erwähnte er, die Zigarette in den Lippen, dass noch ein dritter Passagier die Kabine mit ihnen teilen werde, aber ein angenehmer Gast. Ein Freund von ihm: Roger Philipp, ein reizender Junge, den alle Welt gern hatte. Übrigens würden sie ihn kaum zu sehen bekommen, nur in der Nacht. Er sei sehr beschäftigt. „Er ist Sekretär bei J. P. G.“, sagte Prince.
„J. P. G?“
„Bei J. P. Gardener“, fügte Prince hinzu. Aber dieser gewichtige Name, schwer wie Gold, schien auf den Mann mit der Krone auf dem Etui nicht den geringsten Eindruck zu machen. „Sie wissen doch wohl, wer J. P. Gardener ist?“
Kinsky lachte leise und belustigt in seine Handtasche hinein. Er wusste es wirklich nicht, und es schien ihm auch völlig gleichgültig zu sein.
„J. P. Gardener“, erklärte Prince voller Wichtigkeit, „das ist die Kohle Amerikas!“ Die Kohle Amerikas! Das war wohl nicht wenig, oder?
Kinsky packte seine Reisetasche aus, er gab keine Antwort mehr und schien gar nicht zuzuhören.
Das Signal einer Trompete drang durch den Korridor, es klang sehr fern, wie in einem Wald. Die Trompete rief zum Lunch.
„Wenn Sie an unserem Tisch Platz nehmen wollen, mein Herr“, sagte Prince höflich, während er in seinen Rock schlüpfte, „so wird es Philipp und mir ein Vergnügen sein.“
„Danke!“
„Sie reisen nach New York?“, fragte Prince neugierig und sachlich, als wolle er Kinsky interviewen. Er konnte jetzt seine Neugierde nicht länger zügeln.
„Ja, nach New York.“
„In Geschäften, wenn ich fragen darf?“
„Nein, nicht in Geschäften“, entgegnete Kinsky zerstreut und vermied Warrens Blick.
„Also wohl zu Studien?“
„Nein, auch nicht zu Studien“, sagte Kinsky ausweichend.
Warren überprüfte seinen Anzug im Spiegel und war zufrieden. Er hatte sich in Paris völlig neu ausstatten lassen, bei Monsieur Pelot, Rue Richelieu. Ein fabelhafter Schneider und gar nicht teuer. Etwas zerstreut fragte er weiter: „Sie reisen also als Tourist?“
„Nein. Auch nicht als Tourist eigentlich. Aber vielleicht könnte man sagen als Tourist.“
„Sie sind Deutscher?“
„Nein, Österreicher.“
„Oh, ich dachte es mir. Nach der Aussprache. Aus Wien?“
„Ja, ich bin in Wien geboren.“
„Oh, Wien! Eine herrliche Stadt, die ich liebe!“, rief Warren freudig aus. Er sprach nun Deutsch, das er völlig beherrschte. Bisher hatten sie Englisch gesprochen. Dieser junge Mann sprach fließend sechs Sprachen. „Sie wissen vielleicht, dass eine berühmte Landsmännin von Ihnen an Bord ist?“
Kinsky hob das Auge.
„Frau Eva Königsgarten! Sie kennen sie wohl?“
Kinsky blickte zu Boden und schwieg eine Weile.
Warren maß fast einen Meter achtzig und blickte auf Kinskys Scheitel herunter. Die gesenkten Lider Kinskys lagen wie graue Flecke auf seinen mageren, gelben Wangen, die Warren plötzlich gelb und vergrämt erschienen.
„Frau Königsgarten wird morgen Abend ein Konzert an Bord geben. Für die Pensionskasse der Linie.“
„Ja, ich kenne sie“, erwiderte Kinsky, ohne aufzublicken.
„O ja, ich kenne sie sogar sehr gut.“
„Persönlich?“, rief Warren. Er dachte augenblicklich an eine Einführung bei der Sängerin.
Kinsky trat zurück, da ihn Warrens Stimme erschreckte. Sein Gesicht wurde dunkel. „Ja, persönlich“, sagte er, und seine Stimme klang plötzlich ganz verändert. „Aber es ist wohl korrekter, wenn ich sage, ich kannte sie einmal sehr gut. Wir sind etwas auseinandergekommen – Sie wissen, dass das vorkommt.“ Er versuchte zu lächeln, aber das Lächeln misslang.
„O ja, ich weiß es“, erwiderte Warren etwas verwirrt. Dann aber fügte er mit seiner früheren frischen Stimme hinzu: „Wir sehen uns vielleicht beim Lunch, Herr Kinsky? Nicht wahr, Kinsky, das ist doch richtig?“
„Ja, das ist richtig.“
Ein merkwürdiger Herr, dachte Warren, während er in den Speisesaal hinaufstieg. Zu welchem Zweck reist er eigentlich nach New York? Nicht in Geschäften, nicht zu Studien, vielleicht als Tourist? Wie er ihn gemustert hatte, mit einer gewissen Herablassung, sagen wir so, nicht wahr, oh, diese österreichischen Aristokraten gelten ja als die hochmütigsten der Welt.
Kinsky? Kinsky? Irgendwo und irgendwann hatte er diesen Namen schon gehört. Denke nach, Warren! Irgendwo und irgendwann hatte er auch dieses Gesicht schon gesehen. Wo, wann? Denke nach, Warren! Es schien ihm jetzt, als habe er dieses Gesicht nicht in Wirklichkeit gesehen, sondern auf einer Abbildung. Ach, das aber war schon ein kleiner Fortschritt.
Als Prince seine Kabine verlassen hatte, fuhr Kinsky fort, seine Handtasche auszupacken, gleichgültig und gedankenlos, wie jemand, der sich ablenken und beschäftigen will. Er stellte Flakons und Rasierzeug auf den Waschtisch, dessen Armaturen funkelten, und begann dann, seine gepflegten Fingernägel zu polieren. Schließlich hielt er inne und dachte lange nach.
Er ließ alles stehen und liegen und streckte sich auf dem Bett aus. Er rauchte zwei, drei Zigaretten und starrte zur Decke empor.
„Sie ist also hier! Sie ist also wirklich hier!“, sagte er vor sich hin. Seine Lippen bebten. Er schloss die Augen.
6
Als Eva Königsgarten aufwachte, war es schon fast dunkel. Sie wusste nicht sofort, wo sie sich befand. Das Bett, auf dem sie lag, bebte, und unter ihr in großer Tiefe pochte irgendetwas schwer und regelmäßig wie in einem Bergwerk, in dessen Stollen Hämmer arbeiten. O ja, sie war auf See! Sie hatte eine freudige Erregung aus dem Schlaf mitgebracht. Ach, nun wusste sie es: Sie hatte von Grete geträumt.
Da lag sie auf einer jener sanften Anhöhen in der Nähe ihres Landhauses bei Heidelberg, wo sie ihre Ferien zu verbringen pflegte. Es war Sommer. Die heiße, von der Sonne erhitzte Luft umspülte ihre Wangen. Sie lag inmitten der schlichten Blumen und Gräser des badischen Landes, die einen zarten, herrlichen Geruch ausströmten. Wie mit silbrigem Dunst bedeckt, lag unten das Tal des Neckars. Neben ihr kauerte ihr süßes kleines Mädchen und kitzelte sie kichernd mit einem Halm in der Nase. Sie tat, als schlafe sie, und schalt auf irgendeine Fliege, die sie belästige, und ihr süßes Mädchen kicherte. Das war das Spiel. Plötzlich aber war Grete verschwunden, und sie hörte sie aus dem blauen Dunkel des nahen Waldes rufen. Sie richtete sich rasch auf. Grete! rief sie. Aber das Kind antwortete nicht mehr. Grete, Grete, so antworte doch! Da sprang sie erschrocken auf und lief in den Wald hinein, voller Angst. Nun lachte Grete irgendwo in einem Gebüsch. Da erwachte sie.
Sie brachte aus dem Traum noch die Hitze des Sommers mit und den Geruch der heißen Blumen und Gräser und des ausgetrockneten Bodens, der nach Kalk roch. Ja, wo war ihr hochbeiniges süßes Mädchen so plötzlich hingeraten? Irgendein Schabernack, nichts sonst. Sie lächelte, beglückt von dem Geschenk des Traumes: Wie deutlich hatte sie doch Grete gesehen!
Eva setzte sich aufrecht und machte Licht. Auf dem Tischchen neben dem Bett stand das Bild ihres süßen kleinen Mädchens, das sie auf allen ihren Reisen mit sich führte. Ein anderes Bildchen, nur so groß wie eine Briefmarke, trug sie zusammen mit einem winzigen goldenen Kreuz ihrer toten Mutter immer auf der Brust als Talisman mit sich, Tag und Nacht. Eva nahm das Bildchen und küsste es und sagte vorwurfsvoll: „Weshalb bist du eigentlich weggelaufen, du böses Mädchen? Ich sollte mich wohl ängstigen, ein Schabernack bist du, nichts sonst!“ Ihr kleines Mädchen kicherte wie im Traum.
Marta öffnete vorsichtig die Tür des Badezimmers. „Hast du gerufen, Eva?“
Nein, Eva hatte nicht gerufen, sie sprach nur mit sich selbst. War jemand hier gewesen? fragte sie. Ja, Professor Reifenberg war hier, aber sie hatte ihm gesagt, dass Eva schlafe und unter gar keinen Umständen geweckt werden wolle. Was sagte er? Nun, er sagte, dass er morgen um zehn pünktlich zur Stunde kommen werde. Dann hatte der Steward eine Einladung gebracht, hier war sie. Direktor Henricki gab sich die Ehre, Eva heute Abend zum Souper zu bitten, im „Ritz“. In ganz kleinem Kreis. Eva schnitt eine Grimasse. Die Menschen sollten sie doch endlich in Ruhe lassen. Nein, sie war keineswegs erfreut über die Einladung, aber da konnte sie wohl nicht gut nein sagen? Sie schrieb ein paar Zeilen auf ihre Visitenkarte, der Steward sollte sie bestellen. Dann schmiegte sie sich wieder faul in die Kissen und den Halbschatten der Kabine. Dabei plauderte sie halblaut mit Marta, wie es ihre Art war, ohne auf Antwort zu warten. Sie liebte die Räume, die die Linie ihr überlassen hatte; es war eine richtige kleine Wohnung, in der sie sich sofort behaglich fühlte. Ja, hier in dieser kleinen netten Wohnung konnte sie sich endlich einmal richtig ausruhen. Sie wollte niemanden sehen, nein, keinen Menschen, Reifenberg und Gardener natürlich ausgenommen – die Menschen gingen ihr auf die Nerven. Sie wollte auch meistens auf der Kabine speisen. Ach ja, sie wollte sich ausruhen und pflegen! Du musst sehen, Marta, dass du mir morgen eine Masseuse bringst, meine Brust wird zu stark. Und dann will ich Gymnastik treiben. Ach, ich werde immer fauler, Marta. Nicht wahr, ich fange an, ganz schrecklich faul zu werden? Und Eva lachte plötzlich über sich selbst laut heraus. Sie konnte heiter und hell lachen, wie selten eine Frau, und schon in ihrem hellen Lachen begann es aufzuklingen, und man ahnte ihre herrliche Stimme.
„Ja, es wird Zeit, dass du jetzt aufstehst, Eva“, sagte Marta unzufrieden. „Das Bad wird sonst noch einmal kalt werden.“ Eva empfand den Ton ihrer Stimme als Tadel und stand augenblicklich auf. Marta hatte sie schon als junges Mädchen betreut und besaß noch immer eine große Autorität über sie.
Nach dem Bad ging Eva wieder, eingehüllt in einen tiefblauen, chinesischen Seidenmantel, in ihrem kleinen, halbdunklen Salon hin und her und schnupperte zerstreut in den Blumensträußen. Plötzlich entdeckte sie einen förmlichen Busch von weißem, gefülltem Flieder. Es war eine Art, die herrlich duftete. Diesen Busch, der so ungewöhnlich groß war, konnte sie doch unmöglich früher übersehen haben? Keine Karte, kein Brief, nichts. Sie stand und starrte den Flieder an.
„Marta?“, rief sie erregt. „Wann ist denn dieser weiße Flieder gekommen?“
„Ein Steward hat ihn gebracht.“
„So rufe diesen Steward!“, sagte Eva mit einer sehr eigensinnigen Stimme. Dieser weiße Fliederstrauß hat Eva wahrhaftig in Aufregung versetzt. Sie ahnt, wer diesen weißen Fliederstrauß gesandt hat – niemand anders würde auch auf den Einfall kommen, gleich einen ganzen Busch zu senden. Es wird nicht lange dauern, und ein drahtloses Telegramm wird eintreffen. Endlich kommt der Steward. Er berichtet, dass ihm ein Kollege den Strauß übergeben habe mit dem Auftrag, ihn in der Kabine von Frau Königsgarten abzugeben. „Schicken Sie diesen Steward, bitte!“, befahl die Königsgarten. Aber der Steward kam nach einer Weile zurück, er konnte den Kollegen nicht mehr feststellen. Es war kurz nach der Abfahrt des Dampfers gewesen, wo alle Leute noch durcheinanderliefen, und es waren so viele Stewards mit neuen Gesichtern an Bord.
Ach, Eva ist schlecht gelaunt. Eva hat törichte Gedanken im Kopf. Sie ist plötzlich wahrhaft unglücklich, und ihre vorzügliche Laune ist dahin. Nur um sich zu beschäftigen, kramt sie in ihrem Schrank, um ein Kleid für den Abend auszusuchen, obschon sie gar keine Lust hat, heute noch einmal ihre Kabine zu verlassen. Was für eine Dummheit, dass sie diesem Direktor zusagte. Es war ja nichts als Eitelkeit. „Ach, weißt du, Marta“, sagte sie, „dass dieses Leben mich langsam anekelt? Es wäre viel besser, wir säßen in unserem Garten in Heidelberg. Mit Grete.“
Ja, auch Marta fände das vernünftiger.
Es klopfte an der Tür. „Niemand, niemand, hörst du, Marta, will ich sehen, niemand!“, sagte Eva hastig und stampfte – eine schlechte Gewohnheit von ihr – mit dem Fuße auf.
Aber Marta kam zurück, in gebückter Haltung vor lauter Getue, und flüsterte, der Sekretär von Herrn Gardener sei da. Herr Gardener frage an, ob er den Tee bei Eva nehmen könne.
„Gardener?“ Eva atmete auf. Gardener? O ja, natürlich, sie würde sich freuen. Gardener war ein wahrhaft väterlicher Freund und einer der seltenen Männer, die nichts von ihr wünschten, sympathisch und still. Sie war froh, ihn zu sehen.
Gardener kam. Er hatte Sehnsucht, sagte er, Eva nach so vielen Monaten wiederzusehen, und konnte nicht länger warten, um zu fragen, ob er nicht etwas für sie tun könne. „Kann ich etwas für Sie tun, Eva?“, das war seine ständige Frage. Er schloss Eva etwas ungeschickt in die Arme und streichelte ihr die Wange. Gardener war ein großer, schwerer, älterer Mann mit dichten, aschgrauen Haaren. Sein derbes Gesicht war auffallend dunkel, von tiefen Linien durchfurcht, müde und melancholisch. Er ging leicht gebückt, schleppte den rechten Fuß unmerklich nach und atmete etwas asthmatisch.
„Da sind wir also wieder, Baby!“, sagte er froh, soweit er froh sein konnte, und sah sie mit seinen grauen, düsteren Augen an. Dann ließ er sich schwer in einen Sessel nieder, wie ein Mann, der sich mit einer schweren Last auf den Schultern niederlässt.
Er seufzte, aber voller Zufriedenheit. „Ich bin glücklich, Sie wiederzusehen, Eva. Es geht Ihnen gut, hoffe ich?“
Gardener liebte Eva wie seine eigene Tochter. Ihre gesunde Frische belebte ihn, die Kraft, die aus ihr strömte. Er hatte ihre Bekanntschaft vor einigen Jahren in Chicago gemacht und ihr vom ersten Augenblick an eine aufrichtige und tiefe Freundschaft entgegengebracht. Sie war einige Wochen sein Gast auf seinem Besitz Evelyn Park gewesen, und er erinnerte sich voller Glück an diese wundervolle Zeit. Eva brauchte gar nichts zu tun, nicht einmal zu sprechen, sie musste nur da sein, das genügte ihm. Sooft er nach Europa kam, versäumte er es nie, sie zu besuchen, und wenn er auch Tag und Nacht reisen musste. Er wäre glücklich gewesen, sie immer in seiner Nähe haben zu können.
Ja, es ginge ihr vorzüglich, erwiderte Eva. „Und Ihnen, Gardener?“
Gardener schüttelte langsam den Kopf. Er sah düster und melancholisch aus. Es gab da manches, was nicht gerade sehr erfreulich war! Eva wusste: die Kinder!
Da war sein Sohn George, und da war seine Tochter Hazel. George lebte in Paris, inmitten der Boheme; jahrelang war er von einem Schwarm von Schmarotzern, Schmeichlern und zweifelhaften Frauen umgeben und warf das Geld mit vollen Händen zum Fenster hinaus. Er malte.
Das war George, und der Alte hatte zuversichtlich gehofft, dass er einmal die Leitung von Barrenhills übernehmen würde. Die furchtbare Enttäuschung würgte an ihm. Eva hatte diesen George niemals gesehen, aber Hazel Gardener lernte sie auf Gardeners Landsitz Evelyn Park bei Pittsburg kennen. Diese Hazel war eine robuste Frau, mit dem derben Kinn ihres Vaters, ein Mannweib, mit einem gelben, riesigen Haarschopf, ohne frauliche Eigenschaften, hart, fast lieblos, aber von klarem Verstand. Sie war launenhaft bis zur Hysterie und unfassbar eigenwillig. Kaum erwachsen, wurde sie von politischem Ehrgeiz ergriffen, sie wurde Sozialistin, und die Tochter Gardeners sprach, den gelben, wirren Haarschopf fanatisch schüttelnd, in den Versammlungen der U. W. W. Nach den Versammlungen fuhr sie in ihrer Luxuslimousine nach Evelyn Park zurück, tyrannisierte ein halbes Dutzend von Dienstboten und hielt dem alten Gardener Vorträge über die Prinzipien des Sozialismus.
Er litt damals schwer und bekam ein Gallenleiden. Seitdem war seine Hautfarbe so dunkel geworden.
„Und Hazel? Was macht Hazel?“, fragte Eva.
„Hazel?“ Wieder schüttelte Gardener langsam den Kopf. „Hazel? Ja, was mag sie jetzt wohl machen? Sie ist nicht mehr in Evelyn Park.“
„Sie ist nicht mehr in Evelyn Park?“, fragte Eva voller Verblüffung.
„Nein, sie hat mich verlassen“, sagte Gardener bitter.
Eva goss den Tee ein. Eine Weile schwieg sie, dann sagte sie: „Was ist geschehen, Gardener? Sie wissen, Hazel hat ihre Launen.“
Gardener nickte. „Ja, das weiß ich. Ob ich es weiß! Seit drei Monaten ist sie fort – für immer, wie sie sagte.“
„Aber das glauben Sie doch nicht etwa?“
„Wer weiß es? Sie beschäftigt sich zurzeit mit der Negerfrage.“
„Mit der Negerfrage? Aber auch das wird vorübergehen, wie so vieles andere.“
Gardener hob ungläubig die Schultern. „Vielleicht. Sie meinen es gut mit mir, Eva. Sie sind ein gutes Kind. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Es ist diesmal ein Mann im Spiel. Ein Mann – zum ersten Male in Hazels Leben.“
So also war es: Da erschien eines Tages ein Apostel der Neger in Pittsburg, ein gewisser Dr. Baker, ein studierter Neger. Er war gegen zwei Meter groß, ein Athlet, mit mehliger Gesichtsfarbe, weißer als ein weißer Mann. Dieser Dr. Baker kam aus New York, aus Harlem, er sprach in Chicago, Pittsburg, St. Louis, überall hatte er einen ungeheuren Zulauf. Er kämpfte für die soziale und gesellschaftliche Gleichberechtigung seiner Rasse. Mochte er. Die Gesetze der Staaten gaben jedermann das Recht, für jede Sache, die ihm gut schien, zu kämpfen.
Hazel fühlte sich zu diesem Dr. Baker hingezogen und versäumte keine seiner Versammlungen. Sie befreundete sich mit ihm, sie zeigte sich mit ihm auf der Rednertribüne. Fortan agitierte sie für die Sache der Neger. Hazel Gardener!
Bald erschienen Bilder in den Zeitungen: Hazel Gardener und Dr. Baker. Hazel Gardener ist empört über die Lynchgerichte gegen arme Neger, Hazel Gardener nennt sie eine Schande der amerikanischen Nation.
Das war also die Geschichte mit Hazel. Zurzeit war sie mit Dr. Baker in New Orleans. Er hatte gehört, dass sie sich mit Dr. Baker liiert hatte. Sie wollte zeigen, dass es auch vorurteilslose Amerikanerinnen gab.
Gardener schwieg, die Augen halb geschlossen, und Eva sagte kein Wort. Sie begriff Gardeners tiefen Kummer.
Eine Weile schwiegen sie beide, dann begann Eva von dem Streik auf Barrenhills zu sprechen. Sie habe darüber in den Zeitungen gelesen. „Es dauert ja nun schon wochenlang“, sagte sie.
Gardener krümmte sich noch mehr zusammen.
„Ja“, sagte er, „sechs Wochen. Es steht schlimm, sehr schlimm. Ich hoffe nur, dass Holzmann, der Direktor von Barrenhills, so geschickt ist, die Verhandlungen bis zu meiner Rückkehr hinzuhalten. Aber sprechen wir nicht davon, Eva, nicht von diesen unerfreulichen Dingen.“
Gardener richtete sich auf. Er hoffe, begann er in anderem Ton, dass Eva diesmal längere Zeit in den Staaten bleiben werde, und nichts wünsche er mehr, als dass sie auf einige Zeit sein Gast auf Evelyn Park sei. Einige Zeit? Sie konnte natürlich bleiben, solange sie wollte. Für immer, wenn sie Lust hatte.
Eva lächelte. „Ich werde sehen. Einige Wochen wird es wohl möglich sein.“
Nun fiel Gardener noch etwas ein. Er kramte in der Tasche und zog ein zusammengefaltetes Telegramm heraus. „Hier ist ein Telegramm für Sie, Eva“, sagte er. „Von unserem guten Freund Klingler.“
Eva entfaltete das Telegramm, eine rasche Erregung flog über ihre Züge. „Er hat ja einen ganzen Brief depeschiert!“, sagte sie und las mit einem stillen Lächeln das Telegramm.
„Unser guter Freund Klingler hat mich beauftragt, Sie unter meinen Schutz zu nehmen, Eva“, sagte Gardener. „Ich werde also täglich anfragen, ob ich nicht etwas für Sie tun kann. Klingler meint es wirklich gut mit Ihnen.“
„Ich weiß es, Gardener. Ich habe große Sympathien für ihn.“
„Darf ich ihm das kabeln?“
„Wenn Sie wollen?“ Eva lachte.
„Unser Freund Klingler ist der beste und gütigste Mensch der Welt, Eva“, fuhr Gadener mit einer gewissen Hartnäckigkeit fort. „Er sieht gut aus, er ist gesund und besitzt ein großes Vermögen. Und er liebt Sie. Ich weiß nicht, weshalb Sie sich die Sache so lange überlegen, Eva?“
Eva lachte wiederum. „Hören Sie auf damit, Gardener. Hören Sie endlich auf damit.“
„Ich sage kein Wort mehr, Eva“, sagte Gardener und erhob sich schwerfällig. Er stand und dachte über irgendetwas nach. Einmal hatten Eva und Professor Reifenberg in Evelyn Park abends musiziert, ganz zwanglos, als ob sie beide allein seien. An diesen Abend musste er denken, er war unvergesslich herrlich! Damals war sein Freund Klingler in Evelyn Park zu Gast, und seit dieser Zeit war Klingler, ein ernster, stiller Mann, von Eva wie besessen. Ja, es war ein herrlicher Abend, damals. Gardener lächelte trüb. Er sprach nichts mehr.
„Wenn Sie einmal ein Stündchen Zeit für mich alten Mann haben“, sagte er zum Abschied, „so lassen Sie es mich wissen, Eva. Ich will Ihnen nicht lästig fallen.“
7
Die amerikanische Presse hatte die sensationelle Nachricht verbreitet, dass die „Cosmos“ die Absicht habe, den Schnelligkeitsrekord über den Atlantik an sich zu reißen, den in dieser Zeit die „Mauretania“ innehatte. Die europäische Presse hatte diese Nachricht übernommen. Das Blaue Band! Es war eine ungeheure Sache, und Warren Prince bekam Herzklopfen, wenn er nur daran dachte. Ein Staat, dem es gelang, das schnellste Schiff der Welt zu bauen, es war so viel wert wie eine gewonnene Schlacht! Percival Bell, sein Chef, hatte ihm entsprechende Anweisungen gegeben, und Warren wusste genau, worum es ging.
Die Linie hatte die Meldung der Zeitungen dementiert, natürlich, aber an Bord kursierten trotz allem bestimmte Gerüchte. Die Offiziere, die Warren aushorchen wollte, antworteten ausweichend, aber es schien Warren, als bemühten sie sich, ein geheimnisvolles, zuversichtliches Lächeln zu verbergen. Im Quartier der einhundertundfünfzig Feuerleute munkelte man dies und das; es war eine besonders erlesene Mannschaft von Heizern ausgewählt worden, hieß es.
Der Erbauer der „Cosmos“, Herr Schellong, der an Bord war, ein stiller, schüchterner und äußerst merkwürdiger Mann, hatte nur die Achseln gezuckt, als ginge ihn die ganze Sache nichts an. Er wusste nichts.
„Ich habe die ,Cosmos‘ konstruiert“, sagte er, „aber ich fahre sie nicht.“
Nun, vielleicht war es möglich, diesen liebenswürdigen Direktor etwas auszuhorchen, dachte Warren, als er Henricki in der Tür des Rauchsalons begegnete. Er musste es ja schließlich wissen.
Warren hatte aber kaum den Mund aufgemacht, als dieser Direktor Henricki schon belustigt zu lachen begann, ganz, als erzähle man ihm einen Scherz, ein Märchen, etwas geradezu Unsinniges. „Dummes Zeug“, sagte er und lächelte nachsichtig. Prince möge doch bedenken: eine völlig neue Maschine! Sie müsse sich doch erst einspielen. Ob Prince eine Ahnung habe, wie empfindlich Turbinen seien? Tausende von dünnen Stahlschaufeln! Nein, Warren hatte in der Tat keine Ahnung, und er sah an Henrickis unsicherem Blick, dass auch Henricki keine Ahnung davon hatte. Direktor Henricki lachte belustigt, er hatte ein reizendes, fast frauenhaftes Lachen. Vielleicht nach der sechsten Fahrt, vielleicht, aber auch das glaubte er nicht. Die „Cosmos“ war eigentlich nicht als schnelles Schiff gebaut, so war es.
Eigentlich! sagte er. Es war eine Schwingung in Henrickis Stimme, der Warren misstraute. Der Eifer seines Dementis war etwas auffällig. Auch sein amüsiertes Lächeln kam Warren nicht aufrichtig vor, er schien es bereitgehalten zu haben.
Henricki hatte übrigens Befehl gegeben, die Depeschen anzuhalten, die sich mit diesem Gerücht abgäben. Das sagte er nebenbei und mit äußerster Freundlichkeit. „Sonst können Sie depeschieren, was Sie wollen, Prince!“
Dieser Direktor Henricki, mit dem Beinamen „Die Primadonna der Linie“, war in der Tat einer der liebenswürdigsten Menschen, denen Warren Prince in seinem Leben begegnet war. Seine Liebenswürdigkeit war geradezu bestechend. Er senkte augenblicklich das Ohr, wenn man an ihn herantrat, und seine Augen strahlten schon Zustimmung, während man noch mit ihm sprach. Oh, Warren Prince hatte viele Wünsche, aber Direktor Henricki versprach, sie ihm alle erfüllen zu wollen. Er wollte ihn bei allen Prominenten, die an Bord waren, einführen. Prince sollte Tag und Nacht zu allen Teilen des Dampfers Zutritt haben, zur Maschine, zur Brücke, zu allen Decks. Konnte ein Journalist mehr verlangen?
Henricki lachte erneut. „Sie würden mir wahrhaftig einen Gefallen tun, wenn Sie dieses unsinnige Gerücht dementieren wollten. Wir wollen die Maschine doch nicht in Klumpen fahren. Kommen Sie, Prince“, sagte er und schlang den Arm vertraulich um die Schulter von Warren. „Ich will zur Brücke hinauf, ich kann Sie bei dieser Gelegenheit dem Kommodore vorstellen.“
Sie stiegen über die vom Licht geblendeten Decks nach oben. Musik drang aus den Salons, Stimmen und frohes Gelächter. Die Passagiere, kaum an Bord, hatten das neue Schiff, das noch nach Farbe und Lack roch, schon völlig in Besitz genommen. Ganz oben auf dem Schiff, in dem weißen, flachen Villenviertel zwischen den roten Schornsteinen, dem Quartier der Offiziere, war es plötzlich sehr still. Ein jäher Wind fuhr über sie her. Hier oben war es fast ganz dunkel, nur wenige Lampen zeigten den Weg. „Der Kommodore?“, rief Henricki den Schatten eines Matrosen an.
„Auf der Brücke!“ Ach, hier oben herrschte ein ganz anderer Ton.
Die „Cosmos“ jagte durch den Kanal und stieß aus ihren drei roten Türmen dunklen Qualm in den nächtlichen Himmel empor. Sie bebte und knarrte zuweilen, manchmal schien es, als ob sie sich unmerklich hob und senkte, wie ein Schwimmer. Sie war in eine widrige, zähe Strömung geraten. Wirre, fantastische Stimmen des Windes schrien hier in dem Villenviertel in der Luft, und dann und wann vernahm man aus der Tiefe das peitschende, harte Klatschen der Wellen, die an der Schiffswand emporschlugen. Das waren die Vorboten des großen weiten Meeres.
Auf der „Cosmos“ brannten über dreißigtausend elektrische Lampen. Sie waren bestickt mit Reihen gleißender Sterne. Ihre hohen Verdecks blendeten wie die Etagen eines festlich beleuchteten Schlosses. Ihre roten Schornsteine, durch Scheinwerfer beleuchtet, leuchteten, als ob sie in Rotglut glühten. Von Lichtnebeln umweht, ein Haufe von Sternen, zog die „Cosmos“ durch die Nacht dahin.
Oben auf der Kommandobrücke aber, einem richtigen, lang gestreckten Saal, war es fast vollkommen dunkel, und Warren, noch geblendet von den Lichtern der Decks, sah zuerst überhaupt nichts. Das Vorschiff lag abgeblendet in tiefstem Schatten. Nach einer Weile unterschied er einige rote Lampen, die irgendwo brannten, wie Lampen in einer Dunkelkammer, dann sah er in der Mitte der Brücke eine matt beleuchtete Scheibe, das war der Kompass. Aber der Rudergänger, der das Rad führte, war nichts als ein Schatten, der sich nicht bewegte. Es war so still hier oben wie in einer Kirche, und die Stille war fast beklemmend, wenn man aus dem Schiff heraufkam, das von unten bis oben angefüllt war mit dem Lärm der Menschen.
„Wer ist da?“, fragte plötzlich eine forsche Stimme, und ein Schatten trat unvermittelt an Warren heran. Es war der Zweite Offizier, Unmack, ein untersetzter Mann mit breiten Schultern.
„Ich bin es, Unmack“, erwiderte Henricki an Warrens Stelle mit gedämpfter Stimme. „Ich bringe Ihnen Herrn Warren Prince, den Vertreter der Universe-Press.“
„Sehr erfreut, Herr Prince!“, sagte Unmack.
Die „Cosmos“ hielt rein westlichen Kurs. Eine dunkle Wolkenbank lag im Westen wie ein hohes dunkles Kap, in das der Dampfer hineinzufahren schien. Aber da, wo vor einer Stunde die Sonne untergegangen war, stand noch ein düsterer, rötlichgrauer Schein am schwarzen Himmel, wie der Schein einer erlöschenden Feuersbrunst. Steuerbord schleuderte in der Ferne ein Leuchtturm seine Windmühlenflügel aus gleißenden Lichtschleiern gespenstisch in die Dunkelheit hinein. Noch ferner glühte am Horizont ein feuriger Schädel, er blähte sich auf, als wolle er zerplatzen, um plötzlich wieder zusammenzuschrumpfen. Der Offizier trat augenblicklich wieder an seinen Platz zurück. Er hielt die Augen scharf auf einen Schatten gerichtet, der vor dem Bug herumkroch. „Dieser verfluchte Skipper, man müsste dieses Viehzeug ganz einfach über den Haufen fahren“, knurrte Unmack. Es war ein Gaffelschoner, der vor dem Wind fuhr und leicht einige Striche abfallen konnte. Aber er dachte gar nicht daran. Die „Cosmos“ stieß ein kurzes, drohendes Knurren aus und schwang im Bogen nach Backbord aus.
„Wo ist der Kommodore?“, fragte Henricki. Unmack deutete mit dem Kopf auf einen Schatten, der am anderen Ende des schmalen Saals erkennbar war, und richtete augenblicklich wieder die Augen auf das dunkle Meer.
Diese dunkle, feierliche, stille Brücke faszinierte Prince, sie benahm ihm den Atem. Es war das Geheimnisvollste, was er je in seinem Leben gesehen hatte.
Henricki interessierte sich für die Wettermeldungen. Der Ton seiner Stimme schien mehr Interesse zu verraten, als diese an Bord alltägliche Frage zuließ. Warren spitzte die Ohren.
„Ausgezeichnet! Wir werden voraussichtlich herrliches Wetter haben, die Nacht wird sternenklar sein“, sagte Terhusen mit seiner ruhigen, etwas heiseren Stimme aus dem Dunkel.
„Herrlich, wunderbar!“
„Die Prognose ist günstig. Wir waren soeben in Verbindung mit der „Labrador“, die vierundzwanzig Stunden vor uns liegt. Wir fahren in ein Hoch hinein!“
Der Kommandant schien äußerst zufrieden zu sein, ebenfalls Direktor Henricki. Warren sah seine Augen aufglänzen. „Herrlich, wunderbar!“, wiederholte er.
Wann werden wir Bishops Rock passieren?“, wagte Warren bescheiden zu fragen.
Ja, so sind diese Journalisten, sie haben sich da etwas in den Kopf gesetzt und lassen ganz einfach nicht locker. Es ist wie eine Krankheit bei ihnen. Es ließen sich die unglaublichsten Beispiele erzählen.
„Gegen neun Uhr“, erwiderte Terhusen höflich.
Gegen neun Uhr! Um neun Uhr hieß es also aufpassen. Von Bishops Rock an wurde die eigentliche Atlantikfahrt gerechnet, die beim Ambrose-Feuerschiff am Eingang des New Yorker Hafens endete.
Noch etwas benommen, stieg Warren wieder zu den Decks hinunter. Es war ein Ernst da oben wie in einer Festung, die auf den Feind lauert.
Der Mensch von heute! Wie, Warren, der Mensch von heute? Er, Warren Prince, bewunderte ihn.
Hunderte von Dampfern pflügten in diesem Augenblick, ganz wie die „Cosmos“, die Meere, Tausende von Expresszügen rasten in diesem Augenblick dahin, in Europa, Amerika, Australien, durch Nacht und Nebel und Schnee, die Flugzeuge schnarchten hoch oben in der Luft – und überall war der Mensch von heute, der seinen Dienst versah und nicht viel redete. Er ging auch unter, wenn es sein musste, ohne ein großes Geschrei zu machen. Nie war der Mensch kühner gewesen als heute!
Warren liebte seine Zeit! Er war glücklich, gerade in dieser Zeit geboren zu sein. Die Menschen sprachen mit geheimnisvollen Wellen über die Kontinente, sie flogen wie die Adler, sie hatten Instrumente ersonnen, die ihnen das unergründliche Wunder der Welt in einem Wassertropfen offenbarten. War das nichts?
Und wenn nun jemand Warren Prince, von der Universe-Press, New York, gefragt hätte: Warren, was schätzt du mehr, die funkelnden Turmhäuser New Yorks, einen Dampfer wie die „Cosmos“ oder die Pyramiden? Wie? Nun er, Warren, hätte es überhaupt nicht nötig gehabt, sich zu besinnen. Er hätte sofort erklärt, dass die ägyptischen Pyramiden ein elender Plunder waren im Vergleich zu den Turmhäusern New Yorks und dieser „Cosmos“. Ein elender Plunder, und sie konnten ihm gestohlen werden, ganz offen gesagt.
Das war seine Meinung, Warren Princes, von der Universe-Press, New York. Aber niemand war da, ihn zu fragen.
Und da gab es Leute – Warren saß schon im Speisesaal –, die diese Kultur anzweifelten? Zum Beispiel – wie hieß er doch? – Kinsky, Kinsky … jener merkwürdige Herr, der die Kabine mit ihm teilte. Wie ein Gespenst würde sich dieser österreichische Aristokrat im Mahlstrom des Broadway ausnehmen. Und niemand wird dieses Gespenst beachten! Ja, niemand! Nicht einmal lachen würde man über das Gespenst.
Auch hier im Speisesaal stand Warren noch ganz unter dem Bann dieser gespenstisch dunklen und stillen Kommandobrücke da oben. Der Speisesaal mit seinen blitzenden Lichtern und seinem funkelnden Kristall blendete ihn unerträglich. Hier speisten einige hundert Menschen, aber er hörte ihren fröhlichen Lärm nur ganz fern und wie im Halbschlaf, so benommen war er noch.
„Wünschen der Herr Wein?“, fragte der Steward und reichte ihm die Weinkarte.
Warren sandte einen mitleidigen und spöttischen Blick nach oben. Wein? Warren Prince und Wein? Er bestellte eine Flasche Sodawasser.
„Auch ich! Wartet nur!“, sagte Warren leise vor sich hin. „Auch ich!“ Und er träumt den Traum aller ehrgeizigen jungen Männer. Ja, sie mochten träumen, so ausschweifend träumen, wie sie wollten, kaum der hundertste Teil ihres Traums würde sich erfüllen.