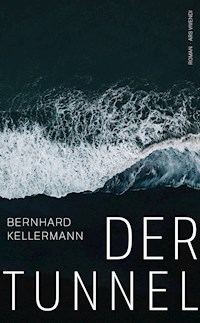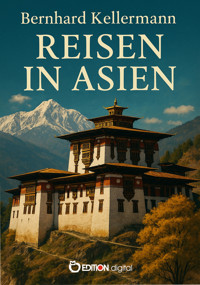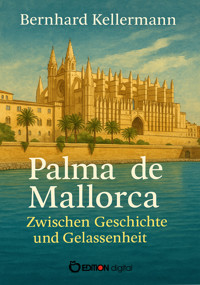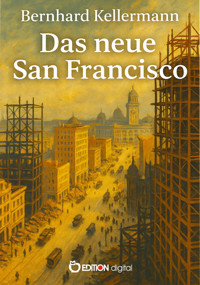Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hirnkost
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Wiederentdeckte Schätze der deutschsprachigen Science Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein Atlantik-Tunnel soll zur neuen Verbindung zwischen Europa und Amerika werden, doch nach sieben Jahren Bauzeit macht eine Explosion dem Vorhaben ein jähes Ende: Millionen von Menschen sind auf der Flucht, werden arbeitslos und Machtverhältnisse geraten mit verheerenden Folgen ins Wanken. Bernhard Kellermanns 1913 erschienener Roman »Der Tunnel« war ein großer Erfolg, wurde in 25 Sprachen übertragen, viermal verfilmt und konnte bereits 1939 mehr als eine Million verkaufte Exemplare verzeichnen. Dieser Meilenstein der Science Fiction bildet den Auftakt zur auf 40 Bände angelegten Edition »Wiederentdeckte Schätze der deutschsprachigen Science Fiction«, herausgegeben von Hans Frey.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BERNHARD KELLERMANN
Der Tunnel
Originalausgabe
© 2022 Hirnkost KG, Lahnstraße 25, 12055 Berlin;
[email protected]; http://www.hirnkost.de/
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage Juni 2022
Die Erstauflage erschien 1913 im S. Fischer Verlag, Berlin.
Vertrieb für den Buchhandel:
Runge Verlagsauslieferung; [email protected]
Privatkunden und Mailorder:
https://shop.hirnkost.de/
Herausgeber: Hans Frey
Lektorat: Klaus Farin
Korrektorat: Christian Winkelmann-Maggio
Layout:benSwerk
ISBN:
PRINT: 978-3-949452-28-4
PDF: 978-3-949452-30-7
EPUB: 978-3-949452-29-1
Hirnkost versteht sich als engagierter Verlag für engagierte Literatur.
Mehr Infos: https://www.hirnkost.de/der-engagierte-verlag/
Dieses Buch erschien als Band I der Reihe »Wiederentdeckte Schätze der deutschsprachigen Science Fiction«. Alle Titel und weitere Informationen finden Sie hier: https://shop.hirnkost.de/produkt/schaetze/
Bernhard Kellermann • 1879–1951
Bernhard Kellermann, geboren in Fürth, studierte ab 1899 in München zunächst an der Technischen Hochschule, später Germanistik und Malerei. Ab 1904 machte er sich einen Namen als Romanautor, als sein Debütroman Yester und Li außerordentlichen Erfolg erreichte und bis 1939 insgesamt 183 (!) Auflagen erlebte. Auch sein zweiter Roman Ingeborg erreichte 131 Auflagen. Bis zum Ersten Weltkrieg verarbeitete er seine Reisen in die USA und Japan in Romanen und Reiseberichten. Sein Roman Das Meer von 1910 wurde 1927 mit Heinrich George und Olga Tschechowa verfilmt. Sein Hauptwerk Der Tunnel von 1913 erreichte schließlich eine Gesamtauflage von über einer Million, wurde in 25 Sprachen übersetzt und viermal verfilmt.
Im Ersten Weltkrieg arbeitete Kellermann als (Kriegs-)Korrespondent des Berliner Tageblatts. 1920 erschien sein Roman Der 9. November, der sich kritisch mit dem Verhalten von Soldaten undOffizieren gegenüber der Bevölkerung auseinandersetzte und 1933 verboten und öffentlich verbrannt wurde. Kellermann wurde aus der Preußischen Akademie der Künste ausgeschlossen, emigrierte aber nicht, sondern zog sich zurück und schrieb nur noch einige wenige unanstößige Trivialromane.
Nach dem Zusammenbruch der NS-Diktatur gründete Kellermann zusammen mit Johannes R. Becher den Kulturbund. Er wurde Abgeordneter der Volkskammer der DDR sowie Vorsitzender der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft. Für seinen Roman Totentanz erhielt er 1949 den Nationalpreis der DDR. Sein politisch-kulturelles Engagement in der DDR führte zu einem Boykott seiner Werke im westdeutschen Buchhandel. Sein Name geriet dadurch in Westdeutschland in Vergessenheit. Im Jahr 1975 produzierte allerdings der Südwestfunk eine 214-minütige Hörspielfassung desTunnelsin 12 Teilen, der Bayerische Rundfunk produzierte 1985 eine 75-minütige Hörspielfassung. Noch kurz vor seinem Tod 1951 rief Kellermann die Schriftsteller beider deutscher Staaten auf, sich für gesamtdeutsche Beratungen einzusetzen.
benSwerk
geboren 1970, lebt in Berlin. Studierte Werbegrafik und freie Kunst. Wenn sie nicht für Hirnkost layoutet, porträtiert sie das kleine Volk und andere Wesenheiten der Anderswelt, ersinnt Orakelkarten oder gestaltet andere Bücher – mit Vorliebe in den Bereichen WeirdFiction oder Phantastik. www.benswerk.com
Andreas Eschbach
geboren 1959, schreibt seit seinem 12. Lebensjahr. Er studierte Luft- und Raumfahrttechnik und arbeitete zunächst als Softwareentwickler. Bis 1996 Geschäftsführer einer IT-Beratungsfirma, lebt er seit 2003 als freier Schriftsteller in der Bretagne. Er ist verheiratet und hat einen Sohn. Zu seinen bekanntesten Romanen zählen Das Jesus-Video, Die Haarteppichknüpfer, Eine Billion Dollar, Ausgebrannt, Herr aller Dinge und NSA.
Hans Frey
geboren 1949, Germanist, Lehrer und Ex-NRW-Landtagsabgeordneter, ist in seinem »dritten Leben« Autor und Publizist. Seine Spezialität ist die Aufarbeitung der Science Fiction. Bisher veröffentlichte er ein umfangreiches Werk über Isaac Asimov, das Sachbuch Philosophie und Science Fiction und Monographien über Alfred Bester, J. G. Ballard und James Tiptree Jr. Seit 2016 arbeitet er an einer Literaturgeschichte der deutschsprachigen SF. Drei Bände sind bislang bei Memoranda erschienen (Fortschritt und Fiasko, Aufbruch in den Abgrund und Optimismus und Overkill). Für die ersten beiden Bände erhielt er den Kurd Laßwitz Preis 2021.
Zum Geleit
Vorwort von Andreas Eschbach
Erster Teil
Zweiter Teil
Dritter Teil
Vierter Teil
Fünfter Teil
Sechster Teil
Schluss
Nachwort von Hans Frey
Zum Geleit
Wir leben in einer Gegenwart des radikalen Umbruchs, der alle Bereiche der menschlichen Zivilisation durchdringt. Die Probleme scheinen uns über den Kopf zu wachsen. Wir brauchen kluge Ideen, tragfähige Lösungen, vielleicht sogar Utopien, die neue Perspektiven aufzeigen.
Vielleicht ist es gerade in dieser aufwühlenden Situation auch hilfreich, einmal innezuhalten und zurückzublicken. Denn vieles, was uns heute beschäftigt, ist nicht wirklich neu. Schon vor über einhundert Jahren machten sich Autoren und Autorinnen Gedanken über das Klima, über Armut, Wohnen, Ernährung und das Bildungssystem, ob und wie weit Technik ein Motor für den Fortschritt oder eine existenzielle Gefahr darstellen kann (beispielsweise Atomkraft, Geo-Engineering, Gentechnik). Vor allem die Autoren und Autorinnen der einst „Zukunftsliteratur“ genannten Science Fiction entwarfen wie in keinem anderen Genre sonst gesellschaftliche Utopien und Dystopien, die noch heute so gegenwärtig wirken, als wären sie gerade erst entstanden. Sie sind trotz oder vielleicht gerade wegen ihres oberflächlich antiquiert wirkenden Charmes heute noch mit Gewinn und Genuss zu lesen sind. Vierzig Perlen aus der deutschsprachigen Science Fiction möchte Ihnen diese Edition im Laufe der nächsten Jahre präsentieren.
Jedes Buch der Edition enthält den Roman selbst sowie in einigen Fällen ergänzende Texte der jeweiligen Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Umrahmt werden die Originaltexte von einem Vorwort namhafter Autoren und Autorinnen der Gegenwart und einem historisch-analytischen Nachwort von anerkannten Expertinnen und Experten, das vornehmlich die literaturhistorischen und zeitgeschichtlichen Hintergründe des Textes beleuchtet.
Parallel zur gedruckten Version erscheinen EPubs in allen Formaten und Vertriebsoptionen, die in der Regel zusätzliche ergänzende Materialien (etwa dazugehörige weitere Romane, Sachbücher und Essays der Autoren und Autorinnen, zeitgenössische Rezensionen und andere Leserstimmen sowie weitere Analysen) enthalten und so vor allem für die wissenschaftliche Beschäftigung eine wertvolle Bereicherung darstellen. Damit werden nicht nur die Originaltitel wieder für ein größeres Lesepublikum zugänglich gemacht, sondern auch der Forschung in bislang einzigartiger Weise sowohl historisches Quellenmaterial als auch aktuelle Analysen aufbereitet zur Verfügung gestellt.
Besonderen Wert legen wir auf die Gestaltung. Auch sie soll zum Lesen einladen, denn die von uns herausgegebenen Werke haben es allemal verdient, neue Leser und Leserinnen zu finden. So werden die Werke nicht einfach als Faksimile reproduziert, sondern komplett neu Korrektur gelesen und gesetzt.
Wir, der Verleger Klaus Farin (*1958) und der Herausgeber Hans Frey (*1949), beide Sachbuchautoren, kennen uns schon seit Jugendjahren. Wir stammen beide aus dem Herzen des Ruhrgebiets, aus Gelsenkirchen, engagier(t)en uns für eine bessere, gerechtere Gesellschaft und sind seit unserer Jugend leidenschaftliche Science-Fiction-Leser. Als wir uns nach Jahren zufällig in Berlin wiedertrafen, wurden sofort Pläne geschmiedet. Angeregt durch die deutschsprachige SF-Literaturgeschichte von Hans Frey im Memoranda Verlag wurde die Idee geboren, eine langfristig angelegte Reihe mit wichtigen, aber fast vergessenen Originaltexten der deutschsprachigen Science Fiction zu veröffentlichen.
Aus dieser Idee ist Realität geworden. Die Reihe leistet einen wesentlichen Beitrag zur lebendigen Aufarbeitung und Bewahrung bedeutender Werke der deutschsprachigen SF. Zudem ist sie ein einzigartiges Dokument für die Vielfalt und Vielschichtigkeit des über die Jahre gewachsenen Genres.
Wahr bleibt indes auch: Ohne engagierte Leser und Leserinnen, die die Bücher kaufen und sich an ihnen erfreuen, kann das Projekt nicht gelingen. Empfehlen Sie es bitte weiter. Abonnieren Sie die Reihe. Wir unterbreiten Ihnen ein verlockendes Angebot. Greifen Sie zu!
Hans Frey, Klaus Farin
Vorwort
von Andreas Eschbach
Sucht man sich seine Lektüre wirklich selber aus? Manchmal ist mir, als sei es gerade umgekehrt – und am stärksten hatte ich dieses Gefühl bei dem Buch, das Sie gerade in Händen halten. Es hat mich geradezu verfolgt.
Davon gehört hatte ich das erste Mal … oh, das muss noch im vorigen Jahrtausend gewesen sein. Da gebe es einen Roman, in dem jemand einen Tunnel zwischen Amerika und Europa bauen will, hörte ich irgendwann, irgendwo jemanden erzählen, und ich weiß noch, wie ich damals dachte: Na, das ist doch mal eine abgefahrene Idee!
Wir denken gerne, das Zeitalter der kühnen Ideen sei heute, aber weit gefehlt: Verglichen mit der Zeit, in der dieser Roman geschrieben wurde, backen wir heute ziemlich kleine Brötchen. Es sind vielleicht vernünftigere Brötchen, mit Ballaststoffen, Vollkorn aus ökologischem Anbau und energiesparend gebacken, aber eben – klein.
Vor über hundert Jahren dagegen, als Bernhard Kellermann über seinen »Tunnel« schrieb, tat er dies in einer Zeit hemmungslosen technologischen Größenwahns. Damals gab es Leute, die allen Ernstes die Meerenge von Gibraltar verschließen und das Mittelmeer leerpumpen wollten, um neues nutzbares Land und Energie aus Wasserkraft zu gewinnen: Atlantropa hieß dieses Projekt, das noch bis in die 1950er-Jahre diskutiert wurde. Andere wollten die Qattara-Senke in Ägypten über einen fünfzig Kilometer langen Kanal mit dem Mittelmeer verbinden, ebenfalls, um ein Wasserkraftwerk zu betreiben, und nebenher aber das Klima in der gesamten Gegend zu verändern. Schon Ende des 19. Jahrhunderts hatte der russische Erfinder Konstantin Ziolkowski nicht nur die theoretischen Grundlagen der Raumfahrt geschaffen (die bis heute gültig sind), sondern auch darüber nachgedacht, ob man nicht einen 36.000 Kilometer hohen Turm in der Art des Eiffelturms bauen könne, um Raumfahrzeuge ins All zu befördern, und davon ausgehend die Idee eines Weltraumlifts entwickelt. In Deutschland wollte der Ingenieur Hermann Honnef Höhenwindkraftwerke bauen, die einen halben Kilometer hoch sein sollten, und ab 1948 verfolgte man in der Sowjetunion den Plan, die sibirischen Flüsse Ob und Jenissei über einen zweieinhalbtausend Kilometer langen Kanal umzuleiten – der sogenannte Dawydow-Plan –, um die Gebiete um den Aralsee und das Kaspische Meer fruchtbar zu machen – ein Vorhaben, das das gesamte Klimasystem dramatisch beeinflusst hätte und erst unter Michail Gorbatschow endgültig aufgegeben wurde.
Verglichen damit klingt die Idee eines transatlantischen Tunnels schon fast wieder machbar.
Wie gesagt, ich hörte irgendwann vor langer Zeit das erste Mal von diesem Roman, staunte einen Moment – und vergaß die Sache wieder.
Doch es blieb nicht bei dem einen Mal. Immer wieder erwähnte jemand den »Tunnel« von Bernhard Kellermann, oder ich las einen Text, in dem jemand auf dieses Buch Bezug nahm, und irgendwann fiel mir auf, dass mir dieser Titel immer wieder auffiel, und ich dachte: »Hmm – vielleicht sollte ich das doch irgendwann mal lesen.«
Und schließlich – neulich! –, im Sommer 2021 nämlich, stieß ich »zufällig« auf eine preiswerte E-Book-Ausgabe des Romans Der Tunnel von Bernhard Kellermann, und da sagte ich mir: »Also gut, ich ergebe mich!« und drückte den »Kaufen«-Button.
Aber womöglich – ich weiß es nicht – war es genau umgekehrt und der Roman war es, der von mir gelesen werden wollte? Denn kaum hatte ich die Datei auf meinem Lesegerät, meldete sich der Hirnkost-Verlag und fragte an, ob ich mir vorstellen könne, ein Vorwort für einen alten, klassischen SF-Roman zu schreiben. Sie hätten vor, eine ganze Reihe davon neu aufzulegen, 40 verschiedene Titel, um genau zu sein, und der Roman, für den sie gern ein Vorwort von mir hätten, sei Der Tunnel von Bernhard Kellermann.
In solchen Momenten zweifelt man schon, ob es so etwas wie Zufall wirklich gibt.
Ich ergab mich also in mein Schicksal, sagte zu – und las den Roman endlich.
Und wurde aufs Angenehmste überrascht. Dafür, dass der Roman so alt ist, ist er nämlich noch erstaunlich lesbar, mindestens auf dem Niveau von Jules Verne, aber wesentlich kraftvoller. Nicht nur geht der Autor erzählerisch gleich in die Vollen, man merkt auch, dass er eben gerade nicht der Hybris seiner Zeit verfallen ist, ganz im Gegenteil: Der technologische und wirtschaftliche Wahnsinn eines Unterfangens von solchen Dimensionen wird eindrucksvoll geschildert, in dramatischen, manchmal geradezu ekstatischen Passagen; und wir sehen auch den menschlichen Preis, den einem ein solches Vorhaben abverlangt: Wie eine Droge nimmt es den Protagonisten ganz und gar in Beschlag, und alles andere, was im Leben noch wertvoll sein könnte, verliert dagegen. Immer wieder geraten die Schilderungen zu Bildern, wie Menschen und Technik miteinander verschmelzen – in einer Szene etwa, in der einer gewaltigen Masse von Kleinanlegern ihre Dividenden ausgezahlt werden sollen, werden die Menschen »wie eine körnige Masse« durch den Kassenraum »gepumpt«. Man erlebt mit, wie der technische Prozess Menschen verschlingt, und auch die finanziellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Dimensionen werden nicht vergessen. Zwar mutet das gesellschaftliche Bild heute überholt an und fremd, vor allem, was das Verhältnis zwischen den Geschlechtern anbelangt, aber dennoch ist es eine Geschichte, die einem im Gedächtnis bleiben wird.
Und man stelle sich meine Verblüffung vor, als ich an die Stelle kam, an der der Autor schildert, wo das europäische Ende des transatlantischen Tunnels sein solle: in Frankreich nämlich, genauer gesagt in Finistère, und dort praktisch in Sichtweite des Hauses, in dem ich wohne …
Zufälle? Ha!
Wie auch immer, nun halten Sie dieses Buch in Händen. Mein Rat: Blättern Sie um. Es will offensichtlich auch von Ihnen gelesen werden.
Erster Teil
1.
Das Einweihungskonzert des neu erbauten Madison-Square-Palastes bildete den Höhepunkt der Saison, war eines der außerordentlichsten Konzerte aller Zeiten. Das Orchester umfasste zweihundertundzwanzig Musiker, und jedes einzelne Instrument war mit einem Künstler von Weltruf besetzt. Als Dirigent war der gefeiertste lebende Komponist, ein Deutscher, gewonnen worden, der für den einen Abend das unerhörte Honorar von sechstausend Dollar erhielt.
Die Eintrittspreise verblüfften selbst New York. Unter dreißig Dollar war kein Platz zu haben, und die Billettspekulanten hatten die Preise für eine Loge bis auf zweihundert Dollar und höher getrieben. Wer irgendwie etwas sein wollte, durfte nicht fehlen.
Um acht Uhr abends waren 26., 27. und 28. Straße und Madison Avenue von knatternden, ungeduldig bebenden Automobilen blockiert. Die Billetthändler, die ihr Leben zwischen den Pneumatiken von sausenden Automobilen verbringen, stürzten sich, schweißtriefend trotz einer Temperatur von zwölf Grad Kälte, Bündel von Dollarscheinen in den Händen, tollkühn mitten in den endlos heranrollenden Strom wütend donnernder Wagen. Sie schwangen sich auf die Trittbretter, Führersitze und selbst Dächer der Cars und versuchten das Schnellfeuer der Motoren mit ihren heiser heulenden Stimmen zu überbrüllen.
»Here you are! Here you are! Zwei Parkettsitze, zehnte Reihe! Ein Logenplatz! Zwei Parkettsitze …!«
Ein schräger Hagel von Eiskörnern fegte wie Maschinengewehrfeuer auf die Straße nieder. Sobald ein Wagenfenster klappte – »Hierher!« –, warfen sie sich blitzschnell wie Taucher wieder zwischen die Wagen. Während sie aber ihr Geschäft abschlossen, Geld in die Taschen stopften, gefroren ihnen die Schweißtropfen auf der Stirn.
Das Konzert sollte um acht Uhr beginnen, aber noch ein Viertel nach acht warteten unabsehbare Reihen von Wagen darauf, bei dem in Nässe und Licht schreiend rot leuchtenden Baldachin vorzufahren, der in das blitzende Foyer des Konzertpalastes hineinführte. Unter dem Lärm der Billetthändler, dem Knattern der Motoren und Trommeln der Eiskörner auf dem Baldachin quollen aus den einander blitzschnell ablösenden Cars immer neue Menschenbündel hervor, von den dunklen Mauern der Neugierigen mit stets neuer Spannung erwartet: kostbare Pelze, ein funkelndes Haargebäude, aufsprühende Steine, ein seideglänzender Schenkel, ein entzückender weiß beschuhter Fuß, Lachen, kleine Schreie …
Der Reichtum der fünften Avenue, Bostons, Philadelphias, Buffalos, Chicagos füllte den pompösen, in Lachsrot und Gold gehaltenen überhitzten Riesensaal, der während des gesamten Konzerts von Tausenden von hastig bewegten Fächern vibrierte. Aus all den weißen Schultern und Büsten der Frauen stieg eine Wolke betäubender Parfüme empor, zuweilen ganz unvermittelt von dem nüchternen und trivialen Geruch von Lack, Gips und Ölfarbe durchsetzt, der dem neuen Raum anhaftete. Scharen und Aberscharen von Glühlampen blendeten aus den Kassetten der Decke und Emporen über den Raum, so gleißend und grell, dass nur starke und gesunde Menschen die Lichtflut ertragen konnten. Die Pariser Modekünstler hatten für diesen Winter kleine venezianische Häubchen lanciert, die die Damen auf den Frisuren, etwas nach hinten gerückt, trugen. Gespinste, Spinngewebe aus Spitzen, Silber, Gold, mit Borden, Quasten, Gehängsel aus den kostbarsten Materialien, Perlen und Diamanten. Da aber die Fächer unausgesetzt vibrierten und die Köpfe stets in leichter Bewegung waren, so glitt fortwährend ein Glitzern und Flimmern über das dicht gedrängte Parkett, und hundertfach sprühten gleichzeitig an verschiedenen Stellen die Feuer der Brillanten auf.
Über diese Gesellschaft, ebenso neu und prunkvoll wie der Konzertsaal, fegte die Musik der alten, längst vermoderten Meister dahin …
Der Ingenieur Mac Allan hatte mit seiner jungen Frau Maud eine kleine Loge dicht über dem Orchester inne. Hobby, sein Freund, der Erbauer des neuen Madison-Square-Palastes, hatte sie ihm zur Verfügung gestellt und Allan kostete diese Loge keinen Cent. Er war zudem nicht aus Buffalo, wo er eine Fabrik für Werkzeugstahl besaß, hierhergekommen, um Musik zu hören, für die er gar kein Verständnis hatte, sondern um eine zehn Minuten lange Unterredung mit dem Eisenbahnmagnaten und Bankier Lloyd, dem mächtigsten Mann der Vereinigten Staaten und einem der reichsten Männer der Welt, zu führen. Eine Unterredung, die für ihn von der allergrößten Bedeutung war.
Am Nachmittag, im Zuge, hatte Allan vergebens gegen eine leichte Erregung gekämpft, und noch vor wenigen Minuten, als er sich durch einen Blick überzeugte, dass die Loge gegenüber, Lloyds Loge, noch leer war, hatte ihn die gleiche sonderbare Unruhe angefallen. Nun aber sah er den Dingen wieder mit vollkommener Ruhe entgegen.
Lloyd war nicht da. Lloyd kam vielleicht überhaupt nicht. Und selbst wenn er kam, so war damit noch nichts entschieden – trotz Hobbys triumphierender Depesche.
Allan saß da wie ein Mann, der wartet und die nötige Geduld dazu hat. Er lag in seinem Sessel, die breiten Schultern gegen die Lehne gedrückt, die Füße ausgestreckt, so gut es in der Loge ging, und sah mit ruhigen Augen umher. Allan war nicht gerade groß, aber breit und stark gebaut wie ein Boxer. Sein Schädel war mächtig, mehr viereckig als lang, und die Farbe seines etwas derben bartlosen Gesichts ungewöhnlich dunkel. Selbst jetzt im Winter zeigten seine Wangen Spuren von Sommersprossen. Wie alle Welt trug er das Haar sorgfältig gescheitelt; es war braun, weich und schimmerte an den Reflexen kupferfarben. Allans Augen lagen verschanzt hinter starken Stirnknochen; sie waren licht, blaugrau und von gutmütig kindlichem Ausdruck. Im Ganzen sah Allan aus wie ein Schiffsoffizier, der gerade von der Fahrt kam, vollgepumpt mit frischer Luft, und heute zufällig einen Frack trug, der nicht recht zu ihm passte. Wie ein gesunder, etwas brutaler und doch gutmütiger Mensch, nicht unintelligent, aber keineswegs bedeutend.
Allan vertrieb sich die Zeit, so gut er konnte. Die Musik hatte keine Macht über ihn, und anstatt seine Gedanken zu konzentrieren und zu vertiefen, zerstreute und verflüchtigte sie sie. Er maß mit den Blicken die Dimensionen des ungeheuren Saales aus, dessen Decken- und Logenringkonstruktion er bewunderte. Er überflog das flimmernde, vibrierende Fächermeer im Parkett und dachte, dass viel Geld in den Staaten sei und man hier so etwas unternehmen könne, wie er es im Kopf hatte.
Als praktisch veranlagter Mensch unternahm er es, die stündlichen Beleuchtungskosten des Konzertpalastes abzuschätzen. Er einigte sich auf rund tausend Dollar und verlegte sich hierauf auf das Studium einzelner Männerköpfe. Frauen interessierten ihn gar nicht. Dann streifte sein Blick wiederum die leere Loge Lloyds und tauchte in das Orchester hinab, dessen rechten Flügel er übersehen konnte. Wie alle Menschen, die nichts von Musik verstehen, verblüffte ihn die maschinelle Exaktheit, mit der das Orchester arbeitete. Er rückte ein wenig vor, um den Dirigenten zu sehen, dessen stabführende Hand und dessen Arm nur zuweilen über der Brüstung erschienen. Dieser hagere, schmalschulterige, distinguierte Gentleman, dem sie für diesen Abend sechstausend Dollar bezahlten, war Allan vollends ein Rätsel. Er beobachtete ihn lange und aufmerksam. Schon das Äußere dieses Mannes war ungewöhnlich. Sein Kopf mit der Hakennase, den kleinen lebendigen Augen, dem zusammengekniffenen Mund und den dünnen, nach rückwärts stehenden Haaren erinnerte an den eines Geiers. Er schien nur Haut und Knochen zu sein und nichts als Nerven. Aber er stand ruhig inmitten des Chaos von Stimmen und Lärm und ordnete es nach Belieben mit einem Wink seiner weißen, anscheinend kraftlosen Hände. Allan bewunderte ihn, etwa wie einen Zauberer, in dessen Macht und Geheimnisse einzudringen er nicht einmal den Versuch machte. Dieser Mann schien ihm einer fernen Zeit und einer sonderbaren, unverständlichen, fremden Rasse anzugehören, die dem Aussterben nahe war.
Gerade in diesem Augenblick aber streckte der hagere Dirigent die Hände in die Höhe, schüttelte sie wie in Raserei, und in den Händen schien plötzlich eine übermenschliche Kraft zu wohnen: Das Orchester brandete auf und verstummte mit einem Schlag.
Eine Lawine von Beifall rollte durch den Saal, hohl tobend in der ungeheuren Ausdehnung des Raumes. Allan rückte aufatmend zurecht, um aufzustehen. Aber er hatte sich getäuscht, denn drunten leiteten die Holzbläser schon das Adagio ein. Aus der Nebenloge drang noch das Ende eines Gesprächs herüber:
»… zwanzig Prozent Dividende, Mann! Es ist ein Geschäft, wie es glänzender …«
Und Allan war gezwungen, wieder ruhig zu sitzen. Er begann abermals, die Konstruktion der Logenringe zu studieren, die ihm nicht ganz verständlich war. Allans Frau dagegen, selbst angehende Pianistin, ergab sich mit ihrem ganzen Wesen der Musik. An der Seite ihres Gatten erschien Maud zart und klein. Sie hatte den feinen braunen Madonnenkopf in den weißen Handschuh gestützt, und ihr transparent leuchtendes Ohr trank die Tonwellen, die von unten herauf, von oben herab, von irgendwoher kamen. Die ungeheure Vibration, mit der die zweihundert Instrumente die Luft erfüllten, erschütterte jeden Nerv an ihrem Körper. Ihre Augen waren geweitet und ohne Blick in die Ferne gerichtet. So stark war ihre Erregung, dass auf ihren zarten, glatten Wangen kreisrunde rote Flecke erschienen.
Nie, so schien es ihr, hatte sie Musik tiefer empfunden, nie hatte sie überhaupt je solche Musik gehört. Eine kleine Melodie, ein unscheinbares Nebenmotiv konnte eine nie gekannte Helligkeit in ihrer Seele wecken. Ein einzelner Klang konnte eine unbekannte, verborgene Ader von Glück in ihr anschlagen, dass es hell daraus strömte und sie im Innern blendete. Und alles Gefühl, das diese Musik in ihr auslöste, war reinste Freude und Schönheit! All die Gesichte, die ihr die Musik entgegentrug, waren in Helligkeit und Verklärung getaucht und schöner als jede Wirklichkeit.
Mauds Leben war ebenso schlicht und einfach wie ihre Erscheinung. Es gab weder große Ereignisse noch besondere Merkwürdigkeiten darin und glich dem von Tausenden von jungen Mädchen und Frauen. Sie war in Brooklyn, wo ihr Vater eine Druckerei besaß, geboren und auf einem Landgut in den Berkshire Hills von ihrer sie verzärtelnden Mutter, einer geborenen Deutschen, erzogen worden. Sie hatte eine gute Schulbildung genossen, zwei Sommer lang Vorlesungen an der Summerschool von Chautauqua gehört; sie hatte eine Menge von Weisheit und Wissen in ihren kleinen Kopf hineingestopft, um es wieder zu vergessen. Obwohl nicht übermäßig musikalisch begabt, hatte sie sich auf dem Klavier ausgebildet und ihr Studium in München und Paris bei ersten Lehrern abgeschlossen. Sie war mit ihrer Mutter auf Reisen gewesen (der Vater war lange tot), sie hatte Sport getrieben und mit jungen Männern geflirtet wie alle jungen Mädchen. Sie hatte eine Jugendschwärmerei gehabt, an die sie heute nicht mehr dachte; sie hatte Hobby, dem Architekten, der sich um sie bewarb, einen Korb gegeben, weil sie ihn nur wie einen Kameraden lieben konnte, und sie hatte den Ingenieur Mac Allan geheiratet, weil er ihr gefiel. Noch vor ihrer Verheiratung war ihre kleine, angebetete Mutter gestorben, und Maud hatte bittere Tränen vergossen. Im zweiten Jahr ihrer Ehe hatte sie ein Kind geboren, ein Mädchen, das sie abgöttisch liebte. Das war alles. Sie war dreiundzwanzig Jahre alt und glücklich.
Während sie in einer Art von herrlicher Betäubung die Musik genoss, erblühte wie durch einen Zauber ein Reichtum von Erinnerungen in ihr, einander scheinbar willkürlich ablösend, alle sonderbar klar, alle merkwürdig bedeutungsvoll. Und ihr Leben erschien ihr plötzlich geheimnisvoll, tief und reich. Sie sah die Züge ihrer kleinen Mutter in unendlicher Vergeistigung und Güte vor sich, aber sie empfand keine Trauer dabei, nur Freude und unaussprechliche Liebe. Als weilte die Mutter noch unter den Lebenden. Gleichzeitig erschien ihr eine Landschaft in den Berkshire Hills, die sie als Mädchen häufig auf dem Rade durchquert hatte. Aber die Landschaft war voll geheimnisvoller Schönheit und von einem merkwürdigen Glänzen erfüllt. Sie dachte an Hobby, und im gleichen Augenblick sah sie ihr Mädchenzimmer, das vollgestopft mit Büchern war, vor sich. Sie sah sich selbst, wie sie am Klavier saß und übte. Aber unmittelbar darauf tauchte Hobby wieder auf. Er saß neben ihr auf einer Bank am Rande eines Tennisplatzes, der schon so dämmerig war, dass man nur die weißen Streifen der Courts noch unterscheiden konnte. Hobby hatte ein Bein übergeschlagen und klopfte mit dem Rakett auf die Spitze seines weißen Schuhs und plauderte. Sie sah sich selbst, und sie sah, dass sie lächelte, denn Hobby sprach nichts als verliebten Unsinn. Aber eine heitere, übermütige, ein wenig spöttische Passage wehte Hobby hinweg und rief ihr jenes fröhliche Picknick ins Gedächtnis zurück, bei dem sie Mac zum ersten Mal gesehen hatte. Sie war zu Besuch bei Lindleys in Buffalo, und es war im Sommer. Im Wald standen zwei Autos, und sie waren im Ganzen wohl ein Dutzend Damen und Herren. Jedes einzelne Gesicht erkannte sie deutlich wieder. Es war heiß, die Herren waren in Hemdsärmeln, und der Boden brannte. Nun aber sollte Tee gekocht werden und Lindley rief:
»Allan, wollen Sie das Feuer anmachen?«
Und Allan antwortete:
»All right!«
Und Maud schien es jetzt, als hätte sie schon damals seine Stimme geliebt, seine tiefe, warme Stimme, die im Brustkorb resonierte. Da sah sie nun, wie Allan das Feuer zurechtmachte. Wie er still, unbeachtet von allen, Äste zerbrach, zerknackte, wie er arbeitete! Sie sah, wie er mit aufgestülpten Hemdsärmeln vor dem Feuer kauerte und es behutsam anblies; und plötzlich entdeckte sie, dass er auf dem rechten Unterarm eine blassblaue Tätowierung trug: gekreuzte Hämmer. Sie machte Grace Gordon darauf aufmerksam. Und Grace Gordon (dieselbe, die neulich den Eheskandal gehabt hat) sah sie erstaunt an und sagte:
»Don’t you know, my dear?«
Und sie berichtete ihr, dass dieser Mac Allan der »Pferdejunge von Uncle Tom« war, und erzählte das romantische Jugenderlebnis dieses braunen, sommersprossigen Burschen. Da kauerte er, ohne sich um all die schwätzenden, fröhlichen Menschen zu kümmern, und blies das Feuer an, und sie liebte ihn in diesem Augenblick. Gewiss tat sie es, sie wusste es nur nicht, bis heute. Und Maud überließ sich nun ganz ihrem Gefühl für Mac. Sie erinnerte sich an seine merkwürdige Werbung, an ihre Trauung, die ersten Monate ihrer Ehe. Dann aber kam die Zeit, da ihr Mädchen, die kleine Edith, zur Welt kam. Nie würde sie Macs Fürsorge vergessen, jene Zärtlichkeit und Ergebenheit in dieser Zeit, die für jede Frau ein Maßstab der Liebe des Mannes ist. Es zeigte sich plötzlich, dass Mac ein fürsorgliches, ängstliches Kind war. Nie würde sie diese Zeit vergessen, in der sie sah, wie wahrhaft gut Mac war! Eine Welle von Liebe strömte durch Mauds Herz und sie schloss die Augen. Die Gesichte, die Erinnerungen versanken und die Musik trug sie fort. Sie dachte nichts mehr, sie war ganz Empfindung …
Ein Getöse, wie von einer einstürzenden Mauer, brach plötzlich an Mauds Ohr, und sie erwachte und holte tief Atem. Die Symphonie war zu Ende. Mac war schon aufgestanden und reckte sich, die Hände auf der Brüstung. Das Parkett brandete und toste. Und Maud stand auf, ein wenig schwindlig und benommen, und begann ganz plötzlich wild zu applaudieren.
»So klatsche doch, Mac!«, jubelte sie außer sich, das Gesicht glühend rot vor Erregung.
Allan lachte über Mauds ungewöhnliche Aufregung und klatschte einige Mal laut in die Hände, um ihr eine Freude zu machen.
»Bravo! Bravo!«, rief Maud mit ihrer hellen, hohen Stimme und beugte sich mit vor Erregung feuchten Augen weit über die Logenbrüstung.
Der Dirigent trocknete sich das magere, vor Erschöpfung bleiche Gesicht ab und verbeugte sich wieder und wieder. Als aber der Beifall nicht enden wollte, deutete er mit ausgebreiteten Händen auf das Orchester. Diese Bescheidenheit war offenbar geheuchelt und erweckte Allans unausrottbaren Argwohn gegen Künstler, die er nie für volle Menschen nehmen konnte und, offen heraus gesagt, für unnötig hielt. Maud aber schloss sich dem neuen Beifallssturm hingerissen an.
»Meine Handschuhe sind geplatzt, sieh, Mac! Was für ein Künstler! War es nicht wunderbar?«
Ihre Lippen waren verzückt, ihre Augen leuchteten hell wie Bernstein, und Mac fand sie ungewöhnlich schön in ihrer Ekstase. Er lächelte und erwiderte, ein wenig gleichgültiger, als er eigentlich wollte:
»Ja, das ist ein großartiger Bursche!«
»Ein Genie ist er!«, rief Maud und klatschte begeistert. »In Paris, Berlin, London habe ich nie so etwas gehört …«
Sie brach ab und wandte das Gesicht der Tür zu, denn Hobby, der Architekt, trat in ihre Loge.
»Hobby!«, schrie Maud, immer noch klatschend, denn sie wollte, wie tausend andere, den Dirigenten nochmals herausrufen. »Klatsche, Hobby, er muss nochmals heraus! Hip! Hip! Bravo!«
Hobby hielt sich die Ohren zu und ließ einen ungezogenen Gassenbubenpfiff hören.
»Hobby!«, schrie Maud. »Wie kannst du dich unterstehen!«
Und sie stampfte empört mit dem Fuß auf.
In diesem Moment ließ sich der Dirigent, schweißtriefend, das Taschentuch im Nacken, nochmals sehen, und sie klatschte von Neuem rasend.
Hobby wartete, bis der Lärm nachließ.
»Die Leute sind vollständig verrückt!«, sagte er dann mit einem hellen Lachen. »So etwas! Ich habe ja nur gepfiffen, um Lärm zu machen, Maud. Wie geht es dir, Girl? And how are you, old Chap?«
Erst jetzt hatten sie Muße, sich richtig zu begrüßen. Die drei verband in der Tat eine aufrichtige und selten innige Freundschaft. Allan kannte recht wohl die früheren Beziehungen Hobbys zu Maud, und obwohl nie ein Wort darüber gesprochen wurde, verlieh dieser Umstand dem Verhältnis zwischen den beiden Männern besondere Wärme und einen eigenen Reiz. Hobby war noch immer ein wenig in Maud verliebt, war aber taktvoll und klug genug, es sich nie anmerken zu lassen. Allein Mauds sicherer weiblicher Instinkt ließ sich nicht täuschen. Sie genoss Hobbys Liebe mit leisem Triumph, der zuweilen in ihren warmen braunen Augen zu lesen war, und entschädigte ihn mit einer aufrichtigen schwesterlichen Zuneigung. Sie hatten sich alle drei in verschiedenen Lebenslagen, voller Freude, sich nützlich sein zu können, Dienste erwiesen, und besonders Allan fühlte sich Hobby gegenüber zu großem Danke verpflichtet: hatte doch Hobby ihm vor Jahren zu technischen Versuchen und zur Errichtung seiner Fabrik fünfzigtausend Dollar verschafft und für diese Summe persönliche Bürgschaft geleistet. Hobby hatte ferner in den letzten Wochen Allans Interessen vor dem Eisenbahnkönig Lloyd vertreten und das bevorstehende Rendezvous vermittelt. Hobby hätte alles für Allan getan, was überhaupt möglich war, denn er bewunderte ihn. Schon in der Zeit, da Allan nichts geschaffen hatte als seinen Diamantstahl Allanit, pflegte Hobby zu all seinen Bekannten zu sagen:
»Kennen Sie übrigens Allan? Der das Allanit erfand? Nun, Sie werden noch hören von ihm!«
Die Freunde sahen einander jährlich einige Mal. Die Allans kamen nach New York oder Hobby besuchte sie in Buffalo. Im Sommer verlebten sie regelmäßig drei Wochen zusammen auf Mauds bescheidenem Landgut Berkshirebrookfarm in den Berkshire Hills. Ein jedes Wiedersehen war für sie ein großes Ereignis. Sie fühlten sich um drei, vier Jahre zurückversetzt, und alle jene fröhlichen und vertrauten Stunden, die sie zusammen verbracht hatten, wurden irgendwie lebendig in ihnen.
Diesen ganzen Winter hindurch hatten sie sich nicht gesehen, und ihre Freude war umso lebhafter. Sie musterten einander von oben bis unten wie große Kinder, und beglückwünschten sich in heiterem Ton zu ihrem Aussehen. Maud lachte über Hobbys dandyhafte Lackschuhe, die auf den Kappen wahre Rhinozeroshörner aus glänzendem Leder trugen, und Hobby begutachtete wie ein Modekünstler Mauds Kostüm und Allans neuen Frack. Wie bei jedem Wiedersehen nach längerer Zeit mischten sie hundert rasche Fragen und rasche Antworten durcheinander, ohne über irgendetwas eingehender zu plaudern. Hobby hatte, wie immer, die sonderbarsten und unglaublichsten Abenteuer erlebt und deutete das eine und das andere an. Dann kamen sie auf das Konzert, Tagesereignisse und Bekannte zu sprechen.
»Wie gefällt euch übrigens der Konzertpalast?«, fragte Hobby mit einem triumphierenden Lächeln, denn er wusste schon, was die Freunde antworten würden.
Allan und Maud hielten mit ihrem Lob nicht zurück. Sie bewunderten alles.
»Und das Foyer?«
»Grand, Hobby!«
»Nur der Saal ist mir ein wenig zu prunkvoll«, warf Maud ein. »Ich hätte ihn gern intimer gehabt.«
Der Architekt lächelte gutmütig.
»Natürlich, Maud! Das wäre richtig, wenn die Leute hierherkämen, um Musik zu hören. Fällt ihnen gar nicht ein. Die Leute kommen hierher, um etwas zu bewundern und sich bewundern zu lassen. ›Schaffen Sie uns eine Feerie, Hobby‹, sagte das Konsortium. ›Der Saal muss alles bisher Dagewesene totschlagen!‹«
Allan stimmte Hobby bei. Was er aber in erster Linie an Hobbys Saal bewunderte, war nicht die dekorative Pracht, sondern die kühne Konstruktion des frei schwebenden Logenringes.
Hobby blinzelte geschmeichelt.
»Das war keineswegs einfach«, sagte er. »Es machte mir viel Kopfzerbrechen. Während der Ring genietet wurde, schwankte die ganze Geschichte bei jedem Schritt. So …«
Hobby wippte sich auf den Fußspitzen.
»Die Arbeiter bekamen es mit der Angst …«
»Hobby!«, rief Maud übertrieben ängstlich aus und trat von der Brüstung zurück. »Du erschreckst mich.«
Hobby berührte lächelnd ihre Hand:
»Keine Angst, Maud. Ich sagte den Burschen: Wartet nur, bis der Ring ganz geschlossen ist – keine Macht der Welt, höchstens Dynamit ist noch imstande … Hallo!«, rief er plötzlich ins Parkett hinab.
Ein Bekannter hatte ihn durch das zusammengerollte Programm wie durch ein Sprachrohr angerufen. Und Hobby führte eine Unterhaltung, die man durch den ganzen Saal hätte verstehen müssen, wenn nicht gleichzeitig überall Gespräche in dem gleichen ungeniert lauten Ton geführt worden wären.
Allenthalben hatte man Hobbys auffallenden Kopf erkannt. Hobby hatte die hellsten Haare im ganzen Saal, silberblonde, glänzende Haare, die peinlich gescheitelt und glatt gestrichen waren, und ein leichtsinniges schmales Spitzbubengesicht von ausgesprochen englischem Typus, mit einer etwas aufwärtsgebogenen Nase und nahezu weißen Wimpern. Im Gegensatz zu Allan war er schmal und zart, mädchenhaft gebaut. Augenblicklich richteten sich von allen Seiten die Gläser auf ihn, und aus allen Richtungen klang sein Name. Hobby gehörte zu den populärsten Erscheinungen New Yorks und zu den beliebtesten Männern der Gesellschaft. Seine Extravaganzen und sein Talent hatten ihn rasch berühmt gemacht. Es verging kaum eine Woche, ohne dass die Zeitungen eine Anekdote über ihn brachten.
Hobby war mit vier Jahren ein Genie in Blumen, mit sechs ein Genie in Pferden (er konnte in fünf Minuten ganze Heere rasender Pferde aufs Papier werfen), und nun war er ein Genie in Eisen und Beton und baute Wolkenkratzer. Hobby hatte seine Affären mit Frauen gehabt und mit zweiundzwanzig Jahren ein Vermögen von hundertundzwanzigtausend Dollar in Monte Carlo verspielt. Jahraus, jahrein stak er bis über seinen weißblonden Scheitel in Schulden – trotz seines enormen Einkommens –, ohne sich eine Sekunde darüber zu bekümmern.
Hobby war am helllichten Tag auf einem Elefanten durch den Broadway geritten. Hobby war jener Mann, der vor einem Jahr »vier Tage Millionär spielte«, in einen Luxuszug nach dem Yellowstone Park fuhr, um als Viehtreiber heimzufahren. Er hielt den Rekord im Dauer-Bridge, achtundvierzig Stunden. Jeder Trambahnführer kannte Hobby und stand mit ihm nahezu auf Du und Du. Unzählige Witze Hobbys wurden kolportiert, denn Hobby war Spaßvogel und Exzentriker von Natur. Ganz Amerika hatte über einen Scherz gelacht, den er anlässlich der Flugkonkurrenz New York – San Francisco in Szene setzte. Hobby hatte den Flug als Passagier des bekannten Millionärs und Sportmanns Vanderstyfft mitgemacht und über alle Menschenansammlungen, die sie in einer Höhe von achthundert oder tausend Meter passierten, Zettel ausgestreut, auf denen stand:
»Komm herauf, wir haben dir was zu sagen!«
Dieser Scherz hatte Hobby selbst derart entzückt, dass er ihn während der ganzen Reise, zwei Tage lang, unermüdlich wiederholte.
Vor wenigen Tagen erst hatte er New York wiederum durch ein ungeheures, ebenso geniales wie naheliegendes Projekt verblüfft: New York – das Venedig Amerikas! Er, Hobby, schlug nämlich vor (da der Boden im Geschäftsviertel einfach nicht mehr zu bezahlen war), in den Hudson, East River und die New York Bai riesige Wolkenkratzer, ganze Straßen auf Betonquader zu stellen, die mit Klappbrücken verbunden waren, sodass die großen Ozeanfahrer bequem passieren konnten. Der Herald hatte Hobbys faszinierende Zeichnungen veröffentlicht und New York war von dem Projekt berauscht.
Hobby ernährte allein ein Schock Journalisten. Er war Tag und Nacht bei der Arbeit, für sich zu »tuten«; er konnte nicht existieren ohne die ununterbrochene Bestätigung seines Daseins in der Öffentlichkeit.
So war Hobby. Und nebenbei war er der begabteste und gesuchteste Architekt New Yorks.
Hobby brach sein Gespräch mit dem Parkett ab und wandte sich wieder den Freunden zu.
»So erzähle doch, was die kleine Edith treibt, Maud?«, fragte er, obschon er sich schon vorher nach dem Kinde, dessen Pate er war, erkundigt hatte.
Mit keiner Frage konnte man Mauds Herz mehr berühren. In diesem Augenblick war sie von Hobby »ganz einfach entzückt«. Sie errötete und sah ihn mit ihren warmen braunen Augen schwärmerisch und dankbar an.
»Ich sagte dir ja schon, dass Edith mit jedem Tage süßer wird, Hobby!«, antwortete sie mit zärtlichem, mütterlichem Ton in der Stimme, und ihre Augen standen voll Freude.
»Das war sie doch immer.«
»Ja! Aber – Hobby, du kannst dir keinen Begriff machen – wie klug sie wird! Sie fängt schon an zu sprechen!«
»Erzähle ihm doch die Geschichte von dem Hahn, Maud«, warf Allan ein.
»Ja!«
Und Maud erzählte strahlend und glücklich eine kleine drollige Geschichte, in der ihr Mädchen und ein Hahn die Hauptrolle spielten. Alle drei lachten wie Kinder.
»Ich muss sie bald wiedersehen!«, sagte Hobby. »In vierzehn Tagen komme ich zu euch. Und sonst war es langweilig in Buffalo, sagst du?«
»Deadly dull!«, versetzte Maud rasch. »Puh, todlangweilig, Hobby, zum Sterben!«
Sie zog die feinen Brauen in die Höhe und sah einen Augenblick aufrichtig unglücklich aus.
»Lindleys sind nach Montreal übergesiedelt, das weißt du ja.«
»Das ist sehr schade.«
»Grace Kossat ist schon seit dem Herbst in Ägypten.«
Und Maud schüttete Hobby ihr Herz aus. Wie langweilig doch so ein Tag sein könne! Und wie langweilig ein Abend! Und in scherzhaft vorwurfsvollem Ton fügte sie hinzu:
»Was für ein Gesellschafter Mac ist, das weißt du ja, Hobby! Er vernachlässigt mich noch mehr als früher. Manchmal kommt er den ganzen Tag nicht aus der Fabrik. Nun hat er sich zu all den hübschen Dingen noch ein Heer von Versuchsbohrern angeschafft, die Tag und Nacht Granit, Stahl und Gott weiß was bohren. Diese Bohrer pflegt er wie Kranke, genau wie Kranke, Hobby! Er träumt nachts von ihnen …«
Allan lachte laut auf.
»Lass ihn nur machen, Maud«, sagte Hobby und blinzelte mit seinen weißen Wimpern. »Er weiß schon, was er will. Du wirst mir doch nicht auf ein paar Bohrer eifersüchtig werden, Girlie?«
»Ich hasse sie ganz einfach!«, antwortete Maud. »Glaube auch nicht«, fuhr sie errötend fort, »dass er mit mir nach New York gefahren wäre, wenn er nicht Geschäfte hier hätte.«
»Aber Maud!«, beschwichtigte Allan.
Hobby dagegen hatte Mauds lächelnd geäußerter Vorwurf an das Wichtigste erinnert, was er Allan hatte sagen wollen. Er sah plötzlich nachdenklich aus und fasste Allans Frack.
»Höre, Mac«, sagte er etwas leiser, »ich befürchte, dass du heute umsonst von Buffalo hierhergekommen bist. Der alte Lloyd ist nicht wohl. Ich habe vor einer Stunde Ethel Lloyd angeklingelt, aber sie wusste noch nicht, ob sie kommen würden. Das wäre in der Tat fatal!«
»Es muss ja nicht gerade heute sein«, entgegnete Allan, ohne seine Enttäuschung zu verraten.
»Auf jeden Fall bin ich wie der Satan hinter ihm her, Mac! Er soll keine ruhige Stunde mehr haben! Und nun adieu einstweilen!«
Im nächsten Augenblick tauchte Hobby schon mit lautem Hallo in einer Nachbarloge auf, in der drei junge rothaarige Damen mit ihrer Mutter saßen.
Der Dirigent mit dem mageren Geierkopf stand plötzlich wieder am Pult, und ein fein anschwellender Donner stieg aus den Kesselpauken empor. Die Fagotte intonierten ein fragendes, süß klagendes Motiv, das sie wiederholten und steigerten, bis die Geigen es ihnen entrissen und in ihre Sprache übertrugen.
Maud überließ sich wieder der Musik.
Allan aber saß mit kühlen Augen in seinem Sessel, die Brust geweitet vor innerer Spannung. Er bereute nun, hierhergekommen zu sein. Lloyds Vorschlag zu einer kurzen Besprechung in der Loge eines Konzertsaales hatte bei der Wunderlichkeit des reichen Mannes, der nur äußerst selten jemand in seinem Hause empfing, nichts Merkwürdiges an sich, und Allan war ohne zu zögern darauf eingegangen. Er war auch geneigt, Lloyd zu entschuldigen, im Falle dass er wirklich krank war. Aber er forderte für sein Projekt, dessen Größe ihn zuweilen selbst überwältigte, den allergrößten Respekt! Er hatte dieses Projekt, an dem er fünf Jahre lang Tag und Nacht arbeitete, bisher nur zwei Menschen anvertraut: Hobby, der ebenso gut zu schweigen verstand, wenn es sein musste, wie er schwatzen konnte, wenn man ihm die Zunge nicht festband. Sodann Lloyd. Nicht einmal Maud. Er verlangte, dass Lloyd sich in den Madison-Square-Palast schleppte, wenn es irgendwie anging! Er verlangte, dass Lloyd ihm zum Mindesten eine Nachricht schickte, ihm ein anderes Rendezvous vorschlug! Versäumte Lloyd dies – nun, so wollte er nichts mehr mit dem launenhaften, kranken reichen Mann zu tun haben.
Die von vehement bebender Musik, von Parfümen, blendenden Lichtfluten, dem Glitzern von Edelsteinen erfüllte Treibhausatmosphäre, die ihn umfieberte, steigerte Allans Gedanken zu höchster Klarheit. Sein Kopf arbeitete rasch und präzis, obwohl ihn plötzlich eine starke Erregung ergriffen hatte. Das Projekt war alles! Mit ihm stand oder fiel er! Er hatte für Versuche, Informationen, tausend vorbereitende Arbeiten sein Vermögen geopfert und musste, klar gesagt, morgen von vorn anfangen, sobald das Projekt nicht ausgeführt wurde. Das Projekt war sein Leben!
Er rechnete seine Chancen durch wie ein algebraisches Problem, bei dem jedes einzelne Glied das Resultat der vorhergehenden Resultate ist. In erster Linie konnte er den Stahltrust für sein Projekt interessieren. Der Trust hatte in der Konkurrenz mit dem sibirischen Eisen den Kürzeren gezogen und lag in einer unerhörten Flaute still. Der Trust würde sich auf das Projekt stürzen – zehn gegen eins gewettet! – oder aber Allan konnte mit ihm einen Krieg bis aufs Messer führen. Er konnte das Großkapital, die Morgan, Vanderbilt, Gould, Astor, Mackay, Havemeyer, Belmont, Whitney und wie sie alle hießen, attackieren. Den Ring der Großbanken unter Feuer nehmen. Er konnte endlich, wenn alles fehlschlagen sollte, sich mit der Presse verbünden. Er konnte auf Umwegen sein Ziel erreichen; klar gesehen brauchte er Lloyd gar nicht. Aber mit Lloyd als Verbündetem war es eine gewonnene Attacke, ohne ihn ein mühsames Vordringen, bei dem jeder Quadratfuß Terrain einzeln erobert werden musste.
Und Allan, der weder sah noch hörte, arbeitete hinter unerbittlichen, halb geschlossenen Augen seinen Feldzugplan bis in die kleinsten Einzelheiten aus …
Plötzlich aber ging etwas wie ein Schauer durch den Saal, der ohne Laut unter der Hypnose der Musik lag. Die Köpfe bewegten sich, die Steine begannen stärker zu flimmern, Gläser blinkten. Die Musik floss gerade in sanftem Piano dahin, und der Dirigent wandte irritiert den Kopf, da man im Saale flüsterte. Etwas musste geschehen sein, das größere Macht über das Auditorium hatte als die Hypnose der zweihundertundzwanzig Musiker, des Dirigenten und des unsterblichen Komponisten.
In der Nebenloge sagte eine gedämpfte Bassstimme:
»Sie trägt den Rosy Diamond … aus dem Kronschatz von Abdul Hamid … zweimal hunderttausend Dollar wert.«
Allan hob den Blick: Die Loge gegenüber war dunkel – Lloyd war gekommen!
In der dunklen Loge war Ethel Lloyds bekanntes Profil schwach sichtbar, zart, delikat gezeichnet. Ihr goldblondes Haar war nur an einem unbestimmten Flimmern zu erkennen, und an der linken Schläfe (die dem Publikum zugewendet war) trug sie einen großen Edelstein von blass rötlichem Feuer.
»Sehen Sie diesen Hals, diesen Nacken«, raunte die gedämpfte Stimme des Herrn nebenan. »Haben Sie jemals solch einen Nacken gesehen? Man sagt, dass Hobby, der Architekt – ja, der Blonde, der vorhin nebenan war …«
»Nun, das lässt sich denken!«, flüsterte eine andere Stimme mit rein englischem Akzent, und ein leises Lachen drang herüber.
Der Hintergrund von Lloyds Loge war durch einen Vorhang abgetrennt, und Allan schloss aus einer Bewegung Ethels, dass Lloyd dahinter saß. Er beugte sich zur Seite und flüsterte Maud ins Ohr:
»Lloyd ist nun doch gekommen, Maud.«
Aber Maud hatte nur Ohren für die Musik. Sie verstand Allan gar nicht. Sie war vielleicht die Einzige im Saal, die noch nicht wusste, dass Ethel Lloyd in ihrer Loge saß und den »Rosy Diamond« trug. In einer momentanen seelischen Aufwallung, die die Musik in ihr entfachte, streckte sie ihre kleine Hand tastend nach Allan aus. Und Allan nahm ihre Hand und streichelte sie mechanisch, während tausend rasche, kühne Gedanken durch sein Gehirn jagten und sein Ohr Bruchstücke von dem Geklatsch aufnahm, das die Stimmen nebenan raunten und flüsterten.
»Diamanten?«, fragte die flüsternde Stimme.
»Ja«, erwiderte die raunende Stimme. »Man sagt, so fing er an. In den australischen Camps.«
»Er spekulierte?«
»Auf seine Weise. Er war Kantinenwirt.«
»Er hatte keine Claims, sagen Sie?«
»Er hatte seinen eigenen Claim.« (Leises inneres Lachen.)
»Ich kann Sie nicht verstehen.«
»Man sagt es. Seine eigene Mine, die ihn keinen Cent kostete … Die Arbeiter werden, wie Sie wissen, genau untersucht … verschlucken Diamanten.«
»Das ist mir ganz neu …«
»Lloyd, so sagt man … Kantinenwirt … Er tat etwas in den Whisky, dass sie seekrank wurden. Seine Mine …«
»Das ist unglaublich!«
»Man sagt es! Und jetzt gibt er Millionen für Universitäten, Sternwarten, Bibliotheken …«
»Ei ei ei!«, sagte die flüsternde Stimme, vollkommen totgeschlagen.
»Dabei ist er schwer krank, menschenscheu – meterdicke Betonwände umgeben seine Wohnräume, damit kein Laut hereindringt … wie ein Gefangener …«
»Ei ei ei …«
»Pst!«
Maud wandte empört den Kopf, und die Stimmen verstummten.
In der Pause sah man den lichtblonden Hobby in Lloyds Loge treten und Ethel Lloyd wie einer vertrauten Bekannten die Hand schütteln.
»Sie sehen, dass ich recht hatte!«, sagte laut die tiefe Stimme in der Nachbarloge.
»Hobby ist ein Glückspilz! Da ist allerdings noch Vanderstyfft da …«
Dann kam Hobby herüber und steckte den Kopf in Allans Loge.
»Komm, Mac«, rief er, »der alte Mann wünscht dich zu sprechen!«
2.
Das ist Mac Allan!«, sagte Hobby, indem er Allan auf die Schulter klopfte.
Lloyd saß zusammengekauert mit gesenktem Kopf in der halbdunklen Loge, von der aus man einen blendenden Ausschnitt des Logenringes voll lächelnder, schwätzender Damen und Herren überblicken konnte. Er sah nicht auf und es schien, als hätte er nicht gehört. Nach einer Weile aber sagte er bedächtig und trocken, mit heiseren Nebengeräuschen in der Stimme:
»Ich freue mich aufrichtig, Sie zu sehen, Herr Allan! Ich habe mich eingehend mit Ihrem Projekt beschäftigt. Es ist kühn, es ist groß, es ist möglich! Was ich tun kann, das wird geschehen!«
Und in diesem Moment streckte er Allan die Hand hin, eine kurze, viereckige Hand, lasch und müde und seidenweich, und wandte ihm das Gesicht zu.
Allan war von Hobby auf diesen Anblick vorbereitet worden, aber er musste sich trotzdem zusammennehmen, um das Grauen zu verbergen, das ihm Lloyds Gesicht einflößte.
Lloyds Gesicht erinnerte an eine Bulldogge. Die unteren Zähne standen ein wenig vor, die Nasenlöcher waren runde Löcher, und die tränenden, entzündeten kleinen Augen standen wie schräge Schlitze in dem braunen, ausgetrockneten und bewegungslosen Gesicht. Der Kopf war vollkommen haarlos. Eine ekelhafte Flechte hatte Lloyds Hals, Gesicht und Kopf zernagt und ausgetrocknet und die tabakbraune Haut und die eingeschrumpften Muskeln über die Knochen gespannt. Die Wirkung von Lloyds Gesicht war fürchterlich, sie ging vom Erbleichen bis zur Ohnmacht, und nur starke Nerven vermochten den Anblick ohne Erschütterung zu ertragen. Lloyds Gesicht war der tragikomischen Larve einer Bulldogge ähnlich und verbreitete gleichzeitig den Schrecken eines lebendigen Totenkopfes. Es erinnerte Allan an Indianermumien, auf die sie bei einem Bahnbau in Bolivien gestoßen waren. Diese Mumien hockten in viereckigen Kisten. Ihre Köpfe waren eingetrocknet, die Gebisse erhalten, hinter den verschrumpften Lippen grinsend, die Augen mithilfe von weißen und dunklen Steinen grauenhaft natürlich nachgeahmt.
Lloyd, der die Wirkung seines Gesichtes recht gut kannte, war zufrieden mit dem Eindruck, den es auf Allan machte, und orientierte sich mit seinen kleinen feuchten Augen in Allans Zügen.
»In der Tat«, wiederholte er dann, »Ihr Projekt ist das kühnste, von dem ich je hörte – und es ist möglich!«
Allan verbeugte sich und sagte, er freue sich, Herrn Lloyds Interesse für sein Projekt erweckt zu haben. Der Augenblick war entscheidend für sein Leben, und doch war er – zu seinem eigenen Erstaunen – vollkommen ruhig. Noch beim Eintreten erregt, war er nun imstande, Lloyds kurze, präzise Fragen klar und sachlich zu beantworten. Er fühlte sich diesem Mann gegenüber, dessen Aussehen, Karriere und Reichtum tausend andere verwirrt haben würde, augenblicklich sicher, ohne dass er einen bestimmten Grund dafür hätte angeben können.
»Sind Ihre Vorbereitungen so weit gediehen, dass Sie morgen mit dem Projekt vor die Öffentlichkeit treten können?«, fragte Lloyd zuletzt.
»Ich brauche noch drei Monate.«
»So verlieren Sie keinen Augenblick!«, schloss Lloyd in bestimmtem Ton. »Im Übrigen verfügen Sie ganz über mich.«
Hierauf zupfte er ein wenig an Allans Ärmel und deutete auf seine Tochter.
»Das ist Ethel Lloyd«, sagte er.
Man wandte Ethel, die ihn während des ganzen Gespräches betrachtet hatte, den Blick zu und grüßte.
»How do you do, Mr. Allan?«, sagte Ethel lebhaft und reichte Allan mit der ganzen Natürlichkeit und Freimut ihrer Rasse die Hand, wobei sie ihm offen ins Gesicht blickte.
»Das also ist er!«, fügte sie nach einer kurzen Pause mit feinem, ein wenig schalkhaftem Lächeln hinzu, hinter dem sie ihr Interesse für seine Person zu verbergen suchte.
Allan verbeugte sich und wurde verwirrt, denn mit jungen Damen wusste er gar nichts anzufangen.
Es fiel ihm auf, dass Ethel übermäßig stark gepudert war. Sie erinnerte ihn an ein Pastellgemälde, so zart und weich waren ihre Farben, das Blond ihrer Haare, das Blau ihrer Augen und das feine Rot ihres jungen Mundes. Sie hatte ihn wie eine große Dame begrüßt, und doch klang aus ihrer Stimme etwas Kindliches, als wäre sie nicht neunzehn (das wusste er von Hobby), sondern zwölf Jahre alt.
Allan murmelte eine Höflichkeitsphrase; ein leicht verlegenes Lächeln blieb aus seinem Munde stehen.
Ethel betrachtete ihn immer noch aufmerksam, halb wie eine einflussreiche Dame, deren Interesse eine Huld ist, und halb wie ein neugieriges Kind.
Ethel Lloyd war eine typisch amerikanische Schönheit. Sie war schlank, geschmeidig und dabei doch weiblich. Ihr reiches Haar war von jenem seltenen zarten Goldblond, das die Damen, die es nicht besitzen, stets für gefärbt erklären. Sie hatte auffallend lange Wimpern, in denen Spuren von Puder haften geblieben waren. Ihre Augen waren dunkelblau und klar, erschienen aber infolge der langen Wimpern leicht verschleiert. Ihr Profil, ihre Stirn, das Ohr, der Nacken, alles war edel, rassig und wahrhaft schön.
Aber auf ihrer rechten Wange zeigten sich schon die Spuren jener entsetzlichen Krankheit, die ihren Vater verunstaltet hatte. Von ihrem Kinn aus zogen hellbraune, vom Puder fast zugedeckte Linien, wie Fasern eines Blattes, bis zur Höhe des Mundwinkels, einem blassen Muttermal ähnlich.
»Ich liebe es, mit meiner Tochter über Dinge zu plaudern, die mich lebhaft interessieren«, begann Lloyd wieder. »Und so dürfen Sie es mir nicht übel nehmen, dass ich mit ihr über Ihr Projekt gesprochen habe. Sie ist verschwiegen.«
»Ja, ich bin verschwiegen!«, versicherte Ethel lebhaft und nickte lächelnd mit dem schönen Kopf. »Wir haben stundenlang Ihre Pläne studiert, und ich habe mit Papa so lange darüber geplaudert, bis er selbst ganz begeistert war. Und das ist er jetzt, nicht wahr, Papa? (Lloyds Maske blieb bewegungslos.) Papa verehrt Sie, Herr Allan! Sie müssen uns besuchen, wollen Sie?«
Ethels leicht verschleierter Blick haftete an Allans Augen und ein freimütiges junges Lächeln schwebte über ihren schön geschwungenen Lippen.
»Sie sind in der Tat sehr liebenswürdig, Fräulein Lloyd!«, erwiderte Allan mit einem leisen Lächeln über ihren Eifer und ihr munteres Geplauder.
Ethel gefiel sein Lächeln. Ganz ungeniert ließ sie den Blick auf seinen weißen starken Zähnen ruhen, dann öffnete sie die Lippen, um etwas hinzuzufügen, aber in diesem Augenblick setzte das Orchester rauschend ein. Sie berührte flüchtig das Knie ihres Vaters, um ihn um Entschuldigung zu bitten, dass sie noch spreche – Lloyd war ein großer Musikfreund –, und flüsterte Allan wichtigtuerisch zu:
»Sie haben eine Bundesgenossin an mir, Herr Allan! Ich gebe Ihnen die Versicherung, ich werde nicht erlauben, dass Papa seine Meinung ändert. Sie wissen, er tut das zuweilen. Ich werde ihn zwingen, dass er alles in Fluss bringt! Auf Wiedersehen!«
Mit einem höflichen, aber etwas gleichgültigen Kopfnicken, das Ethel einigermaßen enttäuschte, erwiderte Allan ihren Händedruck – und damit war das Gespräch zu Ende, das über das Werk seines Lebens und eine neue Epoche in den Beziehungen zwischen der Alten und Neuen Welt entschied. Funkelnd und stark im Innern unter dem Anprall von Gedanken und Empfindungen, die dieser Sieg in ihm auslöste, verließ er mit Hobby die Loge Lloyds.
Vor der Türe stießen sie auf einen Mann von kaum zwanzig Jahren, der gerade noch Zeit gehabt hatte, zurückzutreten und sich aufzurichten, bevor er überrannt wurde. Offenbar hatte er versucht, an Lloyds Loge zu lauschen. Der junge Mann lächelte, womit er seine Schuld eingestand und um Entschuldigung bat. Er war ein Reporter des Herald und hatte den gesellschaftlichen Teil des Abends zu bearbeiten. Ungeniert vertrat er Hobby den Weg.
»Herr Hobby«, sagte er, »wer ist der Gentleman?«
Hobby blieb stehen und zwinkerte gut gelaunt.
»Sie kennen ihn nicht?«, fragte er. »Das ist Mac Allan, von den Allanschen Werkzeugstahlwerken, Buffalo, Erfinder des Diamantstahls Allanit, Championboxer von Green River und der erste Kopf der Welt.«
Der Journalist lachte laut heraus:
»Sie vergessen Hobby, Herr Hobby!«, erwiderte er, und indem er mit dem Kopf gegen Lloyds Loge deutete, fügte er flüsternd und ehrerbietig neugierig hinzu:
»Gibt es etwas Neues, Herr Hobby?«
»Ja«, antwortete Hobby lachend und ging weiter. »Sie werden staunen! Wir bauen einen tausend Fuß hohen Galgen, an dem am 4. Juli alle Zeitungsschreiber New Yorks aufgehängt werden.«
Dieser Scherz Hobbys stand tatsächlich am nächsten Tag in der Zeitung, zusammen mit einem (gefälschten) Porträt von Mr. Mac Allan, Erfinder des Diamantstahls Allanit, den C. H. L. (Charles Horace Lloyd) in seiner Loge empfing, um mit ihm über eine Millionengründung zu verhandeln.
3.
Maud schwelgte noch immer. Allein sie war nicht mehr imstande, mit jener heiligen Andacht zu lauschen wie vorher. Sie hatte die Szene in Lloyds Loge beobachtet. Sie wusste wohl, dass Mac damit beschäftigt war, etwas Neues auszuarbeiten, eine »große Sache«, wie er sagte. Irgendeine Erfindung, ein Projekt, sie hatte ihn nie darüber gefragt, denn nichts lag ihr ferner als Maschinen und technische Dinge. Sie begriff auch, wie wertvoll für Mac eine Verbindung mit Lloyd sein musste. Aber sie machte ihm stille Vorwürfe, dass er gerade diesen Abend für eine Besprechung gewählt hatte. Den einzigen Abend des Winters, an dem er mit ihr zusammen ein Konzert besuchte. Sie verstand nicht, wie es ihm möglich war, während eines solchen Konzerts an Geschäfte zu denken! Zuweilen kam ihr der Gedanke, als ob sie nicht recht in dieses Amerika hineinpasste, wo alles Business war und nur Business, ob sie nicht glücklicher geworden wäre da drüben in der Alten Welt, wo sie noch Erholung und Geschäft zu trennen verstanden. Aber nicht das allein beunruhigte Maud, der feine, ewig wache Instinkt der liebenden Frau ließ sie befürchten, dass jene »große Sache«, diese Lloyds und wie sie hießen, mit denen Mac nun zu tun haben würde, ihr noch mehr von ihrem Gatten rauben würden, als die Fabrik und seine Tätigkeit in Buffalo es jetzt schon taten.
Über Mauds fröhliche Laune war ein Schatten gefallen, und sie legte die Stirn in Falten. Dann aber glitt plötzlich eine stille Heiterkeit über ihr Gesicht. Eine fugenartige, tändelnde und heitere Passage hatte ihr – dank einer rätselhaften Ideenverbindung – ganz plötzlich ihr Kind deutlich und in den reizvollsten, eine Mutter beglückenden Situationen ins Gedächtnis gerufen. Es verlockte sie, in der Musik eine Prophezeiung des Lebens ihres kleinen Mädchens hören zu wollen, und anfangs ging alles herrlich. Ja, so glücklich sollte ihre Edith werden, so sollte Ediths Leben sein! Aber die spielerische, sonnige Heiterkeit ging unvermittelt in ein schweres, schleppendes Maestoso sostenuto über, das Beklommenheit und böse Ahnungen erweckte.
Mauds Herz klopfte langsamer. Nein, nimmermehr sollte das Leben ihres kleinen süßen Mädchens, mit dem sie wie ein Kind spielte und das sie wie eine erfahrene alte Frau pflegte, dieser Musik ähnlich werden. Welch ein Unsinn, mit solchen Einfällen zu spielen! Sie breitete sich in Gedanken über die Kleine, um sie mit ihrem Körper gegen diese bange, schwere Musik zu decken, und nach einiger Zeit gelang es ihr auch, ihren Gedanken eine andere Richtung zu geben.
Die Musik selbst kam ihr zu Hilfe. Denn plötzlich riss die Brandung der Töne sie wieder fort zu einer unbestimmten Sehnsucht, die heiß und herrlich war und alle Gedanken erstickte. Sie war Ohr, wie vorher. Mit einer atemlosen, rasenden Leidenschaftlichkeit jagte die Musik dahin, von heißen, verführerischen Stimmen angeführt, und Maud war wie ein loses Blatt im Sturmwind. Plötzlich aber brach sich die wilde, keuchende Leidenschaft an einem unbekannten Hindernis, so wie die Woge an einem Felsen zerschellt, und die donnernde Brandung zerflatterte in schreiende, wehklagende, zitternde und ängstliche Stimmen. Maud war es, als ob sie plötzlich stillstehen müsse und gezwungen wäre, über etwas nachzudenken, das unbekannt, geheimnisvoll und unergründlich für sie war. Die Stille, die dem heißen Sturm folgte, war so bannend, dass plötzlich alle vibrierenden Fächer im Parkett stehen blieben. Mit einer Dissonanz setzten die Stimmen da drunten wieder unsicher, zögernd ein (die Fächer bewegten sich wieder), und diese zusammengepressten, gequälten Töne, die sich nur schwer und mühselig zur Melodie durchkämpften, stimmten Maud nachdenklich und traurig. Die spottenden Fagotte drunten sprachen zu ihr, und die Celli, die ganz ehrlich litten, und es schien Maud, als ob sie plötzlich ihr ganzes Leben verstünde. Sie war nicht glücklich, trotzdem Mac sie anbetete und sie ihn abgöttisch liebte – nein, nein, es war da irgendetwas, das fehlte …
In diesem Augenblick, gerade in diesem Augenblick, berührte Mac ihre Schulter und raunte ihr ins Ohr:
»Entschuldige, Maud – wir fahren am Mittwoch nach Europa. Ich habe noch viel vorzubereiten in Buffalo. Wenn wir jetzt gehen, können wir den Nachtzug noch erreichen. Was denkst du?«
Maud antwortete nicht. Sie saß still und regungslos. Das Blut stieg ihr über Schultern und Nacken ins Gesicht. Ihre Augen füllten sich langsam mit Tränen. So vergingen einige Minuten. Sie war in diesem Augenblick Mac bitterböse im Herzen. Es erschien ihr roh, sie mitten aus dem Konzert zu reißen, nur weil seine Geschäfte drängten.
Allan sah, dass sie schwer atmete und ihre Wangen rot geworden waren. Seine Hand lag noch auf ihrer Schulter. Er machte eine liebkosende Bewegung und raunte begütigend:
»Nun, so bleiben wir, Liebling, ich machte nur den Vorschlag. Wir können auch recht gut den Frühzug nehmen.«
Maud aber war die Laune gründlich verdorben. Die Musik quälte sie jetzt und machte sie bang und unruhig. Sie schwankte noch, ob sie nachgeben sollte oder nicht. Da sah sie zufällig, dass Ethel Lloyd ganz ungeniert das Glas auf sie gerichtet hatte, und augenblicklich schickte sie sich an zu gehen. Sie zwang sich zu einem Lächeln, damit Ethel Lloyd es sähe, und Allan war sehr erstaunt über ihren zärtlichen (noch feuchten) Blick, mit dem sie sich an ihn wandte.
»Gehen wir, Mac!«
Es freute sie, dass Mac ihr zuvorkommend beim Aufstehen behilflich war, und heiter lächelnd, anscheinend in der glücklichsten Laune, verließ sie die Loge.
4.
Sie erreichten Central Station gerade, als der Zug aus der Halle zog. Maud vergrub die kleinen Hände in die Taschen ihres Pelzmantels und lugte aus dem ausgestülpten Kragen zu Mac hin.
»Da fährt dein Zug, Mac!«, sagte sie lachend und gab sich keine Mühe, ihre Schadenfreude zu verbergen.
Hinter ihnen stand ihr Diener, Leon, ein alter Chinese, den alle Welt »Lion« rief. Lion trug die Reisetaschen und sah mit stupidem Ausdruck seines welken, faltigen Gesichtes dem Zuge nach.
Allan zog die Uhr und nickte.
»Es ist zu schade«, sagte er gutmütig. »Lion, wir fahren ins Hotel zurück.«
Im Auto erklärte er Maud, dass es ihm gerade ihretwegen unangenehm sei, dass sie den Zug versäumt hätten; sie habe gewiss noch eine Menge mit dem Packen zu tun.
Maud lachte leise.
»Weshalb?«, sagte sie und sah an Mac vorbei. »Wieso weißt du, dass ich überhaupt mitfahre, Mac?«
Allan sah sie erstaunt an.
»Du wirst schon mitkommen, denke ich, Maud?«
»Ich weiß wirklich nicht, ob es angeht, mit Edith im Winter zu reisen. Und ohne Edith gehe ich auf keinen Fall.«
Allan blickte nachdenklich vor sich hin.
»Daran dachte ich im Augenblick gar nicht«, sagte er nach einer Weile zögernd. »Freilich, Edith. Aber ich denke, es ließe sich trotzdem machen.«
Maud entgegnete nichts. Sie wartete. So leicht sollte er diesmal nicht davonkommen. Nach einer Pause setzte Allan hinzu:
»Der Dampfer ist ja genau wie ein Hotel, Maud. Ich würde Luxuskabinen nehmen, damit ihr es bequem hättet.«
Maud kannte Mac genau. Er würde nicht weiter in sie dringen mitzukommen, sie nicht bitten. Er würde nun kein Wort weiter sagen und es ihr auch gar nicht übel nehmen, wenn sie ihn allein reisen ließe. Sie sah ihm an, dass er sich jetzt schon mit diesem Gedanken abzufinden suchte.
Er blickte nachdenklich und enttäuscht vor sich hin. Es kam ihm gar nicht in den Sinn, dass ihre Absage nichts als eine Komödie war, ihm, der nie in seinem Leben Komödie spielte und dessen Wesen so einfach und aufrichtig war, dass es sie immer von Neuem überraschte.
In einer plötzlichen Aufwallung ergriff sie seine Hand.
»Natürlich komme ich mit, Mac!«, sagte sie mit einem zärtlichen Blick.
»Ah, siehst du!«, erwiderte er und drückte ihr dankbar die Hand.