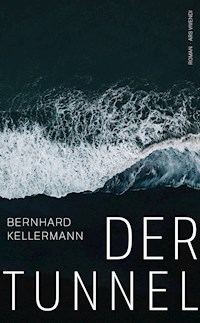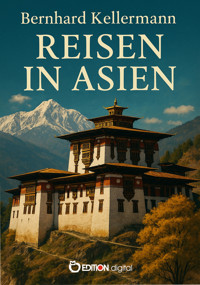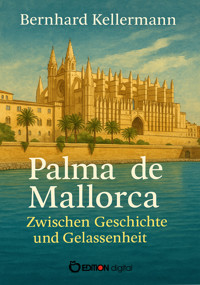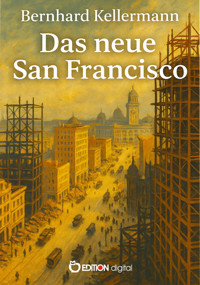4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf dem Dampfer Tschung-King treibt eine kleine Schar Reisender durch die drückende Hitze des chinesischen Sommers den mächtigen Jangtse entlang. Unter ihnen: ein englischer Ex-Jäger, der im Alkohol zu ertrinken droht, ein dänischer Kaufmann, ein kranker Chinese – und der Ich-Erzähler, der Zeuge eines menschlichen Dramas wird. Inmitten der träge dahinfließenden Fluten entfaltet sich die Geschichte des Robert, eines Gestrandeten, dessen Aufstieg, Liebe und Untergang untrennbar mit der geheimnisvollen Welt des Fernen Ostens verbunden sind. Bernhard Kellermann, der große Erzähler der Moderne, verknüpft in dieser atmosphärisch dichten Novelle Schicksal und Natur, Kolonialismus und persönliche Schuld, Leidenschaft und Verhängnis. Jangtsekiang ist eine packende Studie über den Menschen im Taumel zwischen Zivilisation und Untergang – ein Klassiker deutscher Erzählkunst, der nichts von seiner psychologischen Wucht verloren hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 96
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Bernhard Kellermann
JANG-TSE-KIANG
ISBN 978-3-68912-579-0 (E-Book)
Aus: Ausgewählte Werke in Einzelausgaben, herausgegeben im Auftrag der Deutschen Akademie der Künste zu Berlin von Ellen Kellermann und Ulrich Dietzel, 3. Auflage, Verlag Volk und Welt, Berlin 1966.
Die Erzählung wurde 1931 zuerst in „Velhagen und Klasings Monatsheften“ veröffentlicht, ehe sie in Buchform 1934 bei S. Fischer erschien.
© 2025 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Godern
Tel.: 03860-505 788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
JANG-TSE-KIANG
Auf dem Dampfer „Tschung-King“, unterwegs von Hankau nach Schanghai, waren in der ersten Kajüte nur fünf Passagiere. Zwei Dänen, ein hagerer Chinese, Seidenhändler aus Hongkong, ein etwas merkwürdiger Engländer und ich.
Es war im August; niemand reiste, der es nicht unbedingt nötig hatte. Wir lagen von früh bis nachts in den Deckstühlen, häufig auch in der Nacht. Die Hitze war einfach unerträglich, auch nicht ein Hauch in der Luft.
Träg wälzte der Strom seine Wassermassen dahin. Er hatte keine Eile, aber er blieb auch nicht eine Sekunde stehen, wie seit Jahrtausenden, als noch kein Mensch seine Ufer bewohnte. Streckenweise trieben Felder von Blasen, als ginge ein Hagelschauer nieder, Wirbel vom Durchmesser eines kleinen Horizonts kreisten und brachten Unmassen von Lehmbrei an die Oberfläche.
Die niedrigen Ufer wurden nur selten sichtbar, die tanzende Flitze verschlang sie. Im Norden stand, fern wie in einem Meere, eine Fischerflottille, Dschunken mit rotbraunen Segeln und verkohlten Menschen an Bord trieben am Dampfer vorüber. Zuweilen näherte sich die „Tschung-King“ einem Wald von Masten und tutete. Sampans und Dschunken kamen heraus auf den Fluss und übernahmen unter dem Singsang der Kulis Passagiere und Fracht: Säcke, Kisten, Ballen, Ladungen massiver Särge. In der Nacht erschienen Inseln und Berge von Lichtern, wahre Sternhaufen, Städte, wimmelnd von Hunderttausenden, deren Namen in Europa niemand kennt. Fackeln loderten, Lampen tanzten auf dem Strom.
Das war der Jang-tse-kiang, geheimnisvoll und unendlich wie das Land, das er durchfließt. Ist ihm eine Stadt im Wege, so nimmt er sie mit, samt Tempeln, Menschen, Basaren und Grabfeldern, eine Provinz verschluckt er. Viertausend Kilometer ist er schon unterwegs, und noch immer ist sein Weg nicht zu Ende.
Die „Tschung-King“, ein kleiner chinesischer Dampfer unter japanischer Führung, verfolgte ohne jeden Ehrgeiz ihren Weg. Einige Tage mehr oder weniger Verspätung machten ihr nichts aus.
Die beiden dänischen Kaufleute klapperten den ganzen Tag mit den Würfelbechern. Der hagere Chinese aus Hongkong, quittengelb, offenbar an der Malaria erkrankt, kam nur gegen Abend an Deck, um etwas frische Luft zu schöpfen. Er schwankte eine halbe Stunde an der Reling entlang, blickte mit melancholischen, stumpfen Augen über den dampfenden Fluss und verschwand wieder. Der etwas merkwürdige Engländer aber, Mr. Robert, verbrachte Tage und Nächte damit, möglichst viel Whisky zu trinken. Er lag in einem Deckstuhl wie in einer Hängematte, die Beine auf einer Bank mit Schwimmwesten. Glas und Flasche standen auf dem Fußboden neben ihm, er brauchte also nur die Hand auszustrecken. Sein Kopf befand sich tiefer als die Beine, so dass er den Strom nicht sah. Ich erfuhr später, dass er seine guten Gründe hatte, dieses Wiedersehen nach Möglichkeit zu vermeiden. War die Flasche zu Ende, so schleuderte er sie über Bord. Ununterbrochen lief der Boy mit kleinen Flaschen Sodawasser.
Zu den Mahlzeiten kam er sehr selten. Er saß mit verglasten Augen, verbarg schlecht seinen Widerwillen gegen den Geruch der Speisen, würgte an einem Löffel Suppe und ging wieder. „Ich vertrage die Luft unter Deck nicht“, murmelte er, „ich war Jäger und werde wieder Jäger werden.“ Jäger? Er sah viel eher einem Kaufmann ähnlich. Soviel ich aus dem Gespräch der beiden Dänen, die Robert gut zu kennen schienen, entnehmen konnte, war er im letzten Jahre Leiter einer Mine in der Provinz Honan gewesen, aber entlassen worden oder freiwillig aus seiner Stellung ausgeschieden.
Einmal fanden wir ihn vor dem Speisesaal über dem Geländer hängen, ganz wie einen Anzug, den ein Passagier zum Ausbürsten hinausgelegt hatte.
„Sehr schlimm, sehr schlimm“, lispelte der japanische Kapitän der „Tschung-King“ mit einem aufrichtig mitleidigen Lächeln. Er war ein sympathischer alter Mann, dessen ergrauter, brauner Schädel wie mit Eisnadeln gespickt schien.
„Ja, ja“, sagte der eine der Dänen, „jetzt ist Robert endgültig fertig.“
„Ja, ja, total fertig. Schade um ihn!“, sagte der andere der Dänen.
Sie klapperten wieder mit den Würfelbechern, um die Hitze zu vergessen. Ich würfelte gewöhnlich mit ihnen. Wir spielten um alle möglichen Drinks, die der Boy in seiner winzigen Bar hatte. Jede Soda, die wir tranken, erschien augenblicklich wieder in der Gestalt von Schweißperlen, die zusehends größer wurden, auf unseren Stirnen.
Robert lag in seinem Deckstuhl und schlief. Er hatte den Mund etwas geöffnet und röchelte. Was mir sofort auffiel, waren seine schön geformten Lippen, die im Schlaf spöttisch zu lächeln schienen. Es war eigentlich der Mund einer Frau, sicher hatte seine Mutter diese Lippen gehabt. Roberts Gesicht war hochrot wie von Fieber. Er war nicht rasiert, und die hellroten Bartstoppeln ließen sein Gesicht voller erscheinen, als es in Wirklichkeit war. Sein Kopfhaar war gekräuselt, gelockt, wenn man so sagen kann, aber der Schweiß hatte die Locken stark in Unordnung gebracht. Es war rötlich, schon mit starkem Grau durchsetzt. Das Gesicht, im Ganzen betrachtet, war, obgleich die Trunkenheit es jetzt entstellte, das eines gescheiten, verfeinerten Menschen von guter, ja bester Rasse.
Wir würfelten, schliefen ein, erwachten wieder. Und immer dehnte sich draußen gleich endlos der Strom. Am Spätnachmittag, als wir eine Lage Cocktail auswürfelten, gab es plötzlich eine Explosion, die uns alle heftig erschreckte. Robert wollte wieder eine leere Flasche in den Strom schleudern, aber sie flog gegen die Reling und zerschellte. Die Hitze hatte unsere Nerven derartig angespannt, dass wir glaubten, der Dampfer fliege in die Luft, was übrigens jeden Augenblick tatsächlich geschehen konnte, so alt und verwahrlost war er.
Gleich darauf erfolgte auch Roberts gänzlicher Niederbruch, den wir schon lange kommen sahen. Es ging einfach nicht mehr weiter mit ihm. Er wollte nach dem Glas greifen, fiel aus dem Stuhl und blieb liegen wie ein niedergeschlagener Boxer. Zwei chinesische Boys kamen und trugen ihn an Armen und Beinen über das Deck in die Kabine. Ein unsagbar trauriger Anblick. Ein Glück, dass keine Reisenden an Deck waren. Wir schämten uns für Robert. Hätte er sehen können, wie er in seinem zerknitterten Tropenanzug, das Hemd offen, über das Deck geschleppt wurde, so hätte er gewiss nie mehr einen Tropfen Whisky getrunken. Die Boys trugen ihn übrigens mit Rücksicht und mit Bedauern auf ihren glatten Gesichtern. Sie spielten sich nicht als moralische Richter auf, das lag ihnen ganz fern, und betrunkene Europäer hatten sie schon zur Genüge gesehen. Sie trugen ihren besten Kunden, der ihnen Silberdollars vor die Füße geworfen hatte, in die Kajüte, so wie man jemand ins Grab trägt, denn bis Schanghai würde er kaum noch zu sich kommen und mit Silberdollars schmeißen. Oh, wie schade! Der Zweite Offizier der „Tschung-King“ dagegen, ein blutjunger Japaner, folgte dem Abtransport mit einem Lächeln letzten Verachtens. Ich beobachtete ihn genau. Er sah ganz Europa, das er hasste, in diesem betrunkenen Engländer. Aber wir schämten uns ja selbst, wie gesagt.
„Ja, ja“, sagten die Dänen voller Anteilnahme. Wir würfelten noch immer an unserer Lage Cocktail. „Nun ist er endgültig fertig!“ Ihre Teilnahme klang wirklich aufrichtig. Das Schicksal Roberts schien ihnen nahezugehen, und sie wurden schweigsam, als die Dämmerung düster auf den Fluss niedersank. Ein Trinker, was weiter? Er war nicht der erste, den der Orient vernichtete.
Herr Niels Rasmussen aus Kopenhagen, Vertreter der größten dänischen Brauerei in China und dem Fernen Osten, schüttelte den Kopf und sah mich etwas rügend an.
„Je älter man wird“, sagte er, „desto mysteriöser erscheint das Leben. Sind Sie Fatalist? Nein, natürlich nicht. Noch vor wenigen Jahren hätte ich über diese Frage gelacht wie Sie, ganz genauso, aber heute, da mein Haar weiß wird, fange ich an, sehr schwankend zu werden. Es sind jetzt etwa sechs Jahre, dass ich Robert kenne, warten Sie, genau sieben Jahre. Es war in Schanghai. Damals war Robert nicht anders als wir alle, weder besser noch schlechter, vielleicht sogar ein wenig besser. Er war das, was man einen reizenden jungen Mann nennt, voller Talente, zur Freundschaft begabt, immer gut gelaunt. Das ist schon eine ganze Menge. Vielleicht könnte man sogar sagen, dass er das war, was man einen prachtvollen Menschen nennt. Heute ist er ein Wrack, das sieht jeder. Sehr wohl, er kämpfte schon damals gegen den Whisky – es gelang ihm auch am Anfang, und doch musste er schließlich dahin kommen, wo er heute angelangt ist. Sein Schicksal war festgelegt, möchte ich fast sagen, wie der Kurs eines Dampfers, mochte er noch so heroisch dagegen ankämpfen. Vielleicht hätten wir alle kapituliert, einfach die Waffen hingeworfen, ganz wie Robert, wenn uns die Geschichte passiert wäre, die er erlebt hat.“
„Welche Geschichte?“, fragte ich.
„Nun, diese Geschichte mit der schönen Maria Groothus. Sie kennen den Namen nicht? Er stand damals in allen Zeitungen, und im Osten, von Kalkutta bis Jokohama, sprach man Monate davon! Wie sollten Sie auch die Geschichte kennen? Aber hier im Osten kennt sie jedermann, und weil man sie kennt, übt man etwas Nachsicht mit Robert. Er kann in einer Bar in Hongkong oder Schanghai Gläser zerschlagen – man sagt: ,Lassen Sie ihn, es ist Robert.‘ Diese Geschichte mit der schönen Maria Groothus begann in Schanghai. Und wo endet sie? Hier, hier!“
Rasmussen deutete über den unendlichen Strom, der sich langsam dem Meere zuschob.
„Damals also, vor sieben Jahren, verkehrte bei uns im Klub ein amerikanischer Zahnarzt. Moritz Nathanson aus San Francisco, wohl der größte Optimist und der gutmütigste Mensch, den ich je angetroffen habe. Seine Nachsicht mit seinen Mitmenschen war grenzenlos. Selbst die schlimmsten Fehlschläge und Enttäuschungen wusste er noch günstig zu deuten. Auch in geradezu hoffnungslosen Situationen sah ich ihn nie entmutigt, übrigens hat er schließlich recht behalten, was ihn selbst betrifft, heißt das. Er ist jetzt einer der ersten Zahnärzte in Los Angeles und scheffelt die Dollars sackweise. Er hat es mir kürzlich selbst geschrieben. Damals aber, in Schanghai, stand es recht schlecht um sein Geschäft, das kann man wohl sagen. Seine Kundschaft waren hauptsächlich junge Kaufleute, und die bezahlten ihm nicht einen Pfennig, im Gegenteil, sie erklärten ihm, er müsse noch dankbar sein, dass überhaupt jemand in seine Sprechstunde komme. Nathanson also steckte bis an den Hals in Schulden, seine Boys konnte er oft monatelang nicht bezahlen, trotzdem war er immer in strahlender Laune. Und obgleich er oft nicht einen halben Dollar hatte, um sich ein Abendessen zu leisten, gab es keinen Bettler und Abenteurer von Singapore bis hinauf nach Charbin, der ihn nicht angeschnorrt hätte. Auf wahrhaft mysteriöse Weise hatte sich der Ruf von Nathansons grenzenloser Gutherzigkeit im Fernen Osten verbreitet. Unser Moritz war von kleiner Statur und hatte einen runden Kopf, runde Froschaugen und eine recht stattliche Glatze, damals schon. Er sprach laut, zappelte unaufhörlich vergnügt hin und her und glänzte zu jeder Stunde des Tages und der Nacht vor Wohlbehagen.
Eines Tages nun, als ich im Klub Billard spielte, zog mich Nathanson beiseite, ich kannte ihn ja schon, und er bedeutete mir, es müsse da etwas geschehen. Ein junger Engländer liege auf der Straße, es sei eine Schande. Ein hübscher Junge, von zu Hause durchgegangen, gebildet, jetzt heruntergekommen, halb verhungert.
,Lassen Sie ihn liegen‘, sagte ich, ,wir haben ja schon genug Lehrgeld bezahlt.‘
Jeder große Dampfer wirft zweifelhafte Existenzen, Schwindler, Falschspieler, Hochstapler ans Land, Wracks, die die Tropen, Alkohol und Opium vernichteten. Diesen Existenzen ist nicht mehr zu helfen, in den allermeisten Fällen wenigstens. Sie leben von der Albernheit ihrer Mitmenschen, die Hotels und Spielhöllen wimmeln von ihnen. Was in aller Welt sollte man mit ihnen anfangen? Das alles brauchte ich Nathanson natürlich nicht zu sagen, er wusste das so gut wie ich. Trotzdem war er nicht so einfach abzuweisen. Er geriet in Eifer, zerrte an allen meinen Rockknöpfen. Natürlich, natürlich, Abschaum der Gesellschaft, er wisse das alles, aber dieser Fall sei eine Ausnahme. Moritz war unverbesserlich. Es war bekannt, dass er den Rikschakulis gratis die Zähne zog!
,Nein, nein, wenn Sie ihn nur sehen‘, ereiferte er sich, ,dann werden Sie ganz anders urteilen. Ich habe doch schließlich einige Menschenkenntnis. Übrigens – sagten Sie nicht soeben, dass Sie für übermorgen einen Klavierspieler suchen? Nun, der junge Mann kann Klavier spielen. Er behauptet es wenigstens.‘