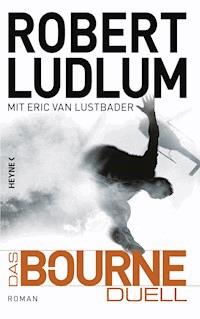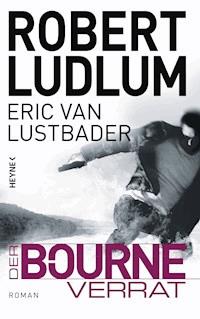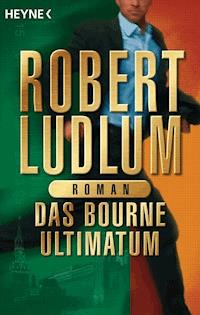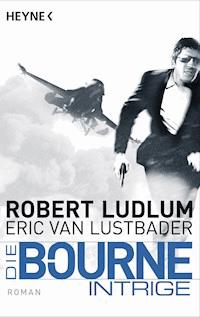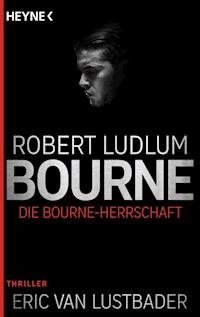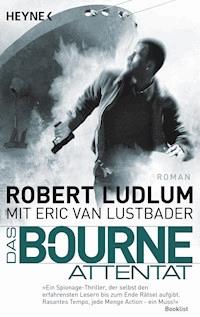
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: JASON BOURNE
- Sprache: Deutsch
Bourne is back!
Als Jason Bourne Informationen über einen drohenden Terroranschlag auf amerikanischem Boden zugespielt werden, begibt er sich sofort auf die gefährliche Jagd nach den Killern. Doch zu spät erkennt er, wer der eigentliche Drahtzieher des Attentats ist. Ein tödlicher Wettlauf beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 766
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Für Dan und Linda Jariabka,
mit Dank und Liebe
Prolog
HOCHSICHERHEITSGEFÄNGNIS KOLONIE 13, NISCHNI TAGIL, RUSSLAND CAMPIONE D’ITALIA, SCHWEIZ
Während die vier Insassen auf Borja Maks warteten, standen sie an die schmutzige Steinmauer gelehnt, deren Kälte ihnen schon nichts mehr ausmachte. Draußen auf dem Gefängnishof, wo sie teure Schwarzmarktzigaretten aus starkem türkischem Tabak rauchten, plauderten sie, als hätten sie nichts Besseres zu tun, als den scharfen Rauch in die Lungen zu saugen und anschließend wieder in die eisige Luft zu blasen. Über ihnen spannte sich ein wolkenloser, von glitzernden Sternen erleuchteter Himmel wie eine Perlmuttschale. Der Große Bär, die Jagdhunde, Perseus und Lynx – dieselben Sternbilder leuchteten auch über Moskau, tausend Kilometer südwestlich von hier, aber was für ein Unterschied war das Leben hier zu den hell erleuchteten überheizten Klubs in der Sadownitscheskaja-Straße.
Tagsüber stellten die Insassen von Kolonie 13 Teile für den russischen T-90-Kampfpanzer her. Aber worüber unterhielten sich Männer ohne Gewissen und Gefühle am Abend? Seltsamerweise über die Familie. Die Sicherheit, dass zu Hause eine Frau und Kinder auf sie warteten, hatte ihrem Leben vor dem Gefängnis eine gewisse Stabilität verliehen, einen geordneten Rahmen, wie es jetzt die mächtigen Mauern taten, die das Hochsicherheitsgefängnis Kolonie 13 umgaben. Was immer sie in ihrem Leben für Geld taten – lügen, betrügen, stehlen, erpressen, foltern und töten – es war alles, was sie kannten. Dass sie diese Dinge taten, war für sie eine Selbstverständlichkeit, eine Notwendigkeit, um zu überleben. Sie führten ein Leben außerhalb der Zivilisation. Heimzukommen zu einer Frau, zu den vertrauten Gerüchen von gekochtem Kohl und geschmortem Fleisch und dem feurigen Geschmack des Wodkas – all das waren Gedanken, die nostalgische Gefühle in ihnen weckten. Und diese Gefühle waren für sie genauso bindend wie die Tätowierungen der zwielichtigen Tätigkeiten, denen sie nachgingen.
Ein leiser Pfiff durchschnitt die frostige Abendluft und löste ihre Erinnerungen auf wie Terpentin die Farben eines Ölgemäldes. Die bunten Bilder, die sie sich vorgestellt hatten, verloren sich in der Dunkelheit, als Borja Maks auftauchte. Maks war ein großer bärenstarker Mann, der jeden Tag, seit er im Gefängnis war, ein Trainingsprogramm mit einer Stunde Gewichtheben und eineinhalb Stunden Seilhüpfen absolvierte. Als Auftragskiller für die russische Mafia-Organisation Kazanskaja, die mit Drogen und gestohlenen Autos handelte, hatte er einen besonderen Status unter den fünfzehnhundert Insassen der Kolonie 13 inne. Die Wärter fürchteten und hassten ihn. Sein Ruf ging ihm voraus wie ein Schatten bei Sonnenuntergang. Einem Hurrikan nicht unähnlich, umgab ihn die Aura von Tod und Zerstörung. Sein letztes Opfer war der fünfte Mann der Gruppe gewesen, die jetzt nur noch zu viert war. Auch wenn er von der Kazanskaja war – Maks musste bestraft werden, sonst würden ihre Tage in der Kolonie 13 früher oder später gezählt sein.
Sie lächelten ihm zu. Einer von ihnen bot ihm eine Zigarette an, ein anderer zündete sie an, als er sich vorbeugte und die winzige Flamme mit beiden Händen vor dem Wind abschirmte. Die beiden anderen Männer packten seine gestählten Arme, während der Mann, der ihm die Zigarette angeboten hatte, mit einem Messer, das er in der Gefängnisfabrik sorgfältig geschliffen hatte, auf Maks’ Solarplexus losging. Im letzten Moment schlug Maks das Messer mit einem genau getimten Schlag zur Seite. Im selben Augenblick traf der Mann mit dem Zündholz Maks’ Kinn mit einem wuchtigen Aufwärtshaken.
Maks taumelte gegen die beiden Männer, die ihn an den Armen festhielten, doch gleichzeitig trat er dem Mann zur Linken mit aller Kraft auf den Fuß. Er schaffte es, seinen linken Arm zu befreien, wirbelte herum und rammte dem Mann zu seiner Rechten den Ellbogen in die Rippen. Nachdem er sich aus dem Griff befreit hatte, stellte er sich mit dem Rücken zur Mauer. Die vier rückten zusammen und gingen erneut auf ihn los. Der Mann mit dem Messer trat vor, ein anderer zog sich ein gekrümmtes Metallstück über die Fingerknöchel.
Nun begann der Kampf so richtig, und die Männer ächzten vor Anstrengung und Schmerz. Maks war stark und schlau; er hatte seinen Ruf nicht zu Unrecht, doch obwohl er genauso viel austeilte wie er einsteckte, hatte er es doch mit vier entschlossenen Gegnern zu tun. Wenn Maks einen von ihnen zu Boden schickte, trat ein anderer an seine Stelle, so dass immer zwei da waren, die auf ihn einschlugen, während sich die beiden anderen sammelten, so gut es ging, um erneut anzugreifen. Die vier wussten genau, wie schwer ihre Aufgabe war. Ihnen war klar, dass sie Maks nicht beim ersten oder zweiten Angriff überwältigen konnten. Ihr Plan war, ihn nach und nach zu ermüden. Während sie selbst sich immer wieder erholen konnten, ließen sie ihm nicht die kleinste Verschnaufpause.
Und es schien zu funktionieren. Blutend und mit blauen Flecken übersät, setzten sie ihre unermüdlichen Attacken fort, bis Maks einen von ihnen – denjenigen mit dem Messer – mit einem Handkantenschlag an der Kehle traf und ihm den Kehlkopf zertrümmerte. Als der Mann in die Arme seiner Kameraden zurücktaumelte, riss ihm Maks das Messer aus der Hand. Der Mann verdrehte die Augen und sank leblos zu Boden. Blind vor Wut stürzten sich die drei anderen auf Maks.
Sie schafften es beinahe, seine Verteidigung zu überwinden, doch Maks wehrte sich ruhig und effizient. Er drehte sich zur Seite, um ihnen eine möglichst kleine Angriffsfläche zu bieten, und setzte das Messer in kurzen schnellen Stößen ein. Er fügte den Angreifern viele kleine Wunden zu, die zwar nicht tief waren, aber trotzdem stark bluteten. Das war gewollt – Maks’ Antwort auf ihre Strategie, ihn zu ermüden. Müdigkeit war eine Sache, aber Blutverlust etwas ganz anderes.
Einer der Angreifer ging erneut auf ihn los, doch er rutschte auf seinem eigenen Blut aus, und Maks schlug ihn nieder. Dadurch öffnete er eine Lücke in seiner Deckung, und der Mann mit dem selbst gemachten Schlagring machte einen Satz nach vorn und knallte ihm das Metall gegen den Hals. Maks bekam für einen Moment keine Luft mehr. Seine Gegner begannen sofort wild auf ihn einzuprügeln und waren drauf und dran, ihn fertigzumachen, als ein Wärter aus der Dunkelheit auftauchte und sie mit einem Schlagstock zurückzutreiben begann.
Eine Schulter wurde unter der Wucht des Schlagstocks zertrümmert; einem anderen Mann wurde der Schädel eingeschlagen. Der dritte wollte fliehen, wurde aber mit voller Wucht im Rücken getroffen, so dass sein Rückgrat brach.
»Was haben Sie vor?«, fragte Maks den Wärter, während er versuchte, wieder zu Atem zu kommen. »Ich habe gedacht, diese Mistkerle hätten alle Wärter bestochen.«
»Haben sie auch«, erwiderte der Wärter und fasste Maks am Ellbogen. »Hier lang«, fügte er hinzu und wies ihm mit dem Schlagstock die Richtung.
Maks kniff argwöhnisch die Augen zusammen. »Da geht es aber nicht zu den Zellen.«
»Willst du raus oder nicht?«, entgegnete der Wärter.
Maks nickte, und die beiden Männer eilten über den verlassenen Gefängnishof. Der Wärter hielt sich dicht an der Mauer, und Maks folgte ihm. Er sah, dass der Mann vor ihm darauf achtete, außerhalb des Lichtkegels der beweglichen Scheinwerfer zu bleiben. Normalerweise hätte er sich gefragt, wer dieser Wärter war, aber dazu blieb ihm jetzt keine Zeit. Außerdem hatte er so etwas erwartet. Er wusste, dass sein Chef, das Oberhaupt der Kazanskaja, ihn nicht für den Rest seines Lebens hier in der Kolonie 13 verrotten lassen würde, und wenn er es nur deshalb tat, weil Maks ein zu wertvolles Werkzeug war, um es einfach ungenutzt zu lassen. Wer hätte den großen Borja Maks ersetzen sollen? Es gab nur einen, der vielleicht dazu imstande gewesen wäre: Leonid Arkadin. Aber Arkadin – wer immer er war; niemand, den Maks kannte, hatte ihn je gesehen – würde sich nicht von der Kazanskaja oder irgendeiner anderen Organisation anheuern lassen. Arkadin arbeitete unabhängig und suchte sich seine Aufträge selbst aus. Falls es ihn überhaupt gab, was Maks stark bezweifelte. Er hatte in seiner Kindheit jede Menge Geschichten von schwarzen Männern mit unglaublichen Fähigkeiten gehört – aus irgendeinem abartigen Grund bereitete es den Russen Vergnügen, ihren Kindern Angst zu machen. Aber Maks hatte schon damals nicht an schwarze Männer geglaubt und deshalb auch nie Angst gehabt. Und er hatte auch keinen Grund, vor einem Gespenst namens Leonid Arkadin Angst zu haben.
Der Wärter öffnete eine Tür etwa in der Mitte der Mauer. Sie schlüpften durch, als ein Scheinwerfer über die Stelle an der Steinmauer strich, an der sie wenige Augenblicke vorher noch gestanden hatten.
Sie bogen mehrmals ab und gelangten in einen Gang, der zu den Gemeinschaftsduschen führte, hinter denen, wie Maks wusste, einer der beiden Eingänge zum Flügel des Gefängnisses lag. Wie dieser Wärter sich vorstellte, an den Kontrollpunkten vorbeizukommen, war ihm ein Rätsel, aber Maks verschwendete keine Energie damit, an ihm zu zweifeln. Bisher hatte der Mann genau gewusst, was er tat – warum sollte es jetzt anders sein? Der Mann war offensichtlich ein absoluter Profi. Er hatte die Gefängnisanlage genau studiert und hatte zweifellos auch die richtigen Männner hinter sich. Anders war es nicht zu erklären, dass er hier hereingekommen war und ihn offenbar niemand an seinem Vorhaben hinderte. Das sah ganz nach Maks’ Chef aus.
Als sie sich auf dem Gang den Duschen näherten, fragte Maks: »Wer bist du?«
»Mein Name ist unwichtig«, antwortete der Wärter. »Das Einzige, was zählt, ist, wer mich geschickt hat.«
Maks nahm alles wahr, was in der unnatürlichen Stille passierte, die an diesem Abend im Gefängnis herrschte. Der Wärter sprach perfektes Russisch, doch für sein geübtes Auge sah er nicht wie ein Russe aus – und auch nicht wie ein Georgier, Tschetschene, Ukrainer oder Aserbaidschaner. Verglichen mit Maks war er eher klein, doch im Vergleich zu ihm war fast jeder klein. Sein Körper war kräftig und seine Bewegungen sparsam und präzise. Er besaß die außergewöhnliche Ruhe einer Energie, die stets im richtigen Maße eingesetzt wurde. Maks selbst war genauso, deshalb erkannte er diese Merkmale, die einem anderen vielleicht entgingen. Die Augen des Wärters waren blass, sein Gesicht konzentriert und nüchtern, wie das eines Chirurgen im Operationssaal. Sein dichtes helles Haar stand stachelig nach oben – eine Frisur, die Maks nur aus ausländischen Zeitschriften und Filmen kannte. Ja, wenn er es nicht besser gewusst hätte, wäre er der Ansicht gewesen, dass der Mann Amerikaner war. Aber das war nicht möglich. Maks’ Chef beschäftigte keine Amerikaner. Er benutzte sie nur für seine Zwecke.
»Dann hat dich also Maslow geschickt«, sagte Maks schließlich. Dimitri Maslow war der Kopf der Kazanskaja. »Ich hätte es sowieso nicht viel länger ausgehalten, das kann ich dir sagen. Fünfzehn Monate hier drin – das kommt einem vor wie fünfzehn Jahre.«
Als sie zu den Duschen kamen, wirbelte der Wärter plötzlich herum und hämmerte den Schlagstock gegen Maks’ Schläfe. Völlig überrascht taumelte Maks über den Betonboden des Duschraums, in dem es nach Schimmel und Desinfektionsmittel stank und nach Männern, die sich nicht um Körperpflege kümmerten.
Der Wärter prügelte weiter auf ihn ein und schwang den Schlagstock fast spielerisch, mit müheloser Leichtigkeit. Er traf Maks mehrmals am linken Oberarm, gerade hart genug, um ihn zu der Reihe von Duschköpfen zu treiben, die aus der feuchten Wand vorstanden. Doch Maks ließ sich nicht treiben, nicht von diesem Wärter oder von sonst jemandem. Als der Schlagstock wieder niederging, sprang er vor und wehrte ihn mit dem angespannten Unterarm ab.
Er stieß mit dem selbst gemachten Messer zu, das er in der linken Hand hielt. Als der Wärter es abwehren wollte, riss Maks es hoch, um die Unterseite des Handgelenks zu treffen und die Adern und Sehnen zu durchtrennen, so dass sein Gegner die Hand nicht mehr einsetzen konnte. Die Reflexe des Wärters waren jedoch genauso schnell wie seine eigenen, und so traf das Messer nicht das Handgelenk des Mannes, sondern nur seine Lederjacke. Doch die Klinge vermochte das Leder nicht zu durchdringen. Maks konnte gerade noch registrieren, dass die Jacke mit Kevlar oder einem anderen undurchdringlichen Material gefüttert sein musste, ehe die schwielige Handkante des Mannes ihm das Messer aus der Hand schlug.
Ein weiterer Schlag ließ ihn rückwärtstaumeln. Er stolperte über eines der Abflusslöcher, und der Wärter trat mit voller Wucht seitlich gegen Maks’ Knie. Mit einem hässlichen Knirschen gab Maks’ rechtes Bein unter ihm nach.
Als der Wärter auf ihn zukam, sagte er: »Es war nicht Dimitri Maslow, der mich geschickt hat, sondern Pjotr Zilber.«
Maks versuchte verzweifelt, den Schuh aus dem Abflussloch zu bekommen, in dem er steckte, obwohl er seinen Fuß nicht mehr spürte. »Ich weiß nicht, wovon du redest.«
Der Wärter packte ihn vorne am Hemd. »Du hast seinen Bruder umgelegt – Alexej. Ein Schuss in den Hinterkopf. Sie haben ihn mit dem Gesicht nach unten in der Moskwa gefunden.«
»Das war geschäftlich«, rechtfertigte sich Maks. »Rein geschäftlich.«
»Ja, verstehe, aber das hier ist persönlich«, erwiderte der Wärter und rammte Maks das Knie zwischen die Beine.
Maks krümmte sich. Als sich der Wärter bückte, um ihn hochzuziehen, richtete sich Maks blitzschnell auf und stieß mit dem Kopf gegen das Kinn des Mannes. Blut spritzte aus dem Mund des Wärters, als er sich auf die Zunge biss.
Maks nützte seinen Vorteil und versetzte dem Mann einen Fausthieb in die Seite, direkt oberhalb der Nieren. Der Wärter riss die Augen weit auf – das einzige Anzeichen, dass er Schmerz spürte – und trat gegen Maks’ kaputtes Knie. Maks ging zu Boden und blieb liegen. Er krümmte sich vor Schmerzen. Während er sich bemühte diese zu unterdrücken, trat der Mann erneut zu. Er spürte, wie seine Rippen nachgaben, und nahm den Gestank des Betonbodens unter seiner Wange wahr. Benommen lag er da, unfähig, wieder aufzustehen.
Der Wärter ging neben ihm in die Knie. Als Maks das schmerzverzerrte Gesicht des Mannes sah, verspürte er eine gewisse Genugtuung, doch das war der einzige Trost, der ihm beschieden war.
»Ich habe Geld«, stieß Maks schwach hervor. »Es ist an einem sicheren Ort vergraben, wo es niemand findet. Wenn du mich rausbringst, führe ich dich hin. Du kannst die Hälfte haben. Das sind über eine halbe Million amerikanische Dollar.«
Das Angebot machte den Wärter zornig. Er schlug Maks hart gegen das Ohr. Sein Kopf wurde von einem Schmerz durchzuckt, der für jeden anderen unerträglich gewesen wäre. »Glaubst du vielleicht, dass ich so wie du bin? Dass ich keine Loyalität kenne?« Er spuckte Maks ins Gesicht.
»Armer Maks, das war ein schwerer Fehler, diesen Jungen umzubringen. Leute wie Pjotr Zilber vergessen so etwas nie. Und sie setzen Himmel und Hölle in Bewegung, um zu erreichen, was sie wollen.«
»Gut«, flüsterte Maks, »du kannst alles haben. Über eine Million Dollar.«
»Pjotr Zilber will deinen Tod, Maks. Ich bin gekommen, um dir das zu sagen. Und um es zu tun.« Sein Gesichtsausdruck veränderte sich ganz leicht. »Aber vorher …«
Er zog Maks’ linken Arm zu sich und trat auf das Handgelenk, um den Arm auf dem rauen Betonboden zu fixieren. Dann zog er eine Baumschere hervor.
Das riss Maks aus seiner schmerzbedingten Benommenheit. »Was machst du da?«
Der Wärter packte Maks’ Daumen, auf dessen Rückseite ein Totenkopf tätowiert war, so wie der größere Schädel, den er auf der Brust trug. Es war ein Symbol für den hohen Rang, den Maks in seinem tödlichen Geschäft innehatte.
»Pjotr Zilber wollte nicht nur, dass du weißt, wer deinen Tod angeordnet hat, sondern er will auch einen Beweis für dein Ableben, Maks.«
Der Wärter setzte die Schere am unteren Ende des Daumens an und drückte zu. Maks stieß einen gurgelnden Laut hervor.
Fachmännisch wie ein Metzger wickelte der Mann den Daumen in Wachspapier ein, zog ein Gummiband darüber und steckte das Ganze in einen Plastikbeutel.
»Wer bist du?«, brachte Maks mühsam hervor.
»Mein Name ist Arkadin«, antwortete der Mann. Er öffnete sein Hemd und entblößte den Kerzenhalter, den er auf die Brust tätowiert hatte. »Oder in deinem Fall – der Tod.«
Mit einer eleganten Bewegung brach er Maks das Genick.
Strahlendes Sonnenlicht schien auf Campione d’Italia herab, eine kleine italienische Stadt außerhalb Italiens, im Schweizer Kanton Tessin. Dank seiner außerordentlichen Lage am Ostufer des Luganer Sees war es nicht nur ein malerischer Ort, sondern auch ein äußerst attraktiver Wohnsitz. So wie Monaco war Campione ein Steuerparadies für die Reichen, die prächtige Villen besaßen und sich die Zeit gern im hiesigen Kasino vertrieben. Geld und Wertsachen konnten in Schweizer Banken aufbewahrt werden, die zu Recht für ihre äußerste Diskretion bekannt waren und ihre Kunden davor bewahrten, dass die internationalen Polizeibehörden in ihren Angelegenheiten herumschnüffelten.
Es war dieser wenig bekannte idyllische Ort, den Pjotr Zilber für das erste Treffen mit Leonid Arkadin gewählt hatte. Er hatte den Auftragskiller aus Sicherheitsgründen über einen Mittelsmann kontaktiert. Schon sehr früh hatte Pjotr gelernt, dass man gar nicht genug auf Sicherheit bedacht sein konnte. Man trug eine schwere Verantwortung, wenn man in eine Familie hineingeboren wurde, die Geheimnisse barg.
Von seinem hohen Aussichtspunkt über der Via Totone genoss Pjotr einen atemberaubenden Panoramablick auf die rot-braunen Ziegeldächer der Chalets und Wohnhäuser, auf die mit Palmen gesäumten Plätze der Stadt, das himmelblaue Wasser des Sees und die Berge, die teilweise in Nebel gehüllt waren. In seinem grauen BMW sitzend, hörte er gelegentlich das ferne Brummen von Motorbooten. In Wahrheit war er mit seinen Gedanken schon bei der bevorstehenden Reise. Nachdem er in den Besitz des gestohlenen Dokuments gelangt war, hatte er es über sein Netzwerk an seinen Bestimmungsort geschickt.
Der Gedanke an die Anerkennung, die ihm vor allem von seinem Vater zuteil werden würde, hatte etwas Elektrisierendes. Er stand vor einem unvorstellbaren Triumph. Arkadin hatte ihn vom Moskauer Flughafen angerufen und ihm mitgeteilt, dass die Operation erfolgreich verlaufen war und er den körperlichen Beweis hatte, den Pjotr brauchte.
Mit der Rache an Maks war er ein großes Risiko eingegangen, aber der Mann hatte Pjotrs Bruder ermordet. Hätte er das einfach so hinnehmen und auf sich beruhen lassen sollen? Er kannte besser als jeder andere den strikten Grundsatz seines Vaters, stets im Verborgenen zu bleiben, doch er dachte sich, dass dieser eine Racheakt das Risiko wert war. Außerdem hatte er die Sache über Mittelsmänner abgewickelt, so wie sein Vater es auch getan hätte.
Er hörte das tiefe Brummen eines Automotors, und als er sich umdrehte, sah er einen dunkelblauen Mercedes die Straße zu dem Aussichtspunkt herauffahren.
Das einzige wirkliche Risiko in der ganzen Unternehmung ging er jetzt in diesem Augenblick ein, aber das ließ sich nun einmal nicht vermeiden. Wenn Leonid Arkadin imstande war, in die Gefängniskolonie 13 in Nischni Tagil einzudringen und Borja Maks zu töten, dann war er auch der richtige Mann für den nächsten Auftrag, den Pjotr zu vergeben hatte. Es ging um eine Sache, die sein Vater schon vor Jahren hätte erledigen sollen. Jetzt hatte er die Chance, das zu vollenden, was sein Vater nicht zu tun gewagt hatte. Dem Kühnen gehörte die Welt. Das Dokument, das er sich angeeignet hatte, war der eindeutige Beweis dafür, dass die Zeit der Zurückhaltung vorbei war.
Der Mercedes hielt neben seinem BMW, und ein Mann mit hellem Haar und noch helleren Augen stieg mit der Geschmeidigkeit eines Tigers aus dem Wagen. Er war nicht extrem kräftig gebaut, kein Muskelprotz wie so viele Angehörige irgendeiner russischen Mafia-Organisation – dennoch spürte Pjotr die stille Bedrohung, die von dem Mann ausging. Schon als Junge hatte Pjotr mit gefährlichen Leuten zu tun gehabt. Mit elf Jahren tötete er einen Mann, der seine Mutter bedrohte. Er hatte keinen Augenblick gezögert. Hätte er gezögert, so wäre seine Mutter an jenem Nachmittag auf dem Basar in Aserbaidschan von dem Killer ermordet worden, der mit dem Messer auf sie losging. Dieser Killer war, so wie einige andere im Laufe der Jahre, von Semjon Ikupow geschickt worden, dem unerbittlichen Feind seines Vaters, dem Mann, der in diesem Augenblick in seiner Villa in der Viale Marco Campione saß, kaum mehr als einen Kilometer von dem Platz entfernt, auf dem Pjotr und Leonid Arkadin gerade standen.
Die beiden Männer grüßten einander nicht und sprachen sich auch nicht mit dem Namen an. Arkadin holte den Metallkoffer, den Pjotr ihm geschickt hatte, aus dem Wagen. Pjotr griff nach dem identischen Koffer, den er in seinem BMW hatte. Sie stellten die beiden Koffer nebeneinander und öffneten die Verschlüsse. In Arkadins Koffer befand sich Maks’ abgetrennter Daumen, in Papier eingewickelt und in einem Plastikbeutel verschlossen. Pjotrs Koffer enthielt Diamanten im Wert von dreißigtausend Dollar, die einzige Währung, die Arkadin als Bezahlung akzeptierte.
Arkadin wartete geduldig. Während Pjotr den Daumen auspackte, blickte er auf den See hinaus. Von Maks’ Daumen ging bereits ein Geruch aus, der Pjotr Zilber nicht unbekannt war. Er hatte selbst den Tod von so manchem Angehörigen miterlebt. Er drehte sich zur Seite, so dass das Sonnenlicht auf die Tätowierung fiel, und zog ein kleines Vergrößerungsglas hervor, mit dem er das Kennzeichen begutachtete.
Nach einer Weile steckte er das Glas wieder ein. »War’s schwierig?«
Arkadin wandte sich ihm zu. Einen Moment lang sah er Pjotr mit hartem Blick in die Augen. »Nicht besonders.«
Pjotr nickte. Er warf den Daumen von dem Aussichtspunkt hinunter und schleuderte den leeren Koffer hinterher. Arkadin betrachtete das als Zeichen, dass ihr Geschäft abgeschlossen war, und griff nach dem Paket mit den Diamanten. Er öffnete die Verpackung, zog eine Juwelierlupe hervor, griff einen der Diamanten heraus und begutachtete ihn fachmännisch.
Als er zufrieden nickte, sagte Pjotr: »Was halten Sie davon, wenn Sie das Dreifache von dem verdienen könnten, was ich Ihnen für diesen Auftrag zahle?«
»Ich bin sehr beschäftigt«, erwiderte Arkadin vage.
Pjotr neigte respektvoll den Kopf. »Daran zweifle ich nicht.«
»Ich übernehme nur Aufträge, die mich interessieren.«
»Würde Sie Semjon Ikupow interessieren?«
Arkadin stand regungslos da, als zwei Sportwagen schnell vorbeifuhren. Durch das Dröhnen der Motoren sagte Arkadin: »Wie passend, dass wir hier zufällig in dem Städtchen sind, in dem Semjon Ikupow lebt.«
»Nicht wahr?«, antwortete Pjotr lächelnd. »Ich weiß ja, wie beschäftigt Sie sind.«
»Zweihunderttausend«, sagte Arkadin. »Die üblichen Bedingungen.«
Pjotr hatte Arkadins Forderung vorhergesehen und nickte zustimmend. »Bei unverzüglicher Ausführung.«
»Abgemacht.«
Pjotr öffnete den Kofferraum des BMW. Drinnen lagen zwei weitere Koffer. Aus einem nahm er Diamanten im Wert von hunderttausend Dollar und legte sie in den Koffer auf der Motorhaube des Mercedes. Aus dem anderen zog er einen Umschlag mit Unterlagen hervor, darunter eine Satellitenkarte, die den genauen Standort von Ikupows Villa anzeigte, außerdem eine Liste seiner Leibwächter und die Pläne der Villa, einschließlich der Stromkreise, der zusätzlichen Stromversorgung und verschiedener Details über die installierten Sicherheitsvorrichtungen. »Ikupow ist jetzt zu Hause«, sagte Pjotr. »Wie Sie hineinkommen, ist Ihre Sache.«
Arkadin blätterte die Unterlagen durch, stellte einige Fragen und legte sie schließlich in den Koffer mit den Diamanten. Er schloss den Koffer und warf ihn auf den Beifahrersitz seines Wagens.
»Morgen um diese Zeit wieder hier«, sagte Pjotr, während sich Arkadin hinter das Lenkrad setzte.
Der Motor des Mercedes begann zu schnurren. Dann legte Arkadin den Gang ein. Als er auf die Straße hinausrollte, drehte sich Pjotr um und ging zu seinem BMW. Er hörte Bremsen quietschen, ein Auto wurde herumgerissen, und als er sich umdrehte, sah er den Mercedes direkt auf sich zukommen. Einen Moment lang war er wie gelähmt. Was zum Teufel macht er denn?, fragte er sich. Viel zu spät begann er zu laufen. Der Mercedes war schon bei ihm und rammte ihn mit dem Frontgrill, so dass er zwischen den beiden Autos eingeklemmt wurde.
Benommen vor Schmerz sah er, wie Arkadin ausstieg und auf ihn zuging. Dann wurde es schwarz um ihn herum, und er sank in die Bewusstlosigkeit.
Er kam in einem holzgetäfelten Arbeitszimmer wieder zu sich, das großzügig mit Isfahan-Teppichen ausgelegt war. Ein Schreibtisch und Stuhl aus Walnussholz standen in seinem Blickfeld, dahinter war ein riesiges Fenster, von dem man auf das glitzernde Wasser des Luganer Sees und die teilweise verschleierten Berge blickte. Die Sonne stand tief im Westen und warf lange Schatten über das Wasser und die weißen Mauern von Campione d’Italia.
Er war an einen einfachen Holzsessel gefesselt, der so fehl am Platz wirkte an diesem Ort des Reichtums und der Macht wie er selbst. Er wollte tief durchatmen und zuckte zusammen vor Schmerz. Als er an sich hinunterblickte, sah er den Verband um seine Brust, und ihm war klar, dass mindestens eine Rippe gebrochen sein musste.
»Wenigstens sind Sie aus dem Reich der Toten zurückgekehrt. Ich habe mir schon ernste Sorgen gemacht.«
Es war schmerzhaft für Pjotr, den Kopf zu drehen. Jeder Muskel in seinem Körper fühlte sich an, als würde er brennen. Aber seine Neugier ließ sich nicht bezähmen, und so biss er die Zähne zusammen und drehte den Kopf noch ein Stück weiter, bis ein Mann in sein Blickfeld kam. Er war eher klein und hatte hängende Schultern. Seine großen wässrigen Augen blickten durch eine Brille mit runden Gläsern. Auf seinem gebräunten Schädel wuchs nicht ein einziges Haar, aber wie zum Ausgleich für seine Glatze waren die Augenbrauen erstaunlich buschig. Er sah aus wie einer dieser listigen türkischen Händler aus der Levante.
»Semjon Ikupow«, brachte Pjotr hervor. Er hustete. Sein Mund fühlte sich an, als wäre er mit Watte ausgestopft. Er hatte den metallischen Geschmack von Blut im Mund und schluckte schwer.
Ikupow hätte sich ein Stück bewegen können, damit Pjotr seinen Hals nicht so stark drehen hätte müssen, um ihn zu sehen, doch er tat es nicht. Stattdessen betrachtete er das schwere Druckpapier, das er auseinandergerollt hatte. »Wissen Sie, diese Pläne von meiner Villa sind so umfassend, dass ich daraus Dinge erfahre, die ich selbst nicht gewusst habe. Zum Beispiel, dass es unter dem eigentlichen Keller noch ein Kellergeschoss gibt.« Er fuhr mit seinem dicken Zeigefinger über den Plan. »Es wäre wahrscheinlich ziemlich aufwändig, da durchzubrechen, aber wer weiß, vielleicht lohnt es sich.«
Er hob abrupt den Kopf und sah Pjotr in die Augen. »Zum Beispiel wär’s der perfekte Ort für Ihr Gefängnis. Dann könnte ich absolut sicher sein, dass mein Nachbar Sie nicht schreien hört.« Er lächelte drohend. »Denn Sie werden schreien, Pjotr, das verspreche ich Ihnen.« Sein Kopf drehte sich zur Seite, und seine Augen suchten nach jemand anderem. »Stimmt’s, Leonid?«
Nun trat auch Arkadin in Pjotrs Blickfeld. Mit einer abrupten Bewegung packte er Pjotrs Kopf mit einer Hand und drückte mit der anderen seinen Kiefer zusammen, so dass Pjotr nicht anders konnte, als den Mund aufzumachen. Pjotr wusste, dass er nach einem falschen Zahn suchte, der mit Zyanid gefüllt war. Eine Todespille.
»Es sind alle seine eigenen«, meldete Arkadin und ließ Pjotr los.
»Ich bin neugierig«, sagte Ikupow. »Wie sind Sie bloß zu diesen Plänen gekommen?«
Pjotr wusste, worauf das Ganze hinauslief, doch er schwieg. Aber plötzlich begann er so heftig zu zittern, dass seine Zähne klapperten.
Ikupow gab Arkadin ein Zeichen, worauf der Killer Pjotrs Oberkörper in eine dicke Decke hüllte. Dann stellte Ikupow einen Stuhl vor Pjotr und setzte sich darauf.
Er sprach weiter, so als hätte er gar keine Antwort erwartet. »Ich muss zugeben, Sie haben sich wirklich einiges einfallen lassen. Aus dem schlauen Jungen ist also ein schlauer junger Mann geworden.« Ikupow zuckte die Achseln. »Das überrascht mich eigentlich nicht. Aber haben Sie wirklich geglaubt, Sie könnten mich täuschen, indem Sie immer wieder Ihren Namen ändern? Die Wahrheit ist, Sie haben angefangen, in einem Wespennest herumzustochern – da dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie gestochen werden. Wenn Sie wieder und wieder gestochen werden.«
Er beugte sich zu Pjotr vor. »Auch wenn Ihr Vater und ich uns noch so hassen – wir sind doch zusammen aufgewachsen. Es gab eine Zeit, da waren wir wie Brüder. Und aus Respekt vor ihm will ich Sie auch nicht anlügen, Pjotr. Ihr kühner Raub wird Ihnen nichts nützen – ja, Ihr Plan war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und wissen Sie, warum? Sie brauchen nicht zu antworten. Natürlich wissen Sie es. Ihre irdischen Gelüste waren Ihr Verderben, Pjotr. Das reizende Mädchen, mit dem Sie in den vergangenen sechs Monaten geschlafen haben, gehört mir. Ich weiß, Sie denken, das ist nicht möglich. Ich weiß, Sie haben sie auf Herz und Nieren überprüft, wie Sie es immer tun. Das habe ich vorhergesehen, und ich habe dafür gesorgt, dass Sie die richtigen Antworten von ihr bekommen.«
Pjotr starrte Ikupow an und merkte, dass seine Zähne wieder zu klappern begannen, egal, wie fest er sie zusammenbiss.
»Tee, bitte, Philippe«, sagte Ikupow zu jemandem, den Pjotr nicht sehen konnte. Wenige Augenblicke später stellte ein schlanker junger Mann ein silbernes englisches Teeservice auf den niedrigen Tisch neben Ikupow. Wie ein gutmütiger Onkel schenkte Ikupow Tee ein und gab etwas Zucker hinein. Er hob die Porzellantasse an Pjotrs bläuliche Lippen und sagte: »Trinken Sie, Pjotr. Es wird Ihnen guttun.«
Pjotr starrte ihn finster an, bis Ikupow schließlich sagte: »Oh, ich verstehe.« Er trank selbst davon, um Pjotr zu zeigen, dass es wirklich nur Tee war, dann bot er ihm die Tasse erneut an. Der Rand klapperte gegen Pjotrs Zähne, doch schließlich trank er, langsam zuerst, dann immer gieriger. Als die Tasse leer war, stellte Ikupow sie auf die dazugehörige Untertasse zurück. Pjotr hatte inzwischen aufgehört zu zittern.
»Fühlen Sie sich besser?«
»Ich werde mich besser fühlen«, antwortete Pjotr, »wenn ich hier herauskomme.«
»Nun, ich fürchte, das wird nicht so schnell passieren«, erwiderte Ikupow. »Wenn es überhaupt passiert. Vorher müssen Sie mir sagen, was ich wissen will.«
Er rückte seinen Stuhl ein bisschen näher heran; der gutmütige Gesichtsausdruck war nun wie weggewischt. »Sie haben etwas gestohlen, das mir gehört«, sagte er. »Ich will es wiederhaben.«
»Es hat Ihnen nie gehört. Sie haben es selbst gestohlen.«
Pjotrs Antwort kam mit einer solchen Bitterkeit, dass Ikupow sagte: »Sie hassen mich genauso sehr, wie Sie Ihren Vater lieben, das ist Ihr Hauptproblem, Pjotr. Sie haben noch nicht begriffen, dass Hass und Liebe so ziemlich das Gleiche sind – weil nämlich ein Mensch, der liebt, genauso leicht zu manipulieren ist wie ein Mensch, der hasst.«
Pjotr verzog den Mund, als hätten Ikupows Worte einen bitteren Geschmack darin hinterlassen. »Außerdem ist es sowieso zu spät. Das Dokument ist schon unterwegs.«
Ikupows Haltung veränderte sich augenblicklich. Alles in ihm spannte sich an, so dass sein kleiner Körper wie eine Waffe aussah, die jeden Moment losgehen konnte. »Wohin haben Sie es geschickt?«
Pjotr zuckte mit den Achseln, sagte aber nichts.
Ikupows Gesicht verdunkelte sich vor Zorn. »Glauben Sie wirklich, ich weiß nichts über die Informationskanäle, die Sie in den vergangenen drei Jahren eingerichtet haben? Auf diese Weise schicken Sie das Material, das Sie mir gestohlen haben, zu Ihrem Vater, wo immer er ist.«
Zum ersten Mal, seit er das Bewusstsein wiedererlangt hatte, lächelte Pjotr. »Wenn Sie irgendetwas Wichtiges über diese Kanäle wüssten, dann hätten Sie längst etwas dagegen unternommen.«
Pjotrs Antwort ließ Ikupow die Kontrolle über seine Emotionen wiedergewinnen.
»Ich habe dir ja gesagt, dass es sinnlos ist, mit ihm zu reden«, warf Arkadin von seinem Platz hinter Pjotrs Sessel ein.
»Trotzdem«, erwiderte Ikupow, »es gibt gewisse Spielregeln, die man einhalten muss. Ich bin ja kein Tier.«
Pjotr schnaubte verächtlich.
Ikupow sah seinen Gefangenen schweigend an. Er lehnte sich zurück, zog sorgsam sein Hosenbein hoch, schlug die Beine übereinander und verschränkte die Finger vor dem Bauch.
»Ich gebe Ihnen noch eine letzte Chance, dieses Gespräch fortzusetzen.«
Erst als das Schweigen sich unerträglich in die Länge zog, hob Ikupow seinen Blick zu Arkadin.
»Pjotr, warum tun Sie mir das an?«, sagte er schließlich in resignierendem Ton. Zu Arkadin gewandt, fügte er hinzu: »Fang an.«
Obwohl es überaus schmerzhaft war, versuchte Pjotr sich auf seinem Stuhl umzudrehen, doch er konnte trotzdem nicht sehen, was Arkadin tat. Er hörte das Klappern von irgendwelchen Gegenständen auf einem Metallwagen, der über den Teppich gerollt wurde.
Pjotr wandte sich wieder Ikupow zu. »Sie machen mir keine Angst.«
»Ich will Ihnen auch keine Angst machen, Pjotr«, erwiderte Ikupow. »Ich will Ihnen wehtun. Sehr, sehr wehtun.«
Mit einem schmerzhaften Zucken zog sich Pjotrs Welt zu einem winzigen Punkt zusammen, nicht größer als ein Stern am Nachthimmel. Er war innerhalb der Grenzen seines Bewusstseins eingesperrt, und trotz seines Trainings und seines ganzen Mutes gelang es ihm nicht, den Schmerz zu verdrängen. Er hatte eine Kapuze über dem Kopf, die am Hals fest zugezogen war. Die Enge der Kapuze verstärkte den Schmerz hundertfach, weil Pjotr bei all seiner Furchtlosigkeit an Klaustrophobie litt. Für jemanden, der enge Räume mied, der noch nie einen Fuß in eine Höhle gesetzt hatte und der sich auch nicht unter Wasser wagte, stellte eine solche Kapuze die schlimmste aller möglichen Welten dar. Seine Sinne verrieten ihm wohl, dass er sich gar nicht in einem engen Raum befand, doch sein Verstand wollte das einfach nicht akzeptieren und versetzte ihn in helle Panik. Die Schmerzen, die Arkadin ihm zufügte, waren schlimm genug – doch ihre Verstärkung durch diese Panik machte sie unerträglich. Pjotrs Verstand geriet außer Kontrolle. Er fühlte sich wie ein Wolf in der Falle, der sich in seiner Verzweiflung das eigene Bein abbeißen wollte. Doch sein Verstand war kein Glied, das sich abbeißen ließ.
Wie aus der Ferne hörte er, wie jemand ihm eine Frage stellte, deren Antwort er kannte. Er wollte nicht antworten, doch er wusste, dass er es tun würde, weil die Stimme ihm sagte, dass sie ihm dann die Kapuze abnehmen würden. Sein in die Enge getriebener Verstand wollte nur eines – dass die Kapuze wegkam. Er konnte nicht mehr unterscheiden zwischen Richtig und Falsch, zwischen Gut und Böse, zwischen Lüge und Wahrheit. Er kannte nur noch ein einziges Ziel – das nackte Überleben. Pjotr versuchte, seine Finger zu bewegen, aber der Mann, der ihn verhörte, drückte sie wahrscheinlich mit seiner Hand nieder.
Pjotr hielt es nicht länger aus. Er beantwortete die Frage.
Die Kapuze kam nicht herunter. Er schrie auf vor Empörung und Angst. Natürlich bleibt sie oben, dachte er in einem kurzen Moment der Klarheit. Hätten sie sie abgenommen, so hätte er keinen Anreiz gehabt, auch die nächste und die übernächste Frage zu beantworten.
Und er würde sie alle beantworten, alle – das wusste er mit erschreckender Sicherheit. Auch wenn etwas in ihm vermutete, dass die Kapuze vielleicht nie mehr herunterkam, würde sein in die Enge getriebener Verstand nach jedem Strohhalm greifen. Er hatte keine andere Wahl.
Aber jetzt, wo er seine Finger bewegen konnte, gab es einen anderen Ausweg. Bevor der Wahnsinn der Panik erneut von ihm Besitz ergriff, traf Pjotr seine Entscheidung. Es gab einen Weg, wie er alldem entkommen konnte, und mit einem stillen Gebet zu Allah ging er ihn.
Ikupow und Arkadin standen vor Pjotrs Leiche. Pjotrs Kopf lag auf der Seite. Seine Lippen waren blau verfärbt, und ein schwacher, aber deutlich erkennbarer Schaum trat aus seinem halb geöffneten Mund. Ikupow beugte sich hinunter und nahm den Geruch von Bittermandeln wahr.
»Ich wollte nicht, dass er stirbt, Leonid, das habe ich ganz klar gesagt«, sagte Ikupow verärgert. »Wie ist er an das Zyanid gekommen?«
»Sie haben sich offenbar etwas ganz Neues einfallen lassen«, antwortete Arkadin mit betretener Miene. »Er hatte einen falschen Fingernagel.«
»Er hätte geredet.«
»Natürlich hätte er geredet«, sagte Arkadin. »Er hat ja schon angefangen.«
»Und darum hat er beschlossen, den Mund für immer zu schließen.« Ikupow schüttelte frustriert den Kopf. »Das wird Folgen haben. Er hat gefährliche Freunde.«
»Ich finde sie«, versicherte Arkadin. »Und ich werde sie ausschalten.«
Ikupow schüttelte den Kopf. »Auch du kannst nicht rechtzeitig alle töten.«
»Ich kann mich an Mischa wenden.«
»Und damit alles aufs Spiel setzen? Nein. Ich weiß, wie du zu ihm stehst – er ist dein engster Freund, dein Mentor. Ich verstehe, dass du jetzt gern mit ihm sprechen würdest. Aber das geht nicht – nicht, bis das hier beendet ist und Mischa zurückkommt. Daran ist nicht zu rütteln.«
»Ich verstehe.«
Ikupow ging zum Fenster hinüber und sah in die Abenddämmerung hinaus. Er schwieg eine ganze Weile, während er nachdenklich die Landschaft betrachtete. »Wir müssen die Dinge beschleunigen, eine andere Möglichkeit gibt’s nicht. Und du fängst in Sewastopol an. Geh dem Namen nach, den du aus Pjotr rausgekriegt hast, bevor er Selbstmord beging.«
Er wandte sich Arkadin zu. »Es liegt jetzt alles an dir, Leonid. Dieser Anschlag wird seit drei Jahren vorbereitet. Er hat das Ziel, die amerikanische Wirtschaft lahmzulegen. Es bleiben uns höchstens zwei Wochen, bis der Plan Realität wird.« Er schritt geräuschlos über den Teppich. »Philippe wird dir Geld, Dokumente und Waffen geben, die die Metalldetektoren nicht registrieren. Finde diesen Mann in Sewastopol. Hol das Dokument zurück, und wenn du es hast, folgst du der Spur des Netzwerks und zerstörst es, damit es nie wieder benutzt werden kann, um unsere Pläne zu durchkreuzen.«
BUCH EINS
Kapitel eins
»Wer ist David Webb?«
Moira Trevor stand vor seinem Schreibtisch in der Georgetown University und stellte die Frage so ernst, dass Jason Bourne sich verpflichtet fühlte, sie zu beantworten.
»Seltsam«, sagte er, »das hat mich noch nie jemand gefragt. David Webb ist ein Linguist, er hat zwei Kinder, die glücklich bei ihren Großeltern« – Maries Eltern – »leben, auf einer Ranch in Kanada.«
Moira runzelte die Stirn. »Vermisst du sie denn nicht?«
»Ich vermisse sie ganz furchtbar«, antwortete Bourne, »aber es geht ihnen dort, wo sie sind, einfach viel besser. Was für ein Leben könnte ich ihnen denn schon bieten? Und dazu kommt die ständige Gefahr durch meine Bourne-Identität. Marie wurde entführt und bedroht, um mich zu erpressen. Diesen Fehler mache ich nicht noch einmal.«
»Aber du siehst sie doch sicher hin und wieder?«
»So oft ich kann, aber es ist schwierig. Ich darf es nicht zulassen, dass mir jemand zu ihnen folgt.«
»Das tut mir wirklich leid für dich«, sagte Moira aufrichtig und lächelte. »Ich muss sagen, es ist schon seltsam, dich hier in einer Universität an einem Schreibtisch zu sehen.« Sie lachte. »Soll ich dir eine Pfeife und ein Sakko mit Ellbogenpatches kaufen?«
Bourne lächelte. »Ich bin zufrieden hier, Moira.«
»Das freut mich für dich. Martins Tod war für uns beide nicht leicht zu verkraften. Mein Mittel gegen den Schmerz ist, dass ich mich in die Arbeit stürze. Deines ist offenbar hier, in einem neuen Leben.«
»Eigentlich ein altes Leben, genaugenommen.« Bourne sah sich in seinem Büro um. »Marie war am glücklichsten, wenn ich unterrichtet habe, wenn ich jeden Tag rechtzeitig nach Hause kam, um mit ihr und den Kindern zu Abend zu essen.«
»Und du?«, fragte Moira. »Warst du auch glücklich damit?«
Bournes Gesicht verdunkelte sich. »Ich war glücklich, wenn ich mit Marie zusammen war.« Er wandte sich ihr zu. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das zu irgendjemand anderem sagen könnte als zu dir.«
»Ein seltenes Kompliment von dir, Jason.«
»Sind meine Komplimente wirklich so selten?«
»So wie Martin bist du ein Meister darin, Geheimnisse zu bewahren«, antwortete sie. »Aber ich habe meine Zweifel, ob das besonders gesund ist.«
»Gesund ist es bestimmt nicht«, bestätigte Bourne. »Aber es ist das Leben, das wir uns ausgesucht haben.«
»Weil wir gerade davon sprechen«, sagte sie und setzte sich ihm gegenüber auf einen Stuhl. »Ich bin ein bisschen früher gekommen, als wir eigentlich zum Essen verabredet waren, weil ich noch über eine Sache mit dir sprechen wollte, die auch mit der Arbeit zu tun hat. Aber wenn ich sehe, wie zufrieden du hier bist, weiß ich nicht, ob ich weitersprechen soll.«
Bourne erinnerte sich an den Tag, als er sie zum ersten Mal gesehen hatte – eine schlanke, gut gebaute Gestalt im Nebel, mit ihrem dunklen Haar, das ihr Gesicht umrahmte. Sie stand an der Brüstung der ehemaligen Klosteranlage The Cloisters, von wo man auf den Hudson River hinunterblickte. Sie waren beide gekommen, um sich von ihrem gemeinsamen Freund Martin Lindros zu verabschieden, den Bourne mit aller Kraft zu retten versucht hatte, was ihm aber letztlich nicht gelang.
Heute war Moira mit einem Hosenanzug aus Wolle bekleidet, dazu trug sie eine Seidenbluse, die am Hals offen war. Ihr Gesicht war ausdrucksvoll, mit einer markanten Nase und intelligenten braunen Augen, und ihr Haar fiel in prächtigen Locken auf die Schultern. Sie strahlte eine ungewöhnliche Gelassenheit aus. Sie war eine Frau, die wusste, was sie wollte, und die sich von niemandem – egal ob Mann oder Frau – einschüchtern ließ.
Vielleicht war es das, was Bourne ganz besonders an ihr gefiel. Zumindest in diesem Punkt – wenn auch in keinem anderen – war sie wie Marie. Er wusste nicht, welcher Art ihre Beziehung zu Martin war, aber er vermutete, dass sie sich geliebt hatten, nachdem Martin ihm aufgetragen hatte, für den Fall, dass er unerwartet sterben sollte, Moira ein Dutzend rote Rosen zu schicken. Das hatte Bourne dann auch getan, mit einer Traurigkeit, die sogar ihn überraschte.
Wie sie auf ihrem Sessel saß, ein wohlgeformtes Bein über das andere geschlagen, sah sie wie ein Paradeexemplar einer europäischen Karrierefrau aus. Sie hatte ihm erzählt, dass sie halb französischer und halb englischer Abstammung war, aber sie hatte auch noch etwas von ihren entfernten venezianischen und türkischen Vorfahren im Blut. Sie war stolz auf das Feuer, das sie von ihren verschiedenen Ahnen geerbt hatte – das Ergebnis, wie sie meinte, von kriegerischen Auseinandersetzungen und leidenschaftlicher Liebe.
»Sprich weiter«, forderte er sie auf und beugte sich vor, die Ellbogen auf den Schreibtisch gestützt. »Ich möchte hören, was du mir zu sagen hast.«
Sie nickte. »Gut. Wie gesagt, NextGen Energy Solutions hat unser neues Flüssiggas-Terminal in Long Beach fertiggestellt. Unsere erste Lieferung soll in zwei Wochen kommen. Mir kam da so eine Idee, die mir jetzt selbst ziemlich verrückt vorkommt, aber ich sage es trotzdem. Ich hätte gerne, dass du dich um die Sicherheitsvorkehrungen kümmerst. Meine Chefs sind besorgt, dass das Verladeterminal eine äußerst verlockende Zielscheibe für irgendwelche Terrorgruppen darstellt, und ich sehe das auch so. Ehrlich gesagt, fällt mir niemand ein, der die Anlage sicherer machen könnte als du.«
»Ich fühle mich geschmeichelt, Moira. Aber ich habe Verpflichtungen hier. Wie du weißt, hat mich Professor Specter zum Leiter der Abteilung für komparative Linguistik ernannt. Ich will ihn nicht enttäuschen.«
»Ich mag Dominic Specter, Jason, wirklich. Er ist ja so etwas wie dein Mentor – genau gesagt, David Webbs Mentor, nicht wahr? Aber ich habe dich als Jason Bourne kennengelernt. Wer ist Jason Bournes Mentor?«
Bournes Gesicht verdüsterte sich, so wie zuvor, als sie von Marie gesprochen hatten. »Alex Conklin ist tot.«
»Wenn du mit mir zusammenarbeitest, könntest du ganz unbelastet an die Sache herangehen. Überleg es dir. Es ist eine Chance, dein altes Leben hinter dir zu lassen – sowohl das von David Webb als auch das von Jason Bourne. Ich fliege demnächst nach München, weil dort ein wichtiger Bestandteil des Terminals hergestellt wird. Ich brauche die Meinung eines Experten, wenn ich die technischen Details überprüfen soll.«
»Moira, es gibt eine Menge Experten, die das erledigen können.«
»Aber keinen, auf dessen Meinung ich so vertrauen würde wie auf die deine. Das ist eine wirklich wichtige Sache, Jason. Mehr als die Hälfte aller Güter, die per Schiff in die Vereinigten Staaten gelangen, kommen über Long Beach – deshalb müssen unsere Sicherheitsvorkehrungen dort wirklich ganz besonders gut sein. Die US-Regierung hat schon signalisiert, dass sie weder die Zeit noch die Absicht hat, den Handelsverkehr zu sichern, also müssen wir uns selbst darum kümmern. Die Gefahr ist in diesem Fall wirklich ernst und sehr real. Ich weiß, wie gut du darin bist, selbst die perfektesten Sicherheitssysteme zu umgehen. Du bist der ideale Kandidat, wenn es darum geht, ganz unkonventionelle Maßnahmen zu installieren.«
Bourne stand von seinem Platz auf. »Moira, hör zu. Marie war David Webbs größter Fan. Seit ihrem Tod habe ich mich weit von ihm entfernt. Aber er ist nicht tot, er lebt in mir weiter. Ich träume oft von seinem Leben, als würde es zu einem anderen gehören, und dann wache ich schweißgebadet auf. Ich fühle mich so, als wäre ein Teil von mir abgetrennt. So will ich mich nicht mehr fühlen. Es ist Zeit, David Webb das zu geben, was ihm zusteht.«
Veronica Harts Schritte waren unbekümmert und leicht, als sie einen Checkpoint nach dem anderen passierte, auf dem Weg in den Bunker, den der Westflügel des Weißen Hauses in Wahrheit darstellte. Der Job, den man ihr übertragen würde – Direktorin der Central Intelligence –, war eine schwierige Aufgabe, vor allem nach dem Desaster des vergangenen Jahres, als die CI von Terroristen infiltriert und der Direktor ermordet wurde. Trotzdem war sie in ihrem ganzen Leben noch nie glücklicher gewesen als jetzt. Sie hatte immer beharrlich auf ihre Ziele hingearbeitet; dass man ihr jetzt eine solche Verantwortung übertrug, war die größtmögliche Anerkennung und der Lohn für all die mühsame Arbeit, die Rückschläge und die Drohungen, die sie aufgrund ihres Geschlechts hatte einstecken müssen.
Und mit ihren sechsundvierzig Jahren war sie der jüngste Chef, den der Geheimdienst je hatte. Doch es war nichts Neues für sie, etwas als Jüngste zu erreichen. Mit ihrer außergewöhnlichen Intelligenz und ihrer Entschlossenheit hatte sie es geschafft, als Jüngste ihr Studium abzuschließen, als Jüngste zum Militärgeheimdienst berufen zu werden, danach ins Armeekommando, um schließlich einen höchst lukrativen Posten beim privaten Sicherheitsdienst Black River zu bekleiden, wo sie in Afghanistan und am Horn von Afrika im Einsatz war – und zwar in so geheimer Mission, dass nicht einmal die Leiter der sieben Hauptverwaltungen der CI genau wussten, wo und mit welchem Auftrag sie dort unterwegs war.
Und jetzt war sie nur noch wenige Schritte vom Gipfel entfernt, dem Höchsten, was man im Geheimdienstgeschäft erreichen konnte. Sie hatte erfolgreich alle Hürden gemeistert, war den Fallen ausgewichen und hatte gelernt, mit wem sie sich gutstellen musste und mit wem sie sich besser nicht einließ. Immer wieder waren Gerüchte aufgetaucht, in denen ihr unschickliches Verhalten und Affären nachgesagt wurden, und auch, dass ihre männlichen Untergebenen eigentlich die Kopfarbeit für sie erledigen würden. Es gelang ihr ausnahmslos, die Lügen zu entlarven und in manchen Fällen sogar diejenigen zu Fall zu bringen, die dahintersteckten.
Sie war längst jemand, mit dem man rechnen musste – eine Tatsache, die sie zu Recht genoss. Und so ging sie frohen Herzens zu dem Treffen mit dem Präsidenten. In ihrer Aktentasche hatte sie eine dicke Mappe mit detaillierten Plänen, in denen sie darlegte, wie sie die CI zu verändern gedachte, um das Chaos in den Griff zu bekommen, das durch Karim al-Jamil und die Ermordung ihres Vorgängers entstanden war. Die Stimmung innerhalb der CI war verständlicherweise auf dem Tiefpunkt, und natürlich waren die Leiter der einzelnen Abteilungen verärgert, weil jeder von ihnen der Meinung war, er hätte eigentlich zum Direktor der CI ernannt werden müssen.
Doch sie hatte bereits eine Reihe von Maßnahmen im Auge, wie sie innerhalb der Organisation für Ordnung sorgen und die allgemeine Arbeitsmoral wieder heben würde. Sie war absolut sicher, dass der Präsident nicht nur mit ihren Plänen hochzufrieden sein würde, sondern auch mit dem Tempo, mit dem sie sie umsetzen würde. Ein so wichtiger Geheimdienst wie die CI durfte nicht auf Dauer in Verzweiflung und Frustration versinken. Nur die »black ops«, die »schwarzen Operationen«, die Martin Lindros unter dem Namen Typhon zur Terrorbekämpfung ins Leben gerufen hatte, funktionierten so, wie sie sollten, und das verdankte sie der neuen Leiterin dieser Abteilung, Soraya Moore. Sorayas Amtsübernahme war völlig reibungslos verlaufen. Ihre Leute liebten sie und wären mit ihr durchs Feuer gegangen. Den Rest der CI würde sie selbst reparieren müssen, damit auch hier die alte Entschlossenheit zurückkehrte.
Sie war überrascht – ja, man konnte durchaus sagen, schockiert –, dass im Oval Office nicht nur der Präsident saß, sondern auch Luther LaValle, der Geheimdienstzar des Pentagons, und sein Stellvertreter, General Richard P. Kendall. Sie ignorierte die beiden und ging direkt über den exquisiten blauen Teppich auf den Präsidenten zu, um ihm die Hand zu schütteln. Sie war groß und schlank von Statur. Ihr blondes Haar war in einer modischen Frisur geschnitten, die ein klein wenig männlich wirkte und ihr ein sehr professionelles Aussehen verlieh. Bekleidet war sie mit einem mitternachtsblauen Hosenanzug, Pumps mit niedrigen Absätzen und kleinen goldenen Ohrringen, und dazu war sie äußerst dezent geschminkt. Ihre Fingernägel waren kurz geschnitten.
»Bitte, setzen Sie sich, Veronica«, forderte sie der Präsident auf. »Sie kennen Luther La Valle und General Kendall.«
»Ja.« Veronica nickte kurz. »Gentlemen, freut mich, Sie zu sehen.« Obwohl das genaue Gegenteil der Fall war.
Sie hasste La Valle. In vielerlei Hinsicht war er der gefährlichste Mann im amerikanischen Geheimdienstwesen, nicht zuletzt deshalb, weil er den enorm mächtigen E. R. »Bud« Halliday, den amerikanischen Verteidigungsminister, hinter sich hatte. La Valle war ein machthungriger Egoist, der der festen Überzeugung war, dass er und seine Leute im amerikanischen Geheimdienstwesen das Sagen haben sollten. Und es war seinen Absichten durchaus dienlich, wenn Krieg oder allgemeine Unsicherheit herrschte. Außerdem hegte Veronica den Verdacht, dass er hinter einigen der schmutzigeren Gerüchte steckte, die über sie in Umlauf gebracht wurden. Er genoss es, den Ruf anderer Leute zu ruinieren und ihre Köpfe rollen zu sehen.
Seit Afghanistan und dem Irak hatte La Valle immer mehr die Initiative ergriffen und einiges unternommen, um »das Schlachtfeld für die kommenden Truppen vorzubereiten«, wie man im Pentagon alle nicht näher definierten Aktivitäten nannte. Mit der Zeit dehnte er die Geheimdienstarbeit des Pentagons immer weiter aus und engte damit den Spielraum der CI bedenklich ein. Es war ein offenes Geheimnis innerhalb der amerikanischen Geheimdienstkreise, dass er es auf die Agenten der CI und ihre gut eingespielten internationalen Netzwerke abgesehen hatte. Jetzt, wo der »große Alte« und auch sein logischer Nachfolger tot waren, musste man durchaus damit rechnen, dass La Valle auf die aggressivste Weise versuchen würde, noch mehr Macht an sich zu reißen. Und genau aus diesem Grund ließ die Anwesenheit von La Valle und seinem Wachhund bei Veronica auch alle Alarmglocken läuten.
Vor dem Schreibtisch des Präsidenten standen drei Stühle; nachdem zwei bereits besetzt waren, blieb Veronica nur noch der freie Platz in der Mitte. Es war gewiss kein Zufall, dass sie sich links und rechts von ihr platzierten. Veronica lachte innerlich. Wenn die beiden dachten, dass sie sie damit einschüchtern konnten, so hatten sie sich schwer getäuscht. Doch als der Präsident zu sprechen begann, hoffte sie sehr, dass ihr das Lachen nicht schon bald vergehen würde.
Dominic Specter kam gerade um die Ecke geeilt, als Bourne die Tür zu seinem Büro absperrte. Die tiefen Falten auf seiner hohen Stirn verschwanden für einen Augenblick, als er Bourne sah.
»David, ich bin froh, dass ich Sie noch treffe, bevor Sie weg sind!«, sagte er begeistert. Dann wandte er sich Bournes Begleiterin zu. »Und das gilt natürlich auch für die großartige Moira«, fügte er mit seinem ganzen Charme hinzu. Ganz der vollendete Gentleman, verneigte er sich vor ihr.
Dann wandte er sich wieder Bourne zu. Er war ein klein gewachsener Mann, der trotz seiner über siebzig Jahre noch voller Energie steckte. Sein runder Kopf war von einem Haarkranz umgeben, der von einem Ohr zum anderen reichte. Seine Augen waren dunkel und neugierig, und seine Haut braun getönt. Mit seinem breiten Mund wirkte er ein bisschen wie ein Frosch, der drauf und dran war, von einem Seerosenblatt zum nächsten zu hüpfen. »Es gibt da eine wichtige Sache, zu der ich gern Ihre Meinung hören würde.« Er lächelte. »Ich sehe, dass Sie heute Abend keine Zeit dafür haben. Aber könnten wir’s vielleicht morgen beim Abendessen besprechen?«
Bourne erkannte etwas hinter Specters Lächeln, das ihn nachdenklich machte; irgendetwas machte seinem Mentor Sorgen. »Wir könnten uns auch zum Frühstück treffen«, schlug er vor.
»Macht Ihnen das keine zu großen Umstände, David?«, fragte Specter, ohne jedoch seine Erleichterung zu verbergen.
»Also, Frühstück passt sogar noch besser für mich«, log Bourne, um Specter entgegenzukommen. »Acht Uhr?«
»Wunderbar! Ich freu mich schon.« Er nickte Moira noch kurz zu und ging weiter.
»Der Mann ist eine Wucht«, meinte Moira. »Hätte ich nur Professoren wie ihn gehabt.«
Bourne sah sie an. »Deine Uni-Jahre müssen die Hölle gewesen sein.«
Sie lachte. »So schlimm war’s auch wieder nicht, aber ich hatte ja auch nur zwei Jahre, bevor ich nach Berlin abhaute.«
»Wenn du Professoren wie Dominic Specter gehabt hättest, wärst du wahrscheinlich nicht weggegangen.« Sie gingen um eine größere Ansammlung von Studenten herum, die den neuesten Klatsch austauschten oder sich über eine Vorlesung unterhielten.
Sie schritten den Gang entlang, zur Tür hinaus und die Stufen auf den Campus hinunter. Raschen Schrittes strebten sie auf das Restaurant zu, wo sie zusammen essen wollten. Studenten strömten an ihnen vorbei und eilten die Wege zwischen Bäumen und Rasenflächen entlang. Die Wolken am Himmel zogen vorbei wie schnelle Segelschiffe auf hoher See, und es wehte ein nasskalter Winterwind vom Potomac herein.
»Es gab eine Zeit, da steckte ich in einer tiefen Depression. Ich wusste es schon, wollte es aber nicht akzeptieren – du weißt ja, wie das ist. Professor Specter war derjenige, der auf mich zuging und den Schutzpanzer durchbrach, hinter dem ich mich versteckte. Ich weiß bis heute nicht, wie er das angestellt hat und warum er sich überhaupt die Mühe gemacht hat. Er sagte einmal, dass er etwas von sich selbst in mir gesehen hat. Nun, wie auch immer, er wollte mir jedenfalls helfen.«
Sie gingen an dem von Efeu überwucherten Gebäude vorbei, in dem Specter, der inzwischen Direktor der School of International Studies an der Georgetown University war, sein Büro hatte.
»Professor Specter hat mir den Job am Linguistik-Institut gegeben. Es war wie ein Rettungsring für einen Ertrinkenden. Was ich am meisten brauchte, was das Gefühl von Ordnung und Stabilität. Ich weiß wirklich nicht, was aus mir geworden wäre, wenn er nicht gewesen wäre. Er hat erkannt, dass es mich glücklich macht, mich in einer Sprache zu verlieren. Egal, wer ich sonst noch war oder bin – meine Sprachkenntnisse sind etwas Konstantes in meinem Leben. Sprachen zu lernen ist im Grunde auch ein Geschichtsstudium. Es spiegelt die ständigen Auseinandersetzungen zwischen Ethnien und Religionen wider. Aus einer Sprache kann man so viel lernen, weil sie von der Geschichte geformt wurde.«
Sie hatten inzwischen den Campus verlassen und gingen die 36th Street hinunter, auf das »1789« zu, ein Lieblingsrestaurant von Moira, das in einem alten Federal Town House untergebracht war. Als sie ankamen, wurden sie im ersten Stock zu einem Fenstertisch in einem gedämpft beleuchteten altmodischen Raum mit Kerzen auf den Tischen geführt, die mit feinstem Porzellan und funkelnden Stielgläsern gedeckt waren.
Bourne beugte sich über den Tisch und sagte mit leiser Stimme: »Hör zu, Moira, ich möchte dir etwas sagen, was nur wenige wissen. Die Bourne-Identität verfolgt mich immer noch. Marie hat sich immer Sorgen gemacht, dass all das, was ich als Jason Bourne tun musste, mich irgendwann gefühllos machen könnte – dass ich irgendwann nach Hause kommen könnte und David Webb für immer fort sein würde. Das darf ich nicht zulassen.«
»Jason, wir beide haben doch jetzt einige Zeit miteinander verbracht, seit wir uns von Martin verabschiedet haben. Ich habe nie irgendein Anzeichen dafür bemerkt, dass du etwas von deiner Menschlichkeit verloren hättest.«
Sie lehnten sich zurück und schwiegen, als der Kellner ihre Getränke auf den Tisch stellte und ihnen die Speisekarten reichte. Als er gegangen war, sagte Bourne: »Das beruhigt mich wirklich. In der kurzen Zeit, die ich dich jetzt kenne, habe ich deine Meinung schätzen gelernt. Jemanden wie dich habe ich noch nie getroffen.«
Moira nahm einen Schluck von ihrem Drink und stellte das Glas ab, ohne den Blick von ihm zu wenden. »Danke. Aus deinem Mund ist das ein beachtliches Kompliment, vor allem weil ich weiß, wie viel dir Marie bedeutet hat.«
Bourne starrte in sein Glas.
Moira streckte den Arm über das makellose weiße Leinentischtuch aus und nahm seine Hand. »Es tut mir leid. Jetzt bist du traurig, weil du an sie denkst.«
Er sah auf ihre Hand hinunter, zog die seine aber nicht zurück. Als er aufblickte, sagte er: »Ich habe mich in so vielen Dingen auf sie verlassen. Und jetzt stelle ich fest, dass mir diese Dinge immer mehr entgleiten.«
»Ist das etwas Gutes oder etwas Schlechtes?«
»Genau das ist es«, sagte er. »Ich weiß es nicht.«
Moira sah den Schmerz in seinem Gesicht und wurde augenblicklich von Mitgefühl ergriffen. Sie erinnerte sich noch gut daran, wie sie ihn in The Cloisters hatte stehen sehen. Er hielt die Bronzeurne mit Martins Asche so fest in der Hand, als wolle er sie nie mehr loslassen. Wenn Martin es ihr nicht schon gesagt hätte, dann hätte sie in diesem Augenblick gewusst, wie nahe sich die beiden gestanden hatten.
»Martin war dein Freund«, sagte sie schließlich. »Du hast dich in größte Gefahr begeben, um ihn zu retten. Das allein zeigt doch, wie viel Gefühl in dir steckt. Außerdem hast du ja vorhin selbst klar gesagt, dass du jetzt nicht Jason Bourne bist, sondern David Webb.«
Er lächelte. »Da hast du auch wieder recht.«
Ihre Miene verdunkelte sich. »Ich möchte dir eine Frage stellen, aber ich weiß nicht, ob ich das Recht dazu habe.«
Sein Lächeln verschwand, als er ihren ernsten Gesichtsausdruck sah. »Natürlich kannst du fragen, Moira. Worum geht’s?«
Sie holte tief Luft und atmete aus. »Jason, ich weiß, du hast gesagt, dass du sehr zufrieden an der Universität bist, und wenn das so ist, dann ist es in Ordnung. Aber ich weiß auch, dass du dir Vorwürfe machst, weil du Martin nicht retten konntest. Du musst aber verstehen – wenn du ihn nicht retten konntest, dann hätte es keiner gekonnt. Du hast dein Bestes getan; er wusste das auch, da bin ich mir sicher. Und jetzt frage ich mich einfach, ob du vielleicht denkst, dass du ihn im Stich gelassen hast – und dass du allein deshalb nicht mehr Jason Bourne sein kannst. Hast du dich schon einmal gefragt, ob du das Angebot von Professor Specter vielleicht nur deshalb angenommen hast, weil du dich von Jason Bournes Leben abwenden willst?«
»Natürlich habe ich mich das auch gefragt.« Nach Martins Tod hatte er tatsächlich wieder einmal beschlossen, Jason Bourne hinter sich zu lassen und wegzukommen von den Kämpfen, von all den Toten. Die Erinnerungen lagen immer auf der Lauer; die traurigen waren allgegenwärtig, doch da gab es noch andere, die stets verschwammen, wenn er sich ihnen näherte. Und was zurückblieb, waren die Gebeine all derer, die er getötet hatte oder die gestorben waren, weil er der war, der er war. Doch er wusste, dass die Bourne-Identität nie sterben würde, solange er atmete.
Er hatte einen gequälten Ausdruck in den Augen. »Du musst verstehen, wie schwer es ist, zwei Persönlichkeiten zu
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel The Bourne Sanction bei Grand Central Publishing, New York
Copyright © 2008 by Myn Pyn, LLC Copyright © 2010 der deutschen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH Published by arrangement with The Estate of Robert Ludlum and Eric van Lustbader c/o BAROR INTERNATIONAL, INC., Armonk, New York, U.S.A. Gesetzt aus der 11,9/14,5 Punkt Adobe Garamond Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
eISBN 978-3-641-09376-1
www.heyne.de
www.randomhouse.de
Leseprobe