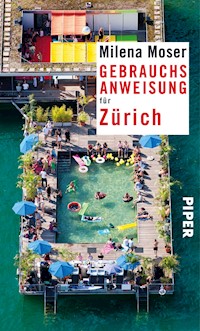Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RADIOROPA Hörbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Nach der Trennung von ihrem Ehemann findet Milena Moser: Nun erst recht! Und fährt – pünktlich zu ihrem 50. Geburtstag – nach Amerika. Auf einer Reise quer durch die USA will sie sich treiben lassen, endlich tanzen lernen, eine neue Liebe und das Glück finden. Das Tanzenlernen gelingt nur halb, aber in Santa Fe ist Moser tatsächlich am Ziel, weil sie ihr Herz gleich mehrfach verliert: an die unfassbar schöne Landschaft, an ein romantisches Häuschen, und an den Verkäufer Frederic. Sie zieht ein. Doch weder das Haus noch Frederic erwidern ihre Zuneigung. – Mit Charme und Humor meistert Milena Moser die Klippe der Lebensmitte und erzählt, wie sich das Glück tatsächlich finden lässt, auch wenn es anders aussieht als gedacht.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:6 Std. 49 min
Sprecher:Kornelia Lüdorff
Ähnliche
Nagel & Kimche E-Book
MILENA MOSER
Das Glück sieht immer
anders aus
Nagel & Kimche
© 2015 Nagel & Kimche
im Carl Hanser Verlag München
Herstellung: Andrea Mogwitz und Rainald Schwarz
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann
ISBN 978-3-312-00657-1
Umschlag: Hauptmann & Kompanie, Zürich
© plainpicture/Millennium/Simon Barber
und © Shutterstock
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Für Victor, der gar nicht vorkommt:
Love is the Answer.
Reiseleitung
Eigentlich hatte ich einen Roadtrip geplant. Seit Jahren redete ich davon. Zu meinem fünfzigsten Geburtstag würde ich drei Monate freinehmen und mit einem Mietwagen durch die Vereinigten Staaten von Amerika fahren, vollkommen allein, vollkommen plan- und ziellos, nur meiner inneren Stimme folgend, die sagen würde: Hier rechts abbiegen. Anhalten. Übernachten. Oder: Hier ist es öde – weiterfahren. Meiner inneren Stimme, die ich im Verlauf meiner langen, unglücklich beendeten Ehe verloren hatte.
On the road: Der klassische Übergangsritus für Generationen junger Männer vor und nach Jack Kerouac. Eine Auszeit auf der Straße nach dem Abschluss der Schulzeit, bevor der Ernst des Lebens beginnt. Ich würde ihn als alternde Frau antreten, zwischen Familienleben und … ja eben: und was? Um das herauszufinden, musste ich allein reisen, denn auch die rücksichtsvollste Reisegefährtin würde mich von meinem Konzept ablenken, meine innere Stimme übertönen, die statt zu entscheiden dann verwirrt fragen würde: «Hast du Hunger? Willst du hier anhalten? Gefällt dir dieses Motel? Oder sollen wir ein anderes suchen?» Ganz auf mich allein gestellt, auf mich zurückgeworfen, würde ich mich neu kennenlernen.
Es war eine Idee, die sofort jedem gefiel, dem ich sie erzählte. Das passierte mir zum ersten Mal. Für gewöhnlich weiß ich nicht, was ich schreibe, bis es vor mir steht. Doch nun hatte ich endlich einen Plan, den ich in dreißig Sekunden formulieren und verkaufen konnte! Ich ertappte mich dabei, wie ich bei jeder Gelegenheit darüber redete, nur weil es sich so gut anfühlte, einen Plan zu haben, eine Idee, die jeder auf Anhieb verstand und spannend fand. Aber vielleicht war es zu viel. Irgendwann fühlte es sich schal an. Und je näher der Zeitpunkt der Abreise rückte, desto weniger freute ich mich darauf.
Denn in den Jahren zwischen der Idee und ihrer Durchführung hatte ich mich aus meiner Ehe befreit, ich lebte allein, ich hörte meine innere Stimme klar und deutlich. Und sie sagte: «Das Letzte, was ich jetzt will, ist tagelang allein im Auto sitzen!»
Schlechtes Timing, könnte man sagen. Manch einer hätte die Sache wohl einfach durchgezogen. Ich nicht. Es so anzugehen hätte bedeutet, dass ich genau das ignoriere, worum es geht. Wichtiger als die gute Idee war die Frage, die ihr zugrunde lag: Was will ich wirklich? Ich?
Die radikalste aller Fragen für eine Frau mit Kindern. Ich erinnerte mich an eine Szene vor fast zwanzig Jahren. Wir waren mit Freunden in Ägypten, mit den Kindern, der Jüngere war noch sehr klein und hatte Durchfall. Wir überlegten, ob wir ein paar Tage früher als geplant nach Kairo zurückkehren sollten, wo uns eine andere Freundin erwartete. Ich weiß noch, wie ich auf dem Bett saß, mutlos, erschöpft, in Tränen.
«Was willst du machen?», fragte Randa. «Sag es mir, und ich mache es möglich!»
«Für Cyril wäre es besser … Ursula hat sich so gefreut … Meine Mutter will nicht … Aber Lino sagte gerade …»
Sie schüttelte den Kopf. Dann schüttelte sie mich: «Was willst DU?», fragte sie. «Du, nur du!» Verwirrt schaute ich sie an. «Nur mich» gab es nicht. Konnte es nicht geben. Und das war auch richtig so. Das Leben mit kleinen Kindern, mit Familie und im Berufsleben ist kompliziert genug, auch ohne dass die eigene Stimme immer dazwischenplärrt: «Und ich, und ich, und ich?» Aber irgendwann braucht man sie wieder, diese Stimme. Stellt sich heraus, sie ist verkümmert, wie ein Muskel, der zu lange untätig war. Doch in diesen schwierigen letzten Jahren hatte ich sie wieder ein bisschen trainiert. Manchmal sah ich sie förmlich am Barren baumeln und sich mühsam vorwärtshangeln, wie in der Physio nach einem schweren Unfall, schmerzhaft, schwerfällig, aber zuversichtlich.
Also setzte ich mich hin und versuchte sie zu hören.
Was fehlte mir?
Nicht viel. Das Glück.
Die Umstände der Trennung hatten mich zermürbt. Mein früher unerschütterlicher Glaube an die Liebe war brüchig. Und meine Umgebung trug nicht gerade dazu bei, ihn wiederherzustellen. «So sind die Typen halt», sagen Frauen in meinem Alter gern. «Was kannst du erwarten?»
Erwarten? Alles, oder? Doch die innere Romantikerin lag schwindsüchtig und blass auf der Chaiselongue, ein Spitzentaschentuch vor den Mund gepresst. Jede Trennung im Bekanntenkreis, jeder Blind-Date-Horror, von dem ich hörte, jeder verbitterte Spruch entzog ihr mehr Kraft.
Kurz vor meiner Abreise wusste ich, dass es nur eine Rettung für die Romantikerin in mir gab: Ich musste das Glück mit eigenen Augen sehen. Kurz entschlossen legte ich meine Reiseroute so, dass mir immer wieder mal ein glückliches Paar begegnen würde. Denn die gibt es tatsächlich. Aber sie sind unauffällig, weil ihr Glück für sie alltäglich ist. Sie reden nicht darüber.
Ansonsten würde ich mich treiben lassen. Musik hören und tanzen gehen und lauter Dinge tun, die ich schon viel zu lange nicht getan hatte. Drei Wochen vor Abflug merkte ich, dass ich einen Auftrittstermin falsch eingetragen hatte. Erneut entstand die Verlockung, die ganze Sache abzublasen. Abenteuer sind anstrengend. Warum bleibe ich nicht einfach hier? Bepflanze meine Terrasse, lerne die Stadt, in der ich seit zwei Jahren lebe, besser kennen, schließe neue Freundschaften? Bade in der Aare?
Doch ich wusste, dass ich diese weißen Flecken nicht erkunden konnte, wenn ich hierblieb. Immerhin entschloss ich mich, in der Mitte die Reise zu unterbrechen und für eine Woche oder zwei in die Schweiz zurückzufliegen. Meinen fünfzigsten Geburtstag würde ich in San Francisco feiern, wo ich acht Jahre lang gelebt habe. Und zwischendurch würde ich mit dem Auto durch die Gegend fahren. In Erwartung von etwas Unbekanntem.
Ich begann mich wieder zu freuen. Mehr noch, ich legte meine ganze Hoffnung in diese Reise. Alle meine Wünsche. Ich würde den Ballast der Vergangenheit abwerfen, ich würde mich befreien! Das Glück der anderen würde auf mich abfärben. Ich würde mich unterwegs verlieben! Schon sah ich mich mit einem Blumenkranz im Haar unter einem Zitronenbaum stehen, einen Mann – jetzt noch ohne Gesicht – heiraten, warum nicht? Vielleicht würde ich gar nicht mehr zurückkehren …
Meine Phantasie brannte mit mir durch, bevor ich überhaupt am Flughafen war. Deshalb zwei Dinge gleich vorweg: Es wird sich herausstellen, dass ich gar nicht gern Auto fahre, schon gar nicht allein.
Und: Das Glück sieht immer anders aus.
I DAS GLÜCK DER ANDEREN
Ausdruckstanz
Meine Reise beginnt in New York. Ein paar Tage verbringe ich dort, bevor ich mein erstes glückliches Paar besuche. Den Flughafen Zürich erreiche ich in letzter Minute und mit letzter Kraft. Am Gate schicke ich die letzte Kolumne ab, konzentriert über den Laptop gebeugt. Aus den Augenwinkeln registriere ich die Bewegungen der anderen Wartenden. Solange sie noch still dasitzen, denke ich, habe ich Zeit. Zeit, um zu arbeiten. Als schließlich alle aufstehen, schaue ich auf und merke, dass ich am falschen Gate sitze. Im letzten Moment erwische ich meinen Flug. Was für ein Anfang! So kann es nicht weitergehen, denke ich.
In den sieben Jahren seit unserer Rückkehr aus San Francisco habe ich mich ganz gegen meine Natur zum Workaholic entwickelt. Einmal im Jahr fliege ich für ein paar Wochen nach Amerika, immer, wie jetzt, auf den letzten Drücker, auf dem Zahnfleisch. Meine Arbeit nehme ich immer mit. Keine Kolumne fällt aus. Trotzdem erhole ich mich jeweils so weit, dass ich zurückfliegen und wieder von vorn anfangen kann. Als wir noch in Amerika lebten, hatte mein Alltag einen einfachen Rhythmus, bestimmt vom Stundenplan der Kinder. Wenn ich sie zur Schule gebracht hatte, lag der Tag vor mir. Zum Schreiben, eine Yogastunde Besuchen, Freundinnen Treffen. Einkaufen, kochen, putzen. Ein simples Leben, überschaubar. Alle ein bis zwei Jahre erschien ein neues Buch, dann flog ich für ein paar Wochen in die Schweiz und nach Deutschland für eine Lesereise. Dann zogen wir in die Schweiz, und alles wurde anders. Intellektuell verstand ich die Spirale, in die ich geraten war, nur zu gut. Aus der zunehmend unerträglichen Leere meiner Ehe flüchtete ich mich in die Arbeit. Gleichzeitig wurden die Aufträge immer spannender, immer verlockender. Wie konnte ich nein sagen? Je mehr mein Privatleben aus den Fugen geriet, desto mehr vergrub ich mich in meine Arbeit. Meine Arbeit wurde zu dem Bereich in meinem Leben, in dem ich mich noch sicher fühlte. Wenn ich schreibe, weiß ich, was ich tue. Wenn ich einen Kurs leite, weiß ich, dass ich etwas zu bieten habe, etwas weitergeben kann. Also arbeitete ich immer mehr, und erst recht nach der Trennung.
Wo einst das Familienleben für Ausgleich sorgte, sind Lücken entstanden, die ich sofort mit Arbeit füllte. Ich liebe meine Arbeit, ich wollte nie etwas anderes tun als schreiben. Aber auch davon kann man zu viel kriegen.
Im Flugzeug schreibe ich eine Liste von Dingen, die ich schon lange mal tun wollte. Ausgehen. Flirten. Im Park sitzen, die Zeitung lesen, Passanten beobachten. Kaffee trinken, mich mit Fremden unterhalten. Einfache Dinge. Alltägliche Dinge. Dinge, die ich vergessen habe. Verlernt vielleicht.
Ich bin müde. Aber ich kann mich nicht mehr entspannen, ich weiß mit meiner freien Zeit nichts mehr anzufangen. Was macht mir Spaß? Was würde ich gern tun? Also tue ich das, was ich kann: Ich schreibe es auf. Ich schreibe eine Liste.
Tanzen steht ganz oben. Ich würde so gerne tanzen, aber ich traue mich nicht. Schreckliche Erinnerungen an Tanzkurse in der Jugend. Mein Exmann war der Einzige, der sich je über meine absolute Unfähigkeit, mich führen zu lassen, hinwegsetzen konnte. In glücklichen Zeiten haben wir im Wohnzimmer getanzt, am Straßenrand, im Licht der Autoscheinwerfer. Das ist sehr lange her.
Ich bin, man kann es nicht anders sagen, ein furchtbares Gschtabi. Dieses Unwohlsein, dieses Nichtzuhausesein im eigenen Körper. Das muss sich doch auflösen lassen, denke ich. Eine Schreibschülerin erzählt mir von 5 rhythms, einer Art Ausdruckstanz, der in New York erfunden wurde. «Da bewegt sich jeder, wie er will! Keiner beachtet dich! Du gehst in der Masse auf, du tobst dich aus!»
Das ist es, denke ich. New York ist schließlich meine erste Station. Das kann kein Zufall sein. Das ist ein Zeichen!
Als ich in New York ankomme, regnet es in Strömen. Es regnet so stark, dass der Verkehr lahmliegt. Ich kann nichts draußen unternehmen. Nicht durch den Park spazieren, im Gras sitzen, durch die Straßen schlendern, die Passanten beobachten. So hab ich mir das nicht vorgestellt. Der dichte graue Wasservorhang zieht sich vor mein Gemüt. Ein Tag vergeht, ein zweiter. Ich sitze in der Wohnung meiner Freundin Gabriele, ich schaue aus dem Fenster, ich wühle in meinem kleinen Koffer. Schöne Sachen habe ich mitgenommen, einen engen mandarinfarbenen Rock, hochhackige Sandalen, mit silbernen Nieten beschlagene Stiefel, ein altmodisches Tanzkleid. Kleider zum Tanzen, zum Flirten, zum Glücklichsein.
Als ich in der Buchhändlerlehre war, kam der Schriftsteller Jürg Federspiel in der Berufsschule zu Besuch. Er trug einen roten Wollpullover. Damals war es etwas Besonderes, dass ein Schriftsteller vorbeikam, um zu uns zu sprechen. Und da ich schon wusste, dass ich das auch sein, dass ich Schriftstellerin sein wollte, setzte ich mich in die erste Reihe und notierte mir jedes Wort. Doch er redete gar nicht über das Schreiben. Er erzählte, dass ihn in New York ein Obdachloser angebrüllt habe, als meine er ihn persönlich: «Hey, you!», brüllte er. «Yes, you: Happiness is not the goal!» Glücklichsein ist nicht das Ziel. Und das von einem Amerikaner in Amerika, wo das Recht auf das Streben nach dem eigenen Glück in der Verfassung festgeschrieben ist. Vielleicht glaube ich deshalb immer wieder, ich könne das Glück dort «drüben» finden? Weil es dort mein Recht ist, oder sogar meine Pflicht? Oder weil ich den Erfahrungswert habe: Ich war glücklich dort?
Damals in der Buchhändlerlehre verstand ich nicht, was Federspiel uns sagen wollte: Ehrlich gesagt, verstehe ich es heute noch nicht. Wenn das Glück nicht das Ziel ist, was sonst könnte es sein?
Eine wilde Ungeduld erfüllt mich. Es soll jetzt losgehen! Der Regen soll aufhören, die Wolkendecke aufreißen. Die dunklen Zeiten sind vorbei. Ich will mich verlieben, ich will Abenteuer erleben, ich will lachen! Stattdessen sitze ich in der Wohnung und steigere mich in eine Verzweiflung hinein. Ich werde nie glücklich sein, ich habe es nicht verdient, es ist nicht vorgesehen! Mein ganzes Leben ist nicht vorgesehen, es dürfte mich gar nicht geben! Diese Verzweiflung ist meine verlässlichste Begleiterin, solange ich denken kann.
Ich sehe, wie in einem Film, meine junge Mutter auf einem schmalen Hotelbett sitzen. Das Zimmer ist schäbig, die gemusterte Tapete verblasst. Zwei schmale Betten, durch die Nachttische voneinander getrennt, hellgrüne Decken. In einem Bett schläft mein Vater. Er schnarcht. Meine Mutter sitzt mit gesenktem Kopf, den Rücken gekrümmt, die Hände zwischen den Beinen. Den Arzt, den sie früher in dieser Situation schon ein- oder zweimal aufgesucht hat, gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, wo dieses Bild herkommt. So genau hat sie mir das nie erzählt. Aber ich weiß noch genau, wie es war, damals in diesem Hotelzimmer. Ich war nicht mehr als eine Handvoll Zellen, ich erinnere mich an ihre Verzweiflung und an meine. Ich spüre sie heute noch. Muss ich wirklich? Muss ich wirklich geboren werden?
Meine Mutter sagt, es sei das Beste gewesen, was ihr passieren konnte. Dass ich zur Welt gekommen bin. Ich möchte es ihr so gern glauben. Aber es fühlt sich nicht so an. Es hat sich nie so angefühlt. Das Gefühl, ein Fehler zu sein, sitzt tief in mir, wie das Bedürfnis, diesen Fehler ungeschehen machen zu wollen. Aber ich tue es nicht. Ich kämpfe. Ich schreibe. Wenn ich schreibe, fühle ich mich sicher. Ich folge meinem Instinkt, einem untrüglichen Gefühl. Sobald ich den Kopf vom Schreibtisch hebe, ist es weg.
Gabriele arbeitet viel, wir sehen uns selten. Ich erzähle ihr von der Tanzstunde, zu der ich mich angemeldet habe, und sehe ihr an, dass sie skeptisch ist. «Kann man sich dazu zwingen, jemand anderes zu sein?», fragt sie.
«Warum jemand anderes? Vielleicht bin ich ja in Wirklichkeit jemand, der tanzt!» Und so fühle ich mich auch, als ich die lebhaften Straßen von Soho entlanggehe, bis ich die Tanzschule gefunden habe. Ich steige die Treppe hinauf, an einer offenen Tür vorbei, kleine Mädchen an der Stange, rosa Strümpfe, Trikots. Ich denke an Fame. Den Film habe ich mit achtzehn gesehen, zusammen mit einer Freundin. Wir waren beide in der Buchhändlerlehre, wir wollten aber beide nicht Buchhändlerin sein, sondern etwas anderes. Nur gestanden wir es uns und einander noch nicht ein. Nach der Vorstellung blieben wir sitzen und schauten uns den ganzen Film noch einmal an. Nachher saßen wir irgendwo draußen und rauchten und waren ganz sicher, dass wir es schaffen würden. Sie wollte Schauspielerin werden. Ich Schriftstellerin.
Ich wollte immer schon schreiben. Nicht tanzen.
Oder war es doch tanzen?
Ich bin etwas nervös, als ich das Studio betrete. Eine langhaarige Fee in einem bodenlagen Kleid umarmt mich und macht dann die Musik an. Zwischendurch gibt sie Anweisungen, die ich kaum verstehe, in einem hypnotisierenden Singsang. Egal. Es sind nur wenig Leute im Raum. Ich nehme mehr und mehr Platz ein. Ich spüre, wie die Anspannung der letzten Monate von meinen Füßen aufsteigt, durch meinen Körper hindurch bis hoch in die Schultern, in den Kopf. Ich krümme mich um meinen eigenen Körper. Um den Schmerz. Ich schüttle meinen Kopf, werfe meine Arme nach oben, ich schüttle alles ab. Ich tanze, bis ich Blasen an den Füßen habe. Nach zwei Stunden bin ich verschwitzt, erschöpft und – anders. Melde mich sofort für den kommenden Abend, meinen letzten, nochmals an. Sage das geplante Essen mit Gabriele dafür ab. Sie freut sich darüber, dass mir der Tanzkurs guttut.
Am nächsten Abend findet der Kurs in einem größeren Saal und mit viel mehr Leuten statt. Es ist heiß, die Musik laut, die Scheiben sind beschlagen. Plötzlich werden wir aufgefordert, einen Partner zu suchen: «Nehmt Blickkontakt auf, stimmt eure Bewegungen aufeinander ab!» Die nächsten zehn Minuten sollen wir nur mit dieser einen Person tanzen, ganz aufeinander eingehen. Ich wende mich nach rechts – da ist niemand mehr. Bewege mich in die Mitte des Raums, drehe mich um – niemand. Ich bin in der Masse untergegangen, ich habe mich aufgelöst, ich existiere nicht mehr. Fünfmal hintereinander werden wir dazu aufgefordert, fünfmal hintereinander bleibe ich allein. In einem Saal mit hundert Tänzern. Jedes Mal, wenn ich mich jemandem zuwende, egal ob Mann oder Frau, jung oder alt, weichen die Tänzer vor mir auseinander. Die Masse teilt sich wie das Rote Meer vor Moses, und ich stehe vor einer Lichtung. Vor dem Nichts. Beim ersten Mal denke ich noch, das sei Zufall. Beim zweiten Mal kriecht die vertraute Scham in mir hoch, und beim dritten Mal will ich aus dem Fenster springen.
Ich erinnere mich an meine allererste Party, die wir «Fez» nannten. Ich war in der fünften Klasse. Meine Mutter kaufte mir extra einen langen Rock und föhnte mir die Haare. Wir waren elf Mädchen und zehn Buben in meiner Klasse. Es kam so weit, dass zwei Buben sich prügelten, damit sie nicht mit mir tanzen mussten. Ich saß den ganzen Abend auf einem Stuhl und erzählte Witze. Als ich nach Hause kam, hatte meine Mutter auf mich gewartet. Ich erzählte ihr, es sei super gewesen. Weil ich mich schämte. Weil ich sie nicht enttäuschen wollte.
Als die tanzende Masse zum vierten Mal vor mir zurückweicht, verlasse ich den Raum. Die ersten Paare wälzen sich bereits auf dem Boden. «Eine gefahrlose Art, Körperkontakt herzustellen», hat meine Schülerin es genannt. «Sich ausprobieren in einem geschützten Raum …» Das ist doch genau das, was ich jetzt brauche! Warum bekomme ich es dann nicht? Als ich in meine Stiefel schlüpfe, meine «lucky boots», habe ich Tränen in den Augen. Auf dem Weg zur U-Bahn fühle ich mich, als sei ich in einer Kapsel gefangen, in einer Blase inmitten eines leeren Raums. Ich bin getrennt von den anderen, die draußen sitzen und lachen und essen und reden und sich küssen. Ich könnte mich zu ihnen setzen. Allein zu essen hat mich noch nie gestört, schon gar nicht auf Reisen. Doch ich habe es zu oft getan. Ich gehe an den Lokalen vorbei, blind für alle Möglichkeiten. Irgendwo kaufe ich mir ein Sandwich, ich achte nicht einmal auf die Füllung, und fahre nach Hause. Und dann, in der U-Bahn, irgendwo unter dieser großen Stadt, lichtet sich meine Verzweiflung plötzlich. Die Wolkendecke reißt auf, ohne Vorwarnung. Ich sehe wieder die sich am Boden wälzenden Paare vor mir und muss plötzlich lachen. Es ist nichts falsch an mir, denke ich, ganz im Gegenteil. Irgendetwas in mir schützt mich vor den gröbsten Fehlern, die ich machen könnte. Vor dem größten Bullshit. Irgendetwas in mir ist gesund und stark: mein Instinkt. Ich kann nicht erwarten, mit Gabriele darüber zu reden, doch als ich nach Hause komme, schläft sie schon. Ich esse mein Sandwich im Dunkeln, ich trinke ein Glas Wein und denke: Ich bin immer noch da.
Das Ruderboot: ein Traum
Gabriele und ich sitzen in einem alten Ruderboot aus Holz. Das Holz ist verwittert, Wasser dringt durch die Planken, wir rudern und rudern und kommen nicht vom Fleck. Weit draußen ein großes Frachtschiff, beladen mit bunten Containern. Es scheint sich nicht zu bewegen. Wir rudern darauf zu, doch wir kommen ihm nicht näher. Verzweiflung erfüllt uns, dringt durch die Ritzen und Löcher wie das schmutzige Wasser der Bucht. Gabriele will aufgeben. Aber aufgeben geht nicht: denn jetzt sehe ich die dreieckige Flosse eines Haifischs näher kommen. Nackte Panik ergreift mich. Der Hai umkreist das Boot, taucht darunter hindurch. Er kommt uns so nahe, dass ich seinen massigen grauen Körper sehen kann. Er reißt das Maul auf: Jaws. Todesangst. Ein zweiter Hai taucht auf, ein dritter. Graue Flossen umkreisen uns.
Wir weinen vor Angst, wir wissen, dass wir sterben werden, fast wünschen wir uns, es wäre schon vorbei. Und immer noch rudern wir. Wir rudern und rudern. Und dann, in einem dieser Zeitsprünge, die nur im Traum möglich sind, haben wir den Frachter erreicht. Eine Strickleiter baumelt vom Deck herab. Wir retten uns im letzten Moment. Unter uns zerfällt das Ruderboot und versinkt. Wir hängen an der Strickleiter über den aufgerissenen Mäulern der nach uns schnappenden Haie. Sie erreichen uns nicht mehr. Wir klettern die Strickleiter hinauf und kommen an den meterhohen Buchstaben vorbei, die den Namen des Schiffes anzeigen. Es heißt HEIMAT.
Ich lache noch, als ich aufwache. Für mich musste die Traumdeutung nicht extra erfunden werden.
Das Eheversprechen: Daphne und Paul
Am nächsten Tag ziehe ich in den Norden weiter, nach Maine, wo Daphne und Paul ein mexikanisches Restaurant führen. Daphne war meine erste richtige Freundin in San Francisco. Auszuwandern war von uns damals eher spontan entschieden worden, wir wollten weg, vielleicht für ein Jahr. Es wurden acht. Nur ein einziges Mal kamen mir Zweifel an unserer Aktion, zu Beginn, als wir erst wenige Wochen dort waren.
Mit dem damals dreijährigen Cyril hatte ich bereits an zwei «play dates» teilgenommen. Aus Zürich war ich es gewohnt, dass die Kinder zusammen spielten, während die Mütter in der Küche Kaffee tranken, Zigaretten rauchten, redeten. Hier aber saßen die Mütter, manchmal unterstützt von den Vätern, die sich extra dafür freigenommen hatten, zusammen mit den Kindern auf dem Boden des Wohnzimmers, inmitten von Bergen von Spielsachen, und kommentierten jede Zuckung: «Samantha, willst du mit dem Auto spielen? Willst du Cyril das Auto zeigen? Cyril, schau, Samantha zeigt dir das Auto. Tolles Auto!! Gut gemacht, Samantha. Das macht Spaß! Nicht wahr Cyril, das macht dir Spaß?»
Keine der anderen Mütter, die ich im Kindergarten und auf dem Spielplatz kennenlernte, teilte mein Bedürfnis nach kinderfreier Zeit, nach einem Gespräch unter Erwachsenen. Verständnislos starrten sie mich an, wenn ich fragte, ob wir uns nicht mal ohne Familie treffen wollten. «Warum denn das?» Ich musste länger in Amerika leben, um zu verstehen, was Familie bedeutet, und was Freundschaft. Das war der erste Moment, in dem mir der Abstand bewusst wurde, der unsere Kultur von der amerikanischen trennt, die uns auf den ersten Blick so vertraut ist wie die eigene.
Deshalb hatte ich Daphnes Einladung ohne Begeisterung angenommen. Außerdem war ihre Tochter Lucy ein Jahr älter als Cyril und – eben – ein Mädchen. Höchstens eine halbe Stunde, dachte ich, als ich an der Tür klingelte. Daphne öffnete die Tür, eine Flasche Wein und einen Korkenzieher in der Hand: «Ist es noch zu früh für ein Glas Wein?»
«O Gott! Nein!» Vor Erleichterung wäre ich beinahe in Tränen ausgebrochen. Wir blieben den ganzen Nachmittag und dann gleich zum Abendessen, obwohl die Kinder tatsächlich nicht viel miteinander anfangen konnten. Aber sie spielten friedlich nebeneinander her, während Daphne und ich auf dem Balkon saßen und dem dicken Nebel zuprosteten, der träge über die Hügel rollte wie eine schwebende Lawine.
Irgendwann fing sie an zu kochen, wie ich es noch bei keiner Amerikanerin gesehen hatte, sorgfältig und doch selbstverständlich. Ich glaube, sie machte Pesto. Dann kam ihr Mann nach Hause, Paul. Von Beruf Flachmaler, mit offenbar britischem Akzent, ein unauffälliger Mann, aber sofort im Mittelpunkt. Die Mädchen sprangen um ihn herum, Lucy führte neue Tanzschritte vor, ihre ältere Schwester Kate zeigte ihm ein Bild, das sie gemalt hatte. Daphne nannte ihn «Babe».
«Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?», fragte ich.
Sie tauschten diesen Blick, den ich später noch so oft sehen sollte. «Erzähl du das», sagte Daphne und wandte sich wieder ihrem Pesto zu.
Paul ist einer der genialsten Geschichtenerzähler, die ich kenne, und das sind viele. Paul und Daphne haben sich in New York kennengelernt, damals vor zehn, unterdessen vor fünfundzwanzig Jahren. Er war «frisch vom Boot», aus Nordirland abgehauen unter Umständen, über die die wildesten Gerüchte kursierten. Irgendwo zwischen Flucht vor der IRA und Liebeskummer lag vermutlich die Wahrheit. Paul spielte in einer Band, und während er auf seinen Durchbruch wartete, wischte er in einem Restaurant die Tische ab und machte einer bildschönen Kellnerin den Hof, die ihn täglich zurückwies. Daphne hatte, wie so viele Frauen, eine Schwäche für «bad boys», für Männer, die sie zum Weinen brachten. Wie an jenem Tag, an dem Paul sie mit verheulten Augen erwischte.
«Geh doch heute Abend mit mir aus», sagte er mit dem Mut eines Verzweifelten. «Geh heute Abend mit mir aus und mach diesen Tag für uns beide zu einem besseren Tag!» Es war keine Frage, denn gefragt hatte er sie schon oft. Doch dieser Tag konnte wirklich nur noch besser werden, also zuckte sie mit den Schultern und sagte ja. Oder eher: von mir aus.
Er wartete auf sie, bis ihre Schicht zu Ende war. Sie gingen hierhin und dorthin, und dann ging er mit zu ihr nach Hause. Und da ist er heute noch.
Drei Wochen nach dieser ersten Nacht war sie schwanger. Sie haben zwei Töchter großgezogen, sind Hand in Hand über den roten Teppich geschritten, als seine Band für einen Grammy nominiert war. Sie haben ein gutgehendes Frühstücksrestaurant geführt, das sie nach ihrer ältesten Tochter benannten und das in Reiseführern als «das Beste, was der Haight Ashbury District seit dem Summer of Love hervorgebracht hat!» angepriesen wurde. In Kate’s Kitchen hat Piper Kerman, die Autorin des Kultbestsellers Orange is the new Black, ihren Mann kennengelernt. Stand jedenfalls neulich in der Zeitung.
Damals, als ich sie in San Francisco kennenlernte, war der Ruhm verflogen, das Geld knapp geworden. Als Paul das Haus, in dem ich wohnte, in Himbeersorbetrot anstrich, rief sie jeden Tag an, immer gegen Mittag. Nach dem dritten Tag hatte ich kapiert, dass sie nicht mit mir reden wollte, sondern mit ihm.
«Ich fahr mal kurz nach Hause», sagte er dann. Wenn er ein paar Stunden später zurückkam, sang er bei der Arbeit einen seiner alten Songs.
«Paul ist ein Glückspilz», sagte sein Lehrling, auch ein Ire, mit Sehnsucht in der Stimme.
Dann reichte das Geld nicht mehr. Daphne und Paul mussten sich einen billigeren Ort zum Wohnen suchen. Sie packten alles ins Auto und fuhren los. Quer durch das ganze große Land, bis an die Ostküste. Zu einem Bruder, der ein Baugeschäft führte. Doch der hatte, anders als versprochen, dann doch keinen Job für Paul. Da saßen sie nun, zu viert in einer schäbigen Mietwohnung, in einem Flecken, in dem sie niemanden kannten und in dem es keine Arbeit gab. Die Kinder hatten sie schon voreilig eingeschult, sie steckten fest. Der Ostküstenwinter war endlos, dunkel und bitterkalt.
Ich erinnere mich an die Telefongespräche, die wir damals führten, an Daphnes Tapferkeit. War die größte Entscheidung ihres Lebens eine Fehlentscheidung gewesen? Nein. Die größte Entscheidung ihres Lebens war es, mit Paul auszugehen. Und sie waren immer noch zusammen. Sie stolperten vielleicht über die Fallen, die ihnen das Leben stellte, aber nie übereinander. Nach acht langen Monaten meldete sich Daphnes Zwillingsschwester Eloise, eine begabte Köchin, mit der zusammen sie damals das Frühstücksrestaurant Kate’s Kitchen in San Francisco geführt hatten. Sie hatte ein vollkommen verfallenes Restaurant in Maine gekauft, zwei Bundesstaaten weiter die Küste hinauf, und fragte, ob sie wieder dabei wären.
Jetzt sitze ich in ihrem kleinen Haus in Brunswick, Maine, gleich neben dem Restaurant El Camino, dem einzigen Mexikaner im ganzen Bundesstaat. Es läuft gut, die Küche wurde bereits in einigen Magazinen erwähnt. Daphne hat den Vormittag mit Einkaufen und Vorbereiten verbracht, ihre Schwester wird kochen, Paul die Gäste empfangen – aber nicht heute, heute ist das Restaurant geschlossen, Daphne kocht. Sie macht frischen Pesto, wie damals, als ich zum ersten Mal bei ihr war.
«Weißt du noch?», frage ich.
«O Gott, ja!» Sie lacht. «Weißt du noch, wie meine Mutter anrief? ‹Daphne, was kochst du? Ah … Nudeln mit Pesto, in Ordnung … aber den Pesto machst du selber? Und den Basilikum hast du auch selber gezogen? Gut, aber was ist mit dem Olivenöl, hast du das selber gepresst?›»
Wir lachen. In den Augen ihrer Mutter, einer verhinderten Künstlerin, ist Daphne das schwarze Schaf der Familie. Weil sie nicht «kreativ» ist, nicht malt, ihre Möbel und Kleider nicht selber herstellt und sich nicht schminkt. Weil sie nie mehr wollte als ein glückliches Familienleben, ein offenes Haus, einen Tisch, an dem viele Menschen sitzen.
Eines Abends lümmeln wir uns auf dem Sofa, und ich erzähle von meiner unerfreulichen Scheidung. «Hab ich dir je von meiner ersten Scheidung erzählt?», fragt Paul. Ich grinse. «Meine erste Scheidung.» Der perfekte Titel des geborenen Geschichtenerzählers. Dabei war seine erste Scheidung auch seine einzige. Ich kenne die Geschichte. Sie endet damit, dass die geldgierige Exfrau sich schließlich mit einem Paar echter amerikanischer Levi’s-Jeans zufriedengab. «Noch schlimmer war aber die Scheidung meiner Mutter», fährt Paul fort. «Mein Vater war mit dem Geld einer Nonne nach Amerika gefahren, um sein Glück zu machen. Wir sollten nachkommen. ‹Gebt mir drei Monate›, sagte er, ‹um etwas aufzubauen, ein halbes Jahr höchstens.› Doch dann haben wir kein Wort mehr von ihm gehört. Bis er, nach vier langen Jahren, endlich meiner Mutter schrieb, er wolle über alles reden, ob sie ihm verzeihen könne, sie solle nach New York kommen. Meine Mutter überlegte hin und her, hatte schlaflose Nächte. Was sollte sie tun, und woher das Geld für ein Ticket nehmen? Doch sie liebte den Mann noch. Die Nachbarn sammelten für die Reise. Endlich stieg sie ins Flugzeug. Doch als er sie in New York abholte, sagte mein Vater: ‹Surprise! Wir fliegen weiter nach Reno, da kann man sich billig scheiden lassen.›»
«Oh, aber dann lernte sie doch diesen Autorennfahrer kennen, erzähl das!», bettelt Daphne. «Du weißt schon, der mit den Ponys!» Dieser Liebhaber hatte Pauls Mutter versprochen, sie zu heiraten. Er würde ein Haus für sie und ihre vier Kinder bauen, und einen Stall, in dem vier Ponys stehen würden. Eins für jedes Kind. Paul und seine Geschwister hatten den Ponys schon Namen gegeben. Alles würde endlich gut werden. Pauls Mutter, Pat, kündigte die Wohnung und ihren Job. Zur vereinbarten Zeit standen sie mit ihren Koffern am Straßenrand und warteten auf den Rennfahrer. Der aber nie kam. Es stellte sich heraus, dass er das Haus wohl gebaut hatte, und den Stall auch, ja sogar die Ponys gekauft. Nur leider für eine andere Frau und andere Kinder.
Doch Pat gab nicht auf. Unbeirrt stürzte sie sich ins nächste Abenteuer. Jahre später tanzte sie bei den Roly Polys, den «Pummelchen», einer Truppe nicht mehr junger und nicht stromlinienförmiger Showgirls, die unter anderem in Las Vegas auftraten.
Am Kühlschrank hängt die Einladung zu einer Hochzeit. Sie zeigt den Schnappschuss eines windzerzausten, verliebten Paars im mittleren Alter. «Wer ist das?», frage ich und nehme das Bild in die Hand.
«Das ist Jenny, eine unserer Kellnerinnen … Sie lebte eine Zeitlang in der Wohnung unter uns. Und Dave war einer unserer Stammgäste.» Als er das erste Mal das El Camino betrat, war Dave noch in Begleitung seiner ersten Frau. Die Ehe war schwierig. «Sie stritten sich oft im Lokal», erinnert sich Paul. Er behauptet auch, genau gemerkt zu haben, wann Dave sich in die Kellnerin verliebte. Aber es dauerte noch achtzehn Monate, bis er seine Ehe beendet hatte und geschieden war. Erst dann sprach er Jenny zum ersten Mal an.
Mir fällt der Kiefer herab. Das gibt es also auch? Das muss ich meinen verbitterten Freundinnen erzählen! Von wegen – alle Männer lügen, alle gehen fremd! Jenny ließ sich auch gar nicht so schnell überzeugen. Es dauerte mindestens noch einmal drei Monate, bis sie sich auf eine erste Verabredung einließ. Dann allerdings ging alles ganz schnell.
«Ich weiß noch, wie ich mal unten bei ihr in der Wohnung saß und mich umschaute. Alles war vollgestopft mit Möbeln, Gegenständen, Erinnerungen. ‹Jenny›, sagte ich zu ihr, ‹wie soll hier ein Mann Platz haben?› Und dann räumte sie ihre Wohnung aus, und dann …»
Ist mein Leben zu voll?, frage ich mich. In Lucys Zimmer, in dem ich schlafe, sind die Wände blau bemalt. In einer adoleszenten Krise hat sie in schönster Schörkelschrift Sinnsprüche an die Wände gemalt, die heute mich trösten. Das werde ich ihr aber nicht sagen. Lucy glaubt noch, das Leben werde einfacher. Die Erwachsenen hätten es im Griff. Ich glaube, ich war vierzig, als ich diese Hoffnung aufgab: Eines Tages ist alles klar. Eines Tages ergibt alles einen Sinn. Ich werde wissen, was ich tue und warum.
Daphne und ich machen einen Ausflug die Küste hoch. Daphne fährt meinen Mietwagen, sie ist eine schlechte Beifahrerin. Wir hören eine CD, die Paul mir geschenkt hat. Still und heimlich hat er wieder angefangen, Musik zu machen. Geduldig nimmt er alle Tonspuren selber auf, eine nach der anderen, in einem kleinen Abstellraum, in dem auch die Waschmaschine steht. Er stellt seine Songs auf Facebook, von dort reisen sie weiter, zwei haben es in den Soundtrack von unabhängigen Filmen geschafft. Der rote Teppich wurde wieder vor Paul und Daphne ausgerollt, er hat nicht mehr dieselbe Bedeutung wie vor zwanzig Jahren.
Wir halten am Meer, es ist immer noch kühl, ich denke an all die Sommerkleider in meinem Koffer. Wir essen Hummersandwiches, köstlich und überhaupt nicht teuer. Ich bin begeistert. Daphne ist erstaunt. «Hummer ist doch nichts Besonderes», sagt sie. «Der wird hier einem hinterhergeworfen, irgendwann hängt er zum Hals heraus.»
Alles eine Frage der Perspektive.
«Frauen wie du und Daphne», sagt Paul später. «Frauen wie du und Daphne haben es nicht leicht. Ihr seid so schön und stark – das kann einen Mann schon einschüchtern.»
Daphne runzelt die Stirn. Schön und stark, denkt sie, ich? In den letzten fünf Jahren hatten sie beide Krebs, erst er, dann sie. Die Behandlung hat ihre Beziehung verändert. Daphne schaut nicht mehr gern in den Spiegel. Sie erkennt sich nicht mehr. Offenbar reicht es nicht, begehrt zu werden, um sich begehrenswert zu fühlen. Sie schaut ihn an, er grinst: «Zum Glück lass ich mich nicht so leicht abschrecken!» Sie lächelt. Am nächsten Tag schiebt sie das Ehebett in ein anderes Zimmer, ein Zimmer, «in dem ich nicht krank war». Das Leben geht nicht besonders sanft mit Daphne und Paul um, denke ich. Sie miteinander dafür umso mehr. Offensichtlich habe ich meine innere Romantikerin falsch erzogen, die immer davon ausging, dass nur eine dramatische Beziehung echt sein kann. Aber das Leben ist Drama genug, warum sich in der Beziehung zerfleischen?
«You teach people how to treat you», sagt Daphne. Wie du von anderen behandelt wirst, das hast du ihnen beigebracht. Ich weiß schon. Deshalb hilft es mir nichts, über meinen Exmann zu lästern, auch wenn es sich manchmal gut anfühlt. Aber die Frage ist nicht: «Was hat er getan?» Die Frage an mich muss lauten: Warum habe ich das mitgemacht?
Ich kenne die Antwort: Ich habe mir mein Gefühl für mich selber abtrainiert, weil die Alternative, den geliebten Menschen in Frage zu stellen, unerträglich war. Das kann ich niemandem vorwerfen, nicht einmal mir selber. Ich weiß alles, was ich wissen muss. Ich stelle mich meinen Dämonen, ich weiche ihnen nicht aus. Ich schaue hin, ich arbeite an mir. Aber das ist anstrengend. Ich bin so müde. Ich möchte es jetzt einfach mal schön haben. Ist das denn zu viel verlangt?
Von den Vorteilen des Alleinreisens
Sehr früh morgens schleiche ich aus dem schlafenden Haus und fahre mit meinem Mietwagen zurück zum Flughafen in Portland. Am Flughafen merke ich, dass ich meinen Pass nicht habe. Ich rufe Daphne an, sie stellt das Haus auf den Kopf – nichts.
Aber der Führerschein, meint sie, der in Amerika zu jeglichem Identitätsbeweis dient, müsste für einen Inlandflug ausreichen.