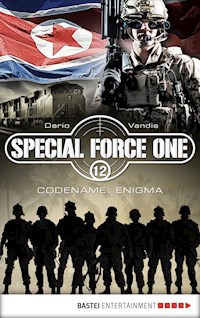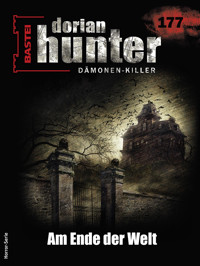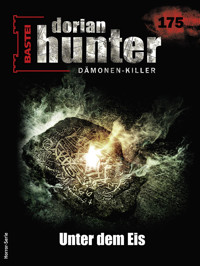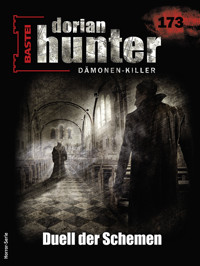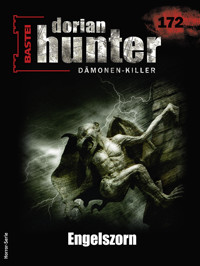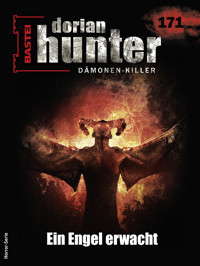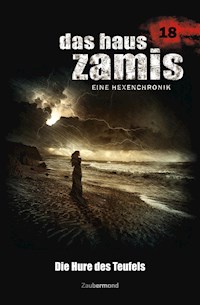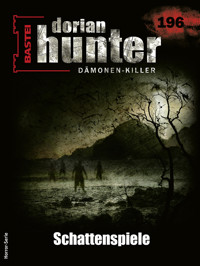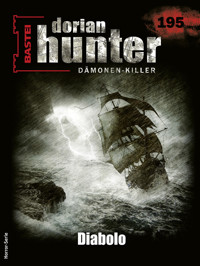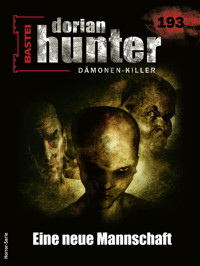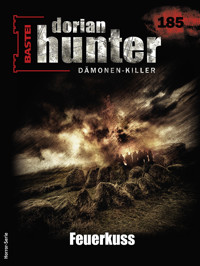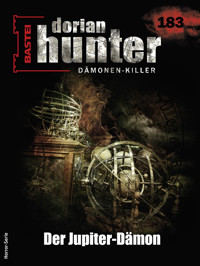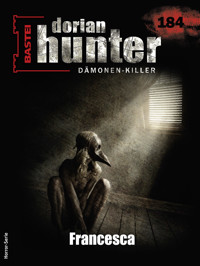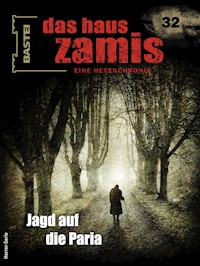
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Das Haus Zamis
- Sprache: Deutsch
Wir betraten die Gangway. Ich war in Gedanken versunken und ließ meinen Blick ziellos über die Köpfe der Passagiere vor mir schweifen. Einer von ihnen kam mir bekannt vor, aber er drehte sich nicht um, sodass ich sein Gesicht nicht erblicken konnte.
Sheridan Alcasta packte meine Hand. Sie zitterte und war feucht. Ich fürchtete schon, dass er wieder seine Gestalt wechseln würde, aber es war nur Schweiß, der über seine Handflächen lief.
»Dämondämondämondämon ...«, murmelte er, und ein Speichelfaden lief aus seinen Mundwinkeln ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah
JAGD AUF DIE PARIA
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
mystery-press
Vorschau
Impressum
Coco Zamis ist das jüngste von insgesamt sieben Kindern der Eltern Michael und Thekla Zamis, die in einer Villa im mondänen Wiener Stadtteil Hietzing leben. Schon früh spürt Coco, dass dem Einfluss und der hohen gesellschaftlichen Stellung ihrer Familie ein dunkles Geheimnis zugrunde liegt. Die Zamis sind Teil der sogenannten Schwarzen Familie, eines Zusammenschlusses von Vampiren, Werwölfen, Ghoulen und anderen unheimlichen Geschöpfen, die zumeist in Tarngestalt unter den Menschen leben und nur im Schutz der Dunkelheit und ausschließlich, wenn sie unter sich sind, ihren finsteren Gelüsten frönen.
Der Hexer Michael Zamis wanderte einst aus Russland nach Wien ein. Die Ehe mit Thekla Zamis, einer Tochter des Teufels, ist standesgemäß, auch wenn es um Theklas magische Fähigkeiten eher schlecht bestellt ist. Umso talentierter gerieten die Kinder, allen voran der älteste Bruder Georg und – Coco, die außerhalb der Sippe allerdings eher als unscheinbares Nesthäkchen wahrgenommen wird. Zudem kann sie dem Treiben und den »Werten«, für die ihre Sippe steht, wenig abgewinnen und fühlt sich stattdessen zu den Menschen hingezogen.
Während ihrer Hexenausbildung auf dem Schloss ihres Patenonkels lernt Coco ihre erste große Liebe Rupert Schwinger kennen. Als ihr schließlich zu einem vollwertigen Mitglied der Schwarzen Familie nur noch die Hexenweihe fehlt, meldet sich zum Sabbat auch Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen Familie, an und erhebt Anspruch auf die erste Nacht mit Coco. Als sie sich weigert, wird Rupert Schwinger in den »Hüter des Hauses« verwandelt, ein untotes Geschöpf mit einem von Würmern zerfressenen Gesicht, das fortan ohne Erinnerung an sein früheres Leben über Coco wachen soll.
Auf weitere Konsequenzen verzichtet Asmodi vorerst, als es Coco gelingt, einen seiner Herausforderer zu vernichten – durch die Beschwörung des uralten Magiers Merlin, der sich auf Cocos Seite stellt. Merlin aber ist seinerseits gefangen – im centro terrae, dem Mittelpunkt der Erde. Um ihn zu befreien, muss Coco sieben Siegel erbeuten, die sie vor dem Einfluss der Zentrumsdämonen schützen. Sie meistert diese Aufgabe – und verliert im Anschluss ihre Erinnerungen an die Reise ins centro terrae, wie Merlin es ihr prophezeit hat.
Zurück auf der Erdoberfläche, erfährt Coco, dass Asmodis Groll auf die Zamis nicht geschwunden ist. Dennoch schließen Asmodi und Michael Zamis einen Burgfrieden. Die Leidtragende ist Coco, die in der Kanzlei des Schiedsrichters der Schwarzen Familie Skarabäus Toth von einer Armee von Untoten getötet wird. Im letzten Moment rettet sie ihre Seele in den Körper einer Greisin. Während Toth den Zamis Cocos Leichnam präsentiert, reist Coco in ihrem Gastkörper nach Amerika, um dort den Seelenfänger Sheridan Alcasta aufzuspüren, der ihr helfen könnte, in ihren eigenen Körper zurückzukehren. Aber Sheridan ist nur noch ein Schatten seiner selbst, und auf dem gemeinsamen Weg zurück nach Europa kündigt sich das nächste Unheil an ...
JAGD AUF DIE PARIA
von Dario Vandis und Christian Montillon
Sie war der Falle entkommen.
Ärger mischte sich in den Blick der finsteren Augen, deren tiefschwarze Pupillen in einem dunkelroten Feuer zu glühen schienen. Das Gesicht verzerrte sich vor Zorn.
Die Hexe lebte!
Er beobachtete sie weiter, verfolgte ihren Weg, spürte über die Distanz, wie sie eine Maschine bestieg und sich in die Lüfte erhob. Er erkannte den Weg, den sie nehmen würde.
Der Dämon, in dessen glühenden Blick sich erwartungsfreudiger Triumph mischte, lachte leise auf. Er gab Befehl, den Kurs geringfügig zu ändern.
Sie war seiner Falle entkommen, doch nun kam sie freiwillig in seine Nähe, unwissend wie ein tumbes Tier. Coco Zamis würde ihm nicht entkommen.
Er bereitete alles vor, eine Katastrophe auszulösen.
1. Kapitel
Schatten. Stille. Und Wasser, so weit das Auge reichte.
Die Schmugglerjacht durchpflügte lautlos und mit ausgeschalteten Bordleuchten die Gewässer der Adria. Libertad, der schwarze Schriftzug auf dem weißen Rumpf der Jacht, wurde in rhythmischen Abständen von den Wellen überflutet. Die Jacht lag tief im Wasser, weil sie stark beladen war. Mit der wertvollsten und gefährlichsten Fracht, die Alfredo Valeri in seinen fünfundzwanzig Jahren als Skipper und Schmuggler für Anatol Chalkiris befördert hatte.
Die Tür öffnete sich, und ein Schatten erschien im Rahmen. Ein unrasiertes Gesicht, ein braun gebrannter, muskulöser Oberkörper, der in einem abgetragenen Baumwollhemd steckte, mit einer tätowierten Schlange, die sich über den Halsansatz bis in den Nacken wand.
»Wie lange ist es noch bis zur Insel, Käpt'n?«
Valeri blickte auf die Positionsangabe am Armaturenbrett. »Es läuft alles nach Plan, Franco. In drei Stunden sind wir da.« Er drehte sich um und musterte den zweiten Mann der Libertad, in dessen Augen sich Nervosität und Angst widerspiegelten. Franco del Mar war alles andere als ein Feigling, und es gab nur einen einzigen Mann auf der Welt, vor dem er sich fürchtete. Vor Anatol Chalkiris.
»Was macht die ›Ladung‹?«, fragte Valeri.
»Ist gut verstaut. Aber die Neuen machen Probleme. Ich glaube, sie bekommen ihre Hormone nicht in den Griff. Vielleicht hätten wir warten sollen, bis die alte Mannschaft ...«
»Wir hatten keine Zeit. Chalkiris erwartet unsere Lieferung, das weißt du ganz genau.«
Franco nickte. »Trotzdem mache ich mir Sorgen. Wenn sich einer von ihnen an der Ladung vergreift ...«
Valeri schlug die Beine übereinander und grinste. »Warum so skeptisch. Du solltest ein bisschen lockerer werden. Willst du eine Zigarette?«
»Es war ein Fehler, diese beiden Kerle an Bord zu nehmen. Durch sie haben wir ...«
Ein Schrei drang an ihre Ohren, durch die mehrfachen Wände fast bis zur Unhörbarkeit gedämpft. Valeri hätte viel darum gegeben, sich getäuscht zu haben.
»Jetzt ist es passiert«, sagte Franco düster.
Er sprach den Gedanken nicht aus, aber Valeri wusste auch so, was Franco meinte. Chalkiris hatte ausdrücklich saubere Ware verlangt. Jungfräuliche Ware. Wenn also einer der beiden Schwachköpfe, die Valeri in Marseille angeheuert hatte, seinen Schwanz nicht in den Griff bekam, würden sie alle dafür büßen müssen.
Valeri stellte die automatische Steuerung ein und erhob sich. Sein Gesicht hatte sich verdunkelt. »Gehen wir runter. Ich will mir die Kerle ansehen, die es wagen, meine Befehle zu missachten.«
Franco ging voraus, über die enge Treppe in die untere Ebene der Libertad, wo sich die Laderäume befanden, in denen sie sonst Schmuggelware transportierten. Alkohol, Zigaretten.
Manchmal auch harte Drogen.
Der Geruch von Salzwasser und Dieselöl erfüllte die Luft. Valeri nahm ihn kaum noch wahr. Die Libertad war sein Kind. Zwanzig Meter lang, schneidig und schnell, hatte er sie vor Jahren vor der Verschrottung bewahrt und wieder auf Vordermann gebracht. Sie war seine Braut, und er würde nicht zulassen, dass sie von ein paar heiß gelaufenen Casanovas in Gefahr gebracht wurde.
Sie erreichten eine Metalltür, vor der ein breitschultriger Kerl vor sich hin döste. In seinem Mundwinkel brannte eine Lucky Strike, und in seinem Hosenbund steckte eine gesicherte Neun-Millimeter. Er zuckte zusammen, als er den Kapitän erblickte.
»Meine Güte, hast du mich erschreckt, Boss. Ich dachte ...«
»Halt's Maul, Jean. Wo ist Pierre?«, fuhr Valeri dazwischen. Er blickte sich um, aber von dem zweiten Franzosen war nichts zu sehen.
In Jeans Miene spiegelte sich das schlechte Gewissen. Er deutete auf die Tür. »Wollte sich drinnen ein bisschen umsehen. Aufpassen, dass die Mädels keinen Mucks von sich geben.«
Valeri fluchte. Er konnte sich vorstellen, was ein Typ wie Pierre unter Aufpassen verstand. Er hatte ihn und Jean in Marseille angeheuert – auf die Empfehlung eines Hehlers, mit dem er seit Jahren Geschäfte machte. Dieser hatte sich für sie verbürgt, aber jetzt zeigte sich, was sein Wort wert war. Den beiden stand der Saft bis zu den Ohren, darauf hätte Valeri wetten mögen.
Er öffnete die Tür und betrat den Laderaum. Franco folgte ihm wie ein Schatten, die Hand unmerklich in der Nähe der kleinkalibrigen Pistole, die in seinem Gürtel steckte.
Licht fiel auf eine Szene, die Valeri lieber nicht gesehen hätte. Pierre stand inmitten des Raumes, das Gesicht zu einer gierig-erregten Maske verzerrt. Vor ihm kniete eine schwarzhaarige Schönheit, deren Hände auf dem Rücken zusammengebunden waren. Ihre Kleidung war zerrissen, die Brüste freigelegt. Deutlich war zu sehen, dass Pierre dabei nicht zimperlich vorgegangen war. Eine Strieme verfärbte ihre Haut vom Hals bis zur linken Schulter, eine Wange war geschwollen. Das Mädchen blickte stumpf vor sich hin.
Pierre fuhr herum, als er Valeri wahrnahm. Seine Grimasse fiel in sich zusammen.
»Was ist hier passiert?«, fragte Valeri scharf.
Pierre stieß die Frau weg. »Dieses Miststück hat sich an mir vergriffen«, sagte er hastig. »Sie wollte mir die Waffe klauen und mich umlegen!«
»Mit gefesselten Händen, oder wie?«, fauchte Valeri. Er trat näher, und sein Blick glitt über Pierres Visage, sein geöffnetes Hemd, dann tiefer. »Seit wann trägst du die Knarre in der Hose?«
Pierre zog hastig den Hosenschlitz zu. »Du verstehst das falsch, Boss. Dieses Luder ist schuld. Sie hat mich einfach überrascht ... Ich schwöre dir, sie hätte mich kalt gemacht, wenn ich nicht ...«
Valeri blickte der Schwarzhaarigen ins Gesicht. Er sah Augen, in denen sich Angst mit Schicksalsergebenheit mischte, und ein wunderschönes Gesicht, das jetzt von einem hässlichen Veilchen entstellt war. Diese Frau hätte Pierre niemals angegriffen. Der Blick des Kapitäns wanderte weiter über die anderen Passagiere. Es waren allesamt Frauen, zwanzig an der Zahl. Erlesene Schönheiten – Jungfrauen, von denen keine älter als neunzehn war. Valeri hatte ihnen die Hände auf den Rücken binden lassen, aber sonst auf jede Erniedrigung verzichtet. Er war kein Sadist, er machte nur seinen Job. Was Chalkiris später mit den Mädchen anstellte, ging ihn nichts an.
»Du weißt, welchen Auftrag wir haben, Pierre?«, fragte Valeri gefährlich ruhig.
Pierre nickte hastig. »Klar, Boss. Wir sollen die Mädchen auf die Insel bringen.«
»Und in welchem Zustand?«
»Unversehrt, Boss. Rein. Nur Ware bester Qualität.«
»Und was ist das?« Valeri packte die Schwarzhaarige und hob ihr Gesicht, sodass das geschwollene Auge deutlich zu sehen war. »Sie ist verletzt, und dir hängt der Schwanz aus der Hose. Wie willst du mir das erklären, he?«
»Aber Boss, ich ...«
»Du bist ein Vollidiot, Pierre. Leute wie dich kann ich auf der Libertad nicht gebrauchen!«
Franco zückte wie auf Befehl seine Waffe.
Ein Rascheln an der Tür verriet, dass Jean, der andere Franzose, aufgesprungen war. Offenbar wollte er seinem Kumpel beistehen. Aber Franco war schneller und richtete die Waffe auf ihn.
»Keine Bewegung, Freundchen«, sagte Franco.
»Ruhig Blut«, keuchte der Breitschultrige entschuldigend. »Das ist doch alles nur ein Missverständnis. Pierre hat die Wahrheit gesagt. Ich habe gesehen, wie die Kleine ihn provoziert hat.«
Valeri streifte ihn mit einem verächtlichen Blick. Die Tür war geschlossen gewesen, wie hätte er da etwas sehen sollen? Die beiden redeten Scheiße. Sie würden das Blaue vom Himmel herunterlügen, um ihren Hals zu retten. »Ich werde dir sagen, was passiert ist, Jean. Ihr habt verabredet, euch die Mädchen vorzunehmen. Zuerst war Pierre dran. Du hast Schmiere gestanden. Und später hättet ihr euch abgewechselt. Wenn die Kleine sich nicht gewehrt hätte, wären Franco und ich ahnungslos geblieben. Wie ein Idiot hätte ich auf der Insel angelegt und Chalkiris verdorbene Ware übergeben!«
»Pierre wollte doch nur ein bisschen Spaß haben ...«
Jean zuckte bei diesen Worten die Achseln, aber Franco entging nicht, wie seine Hand sich bei diesen Worten unmerklich der Neun-Millimeter näherte. Aber der Franzose war nicht der Erste, der die Auffassungsgabe Francos unterschätzte. Franco zielte mit einer raschen Bewegung, ein Schuss fiel, und Jean griff sich an die Brust. Mit ungläubigem Staunen blickte er auf die knopflochgroße Wunde in Höhe seines Herzens, aus der ein Rinnsal Blut sickerte.
»Verdammte Scheiße, du hast ... mich erwischt ...«
Er verdrehte die Augen und brach zusammen. Als er auf dem Boden aufschlug, war er bereits tot.
Pierre war kreideweiß. »Das darf nicht wahr sein. Du hast ihn kaltblütig ermordet!«
»Er wollte dir beistehen, Kumpel«, sagte Valeri. »Er ist für dich gestorben, verstehst du? Aber du verdienst einen solchen Freund wahrscheinlich überhaupt nicht.«
Die Frauen hatten den Mord schweigend verfolgt. Auf einigen Gesichtern zeigte sich Panik, andere weinten, aber die meisten zeigten keine Regung. Die mehrtägige Gefangenschaft auf der Libertad hatte ihren Widerstand zerbrechen lassen, manche von ihnen dämmerten nur noch gleichgültig dahin.
»Gib mir deine Waffe, Franco«, sagte der Kapitän.
Der Gehilfe gehorchte.
»Wir gehen jetzt gemeinsam an Deck, Freundchen«, sagte Valeri zu Pierre. »Ich will keinen Mucks von dir hören. – Franco, nimm die Leiche mit. Wir werfen sie einfach über Bord.«
»Was hast du vor?«, jammerte Pierre. »Verdammt, das kannst du doch mit mir nicht machen. Ich habe immer alles gemacht, was du gesagt hast ...«
»Halt's Maul. Los jetzt.«
Pierre ging vor Valeri, den Lauf der Waffe im Rücken. Er atmete schwer, Schweiß perlte von seiner Stirn. Franco schleppte die Leiche nach draußen, dann schloss er die Tür zum Laderaum und ließ die Frauen in der Dunkelheit zurück. Oben angekommen befahl Valeri Pierre, langsam in Richtung Bug zu gehen.
»Ich flehe dich an, Käpt'n!« Er hätte einen unschuldigen Menschen, ohne zu zögern, in den Tod geschickt, aber jetzt, da es ihm an das eigene Leben ging, greinte er wie ein Kind. »Ich hab doch nichts gemacht. Jean hatte recht. Das Ganze ist ein Scheißmissverständnis ... Käpt'n, bitte!«
»Los, weiter!«
Pierre stand jetzt vor der Reling, und Valeri hob die Pistole. Einen Augenblick spielte er mit dem Gedanken, das Leben dieses Vollidioten zu verschonen. Aber er kam zu dem Schluss, dass er sich das unmöglich leisten konnte. Es würde schwierig genug sein, den Deal zu Chalkiris' Zufriedenheit abzuschließen und die Ware von Bord zu schaffen. Wenn er sich darüber hinaus noch um einen Gefangenen kümmern musste ...
»Bitte nicht, Käpt'n ... bitte nicht ...« Pierres Körper wurde von Weinkrämpfen geschüttelt. Eine Lache breitete sich zwischen seinen Füßen aus. Was für eine Memme!
Valeris Finger krümmte sich um den Abzug.
Da kniff er die Augen zusammen und blickte an Pierre vorbei auf das Positionslicht, das wenige hundert Meter vor ihnen aufgetaucht war. Ein fremdes Schiff!
Es steuerte direkt auf die Libertad zu.
Der Flughafenangestellte führte den Metallsensor zunächst über den Leib des Fluggastes, dann über Arme, Beine und den Rücken. Ein Alarm blieb aus.
»Sie dürfen passieren.«
Ich atmete auf, denn ich hatte mit allem Möglichen gerechnet, nur nicht damit, dass Sheridan Alcasta die Airportkontrolle ohne Komplikationen hinter sich bringen würde.
Ich zog den Dämon mit mir und folgte Dr. Cheryl Evans, die sich bereits auf Höhe der Duty-free-Shops befand und bei den Parfümangeboten stehen geblieben war. Es war ein seltsames Gefühl, Sheridan in »normaler« Gestalt zu sehen – soweit man die verwachsene Statur mit dem halslosen Schädel, der schief auf den Schulterblättern saß, als normal bezeichnen konnte.
Mitleidige Blicke streiften uns auf Schritt und Tritt, aber weder Sheridan noch ich machten uns etwas daraus. Er musterte seine Umgebung mit gepflegtem Desinteresse und schien die Leute, die ihn begafften wie einen Aussätzigen, überhaupt nicht wahrzunehmen.
Sobald ich bemerkte, dass er unruhig wurde, fasste ich ihn an der Hand. Die Berührung schien ihm Sicherheit zu geben. Vielleicht war es ein altes Gefühl der Vertrautheit, eine blasse Erinnerung an sein früheres Leben, als er mir – allerdings unter weit unangenehmeren Umständen – zum ersten Mal begegnet war.
Wir warteten vor dem Duty-free-Shop, bis Cheryl Evans mit einem Papiertäschchen unter dem Arm wieder herauskam. Sie musterte Sheridan skeptisch, der den Kopf in langsamen kreisförmigen Bewegungen rotieren ließ und sich immer wieder mit seinen verkrüppelten Fingern an die Stirn tippte.
»Ich hoffe, er verwandelt sich nicht mitten in der Wartehalle in dieses ... schleimige Etwas«, sagte Dr. Evans und verzog das Gesicht.