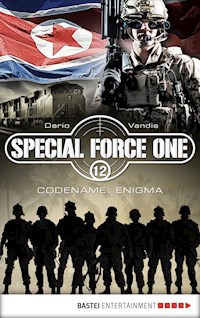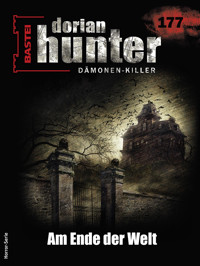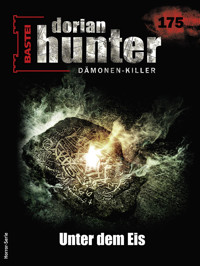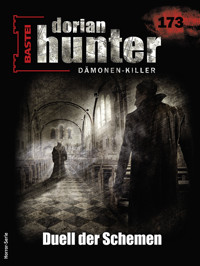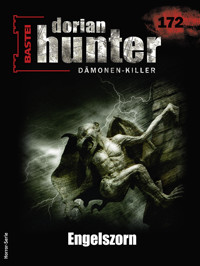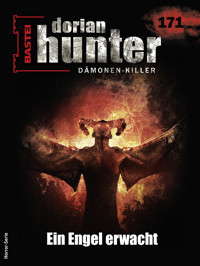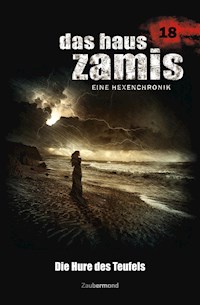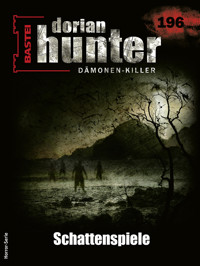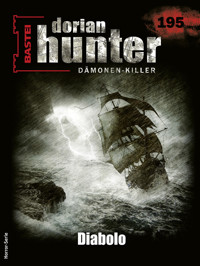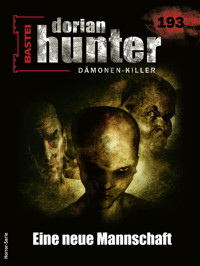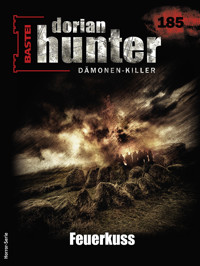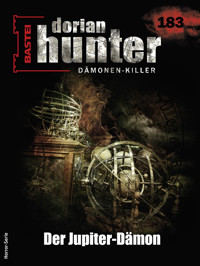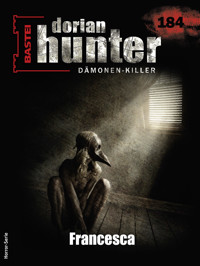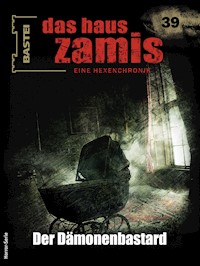
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Das Haus Zamis
- Sprache: Deutsch
Ich wurde auf eine steinerne Bahre gelegt. Amarquos trat zur Seite und entzündete ein Dutzend schwarzer Kerzen, die einen betäubenden Duft verbreiteten. Im flackernden Schein der Flamme erkannte ich die mit Stuck und Freskenmalereien verzierte Decke.
Neben mir, auf einer zweiten Steinbahre, lag der Comte de Guedelon. Sein weiß gepudertes Gesicht wirkte steinern wie bei einer Statue. Ich fragte mich, ob er bereits tot war.
Dann begann Achthon erneut in meinem Unterleib zu wühlen. Die Welt um mich herum versank in rotem Nebel. Ich brüllte wie am Spieß, während die Hebammen sich auf mich stürzten und meine Arme und Beine auf die Bahre pressten.
Coco hat die Reise zum Schloss des Grafen überstanden, aber damit ist ihr Martyrium noch nicht zu Ende. Der Dämonenbastard Achthon wühlt immer noch in ihr - während sie endlich einen Hinweis darauf erhält, warum ihr Vater Michael Zamis ein solches Interesse hatte, den Pakt mit dem Comte zu schließen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah
DER DÄMONENBASTARD
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
mystery-press
Vorschau
Impressum
Coco Zamis ist das jüngste von insgesamt sieben Kindern der Eltern Michael und Thekla Zamis, die in einer Villa im mondänen Wiener Stadtteil Hietzing leben. Schon früh spürt Coco, dass dem Einfluss und der hohen gesellschaftlichen Stellung ihrer Familie ein dunkles Geheimnis zugrunde liegt. Die Zamis sind Teil der sogenannten Schwarzen Familie, eines Zusammenschlusses von Vampiren, Werwölfen, Ghoulen und anderen unheimlichen Geschöpfen, die zumeist in Tarngestalt unter den Menschen leben und nur im Schutz der Dunkelheit und ausschließlich, wenn sie unter sich sind, ihren finsteren Gelüsten frönen.
Der Hexer Michael Zamis wanderte einst aus Russland nach Wien ein. Die Ehe mit Thekla Zamis, einer Tochter des Teufels, ist standesgemäß, auch wenn es um Theklas magische Fähigkeiten eher schlecht bestellt ist. Umso talentierter gerieten die Kinder, allen voran der älteste Bruder Georg und – Coco, die außerhalb der Sippe allerdings eher als unscheinbares Nesthäkchen wahrgenommen wird. Zudem kann sie dem Treiben und den »Werten«, für die ihre Sippe steht, wenig abgewinnen und fühlt sich stattdessen zu den Menschen hingezogen.
Während ihrer Hexenausbildung auf dem Schloss ihres Patenonkels lernt Coco ihre erste große Liebe Rupert Schwinger kennen. Als ihr schließlich zu einem vollwertigen Mitglied der Schwarzen Familie nur noch die Hexenweihe fehlt, meldet sich zum Sabbat auch Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen Familie, an und erhebt Anspruch auf die erste Nacht mit Coco. Als sie sich weigert, wird Rupert Schwinger in den »Hüter des Hauses« verwandelt, ein untotes Geschöpf, das fortan ohne Erinnerung an sein früheres Leben über Coco wachen soll.
Auf weitere Konsequenzen verzichtet Asmodi vorerst, als es Coco gelingt, einen seiner Herausforderer zu vernichten – durch die Beschwörung des uralten Magiers Merlin, der sich auf Cocos Seite stellt. Merlin aber ist seinerseits gefangen – im centro terrae, dem Mittelpunkt der Erde. Coco gelingt es, ihn zu befreien, doch im Anschluss verliert sie ihre Erinnerungen an die Reise ins centro terrae, so wie Merlin es ihr prophezeit hat.
Zurück auf der Erdoberfläche, erfährt Coco, dass Asmodis Groll auf die Zamis nicht geschwunden ist. Dennoch schließen Asmodi und Michael Zamis einen Burgfrieden. Die Leidtragende ist Coco, die in der Kanzlei des Schiedsrichters der Schwarzen Familie Skarabäus Toth von einer Armee von Untoten getötet wird. Im letzten Moment rettet sie ihre Seele in den Körper der Greisin Monika Beck. Als Toth den Zamis Cocos Leichnam präsentiert, schöpft nur Cocos Bruder Georg Verdacht. In Amerika spürt Coco inzwischen in Monika Becks Körper den Seelenfänger Sheridan Alcasta auf, der ihr die Rückkehr in den eigenen Leib ermöglicht. In der Zwischenzeit allerdings hat Michael Zamis einen Pakt mit dem französischen Grafen Guy de Guedelon geschlossen. Coco soll dem Grafen ein Kind gebären. Auf der Fahrt zum Schloss des Comte wächst es bereits in ihr heran – und geht nächtens auf blutige Raubzüge!
DER DÄMONENBASTARD
von Dario Vandis
Rouen, Frankreich, 24. Mai 1431
»Johanna«, dröhnte die kräftige Stimme des Bischofs Cauchon über den Platz, »seid Ihr gewiss, im Stande der Gnade zu sein?«
Atemlose Stille folgte. Hunderte Augenpaare richteten sich auf das schlanke, von Entbehrungen gekennzeichnete Mädchen, das in Ketten gelegt vor der Anklage stand. Ein leiser Ostwind wehte und brachte dunkle Wolken herbei. Sie waren wie ein Menetekel für Jeanne d'Arc, die dennoch nur wenige Augenblicke brauchte, um eine Antwort zu finden.
»Wenn ich es nicht bin«, hob sie an, »so möge mich Gott dahin bringen. Wenn ich es bin, möge mich Gott darin erhalten!«
Ein Raunen ging durch die Menge.
Verfluchtes Biest!, dachte Pierre Cauchon zerknirscht. So ging es nun schon seit Stunden. Welche Falle er der aufrechten »Jungfrau von Orleans« auch stellte, stets fand sie eine Möglichkeit, sich mit klugen Worten einer endgültigen Festlegung zu entziehen – selbst da, wo scheinbar jede Antwort, die sie nur wählen konnte, die falsche war.
1. Kapitel
»Also seid Ihr gewiss?«, hakte er nach.
Sagt es. Er schwitzte und rieb sich die Hände.
»Ihr habt meine Antwort gehört«, entgegnete sie.
Pierre Cauchon, der Bischof von Beauvais, strich sich über das hagere Gesicht. Der kalte Blick seiner dunklen Augen schien Jeanne d'Arc ausziehen zu wollen. Wie keusch sie sich gab. Aber er wusste, dass jeder Mensch seine Grenze hatte. Er wusste es gerade deswegen, weil er nicht zu ihnen gehörte. Aber seine Maske war vortrefflich. Niemand der Umstehenden wäre auf die Idee gekommen, das wahre Monstrum aufseiten der Anklage zu suchen.
Er schoss seine Fragen ab, eine nach der anderen. Er wurde nicht müde, neue Fallen zu stellen, denn er war kein Mensch – aber die neunzehnjährige Jean d'Arc, die trotz aller Legenden nur aus Fleisch und Blut war, gelangte irgendwann an ihre Grenzen. Ihre Antworten kamen zögerlicher, ihre Blicke wurden fahriger. Sie war müde, fast zu Tode erschöpft, auch von der außerordentlichen und geheimen Befragung, der Bischof Cauchon sie im Vorlauf dieses Tribunals unterzogen hatte.
»Ihr gebt zu, dass Ihr gefrevelt habt und dass die Visionen, die Euch angeblich widerfuhren, nichts als schlimme Lästerungen waren, die Euch dazu brachten, an Mannes statt in Kleidern, die Euch nicht geziemten, in den Krieg zu ziehen und hundertfach zu morden ...«
Er sprach so laut und bestimmend, dass er sich fast an seiner eigenen Stimme berauschte. Er hatte die Macht, und er würde an diesem nichtsnutzigen Mädchen ein Exempel statuieren.
Und noch während er sprach, überlegte er.
Verbrennen?
Nein, das wäre zu hart gewesen, obgleich er sich kein größeres Vergnügen vorstellen konnte, als ausgerechnet die gläubige Jungfrau von Orleans auf dem Scheiterhaufen zu sehen.
Aber er musste an den Mob denken. Es gab immer noch Menschen, die mehr oder minder heimlich auf ihrer Seite standen. Erst musste er den Pöbel überzeugen.
»Hiermit verurteile ich Euch zu lebenslangem Kerker, Jeanne d'Arc! Möget Ihr Eure Sünden bereuen, um eines Tages, wenn Eure Stunde schlägt, reinen Herzens dem Herrn gegenüberzutreten ...« Es machte ihm nichts aus, ihn im Munde zu führen. Genauso wenig wie das silberne Kreuz, das auf seiner Kutte prangte. Es war ein besonderes Merkmal seiner Rasse, der Azzuren, dass ihm religiöse Symbole, egal welchen Kulturkreises, keine Schmerzen bereiteten. Das hatte er den Dämonen der Schwarzen Familie voraus.
Vergnügt sah er zu, wie Jeanne d'Arc abgeführt wurde. Sie verzog keine Miene, und als er sie Stunden später in ihrem Kerker aufsuchte, hatte sie sich bereits von der Befragung erholt und trug wieder den hochmütigen, selbstsicheren Zug der wahrhaft Gläubigen, für die die Anfeindungen eines irdischen Tribunals nur Dornen auf dem Weg zum Paradies waren.
Ein Wink genügte, und der Wärter öffnete die Zellentür, um sich anschließend diskret zurückzuziehen.
Cauchon trat ein und blieb vor Jeanne d'Arc stehen. Man hatte sie in Ketten gelegt, sodass sie nur gebückt stehen konnte. Ein schwerer Eisenring lag um ihren Hals und zerrte ihren Oberkörper zu Boden.
»Da seht Ihr, wohin Euch der wahre Glaube geführt hat«, sagte er höhnisch. »Dabei seid Ihr doch so ein hübsches Mädchen ... Lasst Euch einmal richtig ansehen ...«
Er packte den sackartigen Lumpen, in den sie gekleidet war, und riss ihn in zwei Teile. Ihre festen Brüste glänzten im Schein der Fackeln. Cauchon selbst hatte dafür sorgen lassen, dass sie eine Ölung erhielt, als Vorgeschmack auf das Vergnügen, das sie nun erwartete.
»Zier dich nicht, Mädchen«, grunzte er, »dann geht es umso schneller.«
Er warf sie zu Boden, und Jeanne wehrte sich nicht. Sie wusste, dass sie nur verlieren konnte.
Der Bischof warf sich über sie, und sie spürte den kalten Hauch der Verderblichkeit, der ihn umwehte. Nie und nimmer war diesem Mann von Gott bestimmt, das Amt in Würden auszufüllen!
»Ich sehe Euch an, dass Ihr die Wahrheit ahnt«, sagte er kichernd und zwängte ihre Beine auseinander.
Sie spürte etwas Hartes zwischen ihren Schenkeln, etwas Kaltes und Großes, dessen Berührung ihr unsäglichen Schmerz bereitete. Und dann spürte sie, wie er in sie eindrang.
»Die Jungfrau von Orleans ...«, höhnte er, während er sich keuchend auf ihr wälzte.
Jeden seiner Stöße spürte sie wie kalten Stahl. Es zerriss sie innerlich. Sie blutete. Aus dem Rinnsal wurde ein Strom, der aus ihrer Scheide floss, während der Wahnsinnige wie ein leibhaftiger Teufel auf ihr ritt – bis das Martyrium in einem kehligen Schrei und kurzen, quälenden Zuckungen des Bischofs endete.
Cauchon erhob sich. Sein Blick glühte. Es schien, als würde er erst jetzt wieder zur Besinnung kommen.
Mitleidlos starrte er auf Jeanne d'Arc, die kraftlos in ihrem Blut lag. Ihre Wangen waren noch bleicher geworden, ihre Blicke fiebrig. Er hatte sich an ihrer Lebensenergie gelabt, so ausgiebig, dass es für sie fast den Tod bedeutet hätte.
»Ja, der Tod, mein Täubchen«, murmelte er wie im Selbstgespräch. »Er wartet bereits auf dich.«
Er ging zur Zellentür, die sich wie von Geisterhand öffnete. Der Wächter trat ein. Sein Blick war starr. In der Hand hielt er ein Bündel Männerkleider. Jeanne d'Arc war zu schwach, sich aufzulehnen. Er stülpte ihr Hose und Hemd über und zerrte sie am Bischof vorbei in den Gang.
»Bring sie nach draußen«, befahl Cauchon, »und dann rufe die Büttel. Du weißt, was du zu tun hast!«
Cauchon wartete nicht ab, ob der Wächter seinem Befehl folgte, und verließ den Kerker.
Sechs Tage später, am 30. Mai 1431, wurde das Urteil auf lebenslänglichen Kerker widerrufen. Jeanne d'Arc war aus dem Kerker geflohen und abermals in Männerkleidern gesehen worden. Als »notorisch rückfällige Ketzerin« verurteilte Pierre Cauchon sie zum Tode auf dem Scheiterhaufen, und sein Blick vermählte sich mit dem ihren, während die Flammen hoch über ihrem Kopf zusammenschlugen ...
Gegenwart
Die schwarze Limousine hielt im Innenhof des Château de Guedelon, und die beiden bleichen Hebammen öffneten die Türen.
Das Château war hufeisenförmig um den Innenhof angelegt und hatte vier Etagen, in deren Fenstern sich die Sonnenstrahlen spiegelten. Die gelbliche, leicht verblichene Fassade war mit steinernen Skulpturen geschmückt: spärlich bekleidete Männer und Frauen, die mich mit den Blicken ihrer steinernen Augen zu durchbohren schienen. Offenbar hatte der Graf diese Skulpturen anbringen lassen, denn sie passten in das Bild eines klassischen Loire-Schlosses wie eine Hexe in den Vatikan.
An der Hinterseite des Gebäudes ragten zwei Ecktürme lang und spitz in den Himmel. Im linken Turm war ein Fenster geöffnet, und eine Gestalt war zu sehen, die die Ankunft der Limousine beobachtete. Sie war ganz in Schwarz gekleidet. Ich konnte nicht sehen, ob es der Comte war.
Da wurde meine Aufmerksamkeit auch schon wieder abgelenkt – Achthon begann eine seiner nun immer stärkeren Attacken. Ich krümmte mich schmerzerfüllt. Für einen Augenblick war der Geruch der frischen, würzigen Landluft alles, was ich wahrnahm. Ich hörte und sah nichts mehr und spürte nur, wie die kräftigen Arme der Hebammen mich aus dem Wagen hievten.
Achthon schien diesmal nicht ruhen zu wollen, ehe er mein Innerstes nach außen gekehrt und meine Eingeweide mit seinen Raubtierzähnen zerfetzt hatte. Ich hatte das Gefühl, als ob jemand glühende Eisen in mich einführte. Mein Unterkörper schien ein einziger, nicht endender Schmerz, der mir die Luft abschnürte und jeden Gedanken aus dem Hirn brannte.
Ich blutete plötzlich aus der Scheide.
Und ich schrie.
Ich schrie wie noch nie in meinem Leben.
»Bringt sie hinein!«, hörte ich Amarquos' besorgte Stimme wie durch dichten Nebel. »Die Zeit ist reif! Achthons Geburt steht unmittelbar bevor!«
Ich fühlte, wie kräftige Hände mich an Armen und Beinen packten. Ich brüllte mir die Seele aus dem Leib, aber wer hätte mich schon aus den Klauen der Dämonen zu retten vermocht? Und wie? Immerhin trug ich noch dieses Monstrum in mir, und solange Achthon mir die Eingeweide zerriss, konnte ich sowieso keinen klaren Gedanken fassen.
Die Hebammen und Amarquos trugen mich durch das Eingangsportal in eine große Halle, von der weitere riesige Säle abzweigten. Wie durch einen blutigen Schleier nahm ich die bedrückende Atmosphäre des Châteaus auf. Die Räume wirkten dunkel, die Wände waren schwarz gestrichen und mit riesigen Gemälden behängt, auf denen irgendwelche Urahnen des Comte abgebildet waren.
Amarquos gab schrille, kurze Kommandos. Ich spürte, wie es warm zwischen den Beinen hinausrann und das Leben aus mir wich. Wie viel Zeit hatte ich noch? Höchstens ein paar Minuten.
Ich wurde auf eine steinerne Bahre gelegt. Amarquos trat zur Seite und entzündete ein Dutzend schwarzer Kerzen, die einen betäubenden Duft verbreiteten. Im flackernden Schein der Flamme erkannte ich die mit Stuck und Freskenmalereien verzierte Decke. Das Fresko über mir stellte einen Priester mit Raubtierkopf dar, der mit wölfischem Grinsen verfolgte, wie ein junges Mädchen auf dem Scheiterhaufen verbrannte.
Für einen kurzen Moment ließ der Schmerz nach, und mein Kopf fiel kraftlos zur Seite. Neben mir, auf einer zweiten Steinbahre, lag der Comte de Guedelon. Also war die Gestalt im Eckturm jemand anderes gewesen. Der Graf rührte sich nicht, und sein weiß gepudertes Gesicht wirkte steinern wie bei einer Statue. Ich fragte mich, ob er bereits tot war.
Dann begann Achthon erneut in meinem Unterleib zu wühlen. Die Welt um mich herum versank in rotem Nebel. Ich brüllte wie am Spieß, während die Hebammen sich auf mich stürzten und meine Arme und Beine auf die Bahre pressten.
»Lasst mich ... los!«, schrie ich und warf den Kopf hin und her.
Die Hebammen spreizten meine Beine. Ein Blutstrahl schoss aus meiner Scheide und benetzte den Marquis Amarquos, der sich am Fußende der Bahre aufgestellt hatte und mit schwerer Stimme unverständliche Worte rezitierte. Das Blut benetzte seinen Kragen und sein Gesicht, und ich stellte erschrocken fest, dass es zähflüssig war wie Pech. War das wirklich mein Blut? Was hatte Achthon aus mir gemacht? War ich überhaupt noch ich selbst?
Ich wollte gegen den eisenharten Griff der Hebammen ankämpfen, aber sie hielten mich ohne Anstrengung fest. Ihre Gesichter zeigten weder Mitleid noch Anstrengung. Sie hielten mich wie ein Kind, das zu schwach ist, sich ihnen zu widersetzen.
»Achthon ...«, knurrte der Marquis mit gutturaler Stimme. »Finalement, ça y est! – Endlich ist es so weit! Entfliehe dem Leib dieser unwürdigen Hexe, auf dass ein neuer Lebenszyklus für dich beginne!«
Ich hörte kaum hin. Achthon zerrte an mir, wühlte in meinen Eingeweiden. Ich spürte, wie er sich in mir bewegte und meine Organe hin und her schob. Ich konnte fühlen, wie sich Achthon von mir löste. Es war anders als die vorigen Male, als er meinen Körper nur für befristete Zeit verlassen hatte. Ich sah ihn förmlich vor mir, wie er sich wand und drehte, wie er noch im Leib die Nabelschnur kappte und die Plazenta verschlang. Gleich würde er mir die Bauchdecke zerreißen und aus mir hervorkriechen – und dann würde ich nicht mehr seine Mutter sein, sondern nur noch ein blutendes Stück Fleisch, das ausschließlich einem einzigen Zweck diente: dem Dämonenbastard als Mahl zu dienen und ihm meine Lebensenergie zu schenken.
Ich schloss mit dem Leben ab. Ich fand nicht einmal mehr die Kraft, an jene zu denken, die mir etwas bedeuteten. Wer hätte das auch sein sollen? Meine Familie? Auf die gab ich keinen Pfifferling mehr. Otto Keller? Den hatte Achthon ja bereits verschlungen. Nero? Wahrscheinlich war auch er längst ein Opfer des Bastards geworden. Ich hatte niemanden mehr, und das machte das Sterben leichter.
Dachte ich.
Aber Achthon wählte nicht den Weg durch die Bauchdecke, der wenigstens ein schnelles Ende bedeutet hätte. Stattdessen kroch er durch den Gebärmutterhals in Richtung Scheide. Ich brüllte wie ein Tier. Ich spürte, dass Achthon zu unmenschlicher Größe angewachsen war – und dass er sich diesmal nicht kleiner machte, um sich durch die Öffnung zu zwängen, sondern dass er meine Beckenknochen mit brutaler Gewalt zur Seite drückte.
Das Blut – jedenfalls die paar Liter, die sich noch in meinem Körper befanden – rauschte mir in den Ohren. Meine Lider flatterten. Endlich, endlich drohte ich das Bewusstsein zu verlieren.
Aber da änderte sich plötzlich das Timbre von Amarquos' Stimme. Plötzlich zog er meine Blicke wie magisch an.
»Ne me quitte pas, Coco. – Du darfst nicht fortgehen, Coco. Noch nicht. Du musst Achthon den Weg ins Freie weisen ...«
Etwas Fremdes ergriff Besitz von mir. Ich riss die Augen auf. Auf einmal war die Erschöpfung wie weggeblasen. Der Schmerz brach sich wieder mit aller Gewalt Bahn.