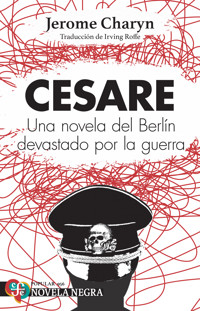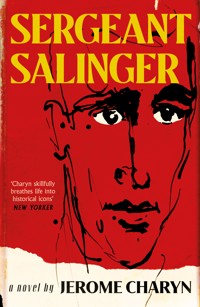Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BEBUG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Rotbuch
- Sprache: Deutsch
Isaac Sidel ist der unbestrittene Supercop des US-amerikanischen Krimis. In seiner legendären Serie, die inzwischen auf zehn Bände angewachsen ist, hat Kultautor Jerome Charyn ein farbenprächtiges Panorama von New Yorks Schattenseite heraufbeschworen: Kleinganoven, korrupte Politiker, Nymphomaninnen und das organisierte Verbrechen beherrschen die Szenerie. Aber sie alle werden kontrolliert von Isaac Sidel, dem härtesten und unbestechlichsten Police Inspector der Stadt. Durch die Verbindung von jüdischem New-York-City-Sarkasmus mit düsteren Thriller-Elementen hat Jerome Charyn vier Noir-Klassiker geschaffen, die zum Außergewöhnlichsten zählen, was Kriminalliteratur je hervorgebracht hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1277
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ZU DIESEM BUCH
In seinem legendären Isaac-Sidel-Zyklus, der inzwischen auf zehn Bände angewachsen ist, hat Jerome Charyn ein farbenprächtiges Panorama von New Yorks Schattenseiten heraufbeschworen: Skurrile Kleinganoven, korrupte Politiker, brutale Cops, schrullige Nymphomaninnen und das organisierte Verbrechen beherrschen die Szenerie. Aber sie alle werden kontrolliert von Isaac Sidel, dem zwielichtigen Helden der New Yorker Polizei. Doch der härteste und unberechenbarste Bulle des Big Apple, Isaac der Tapfere, der Mutige, der Starke, ist auch ein Zweifelnder und Getriebener, der im ethnischen Dickicht aus Latinos, Arabern, Iren, Juden und Asiaten seine eigene Identität sucht und dabei selbst die, die er liebt, nicht vor dem Tod bewahrt.
Durch die Verbindung von düsteren Thriller-Elementen mit jüdischem New-York-City-Sarkasmus hat Jerome Charyn vier atemberaubende Klassiker des Roman noir und eine der schillerndsten Figuren der Kriminalliteratur geschaffen, die bis heute ihresgleichen suchen. In diesem Band liegen nun die ersten vier Romane der Serie erstmals geschlossen vor.
ZUM AUTOR
Jerome Charyn wurde 1937 als Sohn osteuropäischer Immigranten in der New Yorker Bronx geboren. Er studierte in New York und Paris, war Lehrer und Professor für Englisch an unterschiedlichen Colleges und Universitäten. Heute ist er Professor für Filmgeschichte und lebt abwechselnd in Paris und New York. Charyns Bücher sind in zwölf Sprachen übersetzt und wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Zuletzt erschien bei Rotbuch Citizen Sidel (2008), der zehnte Band der Isaac-Sidel-Saga.
JEROME CHARYN
DAS ISAAC QUARTETT
BLUE EYES
MARILYN THE WILD
PATRICK SILVER
SECRET ISAAC
Aus dem Amerikanischen von Jürgen Bürger, Ursula Gnade und Peter Torberg
Mit einem Nachwort von Tobias Gohlis
ROTBUCH VERLAG
AUS DER ISAAC-SIDEL-REIHE VON JEROME CHARYN
LIEGT BEI ROTBUCH AUSSERDEM VOR:
CITIZEN SIDEL (2008)
eISBN: 978-3-86789-524-8
1. Auflage
© 2010 für diese Ausgabe by Rotbuch Verlag, Berlin
Titel der Originalausgabe: »The Isaac Quartet«
© 1974, 1976, 1976, 1978 by Jerome Charyn
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Umschlagabbildung: Getty Images, Neil Emmerson
Ein Verlagsverzeichnis schicken wir Ihnen gern:
Rotbuch Verlag GmbH
Alexanderstr. 1
10178 Berlin
Tel. 01805/30 99 99
(0,14 Euro/Min., Mobil abweichend)
www.rotbuch.de
Inhalt
BLUE EYES UND DER KÖNIG DER BARBIERE
VORWORT
BLUE EYES
MARILYN THE WILD
PATRICK SILVER
SECRET ISAAC
UND DAS WAR ERST DER ANFANG …
NACHWORT
EDITORISCHE NOTIZ
BLUE EYES UND DER KÖNIG DER BARBIERE
Vorwort
Ich war dabei unterzugehen, irgendwann Mitte 1973, verloren im Sumpf eines neuen Romans – ein Dinosaurier von einem Buch über einen König der Barbiere und die Republik Andorra –, als ich Ross Macdonald entdeckte. Ich hatte die Nase voll von meinen eigenen Mythologisierungen und wollte etwas Einfaches lesen. Einen Krimi – wieso nicht? Mir fiel The Galton Case in die Hände, und ich war von Anfang an begeistert von seinem einlullend neutralen Ton.
Das Buch hatte eine Morphologie, die ich bewunderte – als ob Ross Macdonald sich zum Ziel gesetzt hatte, die Körper zu entkleiden, um darunter ihre Skelette freizulegen. Nichts wurde ausgelassen: Die Landschaft, die Sprache und auch die Charaktere wurden völlig entblößt. Das war allerdings kein der Einfalt geschuldeter Unfall. Es war vielmehr Macdonalds besondere Kunst, ein »wucherndes Mauerwerk, das Detail über Detail schichtet, um eine Struktur zu schaffen«1.
Wucherndes Mauerwerk. Das war der Kern von Macdonalds Arbeit: traurige, seltsame Geschichten, die irgendwo zwischen engen, geschlossenen Räumen herumkrochen. Der verlorene Sohn, der aus einer brutalen, blutrünstigen Vergangenheit auftaucht, wird zum Hochstapler, dessen Identität durch einen Mord das Licht der Welt erblickt. Im Zentrum all der Rätsel steht Macdonalds Erzählerfigur, Detective Lew Archer, der weder ein Marlowe noch ein Nick Charles ist. Stattdessen ist er eine Art Todesengel. Ein Beobachter mit echten Gefühlen, der jedoch nur einen kleinen Teil von sich selbst in den Text fließen lässt. Eine Hälfte von ihm ist stets abwesend. Oder wie Macdonald selbst sagt: »Sicherlich steht mein Erzähler, Archer, nicht im Fokus meines Interesses, auch ist er kein Charakter, mit dessen Schicksal ich mich besonders beschäftige. Er ist eine bewusst schmal gehaltene Erzählerfigur, so schmal, dass er fast verschwindet, wenn er einen Schritt zur Seite macht.«2
Dieser enge Fokus erlaubt es Macdonald, sowohl eine Landschaft als auch eine Vergangenheit zu erschaffen, die keinerlei Sentimentalität enthalten. Macdonald kann töten, während uns sein Text einlullt.
Ich widmete mich wieder meinem Dinosaurierroman King Jude. Aber die Dinge waren immer noch faul im Staate Andorra. Ich wusste nicht wohin mit meinem König der Barbiere. Ich konnte ihn in keine Handlung pressen, die Sinn ergab. Da ich ihn aber noch nicht aufgeben wollte, entschied ich mich, an einem Krimi zu schreiben, und Jude den Barbier in meinem Hinterkopf weiter köcheln zu lassen. Aber ich besaß nicht Ross Macdonalds Talent zum stringenten Einlullen. Meine Texte waren unausgegoren und geheimniskrämerisch wie eine Schlange. Ich konnte die Körper mit meinen Worten nicht entkleiden. Und ich liebte Kalifornien nicht so wie Macdonald. Ich hatte drei Jahre dort gelebt, aber es hatte keinerlei mythischen Reiz für mich. Ich erinnerte mich nur an Felsen und Mammutbäume. Ich musste meinen eigenen Detective erfinden und ihn nach New York bringen.
Als Jugendlicher war ich Bodybuilder und Pingpong-Freak. Mein Wissen über die Unterwelt stammte aus Billardhallen und von Straßengangs in der Bronx. Mit zwölf hatte ich mich kurz als Schutzgelderpresser versucht, mir das Ganze aber schnell wieder abgewöhnt. Mit vierzehn lernte ich dann unregelmäßige französische Verben auf der High School für Musik und Kunst. Was zur Hölle sollte ich über das Verbrechen schreiben? Ich hätte in die Bibliothek gehen und mir Akten über die bekanntesten Diebe aus Manhattan und der Bronx ansehen müssen, aber ich wollte keinen Krimi schreiben, der nach Recherche stank. Ausnahmsweise konnte ich mich diesmal aber auf mein Glück verlassen. Ich hatte einen Bruder, der im Morddezernat tätig war. Also machte ich mich auf in die Wildnis von Brooklyn, wo er arbeitete. Ich traf mich mit Harvey Charyn in seinem Polizeirevier in der Nähe des Strandes. Ich sah die Zellen, in denen all die bösen Jungs einsaßen. Ich war im Mannschaftsraum, wo die Polizisten nach dem Einsatz ein Nickerchen hielten. Ich war Charyns kleiner Bruder, der Schreiberling, und die Frauen vom Polizeifunk flirteten mit mir. Ich traf einen Detective, dem im Kampf ein Ohr abgebissen worden war, einen anderen, der mit seinen Affären herumprahlte, und einen dritten, der zwar ständig nervös zusammenzuckte, aber voll bei der Sache war, wenn es heiß herging.
Mein Bruder fuhr mit mir in die Pathologie von Brooklyn, da ich mir ja für meinen Roman Leichen anschauen musste. Der Pathologe führte uns herum. Die Toten sahen alle aus wie Indianer, ihre Haut hatte sich in Baumrinde verwandelt. Ich distanzierte mich von den toten Körpern und redete mir ein, ich sei auf einer Faschingsparty mit Kühlregalen. Es war Harvey, der ein Pfefferminzbonbon nach dem anderen lutschte und ziemlich bleich aussah. Ich war lediglich ein beschissener Voyeur im Haus der Toten.
Aber ich hatte den Anfang einer Kriminalgeschichte: der traurige Job von ein paar Detectives im Brooklyner Morddezernat. Ich fuhr mit ihnen in ihren Zivilwagen durch die Gegend und hörte mir ihren Hass auf die Straße an. Sie waren nicht die Krieger, als die ich mir Detectives immer vorgestellt hatte; sie waren Beamte mit einer Pistole, die besessen vom Gedanken an ihre Rente waren. Und als ich mich an meinen Bruder und unsere gemeinsame Jugend erinnerte, an seine Muskelshirts und seinen Traum, Mr. America zu werden, erschien mir Harvey als der Traurigste von allen. Er war derjenige, der zu Hause Bücher gelesen hatte, aber ich wurde Schriftsteller. Er war der Künstler in unserer Familie, aber ich war auf die High School für Musik und Kunst gegangen. Ich hatte irgendwie den Platz meines Bruders eingenommen, ihn aus dem Weg geschubst. Ich saß schreibend in einer Universität, und er musste sich Leichen ansehen. Er erzählte mir von einem verstoßenen Rabbi, der einen Monat lang in seiner Badewanne vor sich hin gefault hatte; von einer vierzehnjährigen Prostituierten, die von Zuhältern zu Tode getreten worden war, nur weil sie in deren Territorium angeschafft hatte; oder vom Opfer eines Bandenkrieges, dessen Arme in New Jersey gefunden wurden, wäh rend seine Beine auf einer Kartoffelfarm irgendwo auf Long Island begraben lagen. Sein Rumpf wurde nie gefunden.
Ich betrachtete das Gesicht meines Bruders, als er diese Geschichten erzählte. Da war keine morbide Faszination. Er berichtete einfach nur Fakten aus seinem Leben als Detective. Es fühlte sich ziemlich mies an, sich mit seinen Totenakten füttern zu lassen. Und so begann ich meinen Roman über einen blauäugigen Detective namens Manfred Coen. Dieser Blue Eyes war ein sonderbares Amalgam aus Harvey und mir, zwei braunäugigen Jungs. Coen war ein Pingpong-Freak, wie ich früher. Und auch wenn er nicht Harveys Augenfarbe hatte, so hatte er doch das traurige, sanfte Wesen meines Bruders. Ein Streuner in Manhattan und der Bronx, der von Leichen träumte wie Harvey. Ich gab Blue Eyes einen Mentor, Isaac Sidel, seinen Chef im Polizeihauptquartier. Anfangs protegiert er ihn, und später lässt er zu, dass er getötet wird. Isaac ist der finstere Boss und Coen sein blauäugiger Engel, eine Art Billy Budd.
Einen großen Teil von Blue Eyes schrieb ich in Barcelona. Ich war sechsunddreißig und noch nie zuvor im Ausland gewesen. Angekommen war ich in Madrid, fest entschlossen, buchstäblich jeden Balkon in jeder einzelnen Straße aufzusaugen. Ich sah mir die Goyas im Prado an und fühlte mich, als ob mein eigenes Leben auf den blutig düsteren Leinwänden dargestellt wäre: Der Riese, der seine Kinder fraß, hätte in der Bronx geboren sein können. Dann ließ ich mich in Barcelona nieder und schrieb sechs Wochen lang.
Ich beendete Blue Eyes in New York und zeigte es meinem Agenten Hy Cohen. Er sah sich das Titelblatt an: »Wer ist Joseph da Silva?«
Nachdem ich sieben Romane als Jerome Charyn geschrieben hatte und alle gerade dabei waren, in der Versenkung zu verschwinden, hatte ich mich entschieden, einen nom de guerre zu verwenden. Für Blue Eyes hatte ich eine Familie von Marrano-Gaunern erfunden, die ich Guzmann nannte. Isaac Sidel liefert sich einen Kleinkrieg mit dieser Sippe, und die Guzmanns werden zu Erfüllungsgehilfen von Manfred Coens Tod. Da ich für mich selbst auch so ein Sippengefühl wollte, hatte ich mich für den Marrano-Namen Joseph da Silva entschieden und hoffte, dass sich meine Bücher so besser verkaufen würden als die von Jerome Charyn.
Aber Hy Cohen überzeugte mich, Jerome zu bleiben: »Junge, du hast sieben Bücher veröffentlicht. Das ist eine Grundlage. Als da Silva fängst du komplett von vorne an. Im Gegensatz zu jemandem, der sieben Bücher veröffentlicht hat, sind Debütanten eine bedrohte Spezies. Die werden dich da draußen zerfleischen.«
Also veröffentlichte ich Blue Eyes ohne Pseudonym und widmete mich wieder King Jude. Ich schrieb daran in Paris, London, Edinburgh, Connecticut und an der Upper West Side in Manhattan. Der Roman wuchs auf tausend Seiten an, und ich fand immer noch kein Zuhause für meinen König der Barbiere. Während ich weiter Seiten sammelte, schien mein Hinterkopf an einem anderen Buch zu arbeiten. Blue Eyes’ Tod beschäftigte mich immer noch, und ich musste ihn wiederbeleben. Also begann ich mit Marilyn the Wild, was Manfred Coen in seine Vergangenheit zurückbrachte. Isaac Sidel hat eine Tochter, Marilyn, die ständig heiratet, sich wieder scheiden lässt und dabei eigentlich in Coen verliebt ist. Isaacs zwiespältiges Verhältnis zu seinem blauäugigen Engel wurde mir nun klarer. Der alte Chief lehnt die Verbindung seiner Tochter zu Blue Eyes ab, behält das aber für sich. Wenn es um seine Tochter geht, ist er ein Feigling, der nicht riskieren will, dass Marilyn the Wild und er sich entfremden. Hier können wir fühlen, wie das Böse heraufzieht. Isaac ist verrückt nach Marilyn, aber sie ist viel zu selbstständig für einen Alpha-Bullen. Er findet keinen Weg, sie zu manipulieren, also manipuliert er Coen. Und als er Coen in den Tod schickt, bestraft er Marilyn, Blue Eyes und sich selbst.
Aber ich konnte Coen immer noch nicht begraben. Ich musste noch ein Buch schreiben, eines, das an seinen Tod anschloss. Isaac ist nun zu Coens Chronist geworden. Patrick Silver handelt von Isaacs innerer Zerrissenheit. Er hat sich von den Guzmanns einen Bandwurm eingefangen, der aktiv wird, nachdem Coen gestorben ist. Isaac taumelt durch die Stadt, mit diesem Wurm in sich, und träumt, dass Coen noch lebt. Coens Tod hat ihn aus seinem sauberen kleinen Universum gerissen und quält ihn. Manfred und Marilyn waren seine einzige Verbindung zum Leben außerhalb des Polizeireviers. Sie waren Isaacs Geschichte. Jetzt hat er den Wurm.
Ich hoffte, dass die Geschichte nun zu Ende gebracht war. Ich musste mich wieder mit meinem König der Barbiere beschäftigen. Aber der Andorra-Roman blieb tot. Es waren nur Ideen, die sich verselbstständigten, ohne einen eigenen Mythos zu entwickeln. Ich vollführte auf den Seiten herrliche Pirouetten. Ich tanzte von Zeile zu Zeile, aber am Ende war alles nur langweilige Dekoration.
Ich kam zurück zu Isaac und widmete ein ganzes Buch nur ihm: Secret Isaac. Es war Isaacs Geschichte nach seiner privaten Katastrophe. Sein beruflicher Erfolg steigt hier im gleichen Maße, wie seine Depression sich verschlimmert. Der Wurm frisst ihn bei lebendigem Leib, aber Isaac ist jetzt New Yorks Polizeipräsident. Dann passiert etwas Sonderbares: Isaac beginnt, sich selbst zu verspeisen; er ernährt sich von seinem eigenen Wurm. Er nimmt Blue Eyes’ Geist in sich auf. Er wird zu Coen und jault sein eigenes Lied von Unschuld und Schicksal.
Ich dachte über weitere Bücher nach, eine Art Balzac’sche Reihe von Abenteuern, in denen Isaac durch das Land reist und die Vereinigten Staaten verschlingt. Welche Stadt wäre eine Herausforderung für ihn und seinen Bandwurm? Aber ich konnte nicht wie Balzac schreiben. Wenn ich bei meinem Bruder im Revier anrief, sagte die Rezeptionistin: »Ah, Sie sind’s, Jerome. Wie geht’s Blue Eyes?«
Ich bin der Star des Brooklyner Morddezernats. Captains und Lieutenants wollen, dass ich ihre Geschichte aufschreibe. Ich bin ihr Chronist. Und Harvey? Er nimmt mir die Verwicklungen in den letzten drei Büchern über Isaac übel. Er bevorzugt die Reinheit von Blue Eyes. Manfred Coen war aus der Bronx, wie er und ich. Manfred Coen war auf der High School für Musik und Kunst gewesen. Ich bin mir sicher, dass er sich Coen als Bodybuilder vorstellt, aber Coen war zu beschäftigt damit, sich von Marilyn anhimmeln zu lassen, um Gewichte zu heben. Blue Eyes hätte aus seinem Revier sein können. Blue Eyes wäre einer von seinen Jungs gewesen.
Aber ich sehe Manfred Coen anders. Blue Eyes war zu einem Geist geworden, lange bevor er getötet wurde. Seine Eltern hatten Selbstmord begangen, und Coen war eine Waise von »Musik und Kunst«, die irgendwie zwischen Isaac und Marilyn gefallen war und nicht wieder hatte aufstehen können. Seine Abwesenheit – vor und nach seinem Tod – scheint die vier Bücher voranzutreiben.
Isaac reist im vierten Buch nach Irland und besucht Leopold Blooms Haus in der Eccles Street. Er ist ein Polizist, der James Joyce liebt, allerdings geht seine Pilgerreise über die Liebe zur Literatur hinaus. Ist Bloom nicht der Vater, der Isaac hätte sein können? Isaac hatte sich in Coen seinen eigenen Stephen Dedalus geschaffen, aber er hatte ihm defekte Flügel gegeben. Er »erschafft« sich Coen, zerstört ihn und leidet unter den Wunden, die diese Zerstörung hinterlassen hat. Und warum fühlte sich Blue Eyes zu Isaac hingezogen? Suchte er einen Vater, der ihn nicht verlässt? Oder wusste er, dass alle Väter Zerstörer sind, die guten wie die bösen?
Was weiß ein Autor schon? Für mich bestehen die vier Bücher aus einem gewaltigen Durcheinander von Vätern und Söhnen. Mein eigener Vater war ein Fellhändler, der niemals sprach. Er knurrte einfache Sätze, die eher nach einem missmutigen Wolf klangen. Aber ich hatte Harvey, der mir das Wolfsknurren übersetzte. Egal in welche Schwierigkeiten mich die Bronx wieder gebracht hatte, er half mir raus. Er war für mich Vater und älterer Bruder und ein bisschen sogar Mutter. Obwohl er mich im Stich ließ, als ich zwölf war, und mich vor seiner neuen Freundin verprügelte. Er musste sich eben um seine Muskelshirts kümmern und hatte keine Zeit für einen dürren Jungen, der ihm hinterherlief.
Isaacs Wurm hatte wohl ziemlich lange in mir geschlummert. Er war in einem mehr als dreißig Jahre alten Riss zwischen mir und Harvey geboren worden. Vergiss das Morddezernat Brooklyn, es braucht schon einen Sherlock Holmes, um die Wurzeln einer Geschichte aufzuspüren. Ich war zu Harvey gegangen, um Material für einen einfachen Krimi zu sammeln, und am Ende hatte ich vier Bücher über ihn und mich und einen hartnäckigen Bandwurm geschrieben.
Schließlich hatte ich meinen König der Barbiere verworfen. Andorra war nicht der magische Ort, an dem sich Jungen und Könige gegenseitig heilen konnten. Ich hatte tausend Jahre Geschichte für Jude entworfen, eine Chronologie, die unglaubliche Details enthielt, aber sie war aus reiner Vermeidungsstrategie gesponnen und diente nur der Flucht. King Jude ist ein kaltes Buch. Mythologie ohne Wurm.
Vielleicht hatte ich mehr von Ross Macdonald übernommen, als ich mir selbst eingestanden hatte. Macdonald taumelt in The Galton Case in seine eigene Vergangenheit zurück, webt eine Erzählung um seine eigene Wunde, ein nagendes Gefühl der Unrechtmäßigkeit. Der Hochstapler, der vorgibt, der Sohn von Anthony Galton zu sein, trägt einen Teil von Macdonald in sich. Oder besser gesagt Kenneth Millar, da Ross Macdonald Millars Pseudonym war. »Ich war seit Jahren von einem imaginären Jungen besessen, der eine Art dunkle Seite meiner eigenen Jugend widerspiegelte. Mit sechzehn Jahren hatte er bereits in fünfzig Häusern gelebt und in jedem davon die Sünde der Armut begangen. Ich konnte nicht ohne Zorn und Schuldgefühl an ihn denken.«3
Wie jeder Erzähler ist Macdonald »ein Anmaßender, mit einem Abschluss aus dem Armenhaus, der versucht, sich einen Weg in den Palast zu lügen«4. Ich bin auch einer dieser »Anmaßenden«, der hofft, mit Isaac Sidel und Manfred Coen in den Palast gelassen zu werden.
Aus dem Amerikanischen von Malte Belz
1 Ross Macdonald: »Writing the Galton Case«. In: Ders.: Self-Portrait: Ceaselessly into the Past. Santa Barbara 1981.
2 Ebd.
3 Ebd.
4 Ebd.
BLUE EYES
TEIL EINES
1
»Shotgun Coen.«
Der diensthabende Lieutenant versetzte seinem Untergebenen einen Rippenstoß und blinzelte der Hilfspolizistin zu, einer Portorriqueña, die zwischen den Dienstzeiten die Telefonzentrale bediente und eine Schwäche für Polizeibeamte hatte; sein Untergebener machte sich Hoffnungen, diese Portorriqueña weich zu kriegen, indem er sich die Haare in seiner Nase auszupfte und es mit französischem Parfüm probierte, doch er hätte niemandem erzählen können, welche Farbe ihre Unterhose hatte oder sich auch nur über einen Schönheitsfleck oberhalb ihrer Knie äußern können. Isobel bevorzugte die Männer von der Mordkommission und vom Überfallkommando.
Die fünf uniformierten Streifenpolizisten, die im Mannschaftsraum standen, blickten in die gleiche Richtung. Sie missgönnten den Polypen im ersten Stock die Privilegien: golden glänzende Dienstabzeichen, ruhmreiche Aufgaben und die Chancen bei Isobel. Über die Kriegsrüstung dieser Kampftrupps machten sie sich lustig: Schießeisen, Zigarren und Fiberglaswesten. DeFalco, Rosenheim und Brown, drittklassige Beamte, die sich etwas auf ihre schlecht gebundenen Krawatten zugutehielten, konnten sie dulden; diese Art von Aufschneiderei waren sie gewohnt. Coen war ihnen zuwider. Er verdiente mehr als ihr eigener Vorgesetzter und war außerdem noch zum Kommissar ernannt worden. Jetzt saß er auf seinem Bürosessel oder gab Botschaftern und Filmstars im Auftrag des Sonderdezernats das Geleit. Für sie stand fest, dass er für den First Deputy Commissioner spionierte. Sie beteten, er möge mit einer Kugel im Kopf zurückkommen.
Nur Isobel wünschte ihm Glück. Vor ihm hatte sie nie einen Israelita mit blauen Augen kennengelernt. Er forderte sie nicht dazu auf, auf einer der harten Bänke hinter dem Mannschaftsraum zu strippen, wie DeFalco und Brown. Coen nahm sie mit in seine Wohnung, zog sie richtig aus, kaufte ihr Erdbeertörtchen, setzte sich eine Stunde lang mit ihr in die Badewanne und drängte sie nicht, sich schnell wieder anzuziehen. Sie bemerkte, dass er seine Waffe in einer Einkaufstasche trug. DeFalco stellte sich zwischen Coen und Isobel. Er erwartete mehr Aufmerksamkeit von ihr. Vor einer Stunde, direkt vor Beginn ihrer Arbeitszeit, hatte sie ihm neben den Umkleidespinden den Reißverschluss aufgezogen. DeFalco befestigte den Lendenschutz an seiner Fiberglasweste und blieb vor Isobel stehen. Sie weigerte sich immer noch, ihn anzusehen. »Wo ist der Knabe?«, knurrte er Coen an.
»Auf der Treppe.«
Dann zogen sie los, an Isobel und dem Sicherheitswächter vorbei, vier Bullen aus Manhattan. DeFalco, Rosenheim und Brown ignorierten Arnold den Spanier, der auf den Stufen zum Revier saß und Coens Handschellen trug. Arnold war ein schwarzer Puerto Ricaner mit einem Klumpfuß. Er war mit Polizeibeamten in zivilen Wagen gefahren, immer möglichst nahe an der Sirene, und hatte sein Leben bei der Mordkommission verbracht, bis der Commander ihn rauswarf, weil er männliche Gefangene anspuckte und weiblichen Verdächtigen sowie der Hälfte aller Hilfskräfte unzüchtige Anträge machte. Arnold saß verdrossen unter den grünen Laternen. Er wollte den Bullen helfen, den Taxigangster Chino Reyes am Wickel zu kriegen, weil er sich damit die Erlaubnis erringen wollte, sich wieder um den Drahtverhau im Mannschaftsraum zu kümmern. DeFalco empfand kein Mitleid für Arnold. Der Knoblauchfresser war Coens persönlicher Lockvogel; niemand sonst hätte einen Tipp von ihm bekommen. Mit dem Gewicht auf seinem kaputten Fuß warf Arnold einen kurzen Blick in Coens Einkaufstasche. »Ich habe den Chinesen gesehen, Manfred, ich schwöre es dir. Er hat an einem Lammkotelett geknabbert. Bei Bummy, am East Broadway.«
Rosenheim runzelte die Stirn. »Seit wann mischt sich der Chinese unter Wachtmeister und Zivilpolizisten? Du weißt selbst, wer bei Bummy rumhängt. Hör mal, Coen, aus der Bar kommen wir nie wieder heil raus.«
»Bummy«, beharrte Arnold.
»Steig ein«, sagte Brown. Arnold musste sich ziemlich verrenken, um sich mit seinem orthopädischen Schuh in Bewegung zu setzen. Beim sechsten Versuch kam er die Stufen runter. Er klemmte sich zwischen Coen und Brown auf den Vordersitz des grünen Ford. Brown musste fahren, weil er der Jüngste war. DeFalco und Rosenheim ließen sich auf den Rücksitz fallen. »Knoblauch-Arnold?«, flüsterte DeFalco. »Sirene einschalten?«
Arnold setzte seiner Haut mit den Handschellen zu. Er rieb, bis sich blaue Striemen auf seinem Handgelenk zeigten, aber er konnte nicht Nein sagen. Sie überfuhren drei rote Ampeln. Unter ihren Knien wirbelte die Sirene, und Arnold wurde steif. Für eine lange Fahrt mit den Bullen hätte er sogar darauf verzichtet, die Frau des Krämers zu bumsen. Er hielt seine Handschellen hoch, damit man sie von draußen sehen konnte.
»Halt ihn fest. Der Kerl fliegt noch durchs Dach.«
Coen schaltete die Sirene ab. »Lasst ihn in Ruhe.« Arnold wischte sich die Lippen ab. Rosenheim kriegte sich nicht ein. Coen ließ die Einkaufstasche an seinen Schenkeln entlanggleiten.
Rosenheim bekam wieder genug Luft, um zu schreien: »Er hat recht. Coen hat recht. Die besten Köpfe unserer Polizei sind auf der Suche nach dem Lippenstift-Freak, und wir geben uns mit einem gewöhnlichen chinesischen Nigger ab, der Taxifahrern eins aufs Dach gibt. Warum hat man nicht mich und den Spanier auf den Freak angesetzt? Wir hätten ihn platt gewalzt, ihm seinen Schneppel abgehackt und ihm gezeigt, dass man in Manhattan North nicht einfach puerto-ricanische Babys abmurksen kann.«
»Rosenheim«, sagte DeFalco, »jetzt hör schon auf, dem Spanier hausinterne Informationen zu geben. Er könnte sich ein falsches Bild machen. Dann haben wir zwei Freaks am Hals. Soll er doch Chino auf den Fersen bleiben. Coen und der Chinese sind Cousins.«
Rosenheim und DeFalco lächelten. Sie brauchten sich gar nicht erst zuzuzwinkern; beide wussten, dass Coen als Erster durch Bummys Tür gehen würde, und falls der Chinese ihn zufällig abknallen sollte, würden sie ihm nicht nachtrauern. Sie schätzten den Wunderknaben in ihren Reihen nicht besonders. Der First Deputy hatte ihnen Coen auf den Schoß gesetzt. Ein Team ohne Coen wäre ihnen lieber gewesen. Wenn es um Ohrfeigen und schmutzige Detektivarbeit ging, konnten sie sich auf Brown verlassen. Coen hatte in der Abteilung des First Deputy seinen Rabbi verloren, und seine neuen Chefs konnten ihn gar nicht schnell genug wieder loswerden. Sie schubsten ihn von einem Revier zum anderen. Trotzdem musste man in seiner Gegenwart aufpassen, was man sagte. Vielleicht hielten die Chefs sich Coen warm. Nur ein Geistesgestörter würde sich bei einem ehemaligen Schleimer gehenlassen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!