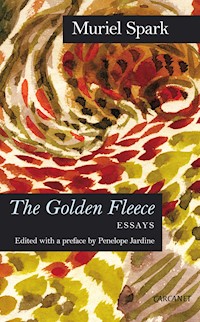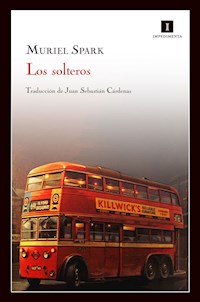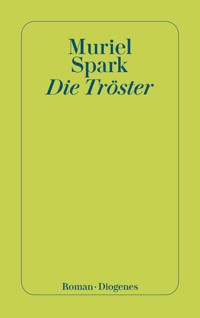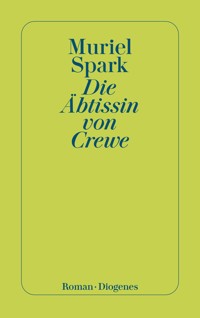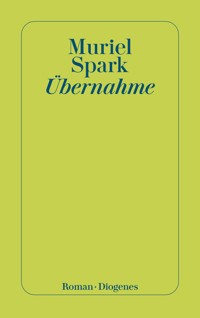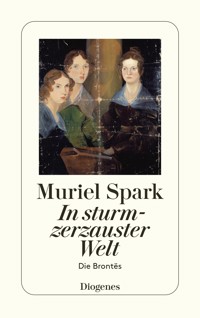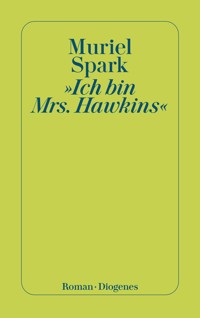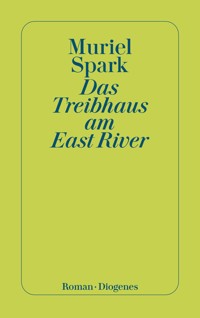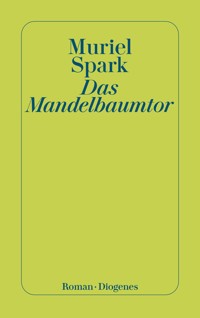
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Muriel Spark erzählt das Abenteuer der englischen Lehrerin Barbara Vaughan. Sie ist eine zum Katholizismus konvertierte Halbjüdin und liebt einen verheirateten Mann, der nach katholischem Recht nicht geschieden werden kann. Sie ist in die zweigeteilte Stadt Jerusalem gekommen, um sich selbst zu finden. Als sie die Grenze nach Jordanien überquert, löst sie damit eine abenteuerliche Ereigniskette aus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Muriel Spark
Das Mandelbaumtor
Roman
Diogenes
Für Lynn und
Virginia Carrick
Teil I
Freddys Spaziergang
Manchmal brachte Freddy Hamilton statt eines Briefes an seine Gastgeberin eine Handvoll Verse von traditionellem Bau zu Papier – Rondeaux redoublés, Villanellen, Rondels oder sizilianische Oktaven –, um seinem Dank einen artigen Ausdruck zu geben. Es war ein angeborenes Taktgefühl, das ihn dazu veranlaßte. Immer plagte ihn der Gedanke, ein langweiliger Gast gewesen zu sein, denn schließlich war man im Leben verpflichtet, sich von seiner angenehmsten Seite zu zeigen. Nicht so sehr beim Besuch selbst, danach vielmehr schlug ihm heftig das Gewissen, weil er auch, als die Unterhaltung zwischen Suppe und Fisch lebhafter geworden war, kein einziges Wort von sich gegeben hatte; sein Gewissen regte sich, dachte er an die Cocktail-Stunden zurück, zu denen er nichts beigesteuert hatte als das Lächeln, für das er schon im Kinderwagen – und seither allerorten, fünfzig Jahre lang – berühmt gewesen war. «Oh, natürlich, Freddy Hamilton. Den guten Freddy mögen alle gern; ein reizender Mensch!»
So hieß es in den vielen britischen Konsulaten, durch die ihn seine bescheidene, subalterne Laufbahn geführt hatte, und er wäre wohl gerührt gewesen, wäre es ihm zu Ohren gekommen; er hätte gelächelt. Eigentlich lag ihm gar nichts daran, bei seinen Freunden irgendwelche Leidenschaften zu wecken oder in ihren Gedanken als besonders aufregender Gegenstand zu figurieren. Ein außergewöhnlich langweiliger oder auch ein außergewöhnlich unterhaltsamer Gast konnte bei den Leuten alle möglichen, nicht eben wünschenswerten Reaktionen hervorrufen – Gefühlsergüsse, Maßlosigkeiten, unerträgliche Anhänglichkeiten, kurz jene Art von Emotionen, die schon auf der Schule und der Universität immer zu Ärger geführt hatten; und zu internationalen Zwischenfällen führten sie auch.
Er liebte es, seine Verse schnell herunterzusagen; man sollte ihnen keinerlei Mühe anmerken. Während er durch die erstaunlichen Gassen des Orthodoxen-Viertels im israelischen Jerusalem wanderte, die sich so gefährlich nah am Mandelbaumtor drängten, begann er an ein Triolett der langerprobten Art zu denken, das am nächsten Tag mit dem Postsack des Außenministeriums nach Jordanien gehen sollte. Eben erst war er durch das Tor zurückgekommen. Er besaß Diplomaten-Immunität und somit die Erlaubnis, an jedem Wochenende das Tor zu passieren, von Israel nach Jordanien und wieder zurück; von Jerusalem nach Jerusalem. Nur wenige Leute gingen von Israel nach Jordanien hinüber; es machte Schwierigkeiten, und bei Europäern war ein Taufschein erforderlich. Ausländische Diplomaten durften den Kontrollpunkt nicht mit dem Wagen passieren; das war verständlich, denn in einem Wagen konnten Dokumente und Bomben versteckt sein.
Freddy trug sein Wochenendgepäck – eine Tasche mit Reißverschluß – und schlug seinen üblichen Weg in die Neustadt ein. Es war der bisher heißeste Tag des Jahres 1961. Das Taxi, das am Tor wartete, hatte er zurückgewiesen; hier wie überall auf der Welt war ihm Taxifahren ein Greuel; sein moralisches Empfinden sträubte sich gegen die Trinkgelder. So war es auch all seinen Onkeln ergangen. Ausgenommen natürlich einen Onkel, den, der in den dreißiger Jahren sein Vermögen durchgebracht und die Familie restlos ruiniert hatte: dessen Inneres hatte sich nicht dagegen gesträubt, Trinkgelder an Taxifahrer und so weiter zu verschleudern. Als Freddy um eine Ecke bog, stieß er mit einem winzigen dunkeläugigen Jungen zusammen, dem flaumiges Schläfenhaar über die Wangen fiel, zu fein noch, um sich zu glänzenden Löckchen ringeln zu lassen, wie sie die älteren Männer der Orthodoxen-Sekte trugen. Die Nase des Jungen stieß an Freddys Knie, und Freddy nahm ihn bei der Hand, um ihn über seine Verwirrung hinwegzubringen. Ein bärtiger, alter Mann im Kaftan mit einem massigen Gesicht murmelte dem Kleinen, der sich schon wieder gefaßt hatte und Freddy nun angelegentlich von Kopf bis Fuß musterte, etwas auf hebräisch zu. Eine Frau von unbestimmbarem Alter, die eine Unmenge schwarzer Gewänder trug, riß das Kind los, und es trottete davon. Die Beinchen in den langen Wollstrümpfen bewegten sich hurtig wie Weberschiffchen, um mit der Mutter Schritt zu halten, aber immer noch drehte sich der Kleine verwundert nach Freddy um. Währenddessen zankte die Frau ihn aus; offenbar versuchte sie ihm einzuprägen, daß Freddy eine unerwünschte Person sei. Freddy ging weiter, hinter dem schwergekleideten Paar her, und hatte das sichere Gefühl, etwas Unrechtes getan zu haben, als er die Hand des Kindes berührte; vermutlich hatten sie ihn für einen modernen Juden gehalten, einen der gewöhnlichen Israelis, die bei dieser Sekte noch stärkere Mißbilligung fanden als der ehrliche, unreine Fremde. Nun ja, dachte Freddy, wo war ich stehengeblieben …
… zög es vor,
mich für die schöne Zeit in franken
und freien Worten zu bedanken,
doch bring ich wieder nichts hervor
als Reimesranken …
Es war übrigens kein Triolett. Joanna, seine Gastgeberin auf der anderen Seite, hatte sich überaus liebenswürdig gegen ihn gezeigt, seit er seinen Posten in Israel angetreten hatte. Drei Wochenenden hatte er in ihrer kühlen Villa verbracht, und sie freute sich über diese Dankeschön-Verse. Eine Strophe würde noch hinzukommen müssen, vielleicht auch zwei. Joanna sollte ihn hier drüben in Israel besuchen; bis jetzt war sie noch nicht in Israel gewesen. Er würde sie an ihr Visum erinnern und ihr sagen müssen, wie sie am besten herüberkam. Es war übrigens kein Triolett, eher eine Art Rondeau. Also das Visum für Joanna mußte beschafft werden, und er würde sie diesseits des Mandelbaumtors erwarten. Einfach absurd, die ewige Spannung am Tor. Man konnte die Grenzzwischenfälle verstehen, solange sie unter den Soldaten immer wieder jäh und unberechenbar aufflackerten. Aber dort am Tor waren das Mißtrauen und die Vorsichtsmaßnahmen der Posten einfach absurd. Kein israelisches Geld nach Jordanien, keine israelischen Postkarten, die jordanischen Polizisten fast physisch unfähig, das Wort ‹Israel› über die Lippen zu bringen. Die israelische Polizei gebärdete sich unmäßig dramatisch: «Kommen Sie heil an», hieß es gewöhnlich, wenn man die Kontroll-Baracke verließ. Der Träger auf der israelischen Seite rannte los, warf das Gepäck auf halbem Wege hin und rannte wieder zu seinem Platz zurück, als gälte es sein Leben. Der jordanische Träger wartete, bis die ganze Wegstrecke leer war; dann rannte er die paar Schritte zu den Taschen hin, ergriff sie und rannte damit zu seinem Platz zurück, als gälte es sein Leben. Alles wurde dramatisiert. Warum mußten die Menschen alles auf die Spitze treiben, warum konnten sie nicht maßhalten? Freddy stieß mit einem Mann in europäischer Kleidung zusammen, der aus einem Laden stürzte, wie sie’s alle taten. Der Mann sagte irgend etwas auf arabisch. Freddy hatte ihn für einen Juden gehalten. Manchmal konnte man sie nicht unterscheiden. Einige hatten ganz dunkle Haut, pechschwarz fast. Warum konnten die Menschen nicht maßhalten?
Es war übrigens kein Triolett, sondern eine Art Rondeau. Freddy bog in eine Gasse ein. Wieder prallte ein Kind, diesmal ein Mädchen, mit ihm in der engen, von Menschen wimmelnden Straße zusammen. Diesmal streckte er keine helfende Hand aus, und die Kleine schlüpfte mit dem scheuen Ausdruck davon, der den Kindern dieses Viertels eigen war, im Unterschied zu der lebhaften Jugend bei den gewöhnlichen Israelis. Sie taten Freddy leid, die Jungen mit ihren würstchenartigen Schläfenlocken und dem schwarzen Knickerbocker-Aufzug, besonders die Halbwüchsigen, die zu zweit oder dritt so tugendsam dahergingen. Es muß die Hölle für sie sein, dachte er, sich so von allen anderen im Lande zu unterscheiden, besonders wenn sie sich eines Tages von all dem losmachen wollen. Auch die arabischen Jungen auf der anderen Seite hatten ihm leid getan, wie sie unterernährt, dürr und in Lumpen ihre räudigen Esel trieben. Seine eigene Jugend fiel ihm ein, seine Schulzeit, und Mitleid mit allen Jungen ergriff ihn. Er war überzeugt, daß die mit den Löckchen durch die gleiche Hölle gingen – die einzige, die ihm bekannt war. Die Löckchen waren einfach absurd, wie das Tor.
«Einfach absurd!» Kraft dieser Worte hatte er überall in der Stadt Freundschaften geschlossen. An exotische Anblicke war er gewöhnt, an widerwärtige Gerüche, an enge orientalische Straßen und an Menschen, die eine Neigung zum Extremen hatten – das alles gehörte zum Auslandsdienst. Doch weder außerhalb noch selbst in der Botschaft wurde er mit den Leuten richtig warm, bevor sie nicht früher oder später die Bemerkung machten, daß alles hier einfach absurd sei.
… in franken
und freien Worten zu bedanken,
doch bring ich wieder nichts hervor
als Reimesranken …
Doch nun, Joanna, laß dein Schwanken.
Nimm meine Verse mit Humor
und neig zugleich ein freundlich Ohr
der Bitte: Komm! Raff dich empor!
Passier die ganz absurden Schranken
am Mandelbaumtor!
Er näherte sich dem Ende des Orthodoxen-Viertels und war in eine Straße eingebogen, an deren Ende der moderne Staat lärmte. Dort barsten kleine Läden vor Geschäftigkeit, schwere Wagen rasten über die Schnellstraße, und überall verkündeten Radioapparate in Sprachen, die von der hebräischen bis zu der der BBC reichten, die neuesten Nachrichten oder erfüllten die heiße Luft mit orientalischem Jazz. Dort, am Ende dieser orthodoxen Straße, so hieß es, sammelten sich gewöhnlich am Samstagmorgen die orthodoxen Juden, um in frommem Eifer die vorüberfahrenden Wagen, Sabbatschänder, zu steinigen. Und auf der anderen Seite der Straße spannten sich Spruchbänder von Gebäude zu Gebäude, auf denen in hebräischer, französischer und englischer Sprache die Ermahnung zu lesen war:
TÖCHTER ISRAELS,
WAHRT ANSTAND AUF DIESEN STRASSEN!
Das, nahm Freddy an, war zum Besten aller Touristinnen gedacht, die vielleicht aus irgendeinem verrückten Grund im Orthodoxen-Viertel in Shorts oder in einem tiefausgeschnittenen Sommerkleid spazierengehen wollten. Die einheimischen Frauen selber hatten solcherlei Warnung nicht nötig. Sie waren ja so oder so das ganze Jahr über gleichbleibend gekleidet und verhüllt.
Fürs erste war Freddy in Zimmern eines Jerusalemer Hotels untergebracht worden, solange noch keine Botschafts-Wohnung frei war. Er hatte es nicht sonderlich eilig mit der Wohnung, denn er zog das Leben im Hotel vor, wo man sich nicht ständig unter die Leute mischen, nicht dauernd die Kollegen unterhalten mußte, sondern sich derlei Verpflichtungen im allgemeinen entziehen konnte. Die Kollegen hier an der Botschaft schienen ihm ein bißchen heftig und neunmalklug; es war eben Nachwuchs, und sie hatten sich noch nicht die Hörner abgestoßen. Als Freddy die Straße überquerte, bemerkte er eine junge Frau, die zur Zeit auch in seinem Hotel wohnte, eine Miss Vaughan. Sie wurde von einem hochgewachsenen, intellektuell wirkenden Juden begleitet. Freddy setzte seine Tasche auf der heißen Straße ab. Er wollte Miss Vaughan ausnehmend höflich begegnen. Er hatte sie eines Abends bei zwei Long Drinks im blätterkühlen Hof des Hotels kennengelernt und bei einer anderen Gelegenheit dann – ohne böse Absicht – eine unglückliche Bemerkung gemacht. Seine Verlegenheit war Miss Vaughan damals nicht entgangen.
Er wartete am Rand der Straße, und sie kamen zu ihm herüber und erkundigten sich, ob er ein schönes Wochenende gehabt habe. Ihren Begleiter hatte er zuvor schon, wenn auch nur flüchtig, kennengelernt: Dr. Saul Ephraim, Dozent für Archäologie an der Hebräischen Universität; er begleitete Miss Vaughan als Führer. Es hatte sich herausgestellt, daß er ein liebenswürdiger Mensch war, auf jene überraschende Art, die israelischen Intellektuellen eigentümlich ist; man war überrascht, weil man von einer Geige, deren Saiten gespannt und gestimmt sind für den unmittelbar bevorstehenden Einsatz, nicht erwartet, daß sie plötzlich liebenswürdig ist. Dr. Ephraim sprach ein leicht amerikanisch gefärbtes Englisch, überraschend liebenswürdig und mühelos locker, wie aus einer natürlichen Begabung heraus, die nur auf eine Begegnung mit Freddy gewartet hatte, um sich zu entfalten. Er trug ein Hemd mit offenem Kragen und Flanellhosen, sein Hals war schlank und mager-muskulös. Freddy plauderte, während er diese Beobachtungen machte, von seinem Wochenende in Jordanien. «Ich habe ein paar ganz reizende Freunde drüben.» Ephraim mochte Anfang Dreißig sein. Er war erpicht darauf, Neues aus Jordanien zu hören.
«Sind Sie noch nie dort gewesen?» sagte Freddy.
«Seit dem Krieg nicht.»
«Natürlich, seit dem Krieg nicht.» Der ‹Krieg› war für Ephraim der Krieg von 1949.
«Es ist absurd», sagte der junge Dr. Ephraim.
In der Nähe begann man Wassermelonen auszuladen. Freddy war einmal von der Ecke einer Lattenkiste getroffen worden, als er bei einer solchen Ladeaktion in Covent Garden vorüberkam. Er wurde nervös und zog das Paar mit sich auf die Seite.
«Sie müssen beide auf ein Glas herüberkommen, wenn Sie fertig sind», sagte er dann und nahm seine Tasche auf.
Miss Vaughan wollte eben etwas erwidern, als ein bärtiger, bejahrter Mann mit schmalen, alten Augen aus der Menge auf sie zutrat und in gutturalem Hebräisch auf Dr. Ephraim einredete. Ephraim gab eine knappe Antwort und machte dabei mit Händen und Schultern eine Geste, als werfe er die Worte des anderen in die Luft. Der alte Mann entgegnete noch etwas und entfernte sich dann brummend, nicht ohne noch einen schiefen Blick auf Miss Vaughan zu werfen.
«Was hat er gesagt?» sagte sie.
«Er sagte: ‹Machen Sie Ihrer Freundin klar, daß sie sich anständig anziehen soll, wenn sie durch diese geheiligten Straßen geht, so wie es immer Sitte gewesen ist!›»
Freddy musterte Miss Vaughan, um zu sehen, wie sie eigentlich gekleidet war. Sie trug eine harmlose Bluse, ärmellos, und einen dunklen Rock. Er blickte zu den mahnenden Spruchbändern hinauf und lächelte sein Lächeln. Er lächelte Miss Vaughan an, die mit ihren herben Zügen und dem korrekt zurückgesteckten grauschwarzen Haar dastand und gleichgültiger dreinsah, als sie Freddys Meinung nach in Wirklichkeit war. Wenn er sie mit ihrem Begleiter verglich, mochte sie gegen Ende Dreißig sein. Immer noch fragte sie Dr. Ephraim nach seinem Wortwechsel mit dem alten Mann aus: «Und was haben Sie ihm darauf geantwortet?»
«Ich sagte: ‹Nun, es ist ein heißer Tag heute.› Und er gab zurück: ‹Nun, heute vor zweitausend Jahren war auch ein heißer Tag.›»
Freddy war froh, das Paar getroffen zu haben, denn nach den Wochenenden auf der anderen Seite fühlte er sich immer ein bißchen einsam. Er bahnte sich seinen Weg durch die Straßen mit ihren herumlungernden Mystikern und Bettlern, die den Israelis allgemein ein Greuel waren, und prallte immer wieder mit den Frauen zusammen, die mit ihren Einkäufen und ihren Kindern aus den Ladentüren stürzten, ohne nach rechts oder links zu sehen. Vielleicht, überlegte er, konnte der junge Saul Ephraim ihm einen Hebräischlehrer empfehlen, wenn er ihn darum bat und Miss Vaughan nicht vergaß, ihn nachher auf einen Drink mit ins Hotel zu bringen. Man sollte schon ein bißchen modernes Hebräisch lernen, um hier im Land zurechtzukommen. Vielleicht übernahm Ephraim selber die Aufgabe; aber als er darüber nachdachte, wie unwahrscheinlich das war, ärgerte er sich, daß es ihm überhaupt erst in den Sinn gekommen war. Es waren nicht eben viele Israelis, deren Bekanntschaft man machte, nur die Beamten und so weiter. Aber natürlich hatte man ja auch nicht allzuviel Zeit. Die wöchentlichen Besuche auf der anderen Seite nahmen seine freien Tage in Anspruch. Einunddreißig oder zweiunddreißig mochte Dr. Ephraim sein. Abdul Ramdez, der Agent von der Lebensversicherung, der Freddy hartnäckig, aber erfolglos eine Police aufzuschwätzen versuchte, sonst aber ganz amüsant war, hatte begonnen, ihm Arabischstunden zu geben. Ramdez mochte Mitte Zwanzig sein. Man mußte sehr aufpassen, wen man sich als Hebräisch- und Arabischlehrer nahm; die Leute hier hatten allesamt eine Neigung zur Heftigkeit. Ramdez war ein armenischer Araber – so behauptete er wenigstens.
Psalmodierender Gesang von Kinderstimmen drang aus einem Oberstockfenster, als Freddy sich durchs Gewühl der Straße drängte, der Modernität und seinem Hotel entgegen. In diesem Oberstock befand sich eine Schule; sie war stets von solchem Gesang erfüllt, wenn er vorüberkam, denn die Kinder dieser Sekte lernten ihre Lektionen, gleich welchen Fachs, auswendig, indem sie die hebräischen Texte in klagender Eintönigkeit vor sich hin sangen. Das faszinierte ihn immer wieder, aber es brachte ihn zugleich auch aus dem Konzept, denn gewöhnlich war er, wenn er an der Stelle vorüberging, in Gedanken bei seinen Dankeschön-Gedichten. Gegenwärtig hatte er bereits die dritte Strophe des neuen Opus im Kopf, in der Joanna schicklich und taktvoll daran zu erinnern war, sich ein Visum zu besorgen und auf alle Fälle als Grund für die Reise anzugeben, daß sie eine Pilgerfahrt zu den heiligen Stätten der Christenheit unternehmen wolle.
Doch das psalmodierende Singen dieser Kinder des Orients brachte ihn aus dem Rhythmus, selbst noch, als er es längst nicht mehr hören konnte und schon in der modernen Stadt war, mitten im Menschen- und Motorgewirr der schnellen, breiten Straßen. Auf dem ganzen Weg zurück ins Hotel, als die Sonnenglut ihm schon jede Lust genommen hatte, sich noch weiter darum zu kümmern, und seine Gedanken nur mehr Hitzewellen waren, klang der monotone Gesang der Kinder in ihm nach, begleitet, wie stets auf diesen Heimwegen, von einer deutlichen Gegenstimme, die sich spontan und unbezähmbar in Freddy erhob: Kultur gegen Kultur ausspielend, sangen die metrischen Unterweisungen von Samuel Taylor Coleridge zärtlich in seinem Kopf herum:
Lang-kurz der Trochäus schreitet;
feierlich im Gleichlauf gleitet
der Spondeen breiter Fluß,
hurtig gefolgt von des Daktylus Verseschluß.
Der Jambus springt von kurz nach lang;
Anapäst hüpft als Leichtfuß die Zeile entlang;
der Amphibrachýs eilt mit hastigen Schritten,
zwei Kürzen zur Seite, die Länge inmitten.
Silbe eins, Silbe drei: lang die zwei; Mitte kurz,
so donnern des Kretikus Hufe beim Rennen im Sturz.
Selbst im Bad noch, als er an andere Dinge dachte, rumorten Coleridges Verse weiter im Hintergrund – selbst als sie längst den eintönigen hebräischen Chorgesang verscheucht hatten –, und selbst noch, ihm freilich kaum mehr bewußt, als er draußen im kleinen grünen Hof des Hotels saß und auf Miss Vaughan und Dr. Ephraim wartete. Er wollte Miss Vaughan ausnehmend liebenswürdig begegnen, nachdem er letzte Woche bei ihrem dritten oder vierten Zusammensein so ins Fettnäpfchen getreten hatte. Mehr als alles andere haßte Freddy den Gedanken, die Gefühle eines Menschen in offenem Zusammenstoß verletzt zu haben. Hoffentlich brachte sie den Archäologen mit dem schlanken braunen Hals mit. Der Nachmittag ging zur Neige. Er klopfte leise mit den Fingern auf die Armlehne seines Korbstuhls und blickte durch das hohe Gitterspalier in die kühlende Helle hinauf.
Lang-kurz der Trochäus schreitet …
Der Kellner brachte den Drink, und Freddys Gedanken weilten einen fröhlichen und nicht undelikaten Augenblick lang bei dem jungen Israeli. Er fühlte sich wie Horaz in der Ode, der in seiner Weinlaube schlichten Dienst erbittet. Persicos odi, puer …
Von seinem Platz aus sah er Miss Vaughan im Hoteleingang erscheinen, allein. Sie ging auf die Treppe zu, warf jedoch einen flüchtigen Blick zur Terrasse hinüber. Freddy stand auf, hob seinen Arm mit einladender Geste, und sie wandte sich um und kam zu ihm.
«Dr. Ephraim konnte es leider nicht mehr einrichten; es war schon ziemlich spät, und seine Familie erwartete ihn. Eigentlich sollte ich hinaufgehen und mich umziehen.»
«Was trinken Sie?» sagte Freddy. Die erste Begegnung mit Miss Vaughan trat ihm jetzt wieder vor Augen, verschmolzen mit Begegnungen hier im grünen Hof, die darauf gefolgt waren. Er sah sie alle vor sich mit jenem umfassenden Wahrnehmungsvermögen, das vielleicht einen Dichter aus ihm hätte machen können, wenn nun nicht der entscheidende Funke gefehlt hätte. Zuerst hatte er den Eindruck gehabt: eine nette englische Jungfer; sie war Englischlehrerin an einer Mädchenschule; sie bereiste das Heilige Land; er hatte mit ihr das ihm so teure Thema traditioneller englischer Lyrikformen diskutiert; er hatte ihr, bei einer anderen Gelegenheit, anvertraut, daß er in seiner Freizeit damit beschäftigt sei, eine Anthologie zusammenzutragen, und vor dem Krieg ein Bändchen mit Versen veröffentlicht habe, die er selbst gelegentlich verfaßt hatte. Ihre Antworten waren von jener vorurteilsfrei objektiven Art gewesen, die man gern hatte. Sie war leicht reizbar; sie trug einen Verlobungsring mit antiker Fassung, in die ein dunkelblauer Stein eingelassen war. Aber aus irgendeinem Grund war es Freddy gar nicht in den Sinn gekommen, daß dieser Ring etwas mit einer wirklichen Verlobung zu tun haben könnte; dergleichen ließ sich bei einer englischen Jungfer durchaus erklären; vermutlich war der betreffende Mann im Krieg gefallen. Jetzt, da er mit ihr fast an derselben Stelle saß, wo sie vor drei Wochen zum erstenmal miteinander gesprochen hatten, kam sie ihm gefährlich vor; er spürte eine dunkle Furcht. Er wünschte, der junge Archäologe wäre mitgekommen.
Aber er war verpflichtet, Miss Vaughan mit ganz besonderer Höflichkeit zu begegnen. Er fingerte an der Korbstuhllehne.
Anapäst hüpft als Leichtfuß die Zeile entlang …
Letzte Woche hatte er sich hier draußen nach dem Essen zu ihr gesetzt. Der Staat Israel hatte an diesem Tag seine erste ferngelenkte Rakete gestartet. Freddy meinte, auf den Straßen scheine eitel Freude zu herrschen, und einer von ihnen regte an, später noch ein bißchen hinauszugehen und den tanzenden Kindern zuzuschauen. Die Kinder tanzten sowieso jeden Abend in den öffentlichen Gärten bis spät in die Nacht hinein. Das Gespräch kam dann auf die Politiker und die Bombe.
Sie hatte gesagt – ganz lässig und beiläufig, denn bis dahin waren sie noch einigermaßen gut miteinander ausgekommen –: «Manchmal denke ich, man sollte die Politiker aus der Weltregierung einfach hinauswerfen und statt dessen den Papst, den Oberrabbiner, den Erzbischof von Canterbury und den Dalai Lama einsetzen. Viel schlechter könnten die’s wohl auch kaum machen, vielleicht sogar besser.»
Freddy hatte darüber ohne übertriebenen Ernst nachgedacht. «Ein griechischer Patriarch müßte auch dabei sein», sagte er, «und dann würden die Buddhisten und die Hindus ebenfalls mitreden wollen. Da wäre kein Ende abzusehen. Aber die Idee ist gut. Ich könnte mir denken, daß es bei den Juden Einspruch gegen den Oberrabbiner geben würde. Soweit ich’s überschaue, sind die meisten Juden hier Ungläubige.»
«Nicht unbedingt», sagte Miss Vaughan. «Sie haben wohl nur eine andere Art zu glauben, als Sie es sich vorstellen. Die Juden glauben mit ihrem Blut. Jude sein – das ist keine Sache, über die sie nachdenken, die sie mit dem Verstand abwägen und der sie dann ihre Billigung geben, wie man es in der christlichen Tradition des Westens tut. Jude sein – das liegt im Blut.»
«Ja, das fürchte ich auch», sagte Freddy mit leichtem Lachen. Als habe er gar nichts gesagt, fuhr sie fort: «Da ich selber Halbjüdin bin, glaube ich zu verstehen, wie …»
«Oh, ich wollte damit nicht sagen … ich meine … man redet manchmal so gedankenlos daher, verstehen Sie …»
«Sie hätten Schlimmeres sagen können.»
Freddy fühlte sich scheußlich. Er klammerte sich an den Gedanken, sie könnte, da sie Halbjüdin war, vielleicht auch nur halb verletzt sein. Schließlich redete man ebenso auch von den ‹Andern› oder den ‹Roten›, und jedermann wußte, was man meinte.
Erst jetzt bemerkte er das Jüdische ihrer Erscheinung, etwas Dunkles, Intensives hinter ihrer äußeren Gestalt und Färbung. Er fühlte sich noch scheußlicher. Es war ein diplomatischer und ein gesellschaftlicher Fauxpas zugleich hier in diesem Land, wo seit einem Jahr der Eichmann-Prozeß lief. Freddy fühlte sich wie ein steckbrieflich gesuchter Mann, den man aus seinem Versteck in einem dunklen Schrank gezogen hatte. Es drängte ihn, ihr zu erklären, daß er kein Massenschlächter sei und daß er noch nie den Wunsch verspürt habe, Sturmbannführer zu werden, Obersturmbannführer, Superobersturmbannführer. Aber er beherrschte sich. Er sagte nur: «Ihr junger Führer gefällt mir. Wie sind Sie an ihn gekommen?»
«Er ist der Freund eines Freundes von mir, der ebenfalls Archäologe ist und zur Zeit gerade auf dem Qumran-Gelände über das Material arbeitet, das sie dort gefunden haben.» Offensichtlich machte seine Verlegenheit auch sie verlegen.
Freddy schnappte nach dem Thema der Schriftrollen vom Toten Meer wie nach einer Melonenschnitte in der Sahara. «Das muß ungeheuer aufregend sein. Ich möchte in nächster Zeit gern selber einmal die Fundstätten besuchen.»
Aber sie war noch mit ihrer Reaktion auf Freddys Verwirrung beschäftigt. Rasend vor Ärger fing sie an, sich über den Israeli, einen gebürtigen Tschechen, auszulassen, den man ihr anfangs als Führer zu den heiligen Stätten zugeteilt hatte. Er war anmaßend gewesen. Er war ihr hinderlich gewesen. Er hatte mit ihr einen Ausflug nach Nazareth unternommen und verlangt, das Ganze in einer halben Stunde durchzuhetzen, während sie darauf bestanden hatte, den ganzen Tag dort zu verbringen. Er war ein fanatischer Christenhasser, der ihr statt der Heiligtümer die Zementfabriken und Pipelines von Israel zeigen wollte und aufsässig geworden war, als er sie auf den Gipfel des Berges Tabor fahren sollte, an die vermutliche Stätte der Verklärung. Sie hatte schließlich nachgegeben, weil dieser unerträgliche Mensch … Es stellte sich heraus, daß sie selber römisch-katholisch war.
Verstört ob ihres extremen und hitzigen Tones blickte sich Freddy nach dem Kellner um. Er sagte zu ihr: «Wir wollen den hiesigen Weißwein probieren.» Er bestellte zwei Gläser und rief dem Kellner nach: «Aber gekühlt bitte!» Er sagte zu Miss Vaughan: «Die servieren ihn nämlich meist warm.»
Der Kellner erschien und brachte zwei Gläser einheimischen Weißwein. Zwei Eisstückchen schwammen darin, deren ursprüngliche Würfelform rasch zerschmolz. Freddy und Miss Vaughan schwiegen, bis der Kellner gegangen war. Bald war das Eis in der heißen Abendluft gänzlich geschmolzen. Freddy schaute lächelnd auf die beiden Gläser. Schließlich nippten sie aber doch an der lauwarmen Mixtur. «Die verstehen hier in den meisten Hotels einfach nichts von Wein», sagte Freddy. Nun, es war wenigstens eine Erleichterung, daß sie auf diese Weise etwas hatten, worüber sie auf gut englisch kichern konnten.
Freddy überlegte jetzt, ob wohl der lange Weg durchs Orthodoxen-Viertel in der Nachmittagshitze daran schuld war, daß er sich so gereizt fühlte. Er hatte eindeutig Angst vor Miss Vaughan. Sie saß da und fingerte nervös an ihrem Verlobungsring. Sie sah sehr abgespannt aus. Vielleicht setzte auch ihr die Hitze zu. Gleichviel, im Hinblick auf seine Entgleisung in der letzten Woche war er entschlossen, sich so angenehm wie möglich zu geben.
Sie sagte: «Ihre Geranien blühen und gedeihen.»
Er hatte ihr zwei von seinen Geranientöpfen gegeben, bevor er letzte Woche nach Jordanien hinübergegangen war. Es waren besondere Geranien. Er hatte sie aus Joannas preisgekrönter Sammlung herübergeschmuggelt.
Er sagte: «Das ist schön. Ich hatte gehofft, Dr. Ephraim würde noch mit hereinschauen. Ich möchte ihn bitten, mir einen Hebräischlehrer zu empfehlen.»
«Er mußte zu Frau und Familie zurück.»
«Ach ja, natürlich.»
«Vielleicht übernimmt er selber die Stunden. Die Bezahlung an der Universität ist nicht allzu gut.»
«Ich muß gestehen, das war sozusagen meine Hoffnung.»
Sie sagte: «Bevor ich nach Jordanien gehe, müssen wir ein Treffen mit ihm arrangieren.»
«Wann gehen Sie denn?» sagte er.
«Ich weiß noch nicht.»
Es war ihm rätselhaft, warum sie nicht schon längst in Jordanien gewesen war. Sie sagte immer, sie «warte darauf, nach Jordanien zu können». Sollte das heißen, daß sie auf ein Visum wartete? Wenn man ihr jüdisches Blut argwöhnte, würde sie kein Visum bekommen. Aber andererseits: wenn sie einen Taufschein besaß und den Mund hielt, mußte es eigentlich leicht sein.
Er sah, wie sie an einem ausgefaserten Geflechtende ihrer Sessellehne zupfte.
Der Jambus springt von kurz nach lang …
Sie sagte: «Ich bin froh, daß ich die Geranien habe. Ich gieße sie jeden Morgen, wenn die Post kommt. Es lenkt meine Gedanken ab. Ich warte auf einen Brief, der eintreffen muß, bevor ich nach Jordanien kann.»
«Wenn es sich um ein Visum handelt, könnte ich vielleicht behilflich sein», sagte Freddy.
«Vielen Dank, aber Sie können da nicht helfen», sagte sie.
«Die christlichen Heiligtümer drüben sind viel interessanter als die hier in Israel», sagte er. «Wenigstens gibt es dort mehr.»
«Ich weiß», sagte sie. «Ich hoffe, sie schon bald sehen zu können. Ich hoffe nämlich sehr bald einen Archäologen zu heiraten, der drüben arbeitet. Den, der am Toten Meer ist.»
«Ich könnte sicher behilflich sein, wenn es nur um ein Visum geht.»
«Ich erwarte eine Nachricht aus Rom», sagte sie. «Er war verheiratet und ist geschieden. Die Frage ist, ob seine Ehe für nichtig erklärt werden kann oder nicht. Ich meine – von der Kirche. Wenn die Kirche die Annullierung ablehnt, wird nichts aus der Heirat. Die Chancen stehen fünfzig zu fünfzig.»
«O je», sagte Freddy. Er sagte: «Steht es wirklich so ernst?»
«Ja», sagte sie.
«Werden Sie denn nicht nach Jordanien gehen, um dort mit ihm zusammen zu sein?» sagte Freddy. Er merkte, wie sie an dem Korbgeflecht zerrte und bekam Angst bei dem Gedanken, wohin diese Unterhaltung am Ende führen könnte. Er konnte sehen, daß irgend etwas sie stark erregte, und fürchtete, es war irgendeine langweilige Überzeugung.
Sie sagte, sie werde überhaupt nicht nach Jordanien gehen, wenn die Entscheidung in Rom gegen die Annullierung der früheren Ehe ausfiele. Sie sagte, sie werde den Mann in diesem Fall nie wiedersehen.
«O je», sagte Freddy, «und wie steht Ihr Verlobter dazu?»
«Nun, natürlich empfindet er das als ein bißchen ungerecht. Er selber ist nicht Katholik.»
«Es scheint in der Tat ein bißchen ungerecht zu sein», sagte Freddy milde. «Es scheint ein bißchen extrem, wenn zwei erwachsene Menschen …»
«Kennen Sie», sagte da diese leidenschaftliche Jungfer mit kalter und erschreckender Stimme, «eine Stelle im Buch der Offenbarung, die sich auf Ihren Standpunkt bezieht?»
«Ich fürchte, mit der Offenbarung bin ich überfordert», sagte Freddy. «Ich habe nie den leisesten Schimmer gehabt, um was es da geht. Mit den Evangelien kann ich noch leidlich dienen, wenigstens mit einzelnen Partien, aber …»
«Die Stelle lautet so», sagte sie, und langsam, fast psalmodierend, kamen ihre Worte:
«Ich weiß deine Werke, daß du weder kalt noch warm bist. Ach, daß du kalt oder warm wärest! Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde.»
Freddy gab keine Antwort. Die Leute sollten einem wirklich nicht mit Zitaten aus der Heiligen Schrift kommen. Einfach absurd war das.
Miss Vaughan lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und strich sich erleichtert über das korrekt frisierte Haar. Freddy blieb still.
Silbe eins, Silbe drei: lang die zwei; Mitte kurz,
so donnern des Kretikus Hufe beim Rennen im Sturz.
Dann stand Freddy auf wie einer, der leise eine Tür geschlossen hat, und sagte: «Ich muß gehen und vor dem Essen noch einen Dankeschön-Brief an meine Gastgeberin drüben loswerden.»
Barbara Vaughans Identität
Die Leute sollten sich wirklich nicht gegenseitig mit Zitaten aus der Heiligen Schrift kommen, dachte Barbara Vaughan und bedauerte ihre Attacke gegen Freddy, die eigentlich eher eine verspätete Gegenattacke gewesen war; aber vermutlich hatte er dieses Täuschungsmanöver nicht erkannt.
Leute, die andere mit Zitaten aus der Heiligen Schrift kritisierten, waren schrecklich langweilig, und gewöhnlich mißbrauchten sie den Text. Mit der Bibel konnte man schließlich jedem alles beweisen. Bis ins kleinste bedauerte sie, den kühlen Mann vom Außenministerium mit der Stelle aus der Apokalypse gerügt zu haben. In Wahrheit genoß sie dies Bedauern ausgiebig, denn es lenkte ihre Gedanken von den anderen Problemen ab – den entscheidenden, für die es im Augenblick keine Lösung gab. Zu ihnen kehrte ihr Denken am Ende immer wieder zurück, wie sich in einem Concerto das Thema immer wieder durchsetzt. Dazwischen jedoch klimperte sie die Tonleitern auf und ab mit der lächerlichen Szene, die sich am Abend zuvor mit Freddy im Hof abgespielt hatte.
Sie saß auf einer niedrigen Mauer neben der Basilika der Verklärung auf dem Gipfelplateau des Berges Tabor, bedauerte und bedauerte und sammelte dabei Kräfte. Sie hatte sich an diesem Morgen selber einen Wagen gemietet, da sie die Führer von der Reiseagentur leid war. Sie hatten zwar eine Menge guter Informationen zu bieten, boten sie aber unablässig an. Weit und breit im Land gingen die Israelis mit Tatsachen um wie mit antibiotischen Injektionen, die sie dem Besucher mit dem Eifer von Amtsärzten verpaßten. Sie waren stolz auf ihr Land, und an den Tatsachen selber hatte Barbara auch nichts auszusetzen. Das Ermüdende an all den Ausflügen, die sie in den vergangenen drei Wochen unternommen hatte, war nur die mühevolle Arbeit gewesen, die es gekostet hatte, die Tatsachen, die ihr wichtig waren, von denen zu trennen, die den anderen wichtig waren.
Die Tatsachen, die ihr wichtig waren: Barbara Vaughans Intelligenz war in der Graduiertentradition des Anglistischen Instituts einer großen Universität zur Reife gelangt. Danach hatte sie sich der Musik gewidmet, doch zu spät, um noch ihren eigenen anspruchsvollen Maßstäben gerecht werden zu können; jetzt hatte sie das Cello-Spielen aufgegeben. Ihrer geistigen Konstitution nach neigte sie dazu, die Dinge aus ‹katholischer Sicht› zu betrachten, aus der nicht alle Tatsachen gleichermaßen relevant schienen, ganz wie sie in den Tagen ihrer Examensarbeit von einem Gedicht immer nur jene Stellen ausgewählt hatte, die zu ihrem Thema in Beziehung standen. Das hieß freilich nicht, daß es ihr versagt gewesen wäre, die christliche Religion in ihrer universalen Bedeutung voll zu erfassen, oder daß sie nicht in der Lage war, die Vorzüge eines Gedichts in einem einzigen schlichten Gedankengang zu erkennen. Es hieß vielmehr nichts weiter, als daß ihr geistiger Habitus es mit der Summe ihrer Erfahrungen nicht aufnehmen konnte, und so befand sie sich denn – wie praktisch jedermann auf die eine oder andere Art – in einem dauernden Konflikt.
Wie praktisch jedermann – und sie war einer von den Menschen, die an ihren Begabungen leiden. Denn sie besaß die Gabe einer rechtschaffenen, analytischen Intelligenz, einer unbestechlichen Genauigkeit bei der Erforschung des Erforschbaren, und zugleich die schöne und gefährliche Gabe des Glaubens, der da ist nach den Worten der Schrift «eine gewisse Zuversicht des, das man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht».
«Wir kommen jetzt nach Beerscheba», hatte der Führer gesagt, auf der ersten Fahrt, die sie kurz nach ihrer Ankunft im Lande unternommen hatte. «Sehen Sie, das alles ist in dreizehn Jahren entstanden.»
Die israelischen Führer irritierten Barbara – wie ihr selber nicht ganz verborgen blieb – hauptsächlich deshalb, weil sie äußerst männliche Männer waren und doch nicht jener eine männliche Mann, nach dessen Nähe es sie verlangte; sie waren nicht Harry Clegg, der Archäologe, der zur Zeit in Jordanien auf dem Ausgrabungsgelände am Toten Meer arbeitete. Sie neigte dazu, sich einzig und allein aus diesem Grund gegen die Erklärungen der Führer zu sträuben, selbst wenn sie für die ständigen Einwände einmal nicht die einfache Entschuldigung hatte: «Ich bin wirklich nur auf einer Pilgerfahrt hier. Ich will wirklich nur die alten Stätten sehen. Ich habe wirklich kein Interesse an Klebefilm-Fabriken.»
«Wir kommen jetzt nach Beerscheba.»
Plötzlich, so schien es, war Beerscheba hinter ein paar Palmen aufgetaucht im gleißenden Weiß moderner Häuserblocks, die sich hinab bis an die großen Wellen der Wüste Negeb erstreckten. Die Wüste wogte wie ein Meer gegen die schimmernden Betonzeilen der Wohnblocks am Rande der Stadt.
Barbara Vaughan sagte: «Ich bin wirklich nur am Beerscheba der Genesis interessiert.»
«Dies ist das Beerscheba der Genesis.»
Langsam fuhren sie durch die Straßen. Barbara blickte von den Häusern zur Wüste hinüber und von der Wüste wieder zu den Häusern. Beerscheba war die Stätte, wo der Patriarch Isaak, da er hochbetagt und seine Augen dunkel geworden, seinen Segen versehentlich dem Jakob gab, der sich für seinen Bruder Esau ausgegeben hatte. Der alte Mann, dem nicht recht geheuer war, betastete Hände und Arme des Sohnes, die mit den haarigen Fellen von zwei Böcklein überzogen waren und fiel auf den Mummenschanz herein. «Die Stimme ist Jakobs Stimme», sagte der alte Mann. Er betastete Arme und Hände – «aber die Hände …» Einmal verliehen, war der mächtige Segen unwiderruflich. Der glatte Jakob, nicht der haarige Esau, übernahm das geistige Erbe und nahm den Platz ein, den der Herr ihm unter den Vätern Israels vorbehalten hatte: – denn also sind des Herrn Wege im Mittleren Osten. In Eton, dachte Barbara, war Gott nicht gewesen. Und Jakob hätte einen blendenden Jesuiten abgegeben … Sie sagte: «Eigentlich sehen nur Wüste und Himmel so aus, wie man sich’s vorstellt, aber ich vermute, es ist die authentische Gegend. Ich bin müde.»
«Dies ist Beerscheba, der Geburtsort Jakobs, des Vaters der zwölf Stämme Israels. Wir haben eine neue Schule für Einwanderer. Damit sie ein Gewerbe und Hebräisch lernen. Ich zeige sie Ihnen.»
Die moderne Stadt hatte tatsächlich ihre eigene Schönheit. Als sie durch die Straßen zurückfuhren, fiel Barbaras Blick auf ein Messingschild neben einer dunkel verglasten Ladentür. ‹Detektiv-Büro› stand darauf.
«Was will man in einer neuen Stadt mit einem Detektivbüro?»
«Mancherlei. Vielleicht hat es in den letzten drei, vier Jahren ein paar Scheidungen gegeben. Bevölkerung: zweiunddreißigtausend. Sehen Sie, hier haben wir eine Klinik mit einem Anbau.»
So war es seit ihrer Ankunft immer wieder gewesen.
«Ich bin wirklich in erster Linie am Heiligen Land interessiert.»
«Dies ist das Heilige Land.»
Saul Ephraim war natürlich noch am sympathischsten. Er kannte Harry Clegg. Bei Saul konnte man sich entspannen. Und einmal, als er ihr den Rat gab: «Lassen Sie sich von diesen offiziellen Führern nicht einschüchtern! Werden Sie ruhig grob. Sagen Sie ihnen, Sie wollen nur Stätten des Altertums sehen. Moderne Wohnviertel und Einkaufszentren können Sie überall auf der Welt besichtigen» – da gab sie aus irgendeinem Grund die Antwort: «Auf lange Sicht ist alles Altertum.» Der Archäologe hatte in seiner beiläufigen, jüdischen Weise die Achseln gezuckt. «Auf lange Sicht!» sagte er. «Die modernen Wohnblocks dürften kaum so lange halten wie die Wasserleitungen des Herodes.»
Die Leute sollten sich wirklich nicht gegenseitig mit Zitaten aus der Heiligen Schrift kommen, dachte Barbara, als sie dort oben auf dem Gipfelplateau des Tabor auf der Mauer saß. Sie blickte hinunter auf das Grün und Blau Galiläas, während ihr geistiges Auge über ihre Probleme hinschweifte, die jahrealten, die vom Vorjahr, von der letzten Woche, von gestern und von morgen.
Saul Ephraim, ihr einziger wirklicher Freund in diesem Land, ließ sie häufig an einen ihrer Vettern denken, mit dem sie in ihrer gemeinsamen Studentenzeit in Golders Green an langen Sonntagabenden in hitziger Diskussion am Eßtisch gehockt hatte, während draußen vor der Verandatür die schlanken Blumen still und immer stiller zu werden schienen. Diese Bilder kamen ihr in den Sinn, als Saul Ephraim vom Kanalisationssystem und den Wasserleitungen des Herodes sprach und ihr erzählte, wie diese kürzlich erst vom Neuen Staat wieder in Gebrauch genommen worden seien. Saul war ein Ungläubiger, der sich gut und genau auskannte im Alten und Neuen Testament, ohne ihnen freilich mehr als das Interesse des Altertumsforschers entgegenzubringen. Das war eine Geisteshaltung, die Barbara verstehen und mit der sie fertig werden konnte.
In Jaffa war es gewesen, wo er ihr den Rat gegeben hatte, mit den Führern energisch umzugehen. Damals standen sie an der Reede und dachten, während sie sich unterhielten, über den alten Hafen nach, der zu seicht war, um noch für den modernen Schiffsverkehr zu taugen. Ein Stück hinter ihnen stand das berühmte Haus Simons des Gerbers, wo der Apostel Petrus eine Zeitlang gewohnt hatte, nachdem man ihn von Lydda geholt, damit er Tabea von den Toten erwecke. Es hatte den Anschein, als wollten die Nonnen, die jetzt das Haus besaßen, an diesem Tag keine Besucher vorlassen. Wieder überkam Barbara das Gefühl, das sich schon in den Wochen zuvor eingestellt hatte, wenn sie endlich die Stätte erreicht hatte, die sie suchte: das Gefühl einer plötzlichen Gleichgültigkeit. Wie etwa in Nazareth, wo sie sich große Mühe gegeben hatte, ein Heiligtum zu finden, das die «Mensa Christi» genannt wird – eine Felsplatte, die Jesus angeblich einmal als Tisch gedient haben soll; voll Neugier, die Platte zu sehen und der Legende nachzuspüren, war sie einen langen, sonnenglühenden Berg hinaufgeklettert. Aber als sie bei dem kleinen Gebäude angelangt war, hatte sie es verschlossen gefunden. Nahe dabei saß dösend auf einem Stein der Kustos, ein knorriger, alter Franziskanermönch, den Schlüssel in der Hand. Sie nahm sich nicht mehr die Mühe, zu ihm hinzugehen. Ihr Interesse an der «Mensa Christi» war plötzlich erloschen.
So war es auch beim Hause Simons des Gerbers zu Jaffa. Saul war herumgegangen zur Hinterpforte, um dort Einlaß zu suchen: «Geben Sie sich keine Mühe, so groß ist mein Interesse nun auch wieder nicht.» Er gab den Versuch auf, nachdem er nur ein paarmal an die Tür geklopft hatte, ohne Antwort zu erhalten.
Sie hatten sich über eine Mauer an der Reede gelehnt und über das alte Meer geschaut. Neben ihnen lag ein gepflasterter Hof, der in einige niedriggebaute dunkle Torwege mündete. Irgendwo dahinter schrie eine Frau, jammerte dann erbärmlich und tauchte schließlich laut schluchzend im Hof auf. Es war ein arabisches Mädchen in einem knappen, kurzen Kleid nach westlichem Schnitt und mit zerzaustem Haar. Sie wurde von zwei anderen Frauen gestützt. Das Kleid war ihr von den Schultern gerissen. Offensichtlich hatte man ihr übel mitgespielt. Hastig wurde sie von ihren beiden Freundinnen in einen anderen dunklen Hauseingang gedrängt. Zwei Männer folgten ihnen, Araber in Europäerkleidung. Der eine blieb stehen und schaute zu Barbara herüber. Er schien sie wiederzuerkennen. Sein Blick veranlaßte sie, sich auch sein Gesicht genauer anzusehen. Er war blauäugig. Wo hatte sie ihn früher schon gesehen? War er der Führer in Nazareth gewesen, bei Josephs Zimmermannswerkstatt? Drinnen im Haus jammerte immer noch die Frau.
«Ich glaube, einer von diesen Männern ist Fremdenführer», sagte sie zu Saul, als der blauäugige Araber den anderen folgte.
«Sie haben nur noch Fremdenführer im Kopf. Nein, das sind keine Führer», sagte er.
«Oh, natürlich, jetzt entsinne ich mich. Das war der Mann, der Mr. Hamilton immer im Hotel besucht – ein Lebensversicherungsagent.»
«Ein was?» sagte Saul.
Darauf bemerkte sie ganz beiläufig, daß die Heilige Schrift für den zum Katholizismus konvertierten Halbjuden besonders wichtig sei. Für sie selber, sagte sie, stehe das Alte Testament dem Neuen so nahe, daß sie auf ihre eigene Erfahrung den Satz aus Dantes Vision anwenden könne: «gebunden von Liebe in einen Band». Als sie dann merkte, daß Saul ernstlich über ihre Worte nachdachte, ließ sie ein schüchternes englisches Lachen hören und fügte hinzu, ihr sei dabei natürlich klar, daß man aus der Schrift auch einen Fetisch machen könne.
Früh an jenem Morgen hatte sie sich einen Wagen gemietet und war nordwärts durch das judäische Bergland nach Galiläa gefahren. Die Szene mit Freddy Hamilton war wie ein Katzenjammer. Unterwegs begann sie sich auf ihre eigene Identität zu besinnen, und es wurde ihr bewußt, daß sie tatsächlich diese Identität unter all den Antworten, die sie sich auf die Fragen der Israelis seit ihrer Ankunft im Lande hatte ausdenken müssen, zu verlieren begonnen hatte. Sie erinnerte sich an den Tag, an dem sie mit einem Führer auf der Autostraße nach Caesarea gefahren war … Es war elf Uhr morgens:
«Halbjüdin?»
«Ja.»
«Welche Hälfte?»
«Mütterlicherseits. »
«Dann sind Sie Volljüdin. Nach jüdischem Gesetz gibt die Mutter das Erbe weiter.»
«Das weiß ich. Doch man sagt ‹Halbjüdin›, um anzudeuten, daß ein Elternteil nichtjüdisch ist und der andere …»
«Aber der Jude erbt sein Blut von der Mutter. Demnach sind Sie laut Gesetz Volljüdin.»
«Ja, aber nicht nach dem Gesetz des Elternteils, der nichtjüdisch ist.»
«Unter welchem Gesetz stand Ihr Vater?»
Das war in der Tat die Frage.
«Ich fürchte, er war sich selber Gesetz», hatte Barbara dem Frager geantwortet, einem großen, blonden Polen. Der lachte darüber.
Sie erzählte ihm von ihrem Vater, von seinen wildüberschäumenden mittleren Jahren und seinem Sturz. «Er brach sich den Hals bei der Fuchsjagd», sagte sie lakonisch. «Das Pferd warf ihn ab. Er landete in einem Graben und starb auf der Stelle.»
«Mein Vater ist ebenfalls in einem Graben gestorben. Erschossen von der SS. Warum sind Sie Katholikin geworden und haben Ihr jüdisches Blut verleugnet?»
«Ich verleugne es nicht. Ich habe Ihnen doch grad eben davon erzählt.»
«Sind Sie als Nichtjüdin aufgewachsen oder als Jüdin?»
«Weder noch. Keine Religion.»
«Und die Verwandten Ihrer Mutter – und die Verwandten Ihres Vaters – welche Religion?»
Barbara hatte gespürt, wie sich ihr Gefühl verlagerte, sie fühlte, wie sich ihre Identität wie ein Nebel von ihrem Körper zu lösen begann. «So viele Fragen», sagte sie. Sie fuhren auf der Straße nach Caesarea dahin durch die fruchtbare Saron-Ebene, die zu beiden Seiten bis an den Straßenrand bebaut war. Sie hatten gemerkt, daß es bei geschlossenen Fenstern im Wagen erträglicher war, als wenn sie den heißen Wind hereinließen. Aber viel machte es auch nicht aus. «So viele Fragen», hatte sie zweimal gesagt mit der in Resignation ersterbenden Stimme eines Opfers, das man der frischen Luft und der bürgerlichen Ehrenrechte beraubt hat.
«Ich frage sie etwas, und sie macht eine große Sache daraus, als ob ich die Gestapo wäre», sagte der Führer zu irgendeinem unsichtbaren Zeugen.
Barbara sagte: «Nun ja, es ist heiß.»
Er sagte: «Ich frage Sie, weil Sie mir sagen, Sie sind Halbjüdin; Sie sagen, daß Sie Katholikin sind, und ich frage Sie bloß, welche Religion die Verwandten Ihrer Mutter und die Verwandten Ihres Vaters haben. Das ist doch eine ganz natürliche Diskussion, wie wenn Sie mich fragen würden, wer sind Sie, wer ist Ihre Mutter, wer ist Ihr Vater, und wie sind Sie hier in Israel Fremdenführer geworden, und ich würde Ihnen diese Fragen beantworten. Dann würde ich Sie fragen, wer sind Sie, was ist mit Ihrer Familie, Ihren Brüdern und Ihren Schwestern …»
Wer bin ich? dachte Barbara. Sie fühlte, bis zu diesem Augenblick hatte sie es gewußt. «Ich bin, der ich bin», sagte sie. Der Führer murmelte einen kurzen Satz auf hebräisch, der, obschon sie die Sprache nicht verstand, unmißverständlich zum Ausdruck brachte, daß sie auf diese Weise in der Diskussion nicht weiterkämen. Barbara hatte schon gemerkt, daß ‹Ich bin, der ich bin› wohl ein bißchen großspurig war, hatte doch so die Antwort gelautet, die Moses auf dem Berge Sinai aus dem brennenden Dornbusch empfing, als er Gott fragte, wie sein Name heiße. Immerhin stand aber auch im Katechismus, daß der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen sei, vor allem, was die Seele betraf. Deshalb entschied sie, daß ‹Ich bin, der ich bin› letztlich doch die angemessene Definition für sie war. Aber die Analytikerin in ihr wollte es dabei nicht bewenden lassen. Sie fuhren in Caesarea ein, der Heimat uralter Gelehrtendispute, während sie den Versuch unternahm, den Führer bekannt zu machen mit dem Golders Green-Judentum ihrer mütterlichen Verwandten und dem ländlichen Anglikanismus ihrer väterlichen, mit den Passah-Versammlungen der einen und den eingeläuteten Vespern der anderen, mit den redseligen Intellektuellen hier und den fanatischen Jagdsportlern und ihrer Meute dort. Der polnische Israeli war verwirrt. Barbara fügte hinzu, daß ihre Eltern natürlich insofern Ausnahmen seien, als sie ja beide mit ihren Traditionen gebrochen hätten, um einander zu heiraten. Und sie selber sei wiederum ein Fall für sich. Der Führer blieb beharrlich bei seinem Standpunkt: Warum war sie Katholikin geworden? Wenn sie eine Religion wollte, so war sie doch bereits Jüdin durch ihre Mutter. Da wußte Barbara, das Wesentliche an ihr blieb unausgesprochen, es ließ sich nicht kategorisieren und lokalisieren. Das beunruhigte sie stark, und sie fühlte die zwingende Notwendigkeit, eine Definition zu finden, die diesem Mann ihr Wesen präzise würde erklären können.
Er forderte eine Definition. Aus langer Erfahrung und aus Veranlagung betrachtete sie es als ein Lebensprinzip, daß der menschliche Geist zu unablässigem Definieren verpflichtet sei. Sie akzeptierte zwar das Geheimnis, jedoch nur unter dem Aspekt einer Dornenkrone. Mit mysteriösen Wahrheiten wie ‹Ich bin, der ich bin› konnte sie sich nicht zufrieden geben; dergleichen mochte auf dem Totenbett angebracht sein, wenn es mit den geistigen Obliegenheiten zu Ende ging. ‹Ich bin, der ich bin› – ja, letzten Endes, wie etwa ein Musikstück sein mag, was es ist; aber man möchte die Sache schließlich auch analysieren. Indes, dachte sie, dieser Mann will wissen, wer ich bin, das heißt, zu was für einer Kategorie von Mensch ich gehöre. Ich sollte ihm die Situation der christlichen Juden im Westen auseinandersetzen und dann über die Unabhängigkeit der britischen Erziehung sprechen und über die eigentümliche Unabhängigkeit des christlichen Juden, dessen eigentliche Existenz sich aus einer nonkonformistischen Verbindung ergibt. Und dann über die Wahrscheinlichkeit des katholischen Anspruchs, dachte sie. Die sengende Mittagshitze drang durch ihre Sonnenbrille. Später, dachte sie, muß ich einen Versuch machen, es ihm zu erklären; nach dem Lunch will ich es ihm erklären.
Aber warum? In Caesarea hatten sie die historischen Ruinen besichtigt und die kürzlich ausgegrabenen Wallanlagen der Herodesstadt; sie blickten auf das prähistorische Mittelmeer hinaus und fühlten sich dadurch erfrischt. Der Mann dogmatisierte über Daten und Ereignisse zu Caesarea, deren wichtigstes – für ihn – der noch nicht weit zurückliegende Augenblick war, als eine Gruppe von Archäologen mit den Ausgrabungen begonnen hatte. Sie aßen draußen an einem Tisch unter der Markise zu Mittag. «In Polen», sagte der Führer, «pflegten die katholischen Priester die Pogrome zu leiten.»
«Das hätten sie nicht tun sollen», sagte sie.
«Warum sind Sie Katholikin?»
Warum? Warum kümmerte sie sich überhaupt um diese Fragen? Der Mann war ein gemieteter Führer. Sie zahlte für seine Dienste. Anderwärts würde man sich entsprechend verärgert zeigen. Aber das war hier in Israel undenkbar; wohl zahlte man bei der Reiseagentur, wohl waren sie gemietet, aber all das schien belanglos für das Verhältnis, in dem man zueinander stand. Auf diesem Territorium hier waren die israelischen Fremdenführer weit autonomer, was ihr Benehmen betraf, als irgendein französischer Bürger auf heimischem Boden oder ein englischer Führer in England. Die Israelis führten einen gewöhnlich nicht nur herum, sie gängelten einen, ob sie offiziell bestallt waren oder nicht. Es ging Barbara auf, daß sie alle in ihrem Schollenbewußtsein bis zu einem gewissen Grad den Iren und Walisern ähnelten, und zugleich wurde sie an die Spiele ihrer Kindheit erinnert, wo in dem eigenen, durch Kreidestriche markierten Reich, war es einmal erobert, nur das galt, was man selber bestimmte, nicht mehr und nicht weniger. Immer wieder sagte sie zu dem Fremdenführer, wie schön die Landschaft sei; denn das fiel ihr leicht, war es doch die Wahrheit. Das freute ihn erwartungsgemäß. «Ich hab’s mir erschwommen», sagte er und erklärte ihr, daß er 1947 als illegaler Einwanderer auf einem Schiff hergekommen und bei Nacht an Land geschwommen sei.
Nach diesem Ausflug nach Caesarea war sie erschöpft und in nervöser Angst ins Hotel zurückgekehrt, in einem Zustand, wie sie ihn vor Jahren einmal mehrere Monate lang nach einer Anämie erlebt hatte. Körperlich war sie jetzt in guter Verfassung; es war, so gestand sie sich unbarmherzig ein, eine geistige Anämie, an der sie litt. Statt ihn am Hoteleingang zu verabschieden und ihm nach Touristenart ein Trinkgeld zu geben, folgte sie einem verzweifelten Versöhnungsimpuls und bat ihn auf einen Drink herein. Dann aber erkannte sie sofort, daß sie einer ihr wohlbekannten Schwäche nachgab und ihrer tyrannischen Anlage den Willen ließ. Jetzt erinnerte sie sich, daß sie dem armen Freddy Hamilton, der im stillen grünen Hof eine Zeitung las, den Burschen aufgehalst hatte und mit der Versicherung verschwunden war, sie werde gleich wieder zurück sein. Sie hatte sich reichlich Zeit gelassen, ehe sie wieder aus ihrem Zimmer herunterkam, und als sie endlich zu den beiden trat, sah sie, daß der riesige Führer angefangen hatte, sich über die Abenteuer des vergangenen Tages zu verbreiten. Der höfliche Mr. Hamilton war ihr mehr als bloß höflich vorgekommen, er lauschte mit tiefem Interesse. Der Fremdenführer zählte an den Fingern seiner linken Hand ab, was er sagte oder vielmehr fast sang, eins nach dem anderen: «Ich hab ihr Abu Gosch gezeigt, ich hab ihr El Ramle gezeigt, wo für die Christen Arimathia liegt, ich hab ihr Lud gezeigt, das sie Lydda nennen, wo nach der Überlieferung St. Georg geboren wurde …»
«Der Schutzpatron von England», sagte der liebenswürdige Mr. Hamilton.
«Ganz recht. Ich hab ihr Haifa gezeigt, hab ihr den Karmel gezeigt …»
«Ah, da ist Miss Vaughan», sagte Freddy Hamilton. «Miss Vaughan, mir ist gerade berichtet worden … darf ich …» Er stand auf, um ihr behilflich zu sein, einen weiteren Stuhl an den Tisch zu ziehen. Der Führer setzte die Aufzählung jetzt an seiner rechten Hand fort: «Ich hab ihr die Höhle des Propheten Elia gezeigt, ich hab ihr die Persischen Gärten und den Tempel der Baha’i gezeigt …»
«Ah ja, die Baha’i-Bewegung, davon habe ich gehört. Sehr interessant. Sehr anständige Leute, sagt man. Gegründet nach dem letzten Krieg. Geld wie Heu.»
«Daran war die Dame nicht interessiert. Sie wünschte dem Baha’i-Tempel keinen Besuch zu machen.»
«Ich denke doch, wir haben genug getan für einen Tag», sagte Barbara.
«Ein ausgefüllter Tag», sagte Freddy.
Als der Israeli gegangen war, sagte Freddy: «Netter Kerl, Scheint sich auf seinen Job zu verstehen.»
«Ich fand ihn unausstehlich anmaßend.»
«Wirklich? Na ja, Sie wissen doch, wir sind hier Fremde. Man neigt dazu, das zu vergessen. Das Wort ‹britisch› bedeutet etwas anderes für sie als für uns, fürchte ich.»
Saul Ephraim, dem sie ausführlich über den Tagesausflug berichtet hatte, sagte: «Sie scheinen nicht ganz glücklich zu sein mit unseren Fremdenführern. Das überrascht mich nicht. Sie sind Britin. Schön und gut, mehr oder weniger. Sie sind konvertierte Katholikin – auch gut. Aber dann sind Sie auch noch Halbjüdin. All das zusammen ist ein bißchen viel.»
«Dabei hatte ich gedacht, gerade weil ich Halbjüdin bin, würde das übrige keine so große Rolle mehr spielen.»
«Das sollten Sie eigentlich besser wissen.»
Sie wußte es besser. Die Familie ihrer Mutter in Golders Green, bei der sie die Hälfte der Ferien ihrer Jugend verbrachte, hatte sich, was ihre wahre Persönlichkeit betraf, als ebenso naiv und beschränkt erwiesen wie die Familie in Bells Sands, bei der sie die andere Ferienhälfte zubrachte.
Auf dem Gipfel des Berges Tabor, das Heilige Land vor Augen, das sich nach allen Seiten bis zu seinen Grenzen erstreckte, dachte Barbara müde über ihre Gedanken nach. Mein Geist brennt darauf, dachte sie, seiner Verfassung zu entrinnen und sein Ziel anderswo zu erreichen. Doch dieses Ziel liegt in der Ewigkeit, dort, wo die Verklärung einsetzt. Bis dahin muß man preisen, was man tragen muß. Bis dahin kreist das Gedächtnis wie der Strom des Blutes. Möge doch das meine gut kreisen, möge es tote Fakten zum Leben erwecken, möge es Heil bringen allem, was zu tragen ist.
In Bells Sands – es war in den Osterferien, kurz nach ihrem sechzehnten Geburtstag – saß die energische, tennisspielende Großmutter Vaughan, das Haar diskret stahlgrau gefärbt, in ihrem weißen Plisseekleid auf der Lehne eines Sessels und ließ eins ihrer langen, sehnigen Beine pendeln, ihrer sommerlich braunen, guterhaltenen Beine. Die Gesellschaft hatte sich nach dem Tennis im Eßzimmer versammelt; es war Teezeit. Ihre Großmutter nahm eine Teetasse von dem Tablett, das ihr das junge rundschultrige Hausmädchen hinhielt. Barbara hatte eben verkündet, daß sie jetzt packen müsse. Ihr Vetter Arthur – damals in Sandhurst lebend und später in Nordafrika gefallen – sollte sie zur Bahn fahren.
«Mußt du denn heute abend noch weg, Liebes?» sagte Großmutter Vaughan. Barbara reichte die Gurkenbrote herum. «Warum fährst du nicht morgen früh mit Arthur? Bleib doch und mach dir’s gemütlich.»
«Nein, ich werde erwartet. Es ist Passah. Ein wichtiges Fest.»
Die Frühlingswärme drang durch die Flügelfenster herein, als sei das Glas durchlässig. Auf der silbernen Teekanne tanzten Lichter und Schatten, wenn ein Luftzug die Vorhänge bewegte. Ein Duft von unsichtbaren Hyazinthen erfüllte das Zimmer. So mußte es damals gewesen sein, vor ihrer Geburt, als die Familie begriff, daß ihr Vater die Jüdin heiraten würde, und nichts mehr zu sagen blieb.
«Das bewundere ich an dir», sagte ihre Großmutter. Die jungen Männer aßen immer gleich zwei Gurkenbrote auf einmal.
«Was?»
«Deine Loyalität gegenüber der Familie deiner Mutter. Aber ehrlich, mein Liebes, es ist wirklich nicht nötig. Kein Mensch könnte dir irgendeinen Vorwurf machen, wenn du dich darüber hinwegsetztest. Schließlich siehst du nicht so aus, als hättest du auch nur einen Tropfen jüdisches Blut. Und schließlich bist du’s ja auch nur zur Hälfte. Ich versichere dir, daran nimmt niemand Anstoß.»
«Du weißt, ich mag sie alle schrecklich gern. Ich spüre nicht die mindeste Versuchung, sie aufzugeben. Warum in aller Welt …?»
«Sicher, ich weiß ja, daß du sie nett findest, das ist ganz natürlich. Ich wollte auch nur, daß du weißt, ich bewundere diese Loyalität an dir, mein Liebes. Ich denke, ich darf wohl sagen, daß wir alle dich bewundern.»
«Großmutter!» mischte sich Miles nun ein, Barbaras anderer Vetter. «Großmutter, jetzt halt aber mal den Mund.»
«Es gibt da gar nichts zu bewundern, bemüht euch nicht», sagte Barbara. «Die Aaronsons nennen es nicht Loyalität, wenn ich hierbleibe. Sie finden es selbstverständlich.»
«Nun, das will ich hoffen, mein Kind. Immerhin war dies Haus das Heim deines Vaters, und darum ist es auch deines.»
Barbara erkannte, daß sie Mut hatte, diese geschmeidige alte Dame. Es forderte Mut von ihr, ständig von ihrem Sohn zu sprechen, ihrem Liebling, ihrer großen Enttäuschung, dessen Leben ein Sturz bei der Jagd ein Ende gesetzt hatte. Das war beileibe keine ausgefallene Todesursache hierzulande, doch gleichviel, lieber hätte die Mutter seine unglückselige Ehe in Kauf genommen.
«Nun, für einen Satz wäre noch Zeit, bevor du dich umziehst und packst, Barbara», sagte Onkel Eddy und schaute zum Himmel hinauf, als könnte er die Zeit dort ablesen. Der Tennisplatz lag da, schön wie die Ewigkeit. Ein Dienstmädchen rief aus einem der oberen Fenster nach Eddys beiden Kindern; sofort erschollen ihre hohen Stimmen zankend zwischen den Büschen und verloren sich hinter dem Haus. Ein Rascheln ging durch die Buchenblätter; es klang, als würden Papiere sanft zusammengeschoben. Eine englische Dämmerung brach an mit ihrer flüchtigen Melancholie.
«Sieh her, Barbara», sagte ihr Großvater ein paar Stunden später in Golders Green, «dies sind die bitteren Kräuter, die unser Elend in Ägyptenland versinnbildlichen …» Er zählte her, was auf dem Sedar-Tisch lag: die Eier, das ungesäuerte Brot, das Osterlamm.
Die Szene war ihr von früheren Sedar-Nächten her vertraut, doch ihr Großvater, der wußte, daß sie nicht feierlich unterwiesen worden war und kein Hebräisch gelernt hatte, gab sich jedes Jahr wieder Mühe, ihr alles zu erklären. Gleichwohl blieb immer viel, was sie nicht verstand, während für die anderen Enkel, ihre Vettern, alles ganz selbstverständlich war. Aber sie hatte erfahren, wie erregend dieses Festmahl war, als sie, ein Kind noch, mit den anderen Kindern und den Erwachsenen zu später Stunde an der fremdartigen Tafel gesessen hatte, die Gesichter von Kerzenlicht beschienen, und jeder Bissen der Speise eine besondere Empfindung in ihrem Mund erzeugt hatte, nicht nur, weil er anders schmeckte als gewöhnliche Speise, sondern weil in dieser Nacht jeder Bissen eine Bedeutung hatte und doch zugleich Speise war. Die Kinder tranken den Wein und mit ihm die Erlösung … Das ungesäuerte Brot, die knusprige, krümelnde Matze, wurde enthüllt. «Dies ist das armselige Brot, das unsere Väter aßen in Ägyptenland.» Schon mit fünf Jahren hatte Barbara begriffen, daß es in Wirklichkeit nicht dieselbe oblatenartige Substanz war, hier auf dem Tisch in Golders Green, die die Israeliten in der ersten Passah-Nacht gebacken hatten, und doch, auf eine geheimnisvolle Weise war es dieselbe. Dies ist das Brot, das unsere Väter aßen …
«Dies ist die Nacht», sagte ihr Großvater, ein Mann, der nicht zu altern schien, zu Barbara, die jetzt so deutlich fühlte, daß sie schon sechzehn war, «dies ist die Nacht, da wir Gott Dank sagen für unserer Väter Errettung. Denn er teilte die Wasser für uns, und wir schritten trockenen Fußes hindurch.» Sie lauschte, als hätte sie nie zuvor davon gehört, während ihre Vettern, bereits erwachsen, zwischen achtzehn und einundzwanzig Jahre alt, ihre Plätze einnahmen. Wie bei Barbara selbst, so hatte sich auch bei ihnen schon ein wacher Verstand, verbunden mit einer Neigung zur Musik, bemerkbar gemacht, noch ehe sie fünfzehn Jahre alt waren.
Die Vettern, Studenten der Philosophie, des Rechts und der Medizin, saßen in zweckbewußter Aufmerksamkeit um den Sedar-Tisch, wo sie gewöhnlich an Sommerabenden nach dem Essen, wenn die Tafel abgeräumt war, zusammengehockt und mit heißen Köpfen über Nietzsche, Freud, Marx, Mussolini, Hitler und den drohenden Krieg debattiert hatten. Nun standen sie im Begriff, in der vorgeschriebenen Reihenfolge die Antwortstrophen anzustimmen zur Geschichte vom Auszug aus Ägypten ins Gelobte Land.
Ein kleines dunkles Mädchen von acht Jahren war dabei, eine Flüchtlingswaise aus Deutschland, die man der Familie im Zuge der Notunterbringung von geretteten Kindern in jenen späten dreißiger Jahren zugeteilt hatte. Die Augen der Kleinen schimmerten im Kerzenlicht wie herrliche Bergkristalle. Die jungen Männer schoben ihre Kappen zurück. Es wurde ihnen warm, durch das faszinierende Ritual nicht weniger als durch die wirkliche Hitze.
Ein paar Monate zuvor erst, in den Weihnachtsferien, waren Barbara und diese aufgeweckten jungen Männer, ihre Vettern aus der jüdischen Linie, eines Abends zu dem Schluß gekommen, daß Agnostizismus die einzige Antwort sei, nachdem ihre atheistischen Mentoren den dogmatischen Weg gewählt hatten. Doch hier und jetzt waren sie ganz plötzlich wieder Kinder Israels – Barbara stets inbegriffen; denn Blut war letzten Endes Blut, und das Erbe kommt von der mütterlichen Seite.
In früheren Zeiten hatte Barbara, da sie die jüngste Teilnehmerin am Festmahl war, aber kein Hebräisch verstand, ihrem Großvater die wohlklingenden Fragen nachgesprochen, die jeweils dem Jüngsten vorbehalten waren. Aber heute nacht wiederholte das deutsche Kind auf hebräisch die Frage:
Warum ist diese Nacht anders als alle übrigen Nächte?
Sie ist anders, hatte Barbara gedacht. Die älteren Aaronsons hofften, sie werde eines Tages einen Juden heiraten, einen Arzt vielleicht oder einen Anwalt, irgendeinen hervorragenden Mann. Sie glaubten nicht, daß ihre nichtjüdischen Verwandten ihr besonders viel Zuneigung entgegenbringen konnten. Und Liebe gar – wie durfte man die erwarten? Die älteren Aaronsons sagten, Barbara – Gott segne sie – wird in fünf oder sechs Jahren schon eine gute Partie machen. Sie würde, meinten sie, Ausgleich schaffen für ihre eigensinnige Mutter, die jetzt nie mehr zu den Familienversammlungen erschien, sondern nur noch Briefe schrieb aus Paris.
Voller Freude psalmodierte Großvater Aaronson. Er war bei guter Stimme. An der reglosen Hand der uralten Tante Bea funkelten die Ringe, als die Kerzen in einem leisen Luftzug flackerten. Michael, Barbaras engster Freund unter den Vettern, murmelte ihr zu Gefallen den englischen Text der liturgischen Versikel, begleitet von des Großvaters tiefem Patriarchenbrummen und den rauhen Antworten der jungen Männer:
Wenn er uns hätte aus Ägyptenland geführt
und nicht Gericht gesendet über sie,
Es wär uns genug.
Wenn er Gericht gesendet hätte über sie
und hätte ihrer Götter doch geschont,
Es wär uns genug.
Wenn er Gericht gesendet hätte ihren Göttern
und hätte nicht die Erstgeburt gewürgt,
Es wär uns genug.