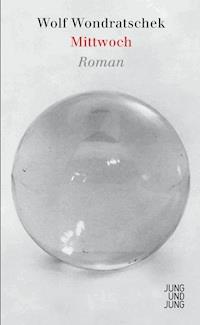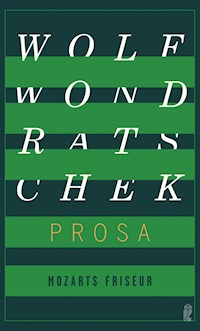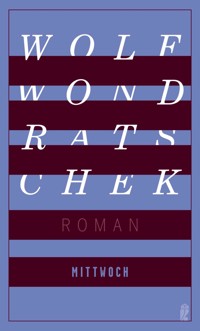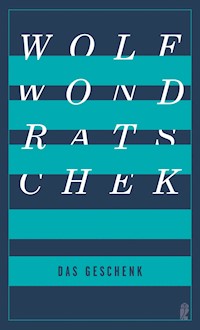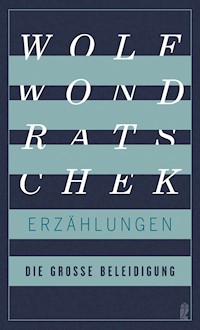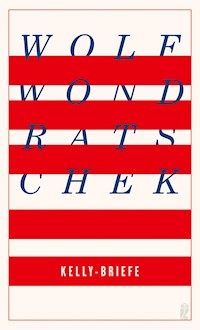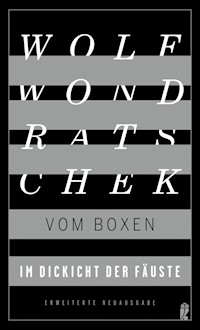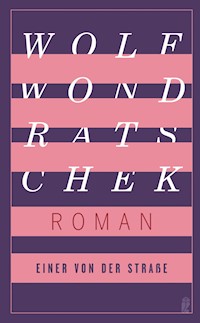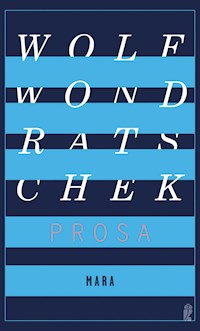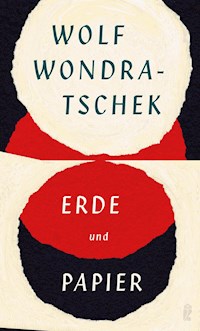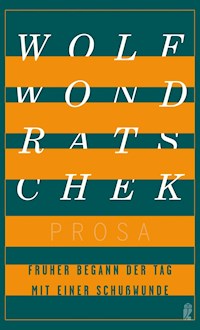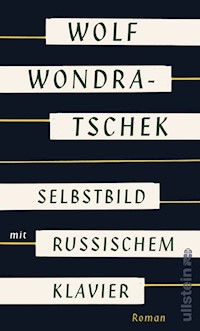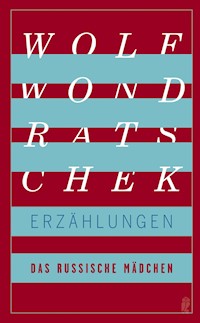
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Wondratscheks Geschichten strahlen Gelassenheit aus, Grazie und Eleganz!" DIE ZEIT Wie immer fängt alles sehr harmlos an: Eigentlich hatte der berühmte Chirurg nicht vorgehabt, aus seinem Ruhestand noch einmal in den Operationssaal zurückzukehren, aber dann erfährt er vom Schicksal eines russischen Mädchens. Diagnose: Wirbelsäulenschaden. Er operiert. Und er versucht sich vorzustellen, was einmal aus dem Mädchen werden wird. Wird es selber Ärztin, um anderen Menschen zu helfen? In seinem Erzählungsband Das russische Mädchen schreibt Wolf Wondratschek Lebensgeschichten. Sie zeigen Menschen, deren Leben sich gegen ihren Willen selbständig macht und sie bedroht – was jedem passieren kann, überall: einem Schriftsteller in Saint Tropez, einem Feuerwehrmann im Wiener Konzerthaus, einem russischen Mädchen, sogar einem glücklich verheirateten Ehepaar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das russische Mädchen und andere Erzählungen
Der Autor
Wolf Wondratschek wuchs in Karlsruhe auf. Von 1962 bis 1967 studierte er Literaturwissenschaft, Philosophie und Soziologie an den Universitäten in Heidelberg, Göttingen und Frankfurt am Main. Seit 1967 lebte er als freier Schriftsteller zunächst in München. In den Jahren 1970 und 1971 lehrte er als Gastdozent an der University of Warwick, Ende der Achtzigerjahre unternahm er ausgedehnte Reisen unter anderem in die USA und nach Mexiko. Gegenwärtig lebt er in Wien.
Das Buch
Die Macht und Magie des Zufalls
Eigentlich hatte der berühmte Chirurg nicht vorgehabt, aus seinem Ruhestand noch einmal in den Operationssaal zurückzukehren, aber dann erfährt er vom Schicksal eines russischen Mädchens. Er operiert und versucht sich vorzustellen, was einmal aus dem Mädchen werden wird. Wird es selber Ärztin, um anderen Menschen zu helfen?In Das russische Mädchen und andere Erzählungen schreibt Wolf Wondratschek über Menschen, deren Leben sich gegen ihren Willen selbständig macht und sie bedroht – was jedem passieren kann, überall: einem Schriftsteller in Saint Tropez, einem Feuerwehrmann im Wiener Konzerthaus, einem russischen Mädchen, sogar einem glücklich verheirateten Ehepaar.
Wolf Wondratschek
Das russische Mädchen und andere Erzählungen
Erzählungen
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
© Wolf Wondratschek (2020)Dieses Werk wurde unter dem Titel Saint Tropez und andereErzählungen erstmals im Jahr 2005 veröffentlicht.© dieser Ausgabe by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2020Alle Rechte vorbehaltenAutorenfoto: © privatUmschlaggestaltung: brian barth, berlinE-Book powered by pepyrus.com
ISBN 978-3-8437-2362-6
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Saint Tropez
Der Feuerwehrmann
Das russische Mädchen
Ein Tier,wahrscheinlich war ich das,bis Gott zwei Menschendaraus machteoder:Die himbeerfarbene Glühbirne
Leise Klopfgeräusche im Holzdreibeiniger Tische
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Saint Tropez
Saint Tropez
Als Junge bin ich lange ziemlich vernarrt gewesen in ein Spiel, für das ich zuerst die Freunde unter meinen Klassenkameraden zu begeistern versuchte, dann, nachdem deren Interesse schnell nachgelassen hatte, meine Mutter, die es aus gewohnter Geduld mir und meinen Einfällen gegenüber auch einige Abende lang tapfer über sich ergehen ließ, dann aber kapitulierte; ich erhielt zum Trost einen Kuß. Sie behauptete, nicht die geringste Begabung dafür zu haben, sich etwas auszudenken, und jede Anstrengung dieser Art, sie kenne das, würde bei ihr unweigerlich Kopfschmerzen auslösen – die vorzutäuschen sie allerdings begabt genug sei, wie mein Vater in gutmütiger Kürze ergänzte. Er selbst übrigens hatte jede Mitwirkung von vornherein immer kategorisch abgelehnt und war trotz aller Bitten noch nicht einmal zu einem Versuch zu dritt zu bewegen gewesen. Tut mir leid, mein Sohn, aber ich kann einfach nicht riskieren, daß du deinen Vater auch noch wegen dessen Einfallslosigkeit, was solche Spielereien betrifft, verachtest. Ich bin noch unbegabter als deine Mutter, die mir übrigens, als wir noch jung und frisch verliebt waren, wundervolle Briefe geschrieben hat, richtige kleine Kunstwerke. Wie dick mit Honig bestrichene Butterbrote! Sie bat ihn, nicht zu übertreiben, was ihn natürlich erst recht veranlaßte, ihr Komplimente zu machen.
Ich war gekränkt, nicht länger die Hauptperson und plötzlich weiter nichts zu sein als ein die Stimmung der beiden störender, allenfalls geduldeter Augenzeuge, und fühlte mich so hilflos wie jeder Junge meines Alters, wenn er im Kino sitzt und ein Liebespaar in Großaufnahme vor der Nase hat, das drauf und dran ist, sich zu küssen. Die Lektion, daß ein Spiel unterbrochen und spielerisch jederzeit in ein anderes verwandelt werden kann, hatte ich noch nicht gelernt. Was blieb mir mit meinen drei gespitzten Bleistiften in der Hand am Ende also übrig, als mich, von allen im Stich gelassen, auf mein Zimmer zu verziehen und mich dort allein mit meinem Zeitvertreib zu vergnügen.
Worum es ging? Ein Stück Papier, ein Bleistift und drei beliebige, möglichst natürlich aufregend unzusammenhängende Wörter, die man sich ausgedacht und aufgeschrieben hatte, genügten, um die Sache in Schwung zu bringen. Das eigentliche Spiel bestand danach darin, entweder einfach nur mit den gegebenen Wörtern einen Satz oder gleich eine ganze Geschichte zu bilden. Ein, wie Sie sich sicher erinnern, nie recht in Mode gekommenes Gesellschaftsspiel, das völlig zu Unrecht, wie ich finde, im Verdacht stand, dem Schreckgespenst eines Intelligenztests zu ähneln, dem Ernstfall eines Examens, einer jedenfalls leidigen Haus- oder Prüfungsaufgabe, die viele der Einfallslosigkeit überführen und mit Geschick doch wohl nur die Phantasiebegabteren bestehen könnten, was in der Schule erfahrungsgemäß immer die waren, die man beim Fußballspielen nicht gebrauchen konnte und deshalb notgedrungen weit weg ins Abseits zweier Torbalken stellte. Daß ich dort eine von allen anerkannte gute Figur machte, erhöhte jedoch meine Chancen, doch noch den einen oder anderen zum Mitmachen überreden zu können, nicht im geringsten.
Ich habe danach nicht mehr oft daran gedacht, bis mir eines Tages etwas in die Hände fiel, das mich wieder an den Jungen erinnerte, der ich vor fünfzig Jahren gewesen war, an die tagelang trotzig verschlossene Tür meines Zimmers, die mich vor dem blamablen Desinteresse meiner Mitmenschen schützen sollte, an die Paraden und glücklich gehaltenen Elfmeter, an die reizbare Hilflosigkeit meiner Mutter und das Mißtrauen meines Vaters der genügsamen Zufriedenheit seines Sohnes gegenüber, der einfach nicht dazu zu bewegen war, sich für etwas anderes als sich selbst zu interessieren – und, das vor allem, an eine erstaunliche, aufregende und, wie sich herausstellen sollte, auch folgenreiche Entdeckung, denn zum ersten Mal schaute ich von mir erfundenen Sätzen ins Gesicht – und lange dauerte es nicht, und ich betrat die vielfach verspiegelten Kabinette mir bis dahin völlig unbekannter Geschichten.
Ich hatte an diesem Tag auf dem Tisch, der bei mir als Ablage für alles zuständig ist, eigentlich nur nach dem Verbleib eines Zettels mit Telefonnummern gesucht und als Trost schließlich ein Blatt mit seltsamerweise genau drei mit Bleistift (einem breiten, samtweichen B8) hingekritzelten Wörtern in der Hand, die ich hier wiedergebe:
Der Junge
Saint Tropez
Schauspielerin
Der Rest nichts als die schreckliche Einöde einer leeren weißen Seite.
Ich sollte Ihnen eine Begegnung mit der Eigenart dieser Unordnung nicht vorenthalten, diesem sich flüsternd auftürmenden, einem Nestbau ähnlichen Gebilde, dem jeden Abend vor dem Einschlafen mein letzter Blick galt, als habe der Magnetismus kommender Träume ihn dorthin gelenkt.
Es liegen hier, neben einer Ansammlung von sonstigem Krimskrams, alle Arten von in Mappen aufbewahrten Papieren herum, freigegeben zur Enträtselung. Notizen, Botschaften, Reste einer Begeisterung, aus Zeitungen gerissene Artikel, speziell jene, in denen die Zahl »23« eine Rolle spielt – »23 Buckelwale vor der Küste Kaliforniens verendet«, »Der Dreiunddreißigjährige tötete die elf Jahre junge hoffnungsvolle Ballettschülerin mit 23 Messerstichen«, »William Shakespeare, Shirley Temple und Vladimir Nabokov sind am gleichen Tag geboren, dem 23. April«, wobei Shakespeare auch noch das Kunststück gelang, an einem 23., ausgerechnet auch noch an einem im April, an seinem Geburtstag also, zu sterben –, eine Zahl, deren Bedeutung mir entfallen, die aber irgendwie bei mir hängengeblieben ist. Und erst meine Sammlung von Namen! Mein Gott, Namen, was alles für Namen, das ganze olympische Register von Polly Apfelbaum bis Adele Zuckerkandl, die Herren Fernand Khnopff und Otto David Langsam hinzugerechnet. Seit ich in Wien wohne, habe ich sie wiederentdeckt, lese sie auf den Schildern alter Ladengeschäfte, den Klingelschildern der Wohnhäuser, an denen ich vorbeispaziere, oder auf Grabsteinen mit einer Begeisterung, als wolle ich sie für immer im Gedächtnis behalten. Ich suche inzwischen sogar schon bei meinem Antiquar die Regale nach Verzeichnissen mit Namen ab; letzte Woche erst habe ich etwas gefunden und natürlich gekauft, ein in Leinen gebundenes Verzeichnis, erschienen anno 1907 in Wien und nicht eben billig, mit nichts als den Namen (inklusive aller Adels- und vom Kaiser verliehenen Ehrentitel) der Mitglieder des Jockey Clubs für Österreich. Aber nicht nur Kostbarkeiten wie dieser Fund stapeln sich auf dem Tisch hier, sondern haufenweise aus meinen Notizblocks herausgerissene Seiten, voll mit kuriosen Begegnungen. Zitate aus Büchern treffen zusammen mit der genauen Uhrzeit einer Verabredung, eine erratische Behauptung wie die, daß die wirklichen, die wissenden Dichter, die wahren Seher und Propheten nicht etwa die Poeten, sondern die Mathematiker, die Physiker, die Wissenschaftler seien mit ganz praktischen Ermahnungen, der etwa, beim Einkauf am Wochenende nicht wieder, wie ich mir (zu spät zumeist) dann immer vorwerfe, mit dem Geld zu geizen, insbesondere nicht bei Olivenöl und Honig; es grüßen sich Frage- und Ausrufezeichen, untermischt mit Stichworten, ganzen Listen von zum Teil unleserlichen Stichworten, wie ich sie vor dem Hinüberdämmern, und oft ohne deshalb extra Licht machen zu wollen, einfach auf ein immer in Reichweite liegendes Stück Papier kritzle, kaum entzifferbare Zeilen, zerdehnt wie die Schrift eines bereits Eingeschlafenen. Das Universum braucht Hilfe, die Hilfe eines Kindes! Die hätte, steht daneben, bitter auch jener Schriftsteller nötig gehabt, der verzweifelte, weil ihm nie jemand applaudierte, nicht einmal seine Schreibmaschine. Hier zum Beispiel, was haben wir hier? Einen von seinem Schein verwirrten Mond. Nicht schlecht, mehr aber auch nicht. Sie onanierte zur Musik von Bellini-Opern, schau an. Das schwere Schweigen ihrer Augen. Weiße Wimpern. Alle im Raum Anwesenden erschienen mir von verletzender Fröhlichkeit. Kampf um keine Gefühle (unterstrichen auch noch, warum nur?). Und was soll das sein? Wer in einem leeren Zimmer sitzt, sollte nicht in die Ecken schauen! Aha! Keine Ahnung, was ich gemeint haben könnte! Ich werde sicher irgendwann mal ein Zimmer leer räumen, ich kenne mich, und mich versündigen; und etwas Unsichtbares entdecken, etwas wie die Einkleidung einer Braut, ein ausblutendes Lamm, eine Kreuzigung. Weg damit, sagt mein Verstand. Aufbewahren, alles aufbewahren, sagt die Erfahrung. Warst Du nicht manchmal mit mir in der tiefen Höhle der Champagnergläser, wo die roten Lobster herumkriechen und schwarze Kellner die roten Rumbas servieren? – ein Zitat offenbar, nur von wem steht nicht daneben. Und hier? Sie geht wie auf weißen Handschuhen. Und darunter (kaum zu entziffern): Einer geht die Welt besuchen wie ein Gast, der am Abend noch anderswo eine Verabredung hat. So geht das weiter. Andere haben Karteikarten, ich einen Saustall.
Ich werde die weißen Handschuhe bei Gelegenheit den kleinen Füßchen einer Frau überstreifen und sie damit eine Straße entlanggehen lassen, mit einem Gang, den man mit Schuhen einfach nicht hinkriegt. Sie schwebt, ein bißchen ungeschickt zwar noch, aber ohne doch groß den Boden zu berühren; das erledigt eine Federboa, die sie hinter sich herschleift. Ob es vernünftig ist, nichts zu essen außer zum Tee etwas Konfekt? Sie scheint sich jedenfalls erfolgreich dem Gewicht ihres Lieblings angepaßt zu haben, der Miniaturausgabe eines Malteserhündchens, das sie Gassi führt. Ich glaube nicht, daß der junge Bursche, der da behaglich im Zentrum eines Sonnenstrahls an der Hauswand lehnt, dafür Augen hat; es sei denn, er entdeckt, was wirklich Gewicht hat: ihre Klunker! Sie hat ihre Finger mit Gold, ihren Hals mit einer dreifach geflochtenen Perlenkette herausgeputzt. Die ganze Dame ist eine Schatztruhe. Könnte es sein, daß er Geld braucht, Verbrecher verehrt, geschickte Diebe? Daß er verrückt nach dem Ruhm ist, den in den Filmen, die ihm gefallen, Gesetzlose genießen, verrückt nach der Fama ihrer Unsterblichkeit, der Endgültigkeit einer Tat? Er will kein Mörder werden wollen, nein. Das Kunststück eines Einfalls sollte genügen, sie ein wenig auszurauben. Und Einfälle traut er sich zu. Da er gerade weiter nichts zu tun hat, geht er ihr hinterher, was nicht einfach ist, weil die beiden nicht recht vorwärtskommen; es geht zu langsam, es gibt zu viele andere Zwei- und Vierbeiner. Daß sie am Ende der Rue Allard ein Taxi anhält und einsteigt (und fort ist sie!), macht nichts. Er hatte ohnehin nur vorgehabt, den Tag zu verbummeln und dann die Küste entlang Richtung Marseille abzuhauen.
Ich halte die Nachricht mit den drei Wörtern immer noch in der Hand, den angedeuteten Gruß einer ungeschriebenen Geschichte.
Ausgeschlossen, daß ich mit dem Gedanken gespielt haben könnte, mir eine Liebesgeschichte ausdenken zu wollen, eine auch noch, die in Saint Tropez spielt, zwischen einem Jungen (wie alt?) und einer Schauspielerin, einer Filmschauspielerin meinetwegen, und der Junge, ein schlaffer, immerzu schläfrig wirkender Snob, hat sie in der Hand (und die Hand auf ihrem Geld), weil er minderjährig ist – was sich nach seiner Verhaftung dann allerdings als Lüge herausstellt, aber er hat sie, um sie erpressen zu können, einen Sommer lang erfolgreich im Glauben gelassen, sich wegen ihrer intimen Beziehung strafbar gemacht zu haben – und in die Frau alles andere als verliebt (was stimmt). Ich hätte die Filmrechte verkaufen und mir endlich ein ordentliches Telefonbuch und einen Stapel Karteikarten leisten sollen.
Schon eher könnte es sein, daß ich in Cafés herumgesessen und in Zeitungen geblättert habe – und dabei irgend etwas aufgeschnappt habe von einer, na ja, einer Hollywooddiva, deren einziger und von ihr vergötterter Sohn heroinsüchtig ist. In einem Film von Bernardo Bertolucci, La Luna, ist der Sohn genau das, seine Mutter allerdings eine Opernsängerin (Mezzosopran), die mit ihrem Adonis von Sohn tatsächlich sogar Inzest begeht. Sie hat eine Schönheitsoperation (nach einem Autounfall) hinter sich, eine Scheidung (eine nur, wie sie in Interviews gern betont) und ihren insgesamt dritten Nervenzusammenbruch, den fröhlichen ersten als Teenager. Auch daraus macht sie kein Geheimnis. Wieso auch, es ergab sich so und hat sie, als es sich wiederholte, nicht einmal mehr gewundert. Auf die wenig belastbaren Nerven, die sie von ihrer Mutter geerbt hat, war kein Verlaß. Sie hätte natürlich, wirft sie sich jetzt vor, weniger Filme drehen oder sich weniger oft mit ihren Regisseuren anlegen können. Sie hätte weniger trinken und auf manche der üblichen Dummheiten danach verzichten sollen, nach den Partys. Ihre Hauptbeschäftigung derzeit: einem schwulen italienischen Exmaoisten, einem inzwischen auch international gefragten Star unter den Innenarchitekten, ihre Wünsche zur Umgestaltung ihres Anwesens zu erläutern und sich von der Idee zu verabschieden, ein Leben ohne den Schutz purpurfarbener Seidentapeten für eine Zumutung zu halten. In Saint Tropez haben solche Leute Villen, ich weiß das, ich kann sie sehen; sie hängen wie glitzernde Schneeklumpen an der Küste, überdacht von Pinien und importierten Palmen.
Ich stelle mir vor, ein Filmproduzent sucht für eine Schauspielerin, in die er sich verliebt hat, die richtige Rolle, die Rolle ihres Lebens. Auf ihrem Nachttisch, so weit ist er schon vorgedrungen, sieht er einen Band mit Gedichten liegen, was ihm mißfällt. Was ihn interessiert, als er das Buch aufschlägt, sind nicht die Gedichte, sondern einzig und allein die Stelle, in die ein Lesezeichen eingelegt ist. Zwei Gedichte, die er überfliegt, aber nur das auf der linken Seite, ein kurzes, aus nur drei Wörtern bestehendes, das er zuerst liest, inspiriert ihn. Da ist sie doch, denkt er, das ist doch die Rolle, über die er sich, seit er sich verliebt hat, den Kopf zerbrochen hat. Sie spielt, was sie ist: eine Schauspielerin, eine Filmschauspielerin, wenn sie will, eine Frau, die nicht denkt (sein Einfall!), es sei denn, und das am liebsten, mit den Hüften, mit der Haut, mit Haut und Haaren, eine, die, wenn sie Nein! sagt, das auch ihre Fingernägel sagen lassen kann. Eine Frau mit Geschmack, eine Frau in der verletzlichen, kostbar kurzen Blüte vor dem Verblühen, diesem ersten hingehauchten, schmelzenden Adieu der Schönheit, die bekanntlich einen Betrachter mehr entzückt als das vom Gedanken an die Vergänglichkeit geplagte Opfer. Sie hat einen Mann, den sie liebt, liebt mit der stillen hellen Kraft einer nie enttäuschten Kinderseele, was sie dennoch nie abgehalten hat, Liebhaber zu haben, intelligente, vielseitig verwendbare, in den meisten Fällen ebenfalls wie sie glücklich verheiratete Männer, und zwischendurch, selten, die eine oder andere Affäre. Er ist schwer zu bremsen, wenn er aus dem Nichts, aber in Leinwandgröße eine Frau modelliert, die ihm auch privat gefallen würde, wobei er ganz vergißt, daß es dieses Mal umgekehrt ist. Einen Film mit ihr drehen ist seine Art, ihr den Hof zu machen. Beginnen wird es am Drehort, in einem Hotel. Es wird gutgehen, bis zur Premiere. Sie werden ein Liebespaar sein, bis ihn sein Beruf zwingt, die Liebe nicht wichtiger zu nehmen als seine Arbeit. Wer den Jungen spielen soll, weiß er auch schon. Das hat ihn nach oben gebracht, seine Schnelligkeit, seine, wie er sie liebevoll nennt, verdammte Schnelligkeit.
Er sichert sich die Rechte an dem Gedicht. Was natürlich, wie ihm klar ist, völlig lächerlich ist, wenn auch, soweit er weiß, im internationalen Filmgeschäft einmalig: einem, der gerade mal drei Wörter auf ein Blatt Papier gerotzt hat, ein Vermögen zu zahlen. Als Erwähnung in einer Autobiographie allerdings ist es genau die Art Anekdote, die er in Büchern so liebt – und also, entscheidet er, das Geld wert. Wie sonst soll er den Dummköpfen, die ihn trotz der Filme und Schlagzeilen, die er produziert, unterschätzen, klarmachen, zu welch poetischer Geste ein Mann fähig war, der seinen Lesern eines Tages gleichwohl versichern wird, daß er diese Kanarienvögel – so nennt er die Dichter! – nie ausstehen konnte.
Ich kenne Filmproduzenten, vor allem einen, der immerhin, wenn er mich sieht, noch Zeit für eine Zigarette und ein paar Freundlichkeiten hat, gleichzeitig aber mit seinem Büro oder Chauffeur telefoniert. Eigentlich, mein Junge, machst du alles falsch, sagt er zwischendurch – was, wie ich ihn kenne, zärtlich gemeint ist, fast ein wenig eifersüchtig, seit er weiß, daß Frauen Gedichte lesen, sogar Frauen, die gut im Bett sind. Ich werde zurückkehren, mit dunkler Haut, wild leuchtenden Augen, eisernen Gliedern, mit starren Zügen, daß man glauben muß, ich gehöre zur Rasse der Starken; ich werde Gold haben, ich werde faul sein und brutal – so oder so ähnlich eine seiner Phantasien, wenn er getrunken hat. Auch wenn er nicht über die humoristische Selbstgenügsamkeit des Genies, das er gerne wäre, verfügt und er am liebsten mit dem Rücken zu seinem Publikum säße, soll die Welt seinen Aufenthalt auf ihr zur Kenntnis nehmen. Er reißt nach dem Aufwachen (gegen Mittag!) die Vorhänge auf, als erwarte er Applaus. Aus schierer Begeisterung über das taktvolle, von einer zurückgelassenen Nachricht beglaubigte Verschwundensein einer Nachtbekanntschaft, die ihn nach Hause verfrachtet haben muß, könnte er sich mit einem Doppelsalto verbeugen vor ihr. Dieser schöne, kraftvolle Gedanke verkümmert allerdings nahezu vollständig bei der ersten Berührung seiner Atemwege mit frischer Luft, denn die nächste halbe Stunde schüttelt ihn erst einmal ein (ihm allerdings wohlbekannter) Hustenanfall, während dem er nicht viel mehr zustande bringt, als ein paar wenig schmeichelhafte Vermutungen anzustellen über den Ablauf der vergangenen Nacht, ausgehend von einigen verstreut um sein Bett herumliegenden Videokassetten, erotisch aggressiver Billigware, die ihm, als er sie sieht, restlos die Lust nehmen, sich weiter mit der Rekonstruktion der vergangenen Stunden abzumühen. Er kennt sich, kennt den Junggesellen, der hier genächtigt hat, lange und gut genug, kennt dessen rohe, jedes Anstandsgefühl außer Kraft setzende Rücksichtslosigkeiten, und er kennt, wenn er es hinter sich hat, sein Bedauern. Wie immer nach dem Erwachen beschäftigt ihn das Bedürfnis, eine Geliebte (nur welche?) um Liebe zu bitten und die allzu verräterischen Requisiten noch vor dem Zähneputzen zum Abfall zu befördern! Nicht daß sich eine je beklagt hätte, das nicht, und nicht eine war jemals wirklich schockiert gewesen, aber es ist, was sie gesehen haben, das, was im Gedächtnis bleibt. Es ändert alles. Es ist jetzt nicht mehr so einfach, ihn kennenlernen zu wollen. Um es sein zu lassen, müßte er sich verlieben, denken sie, und sind, wenn er anruft, wie beim ersten Mal unentschlossen, ungeschickt. Sie verabreden sich. Er läßt nicht locker. Er ist selbst in seiner Hilflosigkeit stärker als sie. Dem Mann, der nach Mitternacht mit den Rosen auftaucht, kauft er alles ab, was er hat – und umarmt die Beute. Er liebt Dornen; und fegt mit ihnen die Gläser vom Tisch, ein Privileg, dessen Kosten sein Büro anstandslos begleicht. Er mag, wenn er blutet, Stierkämpfer, Napoleon, die Stimme der Callas. Warum nicht, nur daß seine Entschlußkraft im Moment (wieder einmal) zu sehr durch die Anstrengung geschwächt ist, sich erst einmal Schicht für Schicht frei zu husten. Es hat etwas Hoffnungsloses. Ein Blick auf die Uhr befiehlt ihm, das Schlachtfeld sich selbst (und seiner wenig pingeligen Putzfrau) zu überlassen. Der Dunkelheit in den Lungen und dem Getöse in seinem Schädel ist mit einem Gebet um Erlösung von allen Übeln der Leidenschaft ohnehin nicht beizukommen. Er kann sich, was die nukleare Energie seiner durch Erschöpfung und Gleichgültigkeit gereizten Sinne betrifft, auch keine Reue leisten, nicht jetzt, wo er unter die Dusche und dort zur alten Stärke zurückfinden muß, bevor er das Haus verläßt.
Wir kennen uns lange. Vor zwanzig Jahren gab es kaum eine Nacht, in der wir uns nicht über den Weg gelaufen sind, beide angetrunken genug, um mit dem Trinken erst gar nicht aufhören zu wollen. Auch sonst konnten wir nicht aufhören, uns treu zu bleiben. Ich überließ ihm das Gold, er mir die Faulheit. Ich hätte ihm auch gern die Frauen überlassen, aber leicht war das nicht. Wir erledigten die Sache fair und per Handschlag. Wir ließen, was gefällt, sie entscheiden. Das letzte Wort ihnen, das letzte Glas uns. Faules Gold, glänzende Faulheit, unsere Chancen waren, sehr auch zu meiner Überraschung, ausgewogen.
An Saint Tropez selbst erinnere ich mich natürlich, ich habe dort schließlich lange genug und regelmäßig die Herbst- und Wintermonate in der Wohnung eines Freundes verbracht, allein, so allein, daß ich die Einsamkeit jedes anderen spürte. Ich zählte die Glockenschläge der beiden Kirchen, die, als lägen sie im Streit um die genaue Stunde, zeitversetzt läuteten; ich traute keiner der beiden, so wenig wie ich dem allnächtlich angestimmten Gelächter und Geschrei später Passanten traute, die unter meinen Fenstern einigen Lärm machten. Wer so laut ist, ist einsam. Es sind die Einsamen, die ich höre.
Ich will nicht behaupten, daß mein seelisches Gleichgewicht vom Anblick ungeheurer Wassermassen und einem ebenso wenig geheuren Himmel darüber abhängt, aber nach einer Nacht mit schweren Träumen tat ein Spaziergang einen langen weiten menschenleeren Strand entlang gut, im Winter besonders, vor allem ohne die Ablenkung, eine wasserscheue Undine im Schlepptau zu haben, ihr womöglich auch noch zuhören und antworten zu müssen. Der Raum war groß und still, eine Stille, die auch die gleichmäßig sich brechenden Wellen nicht störten, und schaffte Platz für etwas Mächtigeres und Dauerhafteres als die zufällige, hinfällige Existenz eines Beobachters, der darauf mit seinem Schweigen, seinem, seit seiner Ankunft, bis zur Absurdität ausgeübten Schweigen antwortete.
Erleichtert und vom Glück des Gehens ermüdet, schlief ich, ein Buch in der Hand und Sand zwischen den Zehen, meistens sofort ein, immer wieder von neuem überrascht, wie es mir gelang, eine lange Stunde mit dem ruhigsten Gewissen (und garantiert traumlos!) einfach einschlafen zu können, zu jeder Tageszeit. Vor dem Fenster schaukelten die Schiffsmasten, schmale bewegliche, mit bewundernswerter Präzision gearbeitete Gebilde. Noch beeindruckender als die Aufbauten der Takelage war die Musik, die sie produzierten, ihr Singen, Surren und Schlagen, nachts vor allem, wenn sich das Ohr ausruhte und zuhörte, wie das Wasser gegen die Hafenmauer klatschte und der Wind mit dem Tauwerk spielte, den Reffleinen, den metallenen Schnüren und Masten. Der Wind redete, der Wind hörte zu, zu Späßen aufgelegt oder tobend. Wie gern ich diese einzigartige Unterhaltung, beschützt hinter geschlossenen Fenstern, belauschte, wie wohlbehalten ich einschlief mit dieser Einladung an den Einsamen, aufzustehen und in See zu stechen.
Die meiste Zeit, das stimmt, lag ich ausgestreckt und angezogen auf dem Bett, schaute schläfrig über den Dorn meiner Stiefelspitzen (made in Texas) auf die Hafenmauer, auf den gegenüberliegenden Küstenstreifen mit den Hügeln, die schmale Linie Wasser dazwischen, auf der bei Sonnenschein alles tanzte, das Licht, die Segelboote und, ausgestreut auf den Wellen, die vielen hellen federnden Punkte. Die Mädchen waren fort, die Möwen geblieben. Ich kam also immer genau richtig.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.