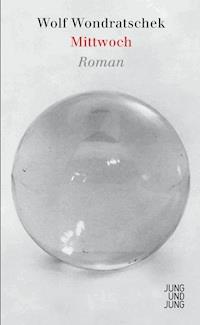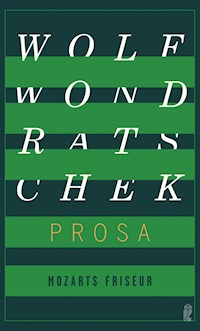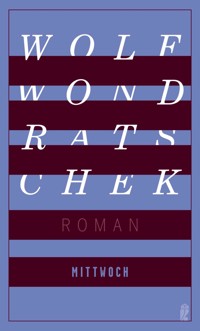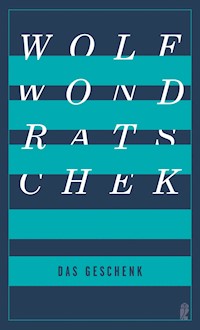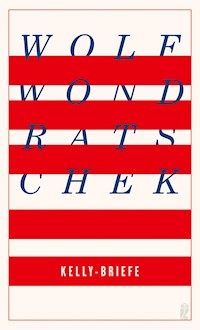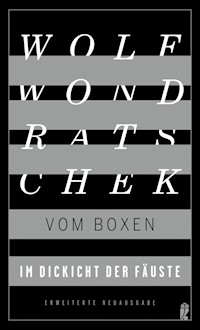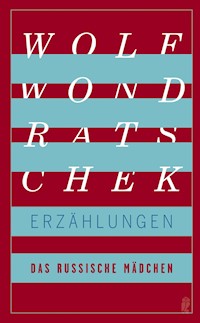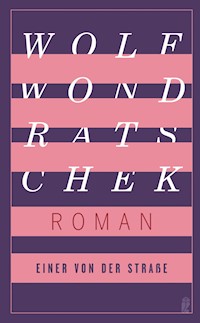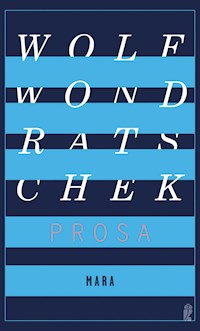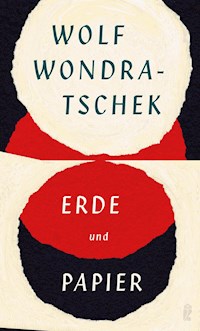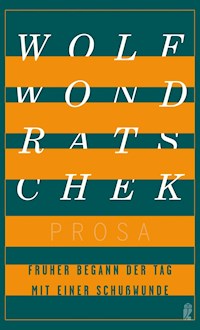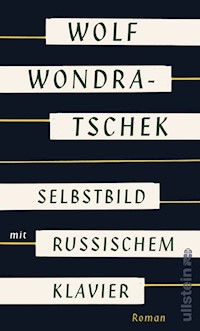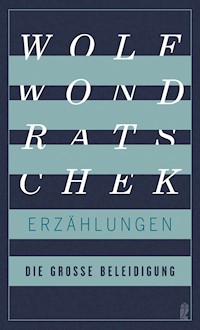
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Da staunen die Kritiker, denn jetzt fliegen ihnen ihre alten Vorurteile um die Ohren. Wondratschek legt hier ein veritables Meisterwerk vor.« Werner Fuld, FOCUS Eine alte, aus aristokratischen Verhältnissen stammende und seit langem in Wien gestrandete Russin erinnert sich beim Anblick von Seidenstrümpfen in einer Auslage am Graben an ihre Jugend in St. Petersburg. Ein Schriftsteller hat für einen Tag seinen kleinen Sohn am Hals und entdeckt, wie man zu einem glücklichen Menschen werden kann. Einem Filmregisseur droht der Verlust seines Augenlichts. Ein Geigenvirtuose leidet so sehr an Lampenfieber, dass er darüber verrückt wird. »Mit diesem Sieg der Kunst über die Schwerkraft meldet sich ein neu zu entdeckender Wolf Wondratschek zurück.« Katrin Hillgruber, Süddeutsche Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die große Beleidigung
Der Autor
Wolf Wondratschek wuchs in Karlsruhe auf. Von 1962 bis 1967 studierte er Literaturwissenschaft, Philosophie und Soziologie an den Universitäten in Heidelberg, Göttingen und Frankfurt am Main. Seit 1967 lebte er als freier Schriftsteller zunächst in München. In den Jahren 1970 und 1971 lehrte er als Gastdozent an der University of Warwick, Ende der Achtzigerjahre unternahm er ausgedehnte Reisen unter anderem in die USA und nach Mexiko. Er lebt seit 1996 in Wien.
Das Buch
Eine alte, aus aristokratischen Verhältnissen stammende und seit langem in Wien gestrandete Russin erinnert sich beim Anblick von Seidenstrümpfen in einer Auslage am Graben an ihre Jugend in St. Petersburg. Ein Schriftsteller hat für einen Tag seinen kleinen Sohn am Hals und entdeckt, wie man zu einem glücklichen Menschen werden kann. Einem Filmregisseur droht der Verlust seines Augenlichts. Ein Geigenvirtuose leidet so sehr an Lampenfieber, dass er darüber verrückt wird.
Wolf Wondratschek
Die große Beleidigung
Erzählungen
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Die Erzählungen wurden alle in Wien geschrieben.
© Wolf Wondratschek (2022)Neuausgabe der unter dem Titel Die große Beleidigung im Jahr 2001 erschienenen Textsammlung© dieser Ausgabe by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022Alle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: brian barth, berlinE-Book powered by pepyrus
ISBN 978-3-8437-2794-5
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Giotto
Auf dem Graben
Die Erfindung eines glücklichen Menschen
Die große Beleidigung
Anmerkungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Giotto
Widmung
»Ich für meinen Teil konnte niemals einsehen, wozu es gut sein sollte, sich Bücher auszudenken und Dinge niederzuschreiben, die sich nicht in der einen oder anderen Form tatsächlich ereignet haben.«
Vladimir Nabokov in »Frühling in Fialta«
Der Autor mit seinem Sohn Raoul »Raoulito« Klein; Foto von Lilo Rinkens
Giotto
1
Plötzlich war da dieser Satz.
»Ich möchte etwas schaffen, das ich, ohne mich zu schämen, Giotto zeigen könnte.«
Giotto! Ich hatte es genau gehört, obwohl ich gerade in einem Tumult von Geschrei und Gelächter nach dem Verbleib meines Mantels fahndete, um die Party, die mich eigentlich nichts anging, zu verlassen. Aber wie es so ist, irgend etwas hält einen auf, man läßt sich das Glas nachschenken und bleibt.
Der Lärm war wirklich beträchtlich, aber dieser Satz hatte sich gegen jede akustische Wahrscheinlichkeit bis zu meinem Ohr durchgekämpft. Gleichzeitig war, wie ich verwundert feststellte, der Lärmpegel gefallen. Irgendein Schalter hatte den Ton abgedreht. Natürlich war ich der einzige, der hörte, wie es still wurde.
Es war dieser Satz, dem ich, wie sich dann herausstellte, meine Bekanntschaft mit Nohál verdankte, ohne ihn allerdings bis jetzt zu Gesicht bekommen zu haben.
Wir waren beide Gäste einer Partygesellschaft. Ich hatte auch die Gastgeberin vorher noch nie gesehen, sondern war, ohne eingeladen zu sein, im Schlepptau eines mit ihr befreundeten ungarischen Tänzers erschienen, der auch mein Freund war, eine Art Naturbursche, gesegnet mit einer Sprungkraft, die es ihm gestattete, aus jeder noch so kleinen Rolle (nein, ein Prinz war er wahrlich nicht!) die umjubelte Attraktion des Abends zu machen. Das war der Ungar, auch wenn er die Schäbigkeit einsah, mit den Bocksprüngen seines Temperaments immer und überall imponieren zu können. Sein zweites großes Talent bestand darin, Frauen, die ihm gefielen – und welche gefielen ihm nicht? –, mit robuster Zielstrebigkeit den Kopf zu verdrehen. (Ein Talent, das mir abgeht. Aber so ist es unter Freunden: Ein jeder ist des anderen Sehnsucht.) Unter der bengalischen Oberfläche, die er der Öffentlichkeit präsentierte, war aber ein anderer versteckt, der nicht sprang und auch nicht tanzte. Ein Mann, der nach einer Frau suchte, die er heiraten und mit der er Kinder haben wollte. Er hatte es satt, den Verführer zu geben, und sehnte sich, wie ich wußte, nach einer Frau, der er zutraute, ihn auf der Stelle in ein monogames Wunderkind zu verzaubern. Im Augenblick allerdings stand mein Freund erst einmal seinem nächsten, bereits erlegten Opfer gegenüber – und wie ich sah, machte er es wie immer kurz und eindeutig. Er hatte schon ihren Mantel im Arm.
Giotto! Ich möchte etwas schaffen, das ich, ohne mich zu schämen, Giotto zeigen könnte. Ich hatte es gehört! Andererseits, wieviel Giottos standen allein in Rom im Telefonbuch? Hieß vielleicht einer der anwesenden Tänzer so? Hatten Italiener nicht alle solche Namen, angefüllt mit der Schönheit kleiner Arien? Hatte ich den Rest des Satzes womöglich mit einer Erinnerung ergänzt, die mir entfallen war? Was sollte ich nun tun? Wonach Ausschau halten? Wer war die Stimme, wem gehörte sie?
Ich schaute mich um, musterte die anwesenden Männer, überlegte, welche Kleinigkeit genüge, die betreffende Person zu verraten. Aber als was? Warum nahm ich an, er müsse Maler sein? Und wenn, wie erkennt man einen? An einem von Humorlosigkeit gequälten Gesicht? An einem bunten Bart? Am ausgefallensten Einstecktuch? An feingliedrigen Fingern? War er überhaupt Maler? Reden so nicht auch Angeber? Ich suchte die Zimmer nach der lautesten Stimme ab, was ich gleich wieder aufgab. Dann landete ich frontal vor einer Frau, die mich, wie sich herausstellte, verwechselte, was sie nicht daran hinderte, mich erst einmal zu begutachten. Da eine Flucht vor ihr im Gedränge schwer zu bewerkstelligen und mir auch nicht nach einer Unfreundlichkeit zumute war, gab ich mich geschlagen.
Sie nahm sich ausgiebig Zeit, meinen Beruf zu erraten. Dabei erstellte sie eine hinreichend sorgfältige Liste besonderer Merkmale und fügte jedes ihrem Ratespiel hinzu, ohne sich am Ende sicher zu sein, ob ich nun Schiffsingenieur sei oder … ja was nur? Ich machte ihr die Freude. Erraten, log ich und gab meiner Anwesenheit in der Stadt den Anstrich eines Landurlaubs. Sie musterte mich wieder. Warum, schien sie zu bedauern, war der Kerl nicht ein einfacher Matrose und einige Erdumrundungen jünger? Trotzdem gab sie nicht auf, mich für ihre Angst vor Ozeanen zu begeistern, und nahm offenbar an, wir müßten uns auf einem leckgeschlagenen Vergnügungsdampfer schon einmal begegnet sein – Auge in Auge, und das nicht nur im Bruchteil jener Sekunde, die einem Kuß vorausgeht, sondern im Angesicht des sicheren Untergangs. Wir hätten, wenn es nach ihr gegangen wäre, auch jetzt keine Zeit zu verlieren gehabt.
Ich sollte ihr Jahre später (sie war jetzt schwarz- statt rothaarig) wiederbegegnen, bei genau jenem Mann, nach dem ich gerade suchte. Sie erinnerte sich nicht mehr, war aber in der Zwischenzeit, wie ich erfuhr, in den Hafen einer Ehe eingelaufen – und hatte es fertiggebracht, dort mehr ihren Mann als sich selbst zu vertäuen. Sie schien weiter die Freiheit zu genießen, das Hafengelände (das war alles, was jenseits ihrer Wohnungstür lag) nach Matrosen abzusuchen, nach einem richtigen Stück Mann, wie sie es nannte, um sich darüber vor Lachen zu schütteln. Ein Hustenanfall ließ sie schlagartig altern. Unter der Schminke schien die Haut zu verrutschen. Zwei gut sichtbare Operationsnarben gaben Farbsignale von sich. Die Schläfen waren blau und durchsichtig. Sie senkte den Kopf, aber nur, um (verjüngt durch zwei, drei tiefe Atemzüge) wieder aufzutauchen. Da sie mich, wie gesagt, nicht wiedererkannte, war wieder ihr Ratespiel an der Reihe. Und wieder Wasser! Sie blieb ihrem Element treu. Ich sei, vermutete sie, sicher tätowiert. Vermutlich habe sie erst gestern von mir geträumt. Ob meine Haut nach Muscheln roch? Sie eliminierte jeden Zufall aus der Tatsache, daß wir einander begegnet waren. Noch eine halbe Stunde – und ich war das Geschöpf ihrer Wahl, unfähig natürlich, dem Organisationstalent ihrer Ideen zu entkommen. Als sie auch noch darauf bestand, in Verwandtschaft mit bereits erloschenen Sternen zu stehen, gab ich auf, segnete sie mit einem Schimpfwort und empfahl mich.
Ich fragte die Gastgeberin, die mich gerade mit einem weiteren Glas Wein bewirtete, ob einer ihrer Gäste Künstler sei.
Alle, lachte sie, mehr oder weniger natürlich.
Entweder, dachte ich, hatte sich einer nur im Ton vergriffen, oder es befand sich ein interessanter Mensch in einem der beiden nichtssagend möblierten Zimmer. Ich schlängelte mich also durch die kleinen Gruppen, die sich zusammengefunden hatten, aber niemand erzählte von einem Urlaubstag im norditalienischen Padua, seinen Kirchen und den Fresken dort, niemand von seinem Staunen über die Kühnheiten alter Kunst. Nichts, was ich aufschnappte, ließ darauf schließen, daß der Name des italienischen Meisters je hätte fallen können. Ich jedenfalls sah keinen Zusammenhang zwischen einem Gedankenaustausch (in der Küche) über leistungsstarke, gleichwohl versicherungsgünstige Autos, einer Debatte (im Flur) über das berufsbedrohende Ballerinen-Handicap eines zu großen Busens oder (rund um das Bett) die Behandlungsmethoden und Heilungschancen in Abano, dem Mekka invalider Tänzerinnen und Tänzer – und Giotto! Und auch der sonstige Klatsch, der die Gäste beschäftigte, war eine Sackgasse; da führte kein Wort in ein Museum oder vor ein Gemälde.
Ich hatte dann aber doch noch Glück. Mir fiel ein Mann auf, der dastand, als wollte er das Gewicht eines Eisschranks nachahmen, und das nur, um nicht als Luftballon zu enden, dessen Schnur gerade den Händen eines Kindes entgleitet. Er war nicht auf die gleiche Weise anwesend wie alle anderen. So sieht einer aus, der nur als Summe seiner Gedanken wahrgenommen werden will. Dazu kam, daß er, wie mir auffiel, offenbar Schwierigkeiten mit seiner Sehschärfe hatte, was nichts mit dem genossenen Alkohol zu tun hatte. Er hielt (ein Kunststück!) Abstand selbst im dichtesten Gedränge, und immerhin kannten ihn fast alle.
Bis auf mich, der sich ihm vorstellte. Ich hatte es nicht eilig, auf Giotto zurückzukommen. Giotto interessierte mich auch nicht. Ich hatte keine Ahnung, was einen Giotto von einem Fra Angelico unterschied; ich hatte mich damit nie abgegeben. Im übrigen verabscheute ich das taubenblaue Geflunker über Kunst. Mit Giotto konnte er nur eine allerhöchste Instanz gemeint haben – und hätte auch gleich Gott sagen können. An den aber, der unter dem Firmenzeichen des Kreuzes immer noch aktuell ist, glaubte er nicht, wie ich dann später erfuhr.
Wir gaben uns die Hand. Sein Händedruck war unangenehm kraftlos. Nohál, stellte er sich vor, Anton Nohál, Sohn eines Forstmeisters.
Nach einer Kindheit mit viel frischer Luft sah er nicht aus, aber die lag, wenn ich richtig schätzte, auch schon sechzig Jahre zurück.
Fünfzig, korrigierte er meinen unausgesprochenen Gedanken.
Alles, was er von sich gab, klang so zerdehnt, so auffällig verlangsamt, als denke er an etwas ganz anderes: An den Gesichtsausdruck eines Mädchens, vertieft in die Lektüre eines Buches? An die Ekstasen der Melancholie und die Unmöglichkeit, sich diese Krankheit in der Kürze eines Menschenlebens je vom Hals schaffen zu können? An den roten Mantel des Glücks?
Ich habe auch bis heute nicht begriffen, was er mit der seltsamen, eigentlich unnötigen Bemerkung, der Sohn eines Forstbeamten zu sein, damals gemeint haben könnte, und gefragt habe ich ihn danach auch nie. Mag sein, daß er sich nur einen Scherz über die Logik der Vorsehung und die Absurdität allgemeiner Vererbungstheorien erlaubt oder ganz einfach aus dem Stegreif etwas erfunden hatte, was ihm die tollkühne Behauptung gestattete, den leiblichen Vater als eigene Erfindung ausgeben zu können. War ihm die genetische Abstammung zu langweilig, die sich in einer Ahnenreihe städtischer Beamter verlor? Sein eigenes Geburtsdatum, schien er vielleicht sagen zu wollen, liege tief im neunzehnten Jahrhundert, er habe jede Menge tote und lebendige Väter gehabt, habe sich wiederholt selbst, eigenhändig sozusagen, unter Mitwirkung all jener Frauen, die er geliebt habe, gezeugt, und dies mit epischem Vergnügen. Ich lernte später drei, vier seiner Verhältnisse kennen; eine Schönheit war nicht darunter, kein spöttisches Kind, keine vergnügte Amazone. In einem Lexikon würde ich, was seinen Geschmack betraf, unter dem Stichwort »Mumifizierte Intelligenzbestien« sicher fündig werden. Wo also lag sein Vergnügen, episch oder nicht, an der Gesellschaft ihm treuergebener Frauen, die er mehr beherrschte als begehrte?
Nun, auch er war nicht, was man einen ausgesprochen schönen, einen rundherum ausgewachsenen Mann hätte nennen können, auch nicht annähernd. Außerdem mußte etwas bei der Art seiner Selbsterfindung schiefgelaufen sein, denn er war auf einem Auge vollständig, auf dem anderen fast ganz blind. Natürlich wage ich nicht, darüber zu befinden, ob zwischen seiner Sehschwäche und seiner Vorliebe für Mauerblümchen (die nie auch nur einen einzigen Tag blühend überstanden hätten) ein Zusammenhang bestand, womöglich gar ein bewußt durchdachter. Vielleicht waren das alles aber auch nur Geschichten, mit denen er Frauen beeindruckte, die anfällig waren für jeden, der noch einen Funken Phantasie hatte – und die altmodische Geduld, seinen Erfolg abzuwarten. Die Bedrohung durch völlige Erblindung nahm dieser Mann jedenfalls mit einer Gelassenheit hin, die mich erstaunte. Der Ausgang jeder neuen Operation war ungewiß. Jede konnte sein Schicksal sein. Und doch zwang er seine Freunde, sich keinerlei Sorgen zu machen. Die Vorstellung, er könne, ganz nach biblischem Brauch, für den Hochmut seiner Einbildungskraft bestraft worden sein, schien ihm zu gefallen. Noch lieber hing er vermutlich der Vorstellung nach, die Götter seien, wenn auch strafend, an seiner Seite.
Nein, Maler war er nicht. Er war Filmregisseur.
Ein Regisseur von Filmen, wie er verbesserte. Nicht jeder, nicht wahr, der einen Pinsel in der Hand halte, sei deshalb gleich ein Maler, geschweige denn das, was wir nicht ohne Bewunderung einen Künstler nennen, ein Genie von mir aus.
Dann kam er auf die vermaledeiten Augen, mit denen er sich herumschlage, zu sprechen. Sicher, die Operationen seien lästig und die Monate danach zermürbend. Der Körper habe Schlagseite, verliere prompt jegliche Orientierung, dazu kämen Übelkeit und Schwindelanfälle und Kopfschmerzen, wahre Stromstöße von Kopfschmerzen. Lustig sei das nicht. Aber auch nicht zu ändern. Vom ewigen Schlaf des Gekreuzigten allerdings sei er noch weit entfernt.
Mir fiel auf, wie gut ihm der Vergleich gefiel. Für Heroismus hatte er, im Sieg oder in der Niederlage, etwas übrig.
Wenn sein Kampf aussichtslos war, würde er weiterkämpfen bis zum Eingeständnis, seine Kräfte überschätzt zu haben.
So bescheiden er in seinen unauffälligen Kleidern auch wirkte, wenn er ins Reden kam, verwandelte er sich in den unbesungenen Helden einer attischen Tragödie. Seine Mythen kannte er. Und manchmal hatte ich den Verdacht, er kenne den einen oder anderen ihrer Helden persönlich. Man glaubte ihm dann, Prometheus bewirtet zu haben, Prometheus, der das Feuer stahl und von den Göttern zur Strafe geblendet wurde.
Es genügte ein Glas zuviel (bei ihm und bei mir), und Nohál saß am Tischende in der Gestalt eines blinden Sehers, der Gegenwart (die er, bis auf die Fortschritte der Medizin, speziell der Augenheilkunde, für belanglos hielt) den Rücken gekehrt. Ein Mann mit dem untrüglichen Blick für Unsichtbares. Kurz, eine außergewöhnliche, höchst unterhaltsame Erscheinung.
Erfolg bedeutete Nohál nichts. Darin war er vorbildlich, beneidenswert vorbildlich. Ich kam ihm jedenfalls nie auf die Schliche, daß seine Gleichgültigkeit, was die Genugtuung öffentlicher Anerkennung betraf, gespielt sein könnte. Er war, was er zu sein vorgab. Mein Mißtrauen ist gegenüber jedem, der Gleiches von sich behauptet, groß, wenn nicht unerschütterlich. Und die Liste der Entlarvten ist schließlich gewaltig. Irgendwann rutschte jedem von ihnen eine Bemerkung heraus, die der Wahrheit die Ehre gab. Erfolg ist ein rauhes Geschäft. Man muß stark sein, um sich nicht einzumischen. An den Gestaden der Seligen herrscht Sturmwarnung, und das rund um die Uhr. Es toben unberechenbare, menschengemachte Unwetter. Und wohin man blickt, sieht es aus wie im Tal des Todes. Es kam vor, daß sich Nohál Späße erlaubte auch über die Opfer, wobei sich seine Spottsucht bester Gesundheit erfreute. Er leistete sich den Luxus, Ruhmsucht als Feigheit anzuprangern – und Erfolg als verdiente Heimsuchung. Da verließ er sich lieber auf seine Anonymität – und das Gedächtnis kommender Generationen.
Die größte seiner Heldentaten jedoch war die Routine, mit der er seinen Optimismus am Leben hielt, vermischt mit einer kräftigen Portion abgeklärten Humors. Ich sehe gerade noch so viel, um Qualität zu erkennen; und mehr ist nicht nötig, nicht wahr? Wäre ich Maler geworden, ließ er mich in Anspielung auf meine Frage wissen, hätte ich auf die Farbe verzichtet. Farbe ist Reklame. Und die hat Kunst nicht nötig. Mehr noch, sie ist absolut tödlich auf der Suche nach Wahrheit.
Aber langsam, langsam, wir hatten uns einander ja gerade erst vorgestellt.
Wahr oder falsch, Forstmeister oder Oberförster, Götter oder Gott, war er weder der Typ, der nach frischer Luft roch (oder zumindest danach aussah), noch wäre einer wie er je auf den Gedanken verfallen, sich auch nur die geringste körperliche Tätigkeit zuzumuten. Nicht bis zu jenem Tag jedenfalls, als er sich ein Sportrad kaufen ging.
2
Bis dahin lebte er mit den Angewohnheiten und Schußligkeiten eines Privatgelehrten, der kaum vor Mittag aus dem Bett kam und nie vor Mitternacht dahin zurückkehrte, lange nach Mitternacht am liebsten, nachdem er in Gesellschaft ausgiebig geredet, geraucht und Weinflaschen geleert hatte. Nachmittags telefonierte er, las, was nur bei Tageslicht und mit einer Brille (mit dem Vergrößerungsmaßstab einer Lupe) möglich war, und schrieb sich die Stoffe, die er zu verfilmen gedachte, selbst. Jedes Projekt konnte seine letzte Chance sein, jede Entscheidung eine endgültige, jede Einstellung Teil seines Testaments. Wer denkt an Teamwork bei der Abfassung eines Letzten Willens? An seiner Arbeit war schon lange nichts mehr gefällig oder gewöhnlich. Geschichten, die sich spannend nacherzählen ließen, gab es nicht mehr. Für Scherze war die Zeit zu knapp. Mit der Geduld eines großen Künstlers jagte er das Konzentrat, das Unwiederholbare. Vielleicht hielten ihn deshalb viele für ein Genie. Kein Wunder, wie er einschränkend zugab, bin ich doch wie ein Komponist, der nichts anderes gelernt hat, als eine Neunte Symphonie zu schreiben.
In der Tat, ein Künstler war er. Einer, der seine Filme wie Partituren notierte und wie Musik inszenierte, langsame, in den Klängen verharrende, schlafende Musik, die alle Zeit der Welt an Ausdauer übertraf. Die interessante Dunkelheit seines Sehens war illuminiert von der Schärfe seines Gehörs. Nirgendwo war der Kampf um Wahrheit heftiger als in den Innenräumen des Verstummens. Dort suchte und fand er die Drehorte für seine Filme.
Er verließ seine Wohnung nur noch selten. Spaziergänge, zu denen ich ihn wieder und wieder zu überreden versuchte, lehnte er als lächerliche Zeitverschwendung ab. Seinen Kaffee trank er zu Hause, seinen Wein auch. Einladungen akzeptierte er nicht, er lud selbst ein. Jeden Sommer machte er einmal eine Ausnahme. Dann packte ihn die eine oder andere seiner Freundinnen in ein Auto und fuhr für zwei Wochen mit ihm nach Italien, wo ihm die Veranda eines angemieteten Hauses genügte. Da saß er dann, diktierte die fälligen Drehbücher, schlief und machte sich ausgeruht allabendlich mit der herrschsüchtigen Sorgfalt eines Einzelgängers an die Zubereitung eines Essens, das mehr Gäste als nur die beiden verdient gehabt hätte. Er rauchte und trank, träumte und kommentierte und redete und dachte nach – bis ihm irgendwann danach war, sich auszustrecken und die Gedanken seiner Freundin zu erraten.
Ich habe mit ansehen müssen, wie ihn alle vergötterten, wie hingebungsvoll sie zusammenzuckten, wenn er sie unterbrach, wie glühend sie erröteten. Ich war Zeuge, wie er sie provozierte, wie unduldsam er ihre Unsicherheiten kommentierte, wie nachsichtig er verzieh, um sie danach, eingedeckt mit Schreibarbeiten, Listen sofort auszuleihender Bücher und Tabellen von Telefonnummern, nach Hause zu schicken. Ich staunte, denn er gehörte, offen gestanden, zu jenen Männern, die keinen Hinweis liefern, geschlechtliche Wesen zu sein. Unvorstellbar, sich den Mann nackt vorzustellen (ich hatte es aufgegeben). Er war ein Müßiggänger ganz anderer Leidenschaften, schaffte es aber mit seiner staunenswerten Gelassenheit und Konsequenz, seinen Harem zusammenzuhalten, mit welchem vitalen Einsatz auch immer. Nein, niemand verwackelte das Gruppenbild hilfreicher, mütterlich offenbar hochbegabter weiblicher Herzen. Ohne diesen Hofstaat an Helferinnen wäre nicht einer seiner vielen Filme möglich gewesen, sowenig wie die Kraftanstrengungen unbezahlbarer Arbeit denkbar wären ohne Liebe.
Die Regie seines Privatlebens war, das ist nicht zu leugnen, eine höchst gelungene Sache, selbst ein Kunstwerk. Ich denke, er sah das auch so. Er wußte, was es heißt, eine Mannschaft zusammenzuhalten. Eine andere Chance hatte er nicht, nicht angesichts der Katastrophe, fast nichts mehr zu sehen. Es blies ihm die Nacht ins Gesicht. Und trotzdem amüsierte er sich, trotzdem drehe ich Filme.
Dreharbeiten, versteht sich, waren nur noch möglich zwischen den Operationen, und auch erst dann, wenn sich das wieder leidlich hergestellte eine Auge genügend stabilisiert hatte. Alles Organisatorische mußte abgeschlossen, alle Details organisiert, die Spiellaune aller stimuliert sein. Achtung Aufnahme! Kamera ab! Wie oft schob sich die Sonne aber gerade dann hinter eine Wolke; wie häufig fehlte plötzlich doch wieder etwas, wenn sie wieder schien; wie mühsam war es, die Konzentration zu halten, die eigene und die aller anderen. Da war es leichter, einem tollwütigen Hund das Fell zu bürsten.
Und da war nun er, selbst ein Himmel, ein Gestirn, ein mit treibenden Wolken versetztes Sonnenlicht, undefinierbaren Sinnestäuschungen ausgesetzt, blind allein schon vor Erschöpfung, einem ganz anderen Zeitdruck unterworfen als dem, der von Kalendertagen und Finanzierungstabellen erfaßt wird. Gerade hatte er eine Ewigkeit des Wartens und Abwartens hinter sich gelassen und wartete schon wieder. Dabei konnte jede seiner Arbeiten die letzte sein, jede unwiderruflich das letzte Dokument, die dann hoffentlich (endlich) gültige Summe seines künstlerischen Gewissens, ein Vermächtnis – eine letzte Symphonie eben.
3
Er kramte, das Weinglas in der Hand, gerade nach seinen Zigaretten. Da er damit Mühe hatte, bot ich ihm eine von meinen an und gab ihm Feuer. Die Art, wie er den Rauch inhalierte, erinnerte mich an die Warnung, Rauchen gefährde die Gesundheit. Ein angenehmer Anblick war das nicht, wie er rauchte. Ich verzichtete deshalb darauf, mir gleich selbst auch eine anzustecken. Statt dessen sah ich ein Gesicht, das sich quälte. Er zog an seinem Glimmstengel, reckte dabei sein Kinn unnatürlich weit nach vorne, öffnete dabei seine Lippen, schob die Zunge heraus, die sich gleichzeitig, und das gut sichtbar und irgendwie unangenehm sorgfältig, zu einer Rinne wölbte, mit deren Hilfe er den Rauch dann (endlich, dachte ich) nach hinten zog. Er atmete aber nicht ein, was er rauchte, sondern verschluckte es, und man konnte es kaum ertragen, wieviel Mühe er sich gab, auch alles tief hinunter in die Lunge zu schaffen. Und schon führte er die Hand mit der Zigarette erneut an die bereits offenen Lippen, die so feucht waren, als wären sie verschwitzt vor Anstrengung. Mir brach selbst fast der Schweiß aus. Mir widersteht’s, es macht mir Übelkeiten, wenn ich den Zug um seine Lippe seh! Genau, ganz meine Meinung, guter Achill, du griechischer Krieger. Zum Wohl!
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.