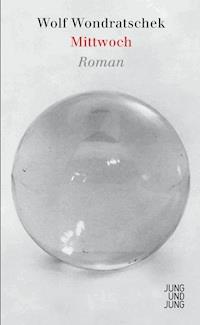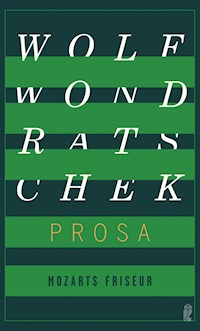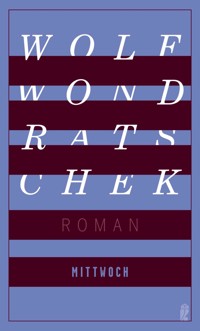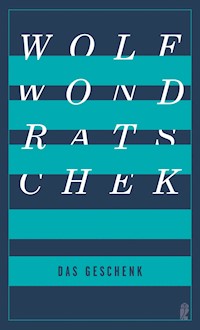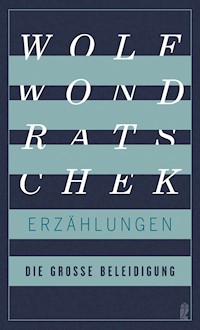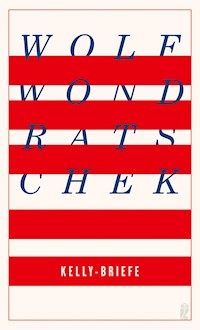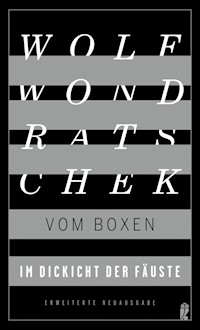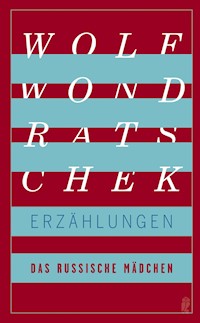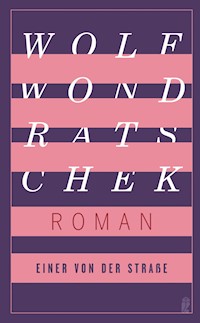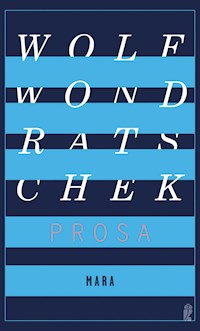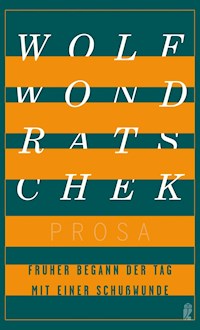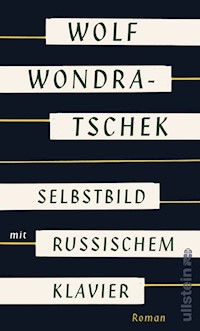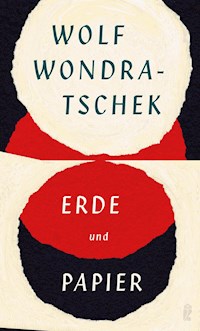
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwischen Underground und Scheinwerferlicht – Unveröffentlichtes, Reportagen, Porträts und Storys John Lennon ist tot, und Wolf Wondratschek erinnert sich an eine Zeit, als vier Liverpooler das Grau der Welt in bunte Explosionen zersprengten. Renoir malt ein schlafendes Mädchen, aber er glaubt dem Maler nicht. In einer Kirche spricht er über Johann Sebastian Bach, in einer Erzählung mit einem, der zu Fuß nach China unterwegs ist. Warum ist die Pfeife, die Magritte gemalt hat, keine Pfeife? Aber der Rauchfangkehrer, der mit Gedichten von ihm vor seiner Tür steht, ist echt. Noch nie hat Wolf Wondratschek sich in Verlegenheit gefühlt, die Vernunft träumen und die Fakten tanzen zu lassen. Fremdes mit Nahem mischen, sich beim Staunen nicht stören lassen - das war und ist es, was sein Schreiben belebt. So entstehen jene Mischformen des Literarischen, die den Leser in "Erde und Papier" überraschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
John Lennon ist tot, und Wolf Wondratschek erinnert sich. Renoir malt ein schlafendes Mädchen, aber er glaubt dem Maler nicht. In einer Kirche spricht er über Johann Sebastian Bach, in einer Erzählung mit einem, der zu Fuß nach China unterwegs ist. Warum ist die Pfeife, die Magritte gemalt hat, keine Pfeife? Aber der Brief von Papst Benedikt XVI., der ist echt. Noch nie hat Wolf Wondratschek sich in Verlegenheit gefühlt, die Vernunft träumen und die Fakten tanzen zu lassen. So entstehen jene Mischformen des Literarischen, die den Leser in Erde und Papier überraschen.
Der Autor
Wolf Wondratschek wuchs in Karlsruhe auf. Von 1962 bis 1967 studierte er Literaturwissenschaft, Philosophie und Soziologie an den Universitäten in Heidelberg, Göttingen und Frankfurt am Main. Seit 1967 lebte er als freier Schriftsteller zunächst in München. In den Jahren 1970 und 1971 lehrte er als Gastdozent an der University of Warwick, Ende der Achtzigerjahre unternahm er ausgedehnte Reisen unter anderem in die USA und nach Mexiko. Er lebt in Wien.
WOLFWONDRATSCHEK
Erde und Papier
Herausgegeben von Claudia Marquardt
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN: 978-3-8437-2041-0
© Wolf Wondratschek (2019)Umschlaggestaltung: Brian Barth, BerlinE-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Über das Buch und den Autor
Titelseite
Impressum
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Editorischer Anhang
Feedback an den Verlag
Empfehlungen
Wem kann ein Künstler noch vertrauen, wenn die Lücke kommt? – richtig, seinem Schmerz, seiner Angst und seiner Lust. Das ist nicht Schreibmaterial. Das ist Himmelsrichtung.
Jim Rakete
Das habe ich noch im Ohr. Meine Mutter will wissen, wie es in der Schule war, und wie ich sage: Na ja, wie immer.
Nur wenn ein Deutschaufsatz dran gewesen war, war ich gesprächiger, weil es mir Spaß machte, Aufsätze zu schreiben. Ich konnte es nicht erklären, aber ich mochte es. Und ich war der Einzige in meiner Klasse, dem Deutschaufsätze zu schreiben Spaß machte. Alle anderen stöhnten.
Eine mögliche Erklärung meiner guten Laune müsste so lauten: Ich hatte, vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben, eine Entscheidung getroffen. Ich hatte mich in etwas Großes, Unbekanntes verliebt, in die Wörter, mit denen man sich Sätze ausdenken konnte, Wörter, die einen Klang hatten, und der Klang konnte Schönheit sichtbar machen – und Wahrheit. Ich ahnte das mehr, als dass ich es begriff, und hätte es damals gar nicht formulieren können. Von Satz zu Satz war die Welt veränderbar, und die Welt, das waren die Geschichten, die man sich erzählt. Da durfte mich nichts ablenken, nichts sich einmischen, da hatte keine andere Autorität das letzte Wort. Ich tat etwas ganz für mich, und das rücksichtslos. Da war nichts mehr halbherzig, und das machte den kleinen Jungen auf eine nie gekannte Weise stolz auf sich. Und in der Folge nicht leicht zu handhaben.
An dieser Stelle wäre es, denke ich, angebracht, dem Deutschlehrer (und anderen in diesem Schulfach) ein Kompliment zu machen. Er hat nicht den Direktor der Schule informiert und auch nicht meine Eltern in seine Sprechstunde zitiert, um herauszufinden, was mit ihrer Erziehung schiefgelaufen war.
Die Rechnung war einfach. Sollte mir erst einmal einer nachweisen, ob das, was ich schrieb, richtig oder falsch war. Das unterschied einen Deutschaufsatz von einer Mathematik-Arbeit oder einer Arbeit in Latein. Da war etwas entweder richtig oder falsch. Und ich bekam Schwierigkeiten. Wenn ich mich dagegen aber über ein Thema auslassen konnte, z. B. darüber, nur ein Beispiel, ob Reisen bildet und was ich von dem Satz, dass Reisen bildet, hielt, war ich in meinem Element. Ich wusste natürlich, dass ich für eine gute Note besser behauptete, ja natürlich bilde Reisen, Reisen seien für jede Bildung ganz wesentlich, und ich die südensüchtigen Maler und Dichter erwähnen sollte, die sich im 18. und 19. Jahrhundert auf die klassische Bildungsreise nach Griechenland oder Italien begeben hatten. Aber während ich in Mathematik und Latein durchaus auf gute Noten aus war, wie hätte ich sonst das Abitur schaffen sollen, waren mir gute Noten in Deutsch völlig egal. Ich behauptete also, nein, Reisen sei eine Mühe, die sich selten lohne, sie ermüde, koste Geld und man treffe auf Menschen, die einem auf die Nerven gingen. So in etwa! Ich bot auch einen Kronzeugen auf, gegen den zu argumentieren nicht leicht sein würde, den Philosophen Pascal, in den hatte ich mal hineingeschaut. Das Unglück des Menschen sei, hatte Pascal geschrieben, dass er nicht in seinem Zimmer bleiben könne! Reisen im Kopf ja, von Reisen träumen, einer Reise in eine der großen Wüsten der Erde, mit dem Ziel, nie wieder in die Zivilisation zurückzukehren. Aber Koffer packen, Koffer schleppen, Koffer auspacken, in Betten schlafen, die man sich nicht ausgesucht hatte?
Irgendwie schaffte ich es, dass meine Deutschlehrer der Reihe nach kapitulierten. Ich setzte die Satzzeichen richtig, machte keine grammatikalischen Fehler, schrieb ein sprachlich schönes, mitunter sogar, wie ich glaubte, elegantes Deutsch, vermied Fremdwörter. Alles in Ordnung, bis eben auf meine Behauptung, man solle besser zu Hause in seinem Zimmer bleiben. Na gut, das Fenster öffnen, dem Singen der Vögel lauschen, dem Regen oder einem Gewitter, zuschauen wie die Wolken dahinzogen oder Flugzeuge, ein Buch lesen, am besten Gedichte und die laut – während an der Tür zu meinem Zimmer das Schild »Bitte nicht stören!« hing.
Rückblickend habe ich den Verdacht, dass mein Deutschlehrer vom Reisen vielleicht auch nicht viel hielt, von den Verkehrsstaus am Brenner, den Trampelpfaden die Akropolis hinauf, dem stundenlangen Geschiebe und Geschubse vor den Ticketschaltern der Uffizien oder denen in Pompeji, das aber als Pädagoge natürlich nicht zugeben durfte, schon gar nicht an einer Schule, die auf Goethe getauft worden war, der bekanntlich auf Bildungsreisen große Stücke hielt.
Was ich für eine Note bekam? Keine. »Mit schulischen Maßstäben nicht zu erfassen!« stand da nur. Ich fand das in Ordnung.
Bis zum Abitur blieb es dabei. Keiner meiner Deutschaufsätze wurde benotet. Ich empfand das als Auszeichnung. Wie auch die Ohrfeige, die mir mein Vater verpasste, als er mich, auf dem Bett liegend, antraf und wissen wollte, was ich tue – und ich ihm sagte: das siehst du doch, ich arbeite.
Und das war nicht einmal gelogen. Ich arbeitete daran, mir ein Leben vorzustellen, das zu leben Spaß machen könnte – was gar nicht so einfach war, wie es sich anhört.
»Wir müssen, was wir suchen, erfinden«, schrieb ich Jahrzehnte später. Ich suchte, scheint mir heute, nach der geheimen Signatur meines Lebens.
Dann hatte ich es mit den Chinesen. In einem Brevier mit fernöstlichen Weisheiten, ich glaube, einem Reclam-Heft, wurde ich mit der Einsicht belohnt, die mich durch und durch erfrischte: »Der Mensch reifte zum Menschen, als ihm das Nutzlose unentbehrlich wurde.«
Ich konnte damit jedem in meiner Familie den schönsten Sonntagnachmittag ruinieren.
Meine Mutter machte sich Sorgen. Sie litt unter der Vorstellung, ich würde, sollte ich meine Drohung, ein Dichter zu werden, wahrmachen wollen, verhungern – was mein Vater, nach seinem Gesichtsausdruck zu schließen, für die gerechte Strafe für einen wie mich ansah.
So ganz unbegründet sind die Sorgen unserer Eltern nie, auch wenn Sorgenkinder andere Sorgen haben als ein sicheres Einkommen im gesetzten Alter. Ich hätte mich geschämt, an Geld zu denken. Ich zweifelte ja keine Minute daran, dass ich, wenn ich Geld bräuchte, es schon irgendwie kriegen könne. Trotzdem hätte ich damals gern eine Mutter gehabt, die mir einfach alles zutraute, egal in welchem Beruf. Und gerne einen Vater, der auf meine Zukunft das eine oder andere Glas trank, wenn er danach nur nicht notorisch versucht hätte, witzig sein zu wollen. Es wird sich schon eine reiche Frau finden, die sich in dich verliebt.
Meine Großmutter, auch sie damals noch am Leben, schaute ihren Sohn, der mein Vater war, mit einem Kopfschütteln an, das energischer nicht hätte sein können. Und nannte ihn einen Dummkopf – und mir streichelte sie sanft mitfühlend die Hand. Setz dem Kind keine solchen Flausen in den Kopf. Ob er nicht wisse, dass reiche Frauen Unglück brächten, anderen und sich selbst.
Hilfreich war das Gespräch, das ich mit einem amerikanischen Schriftsteller, mit dem ich mich in New York angefreundet hatte, geführt habe. Mach nicht den gleichen Fehler wie ich, mein Junge. Lass dich nicht von Leuten, die Geld haben, über den Tisch ziehen. Lass dich bezahlen, gut bezahlen, aber lass dich nicht kaufen!
Das habe ich mir gemerkt – und den Rat, schon aus Respekt vor den Sorgen meiner Mutter, beherzigt.
Dann, ich hatte gerade erst als Schriftsteller debütiert, kamen gute Zeiten. Niemand konnte ahnen, wie viele Menschen die Gedichte, die ich schrieb, lesen wollten. Ich war, was meine Gedichte anging, ganz gegen meinen Willen zu einer Art Bestsellerautor geworden. Ich war – Gott sei’s geklagt – in Mode.
Und deshalb ging dann hin und wieder das Telefon.
Ja, bitte?
Ein Redakteur eines hochklassigen Gourmet-Magazins hatte Fotos vor sich auf dem Tisch liegen, Fotos von einem berühmten Fotografen, die er unbedingt in seinem Heft haben wollte, aber er brauchte irgendwas, einen Text. Etwas über Spaghetti.
In meinem Kopf machte es klick! Das wird teuer, sagte ich.
Dachte ich mir, sagte er.
Wir einigten uns.
Ich wurde für eine Seite Text, die ich in einer Nacht raushaute, besser bezahlt als für ein Manuskript, auch wenn ich daran Tag und Nacht, und das zwei Jahre lang, geschuftet hätte.
Ein anderes Beispiel. Ein hohes Tier eines Automobilkonzerns wünscht sich einen kurzen Text als Vorwort für einen repräsentativen Bildband, der nur an wenige ausgesuchte Händler, das allerdings in aller Welt, abgegeben werden soll. Wenn einer so etwas schreiben kann, dann Sie, sagt er, was mich überrascht. Wäre der amtierende Bundespräsident, ein Weltmeister der Formel 1 oder ein PS-begeisterter Opernsänger nicht die bessere Wahl, wende ich ein. Wir haben uns gedacht, sagt er, dass ein Dichter, einer wie Sie, das machen sollte.
Das wird teuer, sage ich.
Kein Problem, sagt er.
Wir einigen uns.
Es war wirklich ein Haufen Kohle. Man kann, das gebe ich zu, auf den Geschmack kommen.
Damals gewöhnte ich mir an, mir alles in bar auszahlen zu lassen. Keine Schecks. Keine Überweisungen. Ich wollte den Dreck, den Geld für mich darstellt, sehen. Wie ein Arbeiter, der freitags seine Lohntüte kriegt, Geld sehen will. Aber es kommt noch besser. Es gibt eine Anekdote, die niemand für wahr hält, die es aber ist. Ich soll von meinem Verleger für ein Manuskript nicht Geld, sondern eine Kiste Gold verlangt haben. Stimmt, habe ich. Und warum eigentlich nicht? Gedichte mit Gold zu bezahlen erschien mir angemessener, zumindest poetischer als mit einem Bündel dreckiger Geldscheine.
Es war dies nicht das erste Mal – und auch nicht das letzte Mal –, dass ich durch gewisse Eigenheiten, sagen wir ruhig: Extravaganzen auffiel. Ich will darauf jetzt hier nicht weiter eingehen. Irgendwann wird das, hoffentlich zur Erheiterung, in einer Biographie über mich nachgelesen werden können.
Und schon geht wieder das Telefon.
Eine auflagenstarke Illustrierte, zuständig für Klatschgeschichten, für Hochzeiten in Königshäusern und Scheidungen prominenter Zeitgenossen, will etwas über Tanz haben.
Ich kann nicht tanzen, sage ich.
Aber schreiben, sagt die Redakteurin.
Das wird teuer, sage ich.
Wir zahlen, was Sie verlangen, sagt sie.
Wir einigen uns.
Ich hoffe, der Himmel hat ein Einsehen und gibt, was die lebenslange Sorge meiner Mutter betrifft, Entwarnung.
John Lennon wurde ermordet, Steffi Graf spielte in Wimbledon, Max Schmeling wurde achtzig, Muhammad Ali boxte. Wir einigten uns. Ich war in Mode. Ich lieferte, auch etwas über die arme, bedauernswerte, immer sehr unglückliche Lady Diana Spencer, Princess of Wales, als es sie in Paris, an der Seite eines ägyptischen Playboys, erwischte.
Wie lange das her ist!
Die Helden sind gegangen, in den Tod, in Rente. Die Zeitschriften und Zeitungen haben das Geld nicht mehr für Gastauftritte von Dichtern. Jetzt schreiben die, die ohnehin im Haus auf der Lohnliste stehen.
Dass ich endgültig nicht mehr in Mode war, merkte ich, als Bob Dylan den Nobelpreis zugesprochen bekam – und das Telefon keinen Mucks machte.
Aber dann, ich dachte schon, ich hätte nur die Rechnung nicht bezahlt und das Telefon sei stillgelegt worden, klingelte es wieder. Die Tabakindustrie! Ich war sofort guter Laune. Raucher aller Länder auf die Barrikaden! Kampf bis zum letzten Lungenzug! Nach seinem Lieblingsgemüse gefragt, antwortete Frank Zappa: Tabak! Ganz klar ein Heimspiel! Das Honorar: eine Stange pro Woche, ein Jahr lang. Da kann man nicht meckern.
Damit kein Missverständnis aufkommt. Ich war, als ich meine Deutschaufsätze schrieb, nicht auf Krawall programmiert. Ich wollte nicht den Frieden stören, mich nicht als kleines Genie aufspielen. Was ich ablieferte, war mein heiliger Ernst – und jeder, der seine Pubertät – egal wie lange schon – hinter sich hat, weiß, wie ernst ein Pubertierender alles nimmt, wirklich alles, jedes Getuschel in seinem Rücken, jede Gemeinheit, jede Ungerechtigkeit, die in der Familie, die draußen in der Welt. Was ist die Verzweiflung, in die ein Pubertierender seine Eltern treiben kann, gegen die Verzweiflung, der er selbst ausgesetzt ist. Ein Pubertierender ist eine Zeitbombe, die er gern zünden möchte gegen alle Nichtigkeit und Verlogenheit der Welt.
Stellen Sie sich den Jungen, während er seine Deutschaufsätze abfasste, also am besten wie einen vor, den – bei allem Vergnügen, das er beim Schreiben hatte – heftige Stürme heimsuchten. Es war, was ich fühlte, so schwer zu verstehen. Heute würde ich sagen: es war Heimweh nach Aufrichtigkeit, nach Ehrlichkeit in jedem Menschen, in jedem auf jedem der fünf Erdteile.
Und so habe ich den Journalismus, als ich mich darin versuchte, nie nur als Job verstanden, sondern immer als eine dem Schreiben von Gedichten gleichwertige künstlerische Arbeit. Was einen solchen Text auszeichnet, ist, was gutes Schreiben insgesamt ausmacht. Klarheit, Brillanz, Zartheit und Fremdheit.
Es war früher Morgen, der 26. September 1973, und noch wusste ich von nichts. Vor einem ersten Kaffee interessiert mich die Welt nicht besonders, schon gar nicht die Presse darüber. Ich will, solange es eben geht, in Ruhe gelassen werden.
Die Zeitungsstände hatten natürlich schon offen, und vor jedem standen auch schon genug Leute herum. Nur eines war anders. Niemand sagte etwas. Niemand redete. Niemand bewegte sich, was keine Selbstverständlichkeit in den Städten Italiens ist.
Aber, wie gesagt, ich ignorierte das alles. Ich schlief ja noch und wollte erst nach einer ersten Zigarette und einem Cappuccino erwachen, in einer der Bars der nahen Piazza Navona.
Dass auch die Kellner, sonst immer angriffslustig, an diesem Morgen anders waren, fiel mir erst auf, als ich, obwohl so früh der einzige Gast und eigentlich unübersehbar, nicht bedient wurde. Ich war unerwünscht. Mehr noch, ich war überflüssig. Sie reagierten auch nicht auf Zeichen. Sie standen in der Tür, hatten alle drei ihre Zeitung in der Hand, die sie hielten, als sei es eine Qual, ihre Schlagzeile zur Kenntnis nehmen zu müssen. Die ganze erste Seite schwarz, schwarz wie die Glut in ihren Augen, schwarz wie die unbezwingbare Löwenmähne ihrer Haare. MAMMAROMA E MORTA.
Ich saß da, noch immer ahnungslos, und wartete darauf, meine Bestellung loszuwerden. Gesund ist das nicht, aber durchaus römisch, sich ärgern zu müssen. Also gab ich nach und sah dem nächsten Gast zu, der erschien, einem Herrn, auch er sonderbar apathisch, der sich setzte und mit seiner Zeitung den Kellner heranwinkte, der schließlich reagierte und sich langsam, irgendwie gekränkt, in Bewegung setzte.
Irgendetwas stimmte nicht. Ich winkte dem über die noch fast menschenleere Piazza eilenden kleinen Jungen, mir eine seiner Zeitungen zu verkaufen. Und dann hatte ich die Neuigkeit. In der Nacht, vor ein paar Stunden erst, das war geschehen, war Anna Magnani gestorben.
Ich weiß nicht, ob der Brunnen weinte, ob die Sonne eine Freude hatte oder die Stadt sich nicht tot stellen und gleich wieder schlafen legen würde, aber jeder, der die Nachricht gehört oder gelesen hatte, würde heute etwas Endgültiges zu verarbeiten haben. Womit sich trösten, wenn nicht einmal ihre Kraft ausgereicht hatte, nicht zu sterben?
Meinen drei Kellnern ging es nicht anders, sie standen da und weinten. Sie drehten sich nicht einmal um deshalb. Keiner der Männer schämte sich. Dem, der mir schließlich dann doch den Cappuccino brachte, liefen noch beim Kassieren Tränen über das Gesicht.
Die Frage war immer: Treten die Beatles noch einmal zusammen auf? Jetzt haben wir die Antwort: Nein, niemals – nevermore. John Lennon ist tot. Irgendein gottverdammtes Arschloch hat ihn umgelegt. Das Motiv? Warum ein Motiv? Man steht eines schönen Tages auf, kauft sich an der nächsten Ecke ’ne Knarre und ballert das Magazin leer. Es ist in New York mittlerweile sogar modern, auf einen Fluchtversuch zu pfeifen. Man lässt sich festnehmen, gesteht die Tat und lacht dabei den Pressephotographen so seelenruhig ins Blitzlicht, als handle es sich um ein Debüt im Showgeschäft – auch Mord ist dort nur Illusion.
Man versteht nichts, wollte man noch irgendetwas begreifen wollen. Alles ist sinnlos – das Sinnlose macht die Tat erst logisch. Nothing is real – nicht nur in den Erdbeergefilden der Phantasie, sondern erst recht im New Yorker Alltag. Aber natürlich erwischt es nicht jeden Tag einen, der schon unsterblich war, bevor er recht erwachsen wurde.
Ein Idol umzulegen ist Massenmord. Der Mörder muss ’ne Menge Spaß gehabt haben. Die Todesschüsse trafen eine ganze Generation verwelkender Blumenkinder – Schock beschleicht auch die müdesten Knochen, Ernüchterung drückt jedes High nach unten. Strawberry Fields forever. Trauerarbeit über Kopfhörer.
Wäre John Lennon nur einfach, sagen wir, ertrunken, seine Fans hätten sich schon von allein die bessere, die glaubwürdigere Antwort zugeflüstert: Er lebt und hat auf der Yellow Submarine angeheuert. Wäre er an einer schlechten Droge krepiert, es wäre dann eben nur der standesgemäße Betriebsunfall gewesen. Da versteht man Spaß. Wäre er am letzten Montag von der Freiheitsstatue gesprungen – der Werbegag für seine gerade erschienene LP hätte ihn nur das Leben gekostet – na ja.
Aber, Lady Madonna, einfach umgenietet zu werden von einem armselig Verrückten, dem es nicht gefiel, dass er Lennons Autogramm, um das er ihn ein paar Stunden vor dem Mord gebeten hatte, so unleserlich fand?
Ob la di – ob la da? Was tun, da nichts, restlos nichts mehr zu verstehen bleibt? Life is very short hat er gesungen. Natürlich, das war beste Tradition. Kein langes Leben, nur das nicht. Erst die vielen Opfer machten ja den Rock ’n’ Roll so herrlich authentisch.
Nur: Lennon dachte längst anders, und sein Tod passt da nicht hinein ins Konzept willkürlicher Vollendung. Das war keine frivole Konsequenz, rechtzeitig auszusteigen wie Sid Vicious oder Janis Joplin; kein tragisches Alleinsein im Tod, wie sich uns das Ende von Jimi Hendrix verklärt hat. Ganz zu schweigen von den jungen Leichen, die, millionenschwer und weggepustet, auf dem Grund ihres Swimmingpools gefunden wurden.
Dabei gab es ja eine Zeit, da waren John, Paul, George und Ringo wirklich in Lebensgefahr. Die Mädchen hätten die Beatles doch am liebsten gevierteilt vor lauter Sehnsuchtshysterie. Es mussten Polizeisperren und Tausendschaften von Ordnungshütern her. Sie überschwebten zwar unsere lieben sechziger Jahre wie eine Morgensonne, aber auf Erden blieben sie gehetzt von allen Furien.
Lange her – Erinnerungen an eine Zeit, als der Haarschnitt noch in den Bereich »elterlicher Gewalt« fiel, als diese vier Liverpooler das grauenhafte Grau dieser Welt so kinderleicht und rotzfrech in immer buntere Explosionen zersprengten mit kreischenden Kopfstimmen.
Lange her. Sergeant Pepper zuckert. Der Paperback Writer kassiert Tantiemen. Der Peitschenhieb ihrer Gitarren hat schon die Streicher auf den Plan gerufen. Alles hat sich sublimiert zu melodischen Ohrwürmern.
Wie friedlich alles geworden war – bis die Schüsse fielen. Natürlich hat keiner allen Unsinn so gekonnt beherrscht wie John Lennon – auch das Marihuana, das er rauchte, war auf seinem Mist gewachsen –, aber musste es deshalb mit ihm ein so sinnloses Ende nehmen? Gerade um ihn, um diesen schwierigsten, talentiertesten der Beatles, war es doch besonders still geworden. Er war, was er sein wollte: Privatmann, Ehemann, Familienvater. Eine langsame Abblende – niemandem verantwortlich, auch wenn eine Millionenschar nach immer neuen Beatles- Ewigkeiten verlangte.
Vorbei die Guru-Allüren. Keine Give peace a chance-Predigten mehr. Keine poetischen Happenings, die aller Welt seine gnadenlose Liebe zu Yoko Ono beweisen sollten. Wenn ich an ihn dachte, lag er mit Frau und Kind im Bett, schaute fern und las in Comics. Er wollte nicht den Solo-Herausforderer spielen, größer werden noch als vor zehn Jahren. Es gab nichts mehr zu beweisen – es sei denn, dass Erfolg (in welcher Größenordnung auch immer) zu verdauen ist.
In einem kalifornischen Gefängnis sitzt einer, der hat Mordbefehle gehört, als er die Beatles (auf ihrem weißen Album) Happiness is a warm gun singen hörte; er hat nicht gezögert und aufgeräumt wie ein falsch programmierter Jesse James.
Sein Name: Charles Manson.
Die Plattenteller drehen sich. Die Zeit steht still. All you need is love – und: We can work it out. Lauter Grabinschriften.
»Die Beatles und ihre Musik« – das klang schon vor einem Jahrzehnt wie ein Nachruf – »haben den Rhythmus der Welt von heute eingefangen.« Am Ende aber blieb die alte Welt von morgen, die Welt des alltäglichen Überlebens, wozu gerade in New York jedes Verbrechen gut ist; die Welt des Wahnsinns, wo einer nur dem Rhythmus aus dem Trommelrevolver vertraut, dem Rhythmus des Dschungels, der auch dem Nowhere man John Lennon seinen Platz zuweist – einen Platz unter der Erde.
»Ich lebe vom Schreiben, aber ich mag Schriftsteller nicht besonders. Marcel Proust? Kenn ich nicht, interessiert mich nicht. Ich bevorzuge Boxer, Huren und Gauner. Da bin ich zu Hause, da fühl ich mich wohl.« Boxer, Huren und Gauner. Das ist auch das Personal von Nelson Algrens letztem Roman. Der Boxer ist Rubin »Hurricane« Carter, ein dunkelhäutiger Mittelgewichtler (mit Aussichten auf einen Weltmeisterschaftsfight), dessen Schicksal authentisch ist. Im Roman nennt ihn der Autor Calhoun. Der Originaltitel ist ein nicht übersetzbares Wortspiel, dessen Sinn Algren, wie er mir sagte, selbst nicht recht entschlüsseln konnte: The Devil’s Stocking. Eine Hure hatte es ihm gesagt. Aber was zum Teufel hatte sie gemeint? Die Huren vom Times Square. Die Gauner von Chinatown und Jersey City. Algren ist ein Mann aus dem Mittleren Westen, Marcel Proust war Pariser.
Ein paar Monate nach Beendigung des endgültigen Manuskripts fiel Algren um, im Morgengrauen des 9. Mai 1981. Er war 72 Jahre alt.
»Ich kenne keinen Schriftsteller, der nicht glaubt, dass er ein Boxer ist.« Das war auf Norman Mailer gemünzt und dessen Eitelkeit, wie er sie noch immer bei seinen öffentlichen Selbstdarstellungen im Boxring demonstriert. Ein bisschen allerdings mag er auch an sich selbst gedacht haben: auf der Innenseite seines rechten Oberarms hatte er als Tätowierung ein Paar Boxhandschuhe. Er war ein Boxfan. Charles Bronson war sein Lieblingsschauspieler, nicht zuletzt weil er kein Antlitz, sondern ein Gesicht hatte, das eines Boxers. In seinem Arbeitszimmer damals in Hackensack, N. J., hing neben dem Porträt Dostojewskis das Foto ebenjenes Rubin »Hurricane« Carter. Als ich ihn das erste Mal dort besuchte, machte das Manuskript gerade die Runde durch Madison Avenue, die Verleger-Avenue der Ostküste. Algren wartete auf Reaktionen. Und die er bekam, waren ernüchternd. Die Verleger wollten nicht recht, boten erniedrigend geizige Vorschusszahlungen, die Algren ausschlug. Er war mittellos, aber nicht verführbar durch schnelle Dollars. Mehrmals an diesem Nachmittag ging es um Summen von fünfzig- bis sechzigtausend Dollar. Algren wollte »a handful of peanuts, not just one«. Von dem zu erwartenden Geld wollte er vielleicht doch noch einen Traum wahrmachen: Er hätte gern einen eigenen Boxer gemanagt.
Zehn Jahre bevor er in den Fall Carter verwickelt wurde, gab er ausführlich in einem langen Interview Auskunft. Aus Conversations with Nelson Algren, by H. E. F. Donohue, 1964, ich übersetze:
Frage: Wirst du jemals einen politischen Roman schreiben?
Algren: Niemals, nein. Niemals.
Frage: Einen Boxer-Roman?
Algren: Das wäre schwierig, ich weiß einfach nicht genug. Der einzige Weg, da an Kenntnisse zu kommen, wäre, einen eigenen Boxer zu betreuen, mit ihm zu leben. Wenn ich in den Vertrag eines Weltergewichtlers einsteigen könnte, für 1500 Dollar oder so, und einen Raum hätte, wo er sein Training absolvieren könnte, dann rübergehn nach New York, mit Managern verhandeln – diese ganze Sache von innen her aufrollen …
Frage: Kannst du dir das vorstellen?
Algren: Natürlich. Wenn ich genug Geld hätte, warum nicht? Ich würde gern ein Buch schreiben, vor allem weil es nicht nur ums Boxen ginge, der Boxer wäre eher nebensächlich. Ich würde über New York schreiben, und zwar in der Art eines Reporters.
Eine Schießerei in einer Bar machte den Anfang. Dann erfolgte die Festnahme von Rubin »Hurricane« Carter, einem Ass in der Boxwelt der frühen sechziger Jahre. Die Zeitungen überschlugen sich. Algren wurde in Chicago aufmerksam auf den Fall. »Er saß ein wegen dreifachem Mord und hatte gerade ein Buch geschrieben. Ich sollte ihn im Staatsgefängnis von Rahway besuchen und für Esquire Magazine einen Artikel mit Interview machen. Ich war von ihm und seiner Geschichte fasziniert. Sie hatten ihn schuldig gesprochen aufgrund der Zeugenaussagen zweier junger Berufsganoven. Das war alles, was sie gegen ihn in der Hand hatten. Ich schrieb meine Story, aber Esquire druckte sie nicht.«
Eigentlich hatte man damals fest damit gerechnet, dass Carters Wiederaufnahmeverfahren mit einem Freispruch enden würde. Und deshalb war es einfach eine journalistische Pflicht, gegebenenfalls einen Aufmacher parat zu haben. Aber Carter wurde nicht freigesprochen, das Urteil wurde bestätigt.
Algrens Story ging davon aus, dass hier ein Justizirrtum vorlag, und er wies auf die Logik dieses Irrtums hin. Das war, nach dem erneuten Schuldspruch der Geschworenen, den Lesern vom Niveau des Esquire nicht zumutbar. Bekanntlich ist diese Zeitschrift keine Bürgerrechts-Postille.
Algren blieb vorerst weiter am Tatort in Paterson, N. J., er recherchierte weiter, so lange wenigstens, bis Patersons weiße Bürger genug hatten von seinen Aktivitäten. Man wollte hier keinen auch noch so vergessenen Autor dulden.
Also siedelte Algren ins kleine Nachbarstädtchen Hackensack über, wo er die Story umschrieb zu einem dokumentarischen Prozessbericht.
Madison Avenue blieb unbeeindruckt. Keiner biss an. Jetzt entschloss sich Algren, einen Roman zu schreiben: Calhoun.
Inzwischen war er auch den Weißen von Hackensack suspekt, dieser ruhige, stille, alte Mann aus Chicago. Er musste ausziehen. Aber wohin? Er wanderte, seinem Traum von einem Haus am Ozean entgegen, nach Sag Harbor. Dort saß er zur Untermiete in einem Dachgeschoss und wartete, wie die Verleger auf das Manuskript reagieren würden.
»Gute Schriftsteller sind nicht mehr gefragt. Vielleicht brauchen nur die noch Schriftsteller, die keine Bücher lesen.«
Der Justizirrtum im Falle Rubin »Hurricane« Carter diente Algren als letzte Abrechnung mit Amerika. Tatsächlich, wie er prophezeite, würde der Boxer selbst eher nebensächlich sein. Anklagen will der Roman die andauernde rassistische Gewalttätigkeit weißer Geschworenengerichte gegen farbige Angeklagte – in seinem Zentrum aber (und in seinen zweifellos besten Passagen) singt die »Blechpfeife der amerikanischen Literatur« (Algren über sich) noch einmal – und einmal wie immer – das hohe Lied auf den Verlierer, den Einzelgänger in den Höllen der Freiheit. Genau dieser Typ war Algren ja selbst; wenigstens legte er seinen ganzen Stolz und all seinen Humor darein, einen diese Selbsteinschätzung glauben zu machen. Er spielte diese Rolle, wie ich aus eigener Anschauung weiß, überzeugend, spielte sie mit der heiteren Vollkommenheit eines Narren.
Der Schriftsteller und der Angeklagte tauschten ihre Würde – für Algren war das die einzige Allianz von moralischer (und politischer) Bedeutung. »Diese Identifizierung mit jenen, an denen unsere Zivilisation vorbeigegangen ist, die sie verworfen oder unter Anklage gestellt hat, verlieh dem amerikanischen Schriftsteller die besondere Würde, neben dem Angeklagten zu stehen. Und in gleicher Weise gewann der Angeklagte dadurch ebenfalls an Würde, dass sich der Schriftsteller seiner annahm.« (Einleitung zu seinem Kurzgeschichtenband »Neon-Dschungel«)
Einer, der von Anfang an auf Algren gesetzt hatte, war Hemingway. Im Papa-Macho-Stil nannte er ihn bald »den zweitbesten Schriftsteller«. Er sah in ihm seinen »Nachfolger«. (»Mr. Algren, boy, you are good.«) Sie schrieben sich Briefe. Einige davon hingen, hinter Glas, in seinem Arbeitszimmer. Beide beliebten sich auszudrücken wie Boxprofis. »Algren kann«, schrieb Hemingway, »mit beiden Fäusten zuschlagen, er weiß, wie man sich bewegt, und wenn du nicht verdammt aufpasst, wird er dich töten.«
Zwischen beiden gab es eine geradezu schicksalhaft-brüderliche Gewaltenteilung: der eine, Hemingway, spielte sich als Sieger auf – der andere, Algren, als Verlierer. Unrecht hatten sie beide.
Algren blieb, um in der Boxersprache zu bleiben, der contender, der Herausforderer, the near great.
»Lieber Mister Algren«, schrieb ihm einmal eine angehende Schriftstellerin, »ich stehe an der Schwelle zu einer literarischen Karriere … was raten Sie mir?« Algren schrieb zurück: »Geh zwei Schritte zurück, Baby. Lauf davon, lauf, so schnell du kannst. Das ist keine Schwelle – das ist ein Abgrund.«
Vielleicht werden einige der jüngeren Leser den Namen »Hurricane« Carter schon gehört haben. Es war Rockstar Bob Dylan, der mit einem Lied über »Hurricane« einen Hit landete. Wie verhängnisvoll Dylan und die übrige einschlägige Prominenz auf Carters Wiederaufnahmeverfahren eingewirkt haben, ist nachweisbar. Und Algren tut es hier. Sie alle bezeugten eine Unschuld (damals im ausverkauften Madison Square Garden), die ihnen jenseits der Tiefstrahler einer TV-Show gleichgültig blieb. So völlig gleichgültig wie jenen zwei jungen Berufsganoven die Wahrheit über die Schüsse in der Bar in Paterson, N. J., die einen Unschuldigen für neunundneunzig Jahre hinter Gitter brachten.