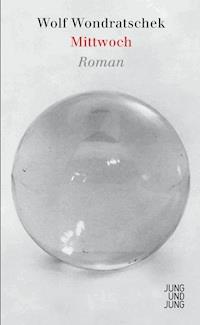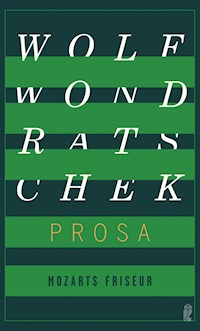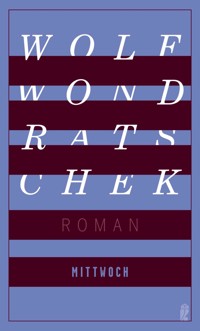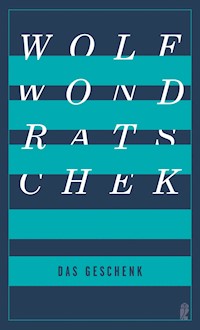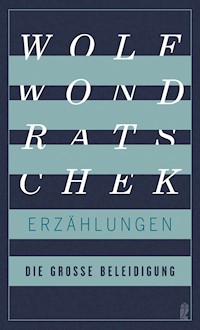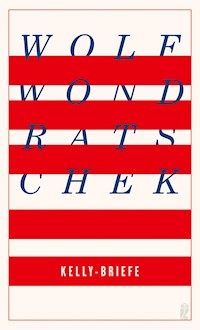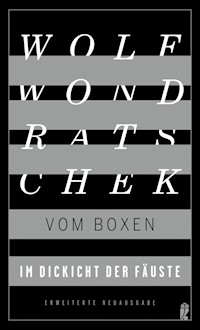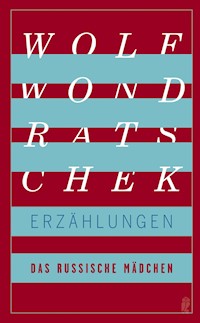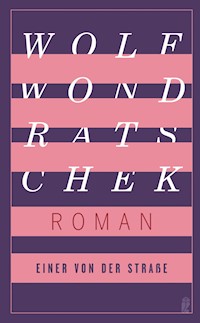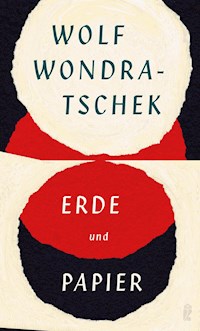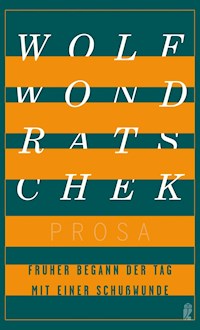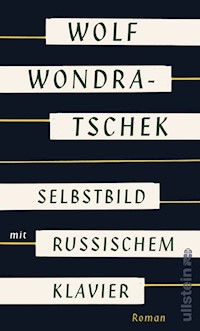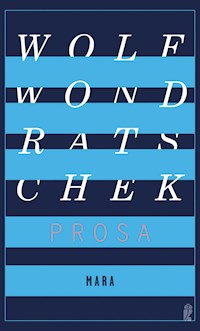
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist mehrmals um die Welt gereist. Es hat für Könige und Bürger gespielt, in Kathedralen und Schlössern. Virtuosen und Banker haben sich seiner angenommen und seinen Wert gesteigert. In der Nacht vom 10. auf den 11. Juli 1963 wäre es in Südamerika, im Mündungsgebiet des Rio de la Plata, fast ums Leben gekommen. Es hat dreihundert Jahre auf dem Buckel und klingt wie am ersten Tag: Kunstvoll und in vielfachen Schwingungen erzählt das berühmte Mara-Cello von seiner Reise durch bewegte Zeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Wolf Wondratschek
Mara
Eine Erzählung
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN: 978-3-8437-2070-0
© Wolf Wondratschek (2019)Dieses Werk wurde erstmals veröffentlicht im Jahr 2003Autorenfoto: © Sepp DreissingerUmschlaggestaltung: brian barth, berlinE-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen, meine Geschichte, wenn ich das darf, die Geschichte eines Cellos. Denn das bin ich, ein Violoncello.
Ich darf mich vorstellen? Mit Vaternamen heiße ich Stradivari. Ich bin 1711 in Italien, in Cremona, in der Werkstatt meines Meisters Antonio Stradivari zur Welt gekommen und – was soll ich machen? – eigentlich seit dem Tag meiner Geburt berühmt. Dafür kann ich nichts. Ich hatte Glück, ich hatte einen Namen und als Spitzname (oder Adelstitel, ganz wie Sie wollen) bald – und bis heute – noch einen. Mara. Die Welt nennt mich Mara. The Mara. Das berühmte, weltberühmte Mara.
Kein schlechter Name, auch wenn er anspielt auf einen eher temperament- als glanzvollen Musiker, ansonsten aber, glauben Sie mir, faszinierenden Sündenlümmel, der Giovanni Mara hieß (oder, je nachdem, in welchen Engagements er sich wo in Europa gerade aufhielt, auch Jean oder Johann Baptist oder Joseph) und dem ich als Eigentum zu Diensten war, eine aufregende, gefährliche Zeit lang, auch für mich gefährlich. Ich erinnere nur an die Flasche Wodka, die er einmal mit der unkontrollierten Kraft eines Jähzornigen gegen die Wand schleuderte und die mich nur knapp verfehlte. Ein anderes Mal warf er im Streit seiner Frau ein Glas hinterher, das zwar sie verfehlte, mich aber nicht. Die Verletzung war nicht schwerwiegend, ein Streifschuß, aber sie ist bis heute sichtbar und gilt seitdem, sonderbar genug, als zusätzliches Gütesiegel, sozusagen als Zertifikat, als Zeichen untrüglicher Echtheit.
Mein Vater war Handwerker, einer der fähigsten und fleißigsten der Stadt, das schon, aber ein Hexenmeister war er nicht. Drei Violoncelli allein in meinem Geburtsjahr, ebenfalls drei im Jahr davor, die Geigen gar nicht mitgerechnet, das ist eine Menge. Da mußte er sich bei seinen Frauen, die ihm die Kinder gebaren, länger gedulden. Aber es ging, wie er einsah, mit ihnen eben leider nicht schneller, mit seiner Francesca nicht, der ersten, die sechs, mit Antonia, der zweiten, nicht, die fünf Kinder zur Welt brachte. Als Handwerker war er angewiesen auf Nachwuchs, auf Söhne vor allem, und darauf, daß sie durchkamen und nicht durch Fieber oder die Pest dahingerafft wurden. Und dann konnte man nur hoffen, daß bei dem ganzen Aufwand wenigstens einer sein Talent geerbt hatte. Mit Francesco, Omobono und dem Nachzügler Paolo, die er alle drei selbst in der Werkstatt noch ausbilden konnte, hatte er zwar einen überdurchschnittlich guten Schnitt, aber selbst alle Vaterliebe reichte nicht aus, sich Illusionen zu machen, es könne einer ihm nachfolgen, ihn an Fertigkeit, an Genie gar noch übertreffen. Es würde mit ihm das Kapitel seiner Kunst beendet sein.
Natürlich frage ich mich manchmal, wenn der Rummel um meine Berühmtheit lächerlich zu werden beginnt, was er zu der fast schon ans Unheimliche grenzenden Verzückung der Leute sagen würde, die uns, mir und seinen anderen Kindern, zuhören? Was zu der grenzenlosen Bereitschaft gewisser wohlhabender, weltgewandter oder eben nur geschäftstüchtiger Kreise, zu denen Champagnerdynastien ebenso gehören wie Sägewerksbesitzer oder Erdöl- und Stahltycoons, seine Geigen, Bratschen oder Celli für mehr als alles Geld der Welt zu ersteigern, zu der Sucht, sie besitzen zu müssen, und sei es auch nur für ihr Prestige, als Trophäe und Kleinod ihrer gepanzerten Kammern und Banktresore? Oder dazu, die Spezialität organisierter Auftragskriminalität, die Instrumente (mit welchem Risiko auch immer) stehlen zu lassen, was mehr als uns Celli natürlich unsere kleinen Geschwister, die Geigen, betrifft, weil sie handlicher sind, auch berühmter, zugegeben, und deshalb mehr bringen? Was würde er sagen zu dem lange schon wahrhaft wahnhaften Kult um seinen Namen, der als magic word, als Markenzeichen, nicht nur Konzertsäle in Kathedralen, Konzertbesucher in Gläubige und Virtuosen in unfaßbar erfolgreiche Verführer verwandelt, sondern dem einen oder anderen gelegentlich ganz schön auch den Verstand verhext?
Natürlich werden wir Stradivaris nicht nur von Kennern und Liebhabern der Musik oder von Dieben hofiert, sondern auch von Fälschern. Ich weiß noch, 1937, als unsere Heimatstadt den zweihundertsten Todestag meines Vaters feierte und die Sache zum Anlaß nahm, eine Ausstellung Cremoneser Instrumente aus aller Welt zu zeigen, waren von fünfhundert der angereisten Instrumente, die ihm zugeschrieben wurden, nur zweihundert unzweifelhaft von seiner Hand. Der Rest Ausschußware! Aber glauben Sie nicht, das seien deshalb alles Fehlgeburten gewesen, zusammengeleimte Waisenkinder. Schade, daß keiner auf die Idee kam, den Experten einfach mal die Augen zu verbinden und abwechselnd echte und falsche Stradivaris zu Gehör zu bringen. Also, ich weiß nicht. Der eine oder andere hätte sich ganz schön blamiert. Aber was tun mit der Ehre, auch unter Ganoven anerkannt zu sein? Keiner der Musikhistoriker, die sich mit der Geschichte der Fälschungen beschäftigt haben, konnte mir die Frage beantworten. Einer winkte mit der Bemerkung ab, es sei selbstverständlich, daß sich die organisierte internationale Verbrecherwelt längst auch auf den Diebstahl dieser kostbaren Meisterwerke geworfen habe.
Hat sie! Mit hochqualifizierten Experten sogar, die wiederum zusammenarbeiten mit gelernten, selbst einmal ausübenden, aus irgendeinem Grund aber glücklosen, durch eine Arm- oder Handverletzung oder sonst ein Mißgeschick aus ihrer Karriere katapultierten oder auch nur einfach von der Routine in unbedeutenden Provinzorchestern gelangweilten Musikern, Schattenmännern in Zusammenarbeit mit korrupten Instrumentenhändlern, die immer zur Stelle sind bei Liquidierungen von Privatkollektionen und, gebildet und kultiviert, wie sie auftreten, hinter der Bühne und im Pulk von Verehrern in Künstlerzimmern nie weiter auffielen. Aber sie hatten nicht nur im Allerheiligsten ihre Augen immer weit offen, sondern im Visier auch die Straßen, Gasthöfe und Poststationen, um beim Wechseln der Pferde oder der Kutschen rechtzeitig zur Stelle zu sein. Später kamen dann die Hotels hinzu (wo sich immer einer findet, der für dunkle Geschäfte zu haben ist), Züge (Schlafwagen), Bahnhöfe, Flughäfen, Aufnahmestudios.
Einer meiner älteren Brüder, genannt Duke of Modena, geboren 1686, ist wo abgeblieben? Wahrscheinlich in Rußland – wie mein (dort entweder umgekommener oder bis heute unter Verschluß gehaltener) anderer Bruder vermutlich auch, dessen Name – Russian Czar – ja eigentlich deutlich genug verrät, wo man zu suchen hätte.
Es gibt Dutzende solcher Geschichten.
Louis Spohr, dem Bravourvirtuosen (und angeblich besten unter den vielen sog. Beinahe-Paganinis), haben Diebe den Geigenkasten damals kurzerhand einfach hinten vom Reisegepäck geschnallt und waren damit auf Nimmerwiedersehen verschwunden; die Kutsche hatte am Stadttor von Göttingen wegen einer Kontrolle der Passierscheine nur kurz angehalten. Es läßt sich denken, erinnert sich Spohr, daß ich die Nacht schlaflos zubrachte. Am nächsten Morgen wurde ich benachrichtigt, daß man in einem Felde einen leeren Koffer und einen Geigenkasten gefunden hatte. Trunken vor Freude eilte ich hin, in der Hoffnung, daß sich die Diebe mit dem Inhalt des Koffers begnügt hätten und die Geige noch in ihrem Behälter sei. Dem war leider nicht so …
Aufgetaucht ist das wertvolle Instrument jedenfalls nie wieder, nicht daß ich wüßte, genausowenig wie die berühmte Herkulesgeige, seit Ysaÿe, Eugène Ysaÿe, sie mit unüberbietbarer Tonfülle gespielt hat. Wo sie steckt? Seit 1907 ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Ysaÿe hatte gerade gespielt, in St. Petersburg, war hinter die Bühne und dann ins Künstlerzimmer gegangen, um das Instrument in sein Etui zu betten, war dann aber von der Begeisterung seines Publikums zu einer weiteren Verbeugung hinausgerufen worden. Als er zurückkam, war die Geige weg. Und blieb weg, bis heute. Aber vielleicht taucht ja auch sie eines Tages wieder auf, wie jenes andere Mitglied meiner Familie, das aus einem New Yorker Museum gestohlen, dann aber in Polen, in der Stadt Krakau, Jahrzehnte später wieder aufgefunden worden war, im Besitz eines Straßenmusikanten, der sie, wie er sich bei seiner Vernehmung zu erinnern glaubte, für fast nichts bei einem Trödler erworben haben wollte.
Fehlt noch jener sorglos sonderbare Kaffeehausgeiger, der eine meiner berühmten kleinen Schwestern, um nicht aufzufliegen, einfach schwarz angestrichen und dann sein halbes Leben lang auf ihren vier Saiten herumgegeigt hatte, ohne daß jemand ahnen konnte, was der gute Mann da unterm Kinn hatte, eben jenes verschollen geglaubte Instrument, das Bronislaw Hubermann nach einem Auftritt in der New Yorker Carnegie Hall aus dem Umkleidezimmer entwendet worden war. Jahre später tauchte eine bunt geschminkte, energische alte Dame (richtig: die Witwe des Kaffeehausgeigers) im Geschäft eines kleinen, sich kümmerlich über Wasser haltenden Händlers auf, um das schwarze Ungetüm zu Geld zu machen, für einen allerdings so stolzen Preis, daß dem Mann fast die Lust verging, sie überhaupt in die Hand zu nehmen; warum sollte er eine Summe hinblättern, die vielleicht dem Andenken ihres verblichenen Gatten schmeichelte, weil der, wie sie ihm vorschwärmte, auf ihr »immer so schön gespielt hatte«, aber doch wohl sonst minderwertig, wenn nicht gar nichts wert war. Aber halt! Sie klang, als er sie dann doch kurz anspielte, nicht übel. Sie klang sogar besser als alles, was je über seinen Ladentisch gegangen war, nicht nur frisch und lebendig, sondern einfach herrlich, einfach großartig! Was sollte er da noch lange feilschen? Unter seinen Händen hatte noch nie ein Instrument so geklungen, so voll und rund, dabei war, wie er wußte, sein Spiel bestenfalls dürftig.
Da war sie also wieder, die Hubermann, die Ex-Hubermann, wie sie heute genannt wird, von Experten anhand von archivarischem Material eindeutig als Instrument von Vaters Hand identifiziert, schwarz überlackiert, leider, aber das war von Spezialisten ohne Beschädigung des ursprünglichen Lacks leicht und ohne Verlust des Klangcharakters der Geige wieder rückgängig zu machen.
Manchmal stelle ich mir vor, der alte Stradivari hätte die Ausstellung ihm zu Ehren selber sehen und die Feierlichkeiten, die Konzerte, Vorträge und Diskussionen erleben können. Wäre er stolz oder verärgert gewesen über all das Brimborium um seine Person? Oder sogar angewidert und in seinem Urteil bestätigt über das, was er da in seiner Heimatstadt in der Lombardei geleistet hatte? Hätte er denn selbst eine Erklärung gehabt für die Eigenart seiner Arbeitsweise, vor allem für das spezielle, einmalige Resultat? Eine andere als die seiner vielen Bewunderer, die, kaum fällt sein Name, ins Leere starren wie in eine aus Tönen ins Unsichtbare gebaute Welt?
Eine Erklärung? Was für eine Erklärung? Probieren Sie Ihr Glück, wenn Ihnen danach ist! Eine Stehplatzkarte läßt sich immer auftreiben, sagen wir, für das Programm Meisterinterpreten, Zyklus I–III. Und in der Pause hören Sie sich einfach mal ein bißchen um unter den Besuchern, den Berufsabonnenten der großen goldenen Konzerthäuser, egal wo. Sie brauchen ja nicht gleich ins Schwärmen zu kommen, überlassen Sie das ruhig anderen. Fordern Sie nur, höflich natürlich, eine plausible Erklärung, was eine Stradivari heraushebt über den Durchschnitt anderer Spitzeninstrumente. Die werden Sie aber anschauen! Ach, wissen Sie, werden Ihnen die musikseligen, kein Konzert versäumenden Ruheständler antworten (und Sie nicht gerade sehr freundlich, dafür aber gründlich von oben bis unten mustern, als hätten Sie kein Recht auf Anwesenheit), wissen Sie, Gott sei Dank gibt es noch ein paar Dinge auf dieser wenig beneidenswerten Welt, die einer Erklärung nicht bedürfen! Und sich auch den Quarzlampen oder Röntgenaugen nicht offenbaren. Ausgeschlossen, völlig ausgeschlossen, wie man das in Worten sagen soll! Das kann man nicht beschreiben, was eine Stradivari ausmacht, nicht wirklich, aber hören kann man es (allgemeine Zustimmung!), man kann es hören, ja, ganz sicher, man hört den Unterschied einfach (alle nicken!), die feinen, sehr feinen Unterschiede, die einzigartigen, untrüglichen, geradezu heiligen Nuancen, die so ein Instrument von allen übrigen Meisterinstrumenten unterscheidet.
Ist das so?
Wäre der gute Antonio auch so ins Stottern gekommen? Hätte er seine Instrumente überhaupt wiedererkannt? Was hätte er geantwortet? Hört, was Ihr hört, hätte er gebrummt, auch wenn Ihr natürlich nur das hören werdet, was Ihr hören wollt, daran aber glaubt wie den Priestern, die Euch predigen! Das war deutlich. Aber ging ihn das alles denn etwas an, die merkwürdigen Millionen, der schicke Kult, all die Einbildungen der frommen Gemeinde, das Fieber ihrer schwärmerischen Geisteszustände, die Gänsehaut in den Gehörgängen, die intime Raserei bis hinein in die Gedärme, diese Dämonie, wie sie in Spielkarten sichtbar sein soll oder im Kern kostbarer Diamanten? Was hatte er zu schaffen mit Geschichten, die beweisen wollen, daß allem Übernatürlichen das Unglück folgt wie dem Fluch das Desaster? Ist das noch komisch, Antonio? Sag endlich was, melde Dich, rede. Halte eine Pressekonferenz ab, gib ein Interview, eine Erklärung, ein Zeichen wenigstens.
Fällt Dir denn nichts ein, zum Beispiel zu der Geschichte jenes vermutlich verrückt gewordenen, allerdings schwerreichen brasilianischen Plantagenbesitzers, der, als es ans Sterben ging, eine meiner kleinen Schwestern doch tatsächlich irgendwo auf seinen Ländereien (und ohne die Stelle zu markieren) in einem Zinnsarg bestattet hat? Niemand sollte sie je wiederfinden, ausgraben, je wieder berühren oder auf ihr spielen. Seiner Witwe tat das Instrument nur insofern leid, als sie es, als Andenken an gemeinsame Stunden mit ihrem Mann, der auf ihm hin und wieder herumgestrichen und trotz seiner sehr begrenzten Fähigkeiten glücklich dabei gewesen war, gerne mit einem Ehrenplatz belohnt hätte. Sie wollte es bei sich im Haus haben, aufgebahrt, wie ihr vorschwebte, in seiner Bibliothek (in einem Schrein aus Glas). Nur, sie kannte die Stelle nicht, wo die Geige unter der Erde lag; und die Kaffeeplantage war ja nicht etwa ein kleines überschaubares Stück Land, das man einfach mit einem Spaten umgraben konnte. Ihr Bruder, den sie in dieser Sache um Hilfe bat, hatte auf Anhieb eigene und handfestere Gründe, an die Geige zu glauben – und tüftelte den Plan eines Versicherungsbetrugs aus, der erst aufflog, als Lloyds, mißtrauisch geworden, einen Suchtrupp nach Brasilien schickte und mit Detektoren das ganze weitläufige Gelände absuchen ließ – und schließlich Erfolg hatte.
Ist das Dein Verdienst, Antonio? Oder Deine Schuld? Was steckt in Deinen Instrumenten, was niemand sehen, niemand finden, niemand nachahmen kann?
Gab man ihm ein Stück Holz – aus Türpfosten, alten Möbeln, Wandverschalungen geschnitten –, lag acht Tage später auf seinem Tisch eine Geige, und nicht irgendeine. Damit bestückten dann die Kaiser und Könige, die Zaren, die Fürsten, Grafen und kosmopolitischen Barone ihre Orchester (oder vermachten sie sich gegenseitig als Geschenke).
In der Welt um ihn herum nahm alles an Beschleunigung zu, währenddessen Antonio in seiner Werkstatt saß, ruhig, ganz der intuitiven Präzision hingegeben, mit der er das Holz aus den venezianischen Rudern schneiden würde, die er hatte anliefern lassen und deren Qualität er kannte. Das Flößen hatte das Holz ausgewaschen, gereinigt und, wie er’s brauchte, leichter gemacht. Versunken saß er in dem Durcheinander seiner Werkzeuge und Zubehörteile, der Instrumentenkästen und Kladden mit den Zeichnungen, versunken in Überlegungen zur Verbesserung der Stärke- und Klangverhältnisse, und polierte Hälse, feilte an Stegen und Baßbalken, Decken und Böden, und zwar, weil es so am schonendsten war, mit getrockneter Haifischhaut.
Was hörte er, wenn er arbeitete? Was hörte er wirklich? Und wie, mit welchem Interesse? Hörte er den Charakter der Klangfarben schon beim Schneiden der Decken und Böden? Hörte nicht nur sein Ohr, sondern auch die Hand, die die Ziehklingen führte? Hörte er mit den Handflächen, die das Holz hielten, mit den Fingerspitzen, wenn sie die Linien der Faserung berührten? Mit den Augen, die ja alles, was er tat, kontrollierten? Hörte er, wie wir Instrumente klingen würden, noch bevor auch nur eine einzige Saite aufgezogen war?
Fichte (Rottanne, picea excelsa) aus den Dolomiten
Die Wissenschaft, die sich mit ihm beschäftigt, mit dem Mann, dem Phänomen, der Eigenart seines Könnens, den Proportionen seiner Produkte, der Beschaffenheit der verwendeten Materialien, ist längst unüberschaubar geworden. Berge von Büchern gibt es, ganze Bibliotheken voller Broschüren, Untersuchungen, Artikel, Abhandlungen – und jede Menge Geschichten, die alle nicht viel plausibler klingen als die Geschichte eines Mannes, der behauptet, dreimal ermordet worden zu sein. Klar, alle wollen, mehr oder weniger wissenschaftlich, nichts anderes, als Antonio Stradivari in die Karten schauen, ihn enträtseln, sein Geheimnis lüften, das er, falls er eines hatte – was ich bezweifle! –, mit ins Grab nahm.
Welches Geheimnis? Das Holz? Der Lack? (Gestatten Sie mir, daß ich mich, was dieses Thema betrifft, nicht mehr äußern will! Mir geht der ganze Unfug, das Raunen und Rätseln, was die Lackierung betrifft, seit mindestens zweihundert Jahren schon auf die Nerven. Was soll mit dem Lack sein? Warum dieses Tamtam? Welcher, bitte, der vielen verschiedenen Lacke, die er ausprobierte, enthält wieviel Prozent Geheimnis? Oder reden wir über die Grundierung der gesamten Holzaußenfläche? Oder die danach aufgetragene Zwischenschicht, die den Lack vom grundierten Holz trennt? Oder nur den ersten Aufstrich, den zweiten, einen irgendwann letzten? Keine Ahnung, was daran geheimnisvoll sein soll! Die Farbe, ihre weichen, transparenten Reflexe, machen die Menschen verrückt, was ich verstehen kann, aber es hat nun mal bei aller Schönheit der Farbe der Lack mit dem Klang nichts zu tun, jedenfalls nichts Entscheidendes. Aber was soll ich große Reden schwingen, deshalb Schluß hier und … Klammer zu.) Die Abmessungen? Das Volumen der Teile, die er zusammenleimte? Was für ein Geheimnis? Hatten die Pioniere in der Ahnengalerie des Geigenbaus eines gehabt? Andrea Amati etwa, Gasparo di Bertolotti, der sich nach seiner Geburtsstadt da Salò nannte? Oder Maggini? Oder Antonios erklärtes großes Vorbild, Andreas’ Enkel Nicolo Amati? Ein Geheimnis zu haben, war das nicht die Erfindung einer späteren Generation, die dann begann, in internationalem Maßstab zu spekulieren, an Profite glaubte, an Agenten, an die Eroberung neuer Märkte? Typen wie Tom Dodd einer war, ein gewiefter Bursche, im Grunde aber doch weiter nichts als ein Nachahmer, der in London tatsächlich ein Geschäft mit der Behauptung machte, das Geheimnis zu kennen, was den Lack, den er aufstrich, betraf, ein, das muß man ihm lassen, erstklassiger Hochstapler, der alles draufhatte, die ganze Palette phantastischer Geschichten, vom Urin rothaariger Knaben, den die alten Meister angeblich verwendet hätten, bis zu in seinem Besitz befindlichen authentischen Klosterhandschriften zur Herstellung von Lacken aus einer Zeit, als noch die Mönche damit Handel treiben durften.
Natürlich kann man damit ein Publikum unterhalten, auch heute noch. Aber bei uns zu Hause? Stand die Tür an der Piazza San Domenico bei gutem Wetter nicht immerzu offen? Gab es nicht jede Menge Augenzeugen, jeden Tag? Jeder Geselle war einer, jeder Freund, der vorbeischaute, der Obsthändler mit den Trauben, der Apotheker, wenn er die Lacke lieferte. Sogar Ruggieri, Gagliano, Montagnana schauten herein, alles Kollegen, die er mochte. War je eine der Schubladen seiner Kästen verschlossen?
Was man brauchte, lag griffbereit herum, die Zeichnungen, Schnitte, Pläne, die Hobel, Zwingen, Raspeln, in kleinen Flaschen oder in Schalen die Öle, Harze, Schleifmittel, die verschiedenen (und verschieden gemischten) Polituren und Pigmente, Weingeist, Leinölfirnis, die Schachteln mit den Intarsien, dem Kork, den Keilen, Stegen, den Stimmstöcken – mein Gott, all das Zeug, was in einer Werkstatt eben so herumliegt. Daß einer (wie mein Vater) ein Genie ist, sprach sich damals nicht schnell herum, jedenfalls nicht in aller Öffentlichkeit. Antonio Stradivari? Das war der Mann, den man, wenn man ihm begegnete, grüßte, ein Handwerker, der (wie andere auch) Streichinstrumente herstellte, immer eine weiße Lederschürze anhatte, seine Frau, seine Familie liebte und immer fleißig und freundlich war. Und in die Kirche ging er auch. Insofern war es nur logisch, daß einer wie der verrückte Paganini keine Stradivari spielte, sondern eine Guarneri del Gesu, seine Kanone, wie er sie nannte, den Geniestreich eines Trunksüchtigen, so Prof. Starkie, den Sie noch kennenlernen werden.
Niemand wirkte weniger wie ein Zauberkünstler als Antonio. Und doch, warum ist sich die Welt einig, einig wie selten, was die besondere, unwiederholbare, unzerstörbare Qualität seiner Arbeiten betrifft? Es mag bestimmte andere Vorlieben geben, warum nicht. Es gab zur gleichen Zeit noch eine Anzahl anderer hervorragender Geigenbauer, in Venedig, in Neapel, in Mailand, aber unbestritten ist, was die Welt weiß: wir, die Stradivaris, tragen die Krone! Die Legende hat uns den höchsten Ruhm zugesprochen. Und die höchste Quote! Höchstpreise, wie sie inzwischen in London, Tokio oder New York an der Tagesordnung sind, können natürlich, wie bei Gemälden auch, nur symbolisch gemeint sein. Das wissen die Banken, die Konzerne oder Foundations, die allein sich das Prestige solcher Extravaganzen noch leisten können, so gut wie die wenigen Glücklichen, denen sie ihre Instrumente auf Zeit überlassen.
Cremona war eine Kleinstadt. Bauern, Weinbauern, Geigenbauer, andere Handwerker natürlich, Apotheker. Was einer wußte, erzählte er seinem Sohn oder seinen Söhnen bei der Arbeit. Es war Gefühlssache, Fingerspitzengefühlssache, Intuition, was einem Wissen seinen Schliff, seinen Sinn gab. Vollkommenheit ist nicht das Resultat einer Wissenschaft, sondern Gnade, flüchtig, unerklärlich. Oder Fluch, Pakt mit einem Teufel, der Worte einer Sprache spricht, die keiner kennt und niemand wiederholen würde.