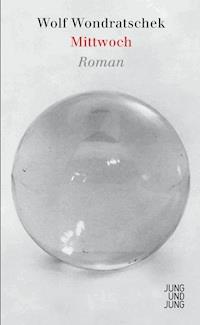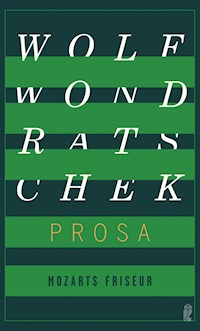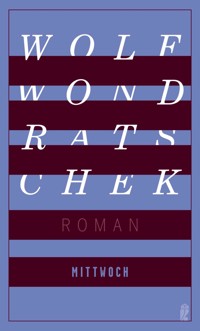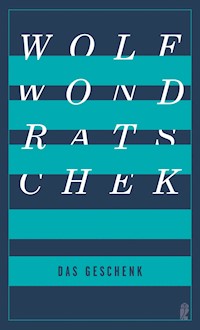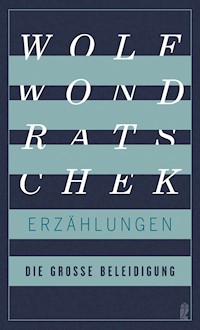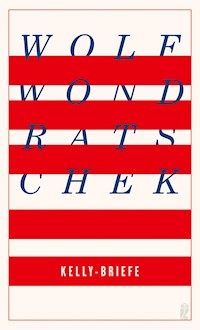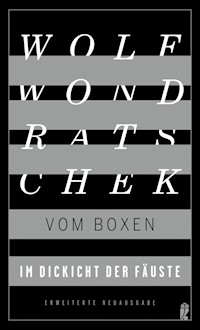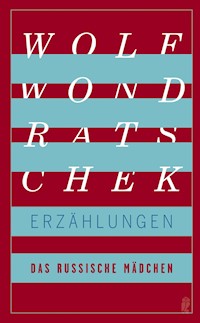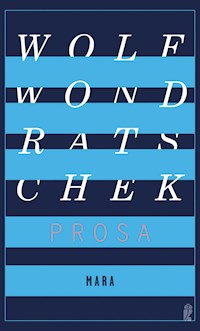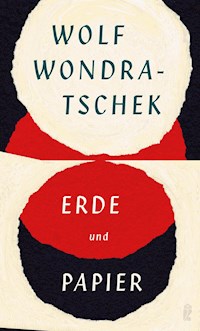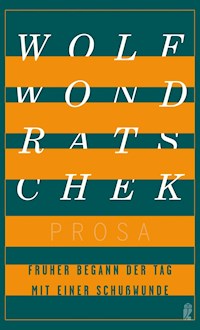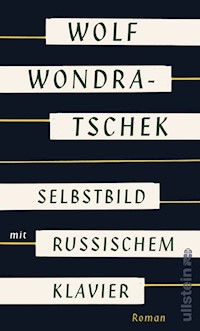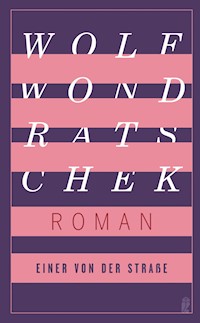
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ein eindrucksvolles Buch über das Leben auf der Überholspur, über Gewalt und Zärtlichkeit, über Hass und Liebe. Eine lakonische Chronik einer kriminellen Karriere. Fast wie ein Schwarzweißfilm." Der Tagesspiegel Gustav Berger wächst in einem Niemandsland der Liebe auf. Als der Krieg zu Ende ist, trennen sich seine Eltern. Stumm und hilflos müssen sie zusehen, wie Gustav sich eine Welt erobert, deren Gesetze täglich neu geschrieben werden: Der Junge schnorrt bei den "Amis", klaut auf Baustellen und schwänzt die Schule. Eine Halbweltkarriere beginnt, die ihn zunächst in ein Erziehungsheim, dann vor Gericht und schließlich hinter Gitter bringt. Jahre später hat Johnny seine Lektion gelernt und setzt sich nach St. Pauli ab. Aber er bleibt ein Rastloser – einer, der das große Geld macht und dem doch immer schmerzlich bewusst bleibt, was für Geld nicht zu haben ist; einer, der stets unterwegs ist und nie vergessen kann, woher er kommt. Ein Getriebener, der erst auf einem anderen Kontinent jene Frau findet, die sein Leben verändert und vielleicht auch ihn.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Einer von der Straße
Der Autor
Wolf Wondratschek wuchs in Karlsruhe auf. Von 1962 bis 1967 studierte er Literaturwissenschaft, Philosophie und Soziologie an den Universitäten in Heidelberg, Göttingen und Frankfurt am Main. Seit 1967 lebte er als freier Schriftsteller zunächst in München. In den Jahren 1970 und 1971 lehrte er als Gastdozent an der University of Warwick, Ende der Achtzigerjahre unternahm er ausgedehnte Reisen unter anderem in die USA und nach Mexiko. Gegenwärtig lebt er in Wien.
Das Buch
Glück ist ein RaubtierAls der Krieg zu Ende ist, müssen Gustav Bergers Eltern stumm und hilflos zusehen, wie ihr Sohn eine Halbweltkarriere beginnt, die ihn zunächst in ein Erziehungsheim, dann vor Gericht und schließlich hinter Gitter bringt.Jahre später hat Gustav seine Lektion gelernt, aber er bleibt ein Rastloser – einer, der auf St. Pauli das große Geld macht und dem doch immer schmerzlich bewusst ist, was für Geld nicht zu haben ist; einer, der stets unterwegs ist und nie vergessen kann, woher er kommt. Ein Getriebener, der erst auf einem anderen Kontinent jene Frau findet, die sein Leben verändert und vielleicht auch ihn.
Wolf Wondratschek
Einer von der Straße
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
© Wolf Wondratschek (2020)Dieses Werk wurde erstmals veröffentlicht im Jahr 1991.© dieser Ausgabe by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2020Alle Rechte vorbehaltenAutorenfoto: © Lilo RinkensUmschlaggestaltung: brian barth, berlinE-Book powered by pepyrus.com
ISBN 978-3-8437-2388-6
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Erstes Buch – An einer Tür ist die Klinke auch nicht in der Mitte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Zweites Buch – Der Tabakkönig
1
2
3
4
5
6
7
8
Drittes Buch – Die Arbeit, am Leben zu bleiben
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Viertes Buch – Glück ist ein Raubtier
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Fünftes Buch – Geld ist nichts
1
2
3
4
5
6
Anhang
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Walter Staudinger gewidmet
Prolog
Der kleine Junge rannte, so schnell er nur konnte, aus dem Zimmer und die Treppe hinunter. Wenn er nichts verpassen wollte, mußte er sich beeilen und schneller sein als seine Mutter, die ihn verfolgte.
Wegrennen konnte er am besten! Außerdem war es heute einfach, weil die ganze Straße voller Menschen war; er mußte sich nur geschickt durch genügend Beine nach vorne drängeln, um sicher zu sein, daß sie ihn nicht finden konnte. Als er niemand mehr vor der Nase hatte, blieb er stehen und schaute in alle Himmelsrichtungen gleichzeitig, so aufgeregt war er. Durch die Straße rollte ein Konvoi der amerikanischen Armee. Neben ihren Geschützwagen und Jeeps gingen Soldaten, die alle lachten und winkten, eine ganze Menge Soldaten. Auf einen, der Schokolade verteilte, wollte er gerade zulaufen, als ihn seine Mutter entdeckt hatte und festhielt. Nicht einmal nach der Packung Kaugummi, die direkt vor seinen Füßen auf die Straße fiel, konnte er sich schnell genug bücken. »Komm«, sagte seine Mutter, »ich heb dich hoch, dann kannst du besser sehen!«
Wenn er böse schaute, gab seine Mutter meistens nach; und wie böse er schauen konnte! Aber sie ließ ihn nicht los. Daß er vor Wut zu schreien anfing, nützte auch nichts. Alle um ihn herum machten einen solchen Lärm, daß seine Mutter gar nicht hörte, wie laut er schrie!
»Seit damals habe ich jede Hand, die mich festhielt, gehaßt. Spätestens da«, erinnerte er sich viele, viele Jahre später, »begann sich in mir das Gefühl auszubreiten, immer der Erste, immer der Schnellste sein zu müssen, um das zu bekommen, was der Zweite, der Langsamere ja nicht bekommen konnte. Nur wußte ich damals nicht, daß ich das Gefühl, immer gewinnen zu müssen, nie mehr loswerden würde.«
Erstes Buch – An einer Tür ist die Klinke auch nicht in der Mitte
Das Talent steckt in den Kinderschuhen.
George B. Shaw
1
Auf seinem Heimweg hatte Herr Schnabel, angestellt beim städtischen Jugendamt, noch einen letzten Termin wahrzunehmen. Einen Routinefall, der auf mehreren Beschwerden über einen gewissen Gustav Michael Berger beruhte, geboren 1942, wohnhaft in München, Dachauer Straße. Der Vater hieß Josef Berger, geboren 1902. Die Akte, die er in seiner Tasche bei sich trug, wies ihn als alleinerziehend aus.
Die Praxis seines Berufs hatte ihn gelehrt, daß es kein Vergnügen war, sich in familiäre Dinge einmischen zu müssen. Manchmal war es schon ein Kunststück, in eine Wohnung überhaupt eingelassen zu werden. Es gab Gründe genug, die es ihm ratsam erscheinen ließen, vor jeder Tür noch einmal tief durchzuatmen.
Vor ihm stand, als sich die Tür öffnete, ein Mann, der aussah, als sei er gestört worden.
»Ja, bitte?«
»Schnabel, Jugendamt. Darf ich reinkommen?«
Josef Berger trat wortlos zur Seite, ließ ihn ein, schloß die Tür und bot ihm einen Stuhl an.
»Und du bist wohl der kleine Gustav«, sagte Herr Schnabel noch im Stehen. Er wollte jeder Auseinandersetzung durch einen ruhigen, freundlichen Ton zuvorkommen.
Gustav zog den Kopf zwischen die Schultern und wartete ab.
»Wenn Sie Beschwerden loswerden wollen, können Sie sich die Mühe sparen.« Während Josef Berger das sagte, säuberte er einen Pinsel mit einem kleinen Lappen.
»Ach, Sie sind Künstler?« versuchte Herr Schnabel die Atmosphäre zu entspannen. Dabei nutzte er die Zeit, sich einen Eindruck von den Wohnverhältnissen zu verschaffen. Alles sah ärmlich aus, was gemildert wurde durch die Tatsache, daß am Fenster eine Staffelei stand.
»Ich male, wenn Sie das meinen.« Wie Josef Berger das sagte, konnte es keinen Zweifel geben, daß er darüber kein Gespräch wünschte – und sich der Zweideutigkeit bewußt war, die der Ausdruck ›Künstler‹ im Munde eines städtischen Beamten besaß.
»Ich habe hier einen ganzen Stoß Beschwerden«, sagte Herr Schnabel, zog dabei die Akte aus der Tasche und legte sie vor sich auf den Tisch, eine Geste, die ihm Kraft einflößen sollte. Kraft würde er brauchen, soviel war sicher bei diesem Mann, der zu keinem überflüssigen Wort aufgelegt schien. Und wie zur Bestätigung einer Bedrohung entdeckte Herr Schnabel erst jetzt oben auf dem Schrank einen schwarzen Vogel. Danach zu fragen, getraute er sich nicht, sondern flüchtete sich in das Labyrinth seiner dienstlichen Gedankengänge und schien zu prüfen, inwieweit ein solches Haustier angebracht war – und ob es einen Zusammenhang gab zwischen einem Raben und dem hier zur Debatte stehenden Erziehungsnotstand. Erst im Verlauf der Unterhaltung kam ihm der Gedanke, der Vogel könnte ausgestopft sein.
»Wir müssen jeder Sache, die an uns herangetragen wird, nachgehen und …«
Josef Berger stand auf. »Verschwenden Sie nicht unnötig Ihre Zeit, stecken Sie Ihre Akte wieder ein und verschwinden Sie.«
Herr Schnabel beabsichtigte, genau das Gegenteil zu tun, nannte die Anzahl aller Beschwerden und erwog die Schwere der Verfehlungen. Die Polizei hatte den Jungen wiederholt aus abgesperrten Ruinengrundstücken geholt, Lebensmittelhändler hatten ihn beim Klauen erwischt, und dem Eisenhändler hatte er Schrott verkaufen wollen, den er angeblich zusammengesammelt, in Wahrheit aber bei ihm selbst gestohlen hatte. Aus der ganzen Nachbarschaft lagen gleich stapelweise Beschwerden vor, mit beigefügten ärztlichen Attesten über Verletzungen, die sich ihre Kinder bei irgendwelchen verbotenen Unternehmungen zugezogen hatten. Offenbar verstand es dieser Junge, auch die größten Angsthasen zu jeder Schandtat zu überreden.
Herr Schnabel tat alles, sein Erscheinen zu rechtfertigen, spürte aber, daß nichts bei Josef Berger Eindruck machte. Gustav saß da, als gehe ihn alles nichts an, und kaute Fingernägel.
»Ah ja, noch was«, fiel Herrn Schnabel ein, »die Mutter, darf ich Name, Adresse und …«
Wieder unterbrach ihn Josef Berger. »Sie hat einen Herrn Karst geheiratet.« Er war sich bewußt, daß es einen besseren Zeitpunkt verdient gehabt hätte, seinem Sohn diese Neuigkeit mitzuteilen.
Nach einer kurzen Pause begnügte sich Herr Schnabel mit dem Namen, die Adresse würde er sich selbst beschaffen. »Wir werden uns also mit der Mutter in Verbindung setzen und prüfen, ob es nicht ratsam wäre, den Jungen ihr zu übergeben. Falls die Verhältnisse das erlauben.«
»Raus!« schrie Josef Berger.
Gustav hatte seine Fingernägel vergessen und schaute zur Wand, wo das Ölporträt seiner Mutter hing, das sein Vater gemalt hatte, und überlegte, ob sie, wenn sie einen fremden Mann geheiratet hatte, überhaupt noch seine Mutter war.
»Noch eines«, sagte Herr Schnabel, als er aufstand, die Akte in seiner Tasche verschloß und noch einmal den ausgestopften Raben fixierte, »ich habe nicht den Eindruck, daß Sie den Ernst dieser vorgebrachten Beschwerden einsehen und sich im klaren sind, daß wir alles tun werden, Frau Karst zu veranlassen, nun ihren Teil an der Kindererziehung zu übernehmen. Was ja wohl in aller Interesse sein dürfte.«
Josef Berger setzte dem Beamten das spitze Ende seines Pinsels auf die Brust. »In Ihrem Interesse ist nur eines: sich hier nicht wieder blicken zu lassen.«
Wieder nur ein »Routinefall«, seufzte Herr Schnabel beim Verlassen des Hauses und war heilfroh, daß dieser Künstlertyp da oben nicht auch noch handgreiflich geworden war.
2
1945 war nicht nur der Weltkrieg zu Ende, sondern auch die siebenjährige Ehe von Josef und Vera Berger. Daß zwei so völlig verschiedene Menschen erst gar nicht hätten heiraten sollen, nur noch darüber herrschte zwischen den Eheleuten ein harmonisches Einverständnis. Also knüpfte Vera Berger am Tag der Trennung zwei eingerissene, abgeschabte Leintücher zusammen, warf ein wenig Kleidung und ein paar ihrer persönlichen Dinge hinein und ging, zog zuerst um die Ecke zu einer Bekannten und von dort weiter zu einer nächsten.
Die Trennung von ihrem Sohn, eine vorübergehende Trennung, wie sie hoffte, nahm sie in Kauf, zumal auch das Jugendamt die Erziehungsvollmacht dem Vater zugesprochen hatte. Soll er erst einmal bei seinem Vater bleiben, dachte sie, da ist so ein schwieriges Bürschchen, das voller Unruhe steckt, wahrscheinlich nicht einmal schlecht aufgehoben. Sie kannte ihren Mann, aber auch ihren Sohn. Josef würde streng mit seinem Kind umspringen, und Gustav sich alles nur Erdenkliche einfallen lassen, seinen eigenen Kopf trotzdem durchzusetzen. Schon beim ersten Schrei im Kreißsaal war ihr klargeworden, daß er offenbar alles andere als ein braves Kind werden wollte. Und sie behielt recht. Nie konnte er stillsitzen. Immer riß er Fenster auf oder die Wohnungstür, denn draußen konnte ja etwas passieren, das mehr Spaß machte, als in einem Buch mit bunten Bären und sprechenden Hühnern zu blättern.
Zu Hause war ihm einfach immer langweilig.
Eine Familie war ihm zuwenig Leben. Er war überhaupt erst richtig in seinem Element, wenn er herumwirbeln konnte, zum Beispiel frühmorgens, wenn es zum Waschen auf den Hausflur ging, an den einzigen Wasserhahn, der allen Hausbewohnern als Waschgelegenheit diente. Da machte es Spaß, dem Bayer-Franzi auf die Zahnpastatube zu treten oder dem Zeder-Berti, der unter ihm wohnte, auf den Kopf zu spucken, Handtücher zu vertauschen und Rasierklingen verschwinden zu lassen. Er konnte jeden zur Weißglut treiben, der ihm zuschaute, wie umständlich er sich wusch; er wusch sich überhaupt nur dann richtig, wenn jemand deshalb warten mußte. Dabei verließ er sich immer auf seinen Vater, der es sich jedesmal lautstark verbat, wann immer sich jemand über seinen Jungen beschwerte.
Einer wie der, dachte Vera Berger, würde sie überall finden, wenn er sie brauchte.
3
»Herr Berger, wie geht’s Ihnen denn?«
»Das geht Sie einen Scheißdreck an!«
Geschwätz war ihm so zuwider, daß er zusehends schweigsamer wurde. Josef Berger war wie jeder Mann, der keine Miene verzieht, ein Mann mit vielen Gesichtern, trotzdem hatte er eines nie gekonnt: sich anpassen; schon unter Hitler nicht, als alle noch jubelten. Er besaß nicht ihre Geschicklichkeit, einen Vorteil auszunutzen, geschweige denn, jemand übers Ohr zu hauen. Auch jetzt nicht, als es ums nackte Überleben ging. Sein störrischer Gerechtigkeitssinn ließ es nicht zu, an etwas anderes als an ehrliche Arbeit zu glauben. Mit seinen Händen konnte er einfach alles, Schuhe besohlen, Uhren reparieren, Vögel, sogar Füchse ausstopfen, Betten zimmern, Bilderrahmen schnitzen, nur einen auf der Straße liegenden Geldbeutel aufheben und in der Tasche verschwinden lassen, konnte er nicht. Jede freie Minute, die Nachtstunden zumeist, wenn Gustav endlich schlief, verbrachte er an der Staffelei und malte Landschaften, vor allem Landschaften der nahen bayrischen Umgebung, die er mehr liebte als die Stadt, ihre Menschen und Wirtshäuser. Er gab die Bilder einer kleinen Galerie in Kommission, wobei er, selbst bei einem Verkauf, immer draufzahlte, denn allein die Farben kosteten mehr, als er bekam; was ihn jedoch nicht im geringsten störte. Soweit es in dem engen Zimmer überhaupt möglich war, machte Gustav einen weiten Bogen um die Staffelei. Manchmal nahm Josef Berger seinen Sohn in ein Museum mit, aber alles, was den dort interessierte, war die Alarmanlage.
Die Könige des Viertels waren die Metzger, Bäcker, Kohlen- und Schrotthändler und die Typen, die alles, was sie zusammengaunern konnten, mit der Geschwindigkeit eines Augenaufschlags an der übernächsten Straßenecke mit doppeltem Gewinn verkauften. Wenn abends die wenigen Lichter, die wieder brannten, angingen, Geldscheine die Besitzer wechselten und sich Ware in bare Münze verwandelte, stritt sich Josef Berger mit seinem Sohn herum, der einfach nie schlafen gehen wollte.
Es verging kein Wochenende, an dem Josef Berger nicht mit dem Zug nach Weßling hinausfuhr und durch den Wald wanderte, Beeren und Pilze sammelte, die er den Marktfrauen auf dem Viktualienmarkt verkaufte. Sie nannten ihn dort ohnehin nur noch den »Schwammerlprofessor«. Gustav wehrte sich jedesmal, wenn er mit mußte, was hieß: um fünf frühmorgens aufstehen, dann, vom Bahnhof aus, waren es bis zum Wald immer noch gute drei Kilometer Fußmarsch, und oft blieben sie sogar über Nacht und legten sich in einen Heustadel zum Schlafen. Einmal war nachts eine Maus über ihn hinweggekrochen. Wie er das haßte. Er haßte seinen Vater, haßte den ganzen Wald, jeden einzelnen Baum, die Beeren und Pilze, die er in einem an sein Handgelenk gebundenes Körbchen tragen mußte. Er hätte schreien können, getraute sich aber nicht, hätte heulen können, fühlte sich dafür aber bereits viel zu erwachsen.
Daß Kupferdraht mehr brachte als Himbeeren und Pfandflaschen mehr als Pilze, hatte Gustav längst herausgefunden, aus Angst vor einer Ohrfeige aber wohlweislich für sich behalten.
Das einzige, was ihn im Wald interessierte, waren Ameisenhaufen. Was für ein Durcheinander das war, wie das zuckte, krabbelte, kroch und kochte. Und Gustav fragte sich, wie das funktionierte – und wer hier wohl der Boß war!
4
Wann immer es möglich war, nahm Josef Berger seinen Sohn mit, wenn er geschäftlich in der Stadt unterwegs war. Es schien nicht mehr ratsam, den Jungen, bevor er eingeschult wurde, zu oft unbeaufsichtigt sich selbst zu überlassen. Weder Ermahnungen noch Schläge waren geeignet, die beängstigende Begeisterung des Jungen für Streiche und Dummheiten einzudämmen.
In diesen Wochen klapperte Josef Berger Baustellen ab, an der einen Hand seinen Sohn, in der anderen einen Koffer mit Armbanduhren, die er vom gleichen Geschäft, für das er sonst Uhren reparierte, in Kommission hatte. Es waren Markenuhren, sie waren preiswert und nicht geklaut. Wem er das aber erklärte, der lachte nur. Alles war geklaut, und nichts funktionierte lange. Man kaufte auf der Straße eine Uhr, die zwei Tage später schon nicht mehr tickte, und der Händler war über alle Berge. Nur ein Dummkopf war in diesen Zeiten ehrlich. Wie Josef Berger es schaffte, seinem Sohn jeden Tag wenigstens eine warme Mahlzeit hinzustellen, wußte er oft selbst nicht.
»Na, du Clown«, riefen sie vom Baugerüst herunter, »zeig mal her, was du da zusammengeklaut hast.«
Sie ließen die Uhren von Hand zu Hand wandern, boten lächerliche Preise oder wollten sie gleich ganz geschenkt haben. Am Ende konnte Josef Berger manchmal schon froh sein, wenn er sie alle wieder vollzählig in seinem Koffer verstaut hatte. Für sie war er weiter nichts als auch nur einer dieser Gauner, die jeden Tag auftauchten, um was loszuwerden.
Gustav stand daneben und war still. Er hörte die Männer in einem Ton mit seinem Vater sprechen, wie noch nie jemand mit ihm gesprochen hatte. Aber gleich würde er, hoffte Gustav, ein paar von ihnen richtig verprügeln.
»Komm morgen wieder, dann aber mit Damenuhren«, schrie einer.
»Oder Unterwäsche«, grölte ein anderer.
Als der Polier erschien, ließen sie ihn stehen. »Pack dein Gelumpe zusammen«, schrie er ihn an, »und halte meine Leute nicht von der Arbeit ab.«
Gustav hatte eine Stinkwut, weil sich sein Vater alles gefallen ließ. Warum hatte er sich nicht gewehrt? Am liebsten wäre Gustav, weil er sich schämte, einfach davongelaufen.
Am Abend saß er am Tisch, kaute auf seinen Kartoffeln herum und wagte nicht, seinen Vater anzuschauen. »Ich bin müde«, log er, legte sich nach dem Essen gleich ins Bett, das Gesicht zur Wand gedreht, damit er nicht gleich die Augen zumachen mußte, und dachte an Australien, wovon ihm sein Vater erzählt hatte und wohin er ihn mitnehmen würde, wenn er dorthin auswanderte. Bevor er einschlief, fielen ihm dann doch noch die leeren Bierflaschen neben der Baracke des Poliers ein. Wenn die morgen noch da waren, würde er sie klauen, Pfand kassieren, für jede zwanzig Pfennige. Am liebsten wäre er gleich losgerannt.
5
Es gefiel Gustav in seiner Straße. Gleich gegenüber lag die ausgebrannte Wehrmachtsbäckerei, der ideale Platz, um Schätze zu vergraben. Es gab jede Menge anderer, entweder bis auf den Grund ausgebombter, ausgebrannter oder halb eingestürzter Mietshäuser, in denen noch hinter Bretterverschlägen Menschen wohnten; und es gab von Bomben aufgerissene Keller, in die man klettern konnte. Nichts war, wenn man etwas angestellt hatte, wichtiger, als sich dort verstecken zu können.
Kraus-Schorschi, dieser Winzling, rannte regelmäßig nach Hause und petzte. Huber-Bertl getraute sich auch nie, stand aber immer so auffällig vor den Verstecken herum, daß sie rausgeholt wurden. Flaschen waren das. Allmer-Willi trug sogar eine Brille, der Schwachkopf.
Gleich nach dem Fußballspielen vor der St.-Benno-Kirche rannte Gustav immer hinüber zu seiner Lieblingsruine, in seinem Schlepptau die halbe Mannschaft. Weil immer er es war, der die Ideen hatte, war er automatisch auch der Anführer. Drei sollten Flaschen klauen, drei Kupferdraht sammeln, vier Glas suchen, und er selbst würde beim Eisenhändler einen Handwagen organisieren, um alles bequem transportieren zu können. Er war es auch, der die Reviere einteilte und bestimmte, wann sie gewechselt werden sollten.
Dann tauchte zu Hause eine Frau auf, die hieß Friedel, war unverheiratet, hatte sich in Josef Berger verliebt und leitete daraus nun das Recht ab, sich unentbehrlich vorzukommen. Gustav bekam das jeden Tag zu spüren. Er wurde das Opfer ihrer Liebe, die nur ein Ziel kannte: einen Trauschein. Sie war so freundlich, daß er sie von Anfang an haßte. Die Kinderbücher, die sie ihm mitbrachte, zerriß er. Außerdem zupfte sie ihm immer an der Kleidung herum, spuckte in ihr Taschentuch, um ihm den Mund abzuwischen, bis er, wie sie fand, ordentlich genug aussah. Dann nahm sie ihn an der Hand und ging mit ihm Besorgungen machen.
Da war sie wieder, die Hand, die ihn festhielt.
6
Als Gustav mit sechs Jahren in die Schule kam, konnte er über seine Nachmittage wieder verfügen, wie er wollte, weil Friedel inzwischen kapituliert hatte und verschwunden war, und vormittags konzentrierte er sich darauf, das Schulschwänzen zu lernen. Was ihm aber weiterhin nicht erspart blieb, waren die Fußmärsche mit seinem Vater. Bei den Sommerfesten draußen am Grinzinger Kircherl durfte er, weil der Pfarrer ihn kannte, manchmal die Fahrräder bewachen, eine günstige Gelegenheit, Ventile abzuschrauben, die, wie er wußte, Mangelware waren. Mehr noch als die Aussicht auf ein gutes Geschäft gefielen ihm seine Ausreden, mit denen er seine Unschuld beteuerte.
Außerdem stellte er jeden Montagabend in einer Gaststätte Kegel auf, wofür es fünf Mark gab, dazu eine Portion Leberkäse und, wenn die Wirtin dazu aufgelegt war, ein Setzei drauf. Statt damit zufrieden zu sein, rechnete Gustav nach: zehn Mark sind das Doppelte von fünf. Also mußte er sich wegen des anderen Jungen, der dienstags die Kegel aufstellen durfte, etwas einfallen lassen.
Als er ihn kommen sah, schätzte er seine Chance ab, falls der andere sich wehren würde. Obwohl er mindestens zwei Jahre älter aussah, stellte Gustav sich ihm in den Weg. »Du kannst gleich wieder nach Hause gehen. Die Kegel stell nämlich heute ich auf!« teilte Gustav ihm mit und unterstrich seine Frechheit damit, daß er dem Jungen gegen die Schulter schlug.
»Warum denn? Du spinnst wohl?«
Er gab ihm noch einen Schubs. »Oder willst du dich prügeln?«
Der Junge drehte sich um und lief weg. Gustav schaute ihm nach und hatte zum erstenmal das Gefühl, daß die Straße ihm gehörte. Dann lief er zum Kreitmeier-Hof hinüber, wo die Männerrunde schon auf ihren Kegeljungen wartete. Sie fragte schließlich Gustav, ob er nicht aushelfen könne.
Konnte er.
7
Der hagere, von Erschöpfung ausgezehrte Mann hieß Werner Karst, hatte den Krieg unverletzt überstanden und war froh, als er die beiden Türme der Frauenkirche wiedersah. Der Blick hinauf zum Himmel diente nicht der Einstimmung zu einem Dankgebet, sondern überzeugte ihn lediglich davon, daß es in den nächsten Stunden nicht regnen würde. Und so machte er sich auf den Weg nach Hause zu seiner Frau, einen langen Fußmarsch, den er nur einmal unterbrach, um sich an einem Brunnen zu erfrischen. Nach fünf Stunden endlich hatte er Ottobrunn, einen Vorort Münchens, erreicht.
Als er die Wohnung betrat, rief er »Ich bin’s!«, aber es kam keine Antwort. Die Küche, in die er hineinschaute, war leer, links im Wohnzimmer war auch niemand. Mit einem »Niemand hier?« öffnete er die Tür des Schlafzimmers. Da war jemand, aber da war noch jemand.
»Allmächtiger!« Er schloß die Augen. Auf dem Bett lag seine Frau in den Armen eines Mannes, auf dessen Uniformjacke die Rangabzeichen der amerikanischen Armee glänzten.
»Allmächtiger!« stotterte er wieder, als seine Frau vom Bett aufstand, ihren Morgenmantel überzog und ihn, beide Arme nach vorne gestreckt, aus dem Schlafzimmer zurück in die Wohndiele zu dirigieren versuchte. Aber das war gar nicht mehr nötig. Werner Karst hatte sich bereits umgedreht. Den gleichen Weg, den er gekommen war, ging er wieder zurück. Als er an einem Gefängnis vorbeikam, blieb er stehen, schaute zu den vergitterten Fenstern hinauf und träumte von einer Zelle, in der er sich schlafen legen konnte, um nie mehr aufzuwachen.
Wie benommen ging er auf die Pforte zu und hörte sich fragen, ob es hier für ihn Arbeit gäbe. Eine Stunde später hatte er eine Anstellung als Hilfsaufseher. Seine erste Amtshandlung war, sich selbst in eine Zelle einzusperren, sich auf die Pritsche fallen zu lassen und die Augen zu schließen.
Vier Jahre später war er bereits zweimal befördert worden, mit der Aussicht auf eine Karriere als Beamter, sobald er die mittlere Reife nachgeholt haben würde. Also hatte er einen Abendkurs an der Volkshochschule belegt und büffelte an allen freien Abenden – mit Ausnahme des Donnerstags, denn da gönnte sich Werner Karst das Vergnügen, ins »Café Wien« zum Tanztee zu gehen, wo er regelmäßig eine Frau traf, die Vera Berger hieß und die wie er eine schiefgegangene Ehe hinter sich hatte.
Sie war ihm aufgefallen, weil sie keinen Tanz ausließ. Und da er sich selbst auch für einen guten Tänzer hielt, faßte er sich ein Herz, sobald an der Säule neben der Tanzfläche das rote Lämpchen aufleuchtete, was immer »Herrenwahl« anzeigte.
Es war nicht leicht, schnell genug als erster an ihrem Tisch zu sein. An den letzten Donnerstagen waren ihm zwei Herren aufgefallen, die sich ebenfalls um sie bemühten. Was ihr offensichtlich Spaß machte, denn mal flirtete sie mit dem einen, mal mit dem anderen. Und beide hatten es offenbar darauf abgesehen, sie zu erobern. Sie selbst, wenigstens hoffte Werner Karst das, schien weiter keine ernsten Absichten zu haben. Auf das grüne Licht, also »Damenwahl«, reagierte sie nie. Da ging sie ihre Frisur richten oder drehte die Nähte ihrer Seidenstrümpfe gerade; und weil sie darauf stolz war, legte sie Wert darauf, daß es auch auffiel. Sie wollte, je älter sie wurde, endlich wieder jung sein dürfen.
Herr Karst ließ sie nicht mehr aus den Augen. Wenn sie sich beim Tanzen unterhielten, so redeten sie gerade nur so viel, daß keiner etwas von sich verraten mußte. Er beschränkte sich auf langsame Walzer und genoß jede Minute, die er sie in den Armen hielt. Die übrige Zeit nutzte Werner Karst, um mehr über die beiden Männer herauszufinden. Der eine, ein japanischer Geschäftsmann, fuhr einen Mercedes, der andere, ein Bayer, einen Opel Laubfrosch. Viel Hoffnung machte er sich nicht, denn er selbst besaß noch nicht einmal einen Führerschein, sondern kam mit dem Fahrrad.
Trotzdem entschloß er sich, anstelle einer Liebeserklärung, die ihn die Zunge gekostet hätte, etwas von seinem knappen Gehalt in einen Strauß Nelken zu investieren. Mit dem erschien er an ihrem Tisch.
Der Japaner erhob sich. »Aoki Shibuya. Angenehm.« Und fügte zu seiner Tischdame gewandt hinzu: »Meine Verlobte!«
»Verlobt? Was soll das denn?« Diese Art Überraschungen konnte Vera Berger noch nie leiden, erst recht nicht im Beisein eines Herrn, der ihr von Woche zu Woche besser gefiel. »Bilden Sie sich nur mal nicht soviel ein, mein Lieber!«
Am selben Abend geschah es, daß Werner Karst sein Fahrrad stehenließ und Vera Berger nach Hause begleitete.
Auf halbem Weg blieb sie stehen. »Sagen Sie mal, haben Sie nicht wenigstens ein Fahrrad?«
»Ja, doch. Vor dem Café steht es.«
»Und wieso lassen Sie mich dann zu Fuß gehen?«
Sie gingen den ganzen Weg wieder zurück. Vera Berger setzte sich hinten auf den Gepäckträger. »Halten Sie sich gut fest!« riet er ihr. Und das tat sie.
Als der Sommer vorbei war, hatten sich beide endgültig ineinander verliebt. »Du warst halt stur«, gab sie zur Antwort, als er unbedingt wissen wollte, warum sie sich ausgerechnet für ihn entschieden hatte.
Geheiratet wurde 1950. Auf die Chancen ihrer Ehe angesprochen, pflegte sie zu antworten: »Wir bleiben so lange verheiratet, wie es dieser Mann bei mir aushält.« Dabei schaute sie ihn an und schien ihn mit einem Lächeln an etwas erinnern zu wollen, wovor sie ihn nach dem ersten Kuß gewarnt hatte: »Aber mit mir, mein Lieber, ist nicht zu spaßen!«
Werner Karst war trotzdem restlos glücklich, auch dann noch, als ihr geschiedener Mann mit dem inzwischen elfjährigen Gustav bei ihr erschien, um ihn, wie es das Jugendamt entschieden hatte, ihrer Fürsorge zu übergeben.
»Lies das, Junge, damit ich mir später nie Vorwürfe anhören muß«, sagte Josef Berger und gab Gustav den Brief zu lesen, den das Jugendamt ihm geschickt hatte. Am meisten gefiel ihm, daß da stand, er stelle für seine gleichaltrigen Kameraden eine Gefahr dar. »Kann ich das behalten?«
Zwei Tage vor der großen Reise in einen anderen, ihm völlig unbekannten Stadtteil räumte Gustav seine Schätze aus dem Versteck in der Ruine: seine Cowboyhefte, zwei Serien Zigarettenbildchen, eine Rolle Schnur, eine Postkarte mit einer Frau, die nichts anhatte, drei Stück parfümierte Seife, drei Markstücke und eine Blechdose mit Zigaretten drin, sechs echte amerikanische Zigaretten.
Alle Jungs waren da, denn keiner wollte etwas verpassen. Sein Abschied mußte sich sogar bis zu den Mädchen herumgesprochen haben.
»Wir wollten nur mal sehn, was ihr hier treibt«, sagte die dicke Marianne. Die andere hieß Helga, die noch eine Freundin mitgebracht hatte. Helga war eine Wucht, wenigstens fand Gustav das, aber er war immer viel zu schüchtern gewesen, sich allein mit ihr zu treffen. Ihr schenkte er die Serie »Geheimnisvoller Orient« mit Palmen, Kamelen und Pyramiden drauf. Auf die Idee hätte ich früher kommen können, dachte er, als er sah, wie sie sich freute.
Dann nahm er ein Stück Seife. »Wer von euch den Rock hebt, der schenk ich ein Stück Seife.«
Den Jungs stockte der Atem. Ein paar lachten nervös und hörten erst wieder auf, als keines der Mädchen rot wurde.
»Ich!« Die dicke Marianne hob ihren Rock.
»Dich hab ich aber nicht gemeint«, sagte Gustav.
Alle lachten.
Gustav schaute Helga an. »Mach du’s!«
Den Jungs war ganz kalt geworden vor Neugier. Man hätte eine Maus schlafen hören können, so still war es jetzt.
»Spinnst du!« Sie blies ihre Haare aus der Stirn, nahm ihre Freundin bei der Hand und ging. Hinter ihnen her rannte die dicke Marianne.
Das war eine Abfuhr, und für alle eine Überraschung. Noch nie hatte jemand widersprochen, wenn Gustav etwas verlangt hatte.
Um die Aufmerksamkeit seiner Spielkameraden von dieser Blamage abzulenken, zerriß er die Postkarte mit der nackten Frau. »Selbst schuld, die blöde Kuh«, stellte er fest, steckte die Seife in seine Tasche und öffnete die Blechdose. »Wer will ’ne Zigarette rauchen?« Gustav nahm eine Camel heraus, steckte sie sich zwischen die Lippen und ließ sich von Kraus-Schorschi Feuer geben. Keiner von ihnen hatte jemals geraucht, jedenfalls nicht richtig.
Gustav hielt den Rauch so lange im Mund, daß es aussah, als könne er es bereits. Dann verteilte er die restlichen fünf und befahl jedem: »Aber richtig auf Lunge!«
Zeder-Berti kotzte als erster. Und Kraus-Schorschi, der immer noch nicht richtig gewachsen war, fing zu weinen an, als er in die Hosen machte. Daran würden sie länger denken als an seine Blamage, freute sich Gustav. Er steckte das Geld in seine Jackentasche, ließ alles andere auf dem Boden liegen und haute ab.
Wenn er zu spät kam, gab’s zu Hause immer eine Abreibung mit dem Gasschlauch. Jetzt war er schon eine halbe Stunde überfällig, trotzdem sagte sein Vater nur: »Setz dich hin und iß.« Nur noch zwei Tage, da war selbst Josef Berger gnädig.
Das brachte Gustav auf die Idee, die drei Stück Seife seinem Vater zu schenken, als Abschiedsgeschenk sozusagen.
»Wo hast du die denn geklaut?« fuhr er ihn an.
»Die hab ich gekauft«, log Gustav.
»Und von welchem Geld?«
Schon hatte Josef Berger das Ende des Gasschlauches in der Hand, packte seinen Sohn am Kragen und drosch ohne allzuviel Beherrschung auf ihn ein. Die Tränen konnte er sich nur verkneifen, weil er an etwas anderes dachte. An allem war nur Helga schuld. Hätte sie sich auf sein Geschäft eingelassen, wäre sein Abschied für alle in besserer Erinnerung geblieben.
8
Gegen das ärmliche Zimmer in der Dachauer Straße, das auch sechs Jahre nach Kriegsende noch immer wie eine Notunterkunft wirkte, war die Zweizimmerwohnung in Ramersdorf ein richtiges Zuhause mit weißen Wänden, einem Vorhang vor jedem Fenster, einer eigenen Küche und einem Badezimmer mit Dusche. In seiner neuen Umgebung erschien Gustav alles auf Anhieb irgendwie »richtig«: Er war nun in einer richtigen Familie, mit einer richtigen Mutter, einem Vater, der zwar nicht sein richtiger Vater war, dafür aber ging er einer richtigen Arbeit nach, und auch einen kleinen Bruder hatte er, der Peter hieß, Peter Karst, Karst wie sein Stiefvater – und wie seine Mutter. Die hieß jetzt gar nicht mehr wie er, was Gustav komisch vorkam. Es war ihm unangenehm, wenn er den neuen Lehrern vor der Klasse erklären mußte, warum er nicht Karst, sondern Berger hieß.
Er einigte sich mit seinem neuen Vater darauf, ihn »Onkel Werner« zu nennen, was ihm leichtfiel, weil er ihm tatsächlich wie ein Onkel vorkam. Der schimpfte nicht mal, wenn er überhaupt nicht zum Essen erschien.
Wenn seine Eltern ins Kino gingen, mußte er auf sein Brüderchen aufpassen. Bald hatte Gustav den Bogen raus, wie Peter zu behandeln war: Er verabreichte ihm ein paar Tropfen Cognac, und der Kleine wachte in den nächsten Stunden bestimmt nicht auf. Zeit genug, noch eine Runde um den Block zu drehen. Was interessierten ihn kleine Kinder. Er bestritt, selbst jemals klein gewesen zu sein.
Das Leben war jetzt ganz anders. Die Jacken paßten, und die Schuhe hatten richtige Sohlen. Brauchte er Schulbücher, Schreibhefte, Tinte, Bleistifte und Farbstifte zum Malen, mußte er nur Onkel Werner fragen. Sein richtiger Vater hatte für so was nie Geld rausgerückt. »Sag deinem Lehrer, daß wir uns diesen Luxus nicht leisten können!« Der hatte auch nicht verstanden, daß Kinder, um was zu lernen, unbedingt in die Schule müssen.
Genau Gustavs Ansicht, aber hingehen mußte er trotzdem.
Niemand sprach jetzt mehr über seinen Vater, Gustav vermißte ihn so wenig, wie er zuvor seine Mutter vermißt hatte. Für die Nachbarn war er jetzt der Sohn eines angesehenen Inspektors, und darunter stellten sich die Leute ein Kind vor, das Blockflöte lernt und darum kämpft, im Klassenzimmer in der ersten Reihe sitzen zu dürfen.
Seine Bühne war der Fußballplatz. Zuschauer, die staunten, was er alles konnte, gab es dort genug. Vor allem wollte er einem Mädchen imponieren, hinter dem, wie er mitbekommen hatte, alle her waren. Alles, was er bisher hatte haben wollen, hatte er entweder gestohlen oder sich sonstwie ergaunert. Aber wie bekam man ein Mädchen? Er hatte mit ihr einen Kußrekord aufgestellt, sieben Minuten lang, die anderen hatten die Zeit gestoppt. Irgendwie galten sie seitdem als Liebespaar, aber darunter hatte er sich immer mehr vorgestellt. Er dachte von morgens bis abends daran, wie er sie rumkriegen konnte, sie dort anfassen zu dürfen, wo sie einen Büstenhalter trug. Als er sie endlich soweit hatte, daß sie sich mit ihm treffen wollte, ohne andere Jungs und ohne daß sie ihre Freundinnen mitschleppte, zog sie mit ihren Eltern nach Pasing, ein Fußmarsch von drei Stunden, wie Onkel Werner behauptete. Wenn er sie dort besuchen würde, wußte sie, daß er in sie verliebt war. Das aber brauchte sie nicht zu wissen. Dann war er lieber nicht verliebt.
Lange aber hielt er es nicht aus. Dreimal mußte er unterwegs fragen, bis er die Straße gefunden hatte. Bisher hatte er sich immer herausreden können, wenn er vor ihrem Haus herumlungerte. Als er sie sah, steckte Gustav die Hände in die Hosentaschen. Gott sei Dank war sie allein.
Hannelore zog vor Verlegenheit an ihrem Pferdeschwanz. »Was machst du denn hier?«
»Ich? Nichts Besonderes!«
»Wohnst du jetzt auch hier?«
»Ich? Nein!« Er mußte einen Schritt machen, um einen Stein wegkicken zu können. Mit dieser Unterhaltung, das spürte er, würde er nie zu einem Kuß kommen. »Drehn wir ’ne Runde?«
»Ich hab jetzt einen neuen Freund«, teilte sie ihm mit.
»Mir doch egal«, antwortete er und war wütend darüber, daß er eifersüchtig war. Unter keinen Umständen durfte er ihr erzählen, daß er ihretwegen die Schule geschwänzt hatte, und, ohne zu bezahlen, mit der Straßenbahn gefahren und den Rest von zwei Stunden zu Fuß gelaufen war.
»Und sonst?« fragte Hannelore.
»Nichts«, erwiderte Gustav, »dann verschwinde ich eben wieder.«
Hannelore preßte die Schultasche an sich. »Tschüs!«
Seine Wut ließ er dann an einem Kaugummiautomaten an der Straßenbahnhaltestelle aus. »Das wird dir noch leid tun.« Auch was er zu sich selbst sagte, sagte er laut.
Am nächsten Tag wurde Deutschland in der Schweiz Fußballweltmeister. Die Geschichte mit Hannelore war damit vergessen.
9
Keine sechs Monate später zogen die Karsts von Ramersdorf nach Giesing. Direkt neben der Strafvollzugsanstalt Stadelheim hatte die Stadt zwei neue Wohnblocks errichtet, die ausschließlich den Gefängnisbediensteten und ihren Familien vorbehalten waren. Komfortable Dreizimmerwohnungen, deren Luxus darin bestand, daß jede Wohnung ein Badezimmer mit einer Badewanne hatte. Noch nie hatte Gustav im warmen Wasser einer Badewanne gelegen.
Werner Karst war hier der ranghöchste Beamte und genoß bei allen Nachbarn entsprechenden Respekt, und seine Frau wurde nur noch mit »Frau Inspektor« gegrüßt.
Vom Fenster seines Zimmers aus konnte Gustav auf das Gefängnis schauen. Viel war nicht zu sehen. Die kleinen vergitterten Fenster. Rundherum eine hohe Mauer. Und nachts die Scheinwerfer. Was sich hinter den Mauern abspielte, erfuhr er erst allmählich. Onkel Werner erzählte nicht viel.
»Wenn du dich nicht besserst, landest du auch einmal dort«, sagte Josef Berger, während Vera Karst Gustavs Geburtstagstorte anschnitt.
»Was muß man denn anstellen, um dort zu wohnen?« wollte Gustav wissen.
»Etwas Unrechtes«, antwortete Onkel Werner. »Da kommen alle hin, die etwas ausgefressen haben.«
»Holt einen dann die Polizei?« Gustav wußte nicht, welchen der drei Erwachsenen er anschauen sollte, also starrte er das Stück Torte an und schob dann den Teller weg.
»Das hast du nun von deinem Gerede«, schimpfte Frau Karst.
»Dem Kind angst machen!«
»Wär schön«, antwortete Josef Berger, »wenn er wenigstens vor irgend etwas Angst hätte.«
Gustav sagte nichts. Eine Heidenangst hatte er schon davor, daß sein Vater ihn zwingen könnte, mit ihm wieder draußen in seiner Natur rumzulatschen. Vorsorglich erzählte er ihm deshalb, daß er sonntags jetzt immer als Ministrant arbeite. »Zehn Pfennig für eine Messe, aber Hochzeiten und Beerdigungen werden extra bezahlt. Gut, nicht?«
»Und was machst du mit dem vielen Geld?«
»Weiß nicht!«
Die paar lumpigen Pfennige, dachte Gustav. Richtig verdiente er nur, wenn er an die Opferstöcke herankam. Wer schnell und geschickt genug war, konnte sogar Scheine rausangeln, ohne daß es einer mitbekam. Er hatte zwar schon ganz schön was versteckt, aber in seiner Blechbüchse war noch Platz.
Mit zwei Freunden beschloß er deshalb, das Kupferdach der Kirche, einem Behelfsbau neben der eigentlichen Hauptkirche, die noch immer nicht wieder aufgebaut war, abzuräumen. Es war nicht schwer, nach Einbruch der Dunkelheit hinaufzuklettern, die Nieten mit Zangen zu lösen und dann das aufgelegte Kupfer abzurollen. Ein besseres Versteck als die Kirchenruine hätte er nicht finden können. Ohne die geringste Angst betrat er am nächsten Morgen die Pfarrei, um sich zu erkundigen, wann er wieder gebraucht würde.
»Gustav, du kannst gleich wieder nach Hause gehen, hier waren Verbrecher am Werk.« Der Pfarrer zeigte ihm das abgedeckte Dach. »Und da es reinregnet«, fügte er hinzu, »fällt Sonntag die Messe aus.«
Im Regen tat ihm der Pfarrer leid. Seine heilige Ratlosigkeit bewies, daß die Täter unerkannt geblieben waren. Gustav stotterte ein paar bedauernde Worte und verdrückte sich.
Das Kupfer brachten sie eine Woche später zu einem Eisenhändler nach Ramersdorf, um es zu Bargeld zu machen. Leider hatte sich die Ungeheuerlichkeit, sich am Allerheiligsten zu vergreifen, inzwischen herumgesprochen, sogar die Zeitungen hatten darüber berichtet. Zum Schein ging der Schrotthändler auf den Kauf ein, aber Gustav spürte, daß etwas nicht stimmte und daß sie so schnell wie möglich abhauen mußten. Ihre heiße Ware ließen sie liegen.
Am nächsten Tag erschien der Schuldirektor in der Klasse. »Berger, Strohbach, Schweikert …«
Draußen wartete bereits die Polizei, und auch seine Mutter war schon da. An diesem Tag war für Gustav der Unterricht zu Ende, obwohl er alles abstritt. Den angedrohten Verweis konnte Werner Karst gerade noch abwenden, was Gustav ihm übelnahm.
Als er nach einer Woche Hausarrest wieder auf den Fußballplatz kam, redeten immer noch alle davon. Seine Frechheit wurde selbst seinen Freunden langsam unheimlich.
10
Wenn jemand eine Abreibung verdient hatte, dann Attinger-Günter, dieser Streber. Er wohnte im gleichen Haus einen Stock höher und ging in die gleiche Klasse. Er war es auch, der seiner Mutter regelmäßig die Beschwerdebriefe seiner Lehrer ablieferte. Wenn das keine Prügel verdient hatte.
Dem werd ich einen Denkzettel verpassen, nahm er sich vor, aber so, daß niemand sagen kann, ich sei schuld gewesen. Er hatte ja auch bestritten, das Kupferblech gestohlen zu haben. Er hatte sogar den Pfarrer soweit gebracht, ihm zu glauben.
Gustav wußte, daß Attinger-Günter ein Auge auf die Kubald-Siggi geworfen hatte, die auf dem Fußballplatz immer mit den Anführern herumstand. Als er zusammen mit ihm von der Schule nach Hause ging, fing Gustav damit an. »Wenn du nichts unternimmst, kriegst du sie nie. Die steht drauf, angemacht zu werden, weiß ich.«
Attinger-Günter schüttelte den Kopf. »Aber doch nicht von mir. Ich hab doch bei der nie eine Chance.«
»Quatsch, bei der hat jeder Chancen. Wenn du willst, helf ich dir.«
»Ehrlich?«
»Klar. Reiß einfach mal die Klappe auf, wenn wir rumstehn.«
»Was soll ich denn zu der sagen?«
»Der gar nichts, du Idiot. Du sollst auf mich losgehen. Morgen kommst du auf dem Schulhof rüber zu uns und sagst zu mir: ›Paß mal auf, du Angeber, deine Art geht mir nun schon allmählich dick auf die Nerven‹. In diesem Ton, kapiert? Und dann sagst du: ›Wenn du nicht aufhörst damit, hier immer alle herumzukommandieren, zeig ich dir mal, daß ich vor dir keine Angst habe.‹ Muß nur echt klingen.«
»Aber die wissen doch, daß ich gegen dich verliere.«
»Denen bleibt die Spucke weg, sag ich dir.«
»Die lachen mich doch aus!«
»Die hören gleich auf zu lachen, glaub mir. Ich sag dann: ›Du kannst ’ne Watschn kriegen, du Hosenscheißer!‹ Du sagst dann: ›Von dir nicht. Bisher hat sich ja nur noch keiner getraut, gegen dich zu sein.‹ Verstehst du, wie du dann dastehst? Genau darauf steht die Kubald-Siggi. Die ist auf alle starken Jungs scharf.«
»Und dann?« wollte Attinger-Günter wissen.
»Dann prügeln wir uns, und ich laß dich gewinnen.«
Endlich hatte Attinger-Günter verstanden und fieberte dem nächsten Morgen entgegen; und damit einer Abreibung, die sich gewaschen hatte. Gustav ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, seine Bestrafung genußvoll in die Länge zu ziehen, irgendwann mußte ja ein Lehrer auftauchen – dann konnte der dritte Akt seiner Inszenierung beginnen. Alle bestätigten, daß es diesmal nicht er gewesen war, der mit dem Streit begonnen hatte.
Seiner Mutter konnte Gustav allerdings nichts vormachen. Auch als er mit zehn Schulkameraden auftauchte, die alle hoch und heilig versicherten, daß er dieses Mal wirklich unschuldig war, schüttelte sie nur den Kopf. »Das kann doch nur einem wie dir einfallen!«
11
Das vorletzte Schuljahr war zu Ende, und mit dem Zeugnis, das bis auf Rechnen und Sport ungenügend war, kam auch ein Brief der Schulleitung. Gustav mußte die Schule verlassen. Selbst das Ansehen seines Stiefvaters hatte nichts mehr geholfen.
Drei Tage später holte sein Vater, sein richtiger Vater, ihn wieder ab. Seine alte Schule in der Gabelsbergerstraße hatte sich bereit erklärt, ihn für das letzte Schuljahr erneut aufzunehmen.
Zur Freude seiner alten Kumpels und zum Entsetzen der Nachbarn ließ Gustav nach seiner Rückkehr erst gar keine Hoffnung aufkommen, daß er sich gebessert haben könnte. Im Gegenteil, er war jetzt bald vierzehn, in vier Monaten jedenfalls, da war er sich andere Sachen schuldig, als Mitschülern das Pausenbrot zu klauen.
Er träumte davon, abzuhauen, irgendwohin, jedenfalls weit weg und für immer. Er brauchte nur noch einen, der mitmachte.
Gustav entschied sich für den sechzehnjährigen Probst-Hansi, mit dem er, ganz nach Plan, die letzten Tage nur deshalb den Unterricht geschwänzt hatte, um ihm mit einer ausgedachten Geschichte die nötige Angst einjagen zu können.
»Weißt du, daß die Polizei hinter uns her ist?«
»Die Polizei?«
»Weil wir die Schule geschwänzt haben. Bei mir zu Hause waren sie schon. Ich hab’s unten von der Treppe aus gehört, wie sie nach mir und nach dir gefragt haben! Nach dir auch.«
»Schöne Scheiße«, stöhnte Probst-Hansi. »Und jetzt? Was sollen wir jetzt machen?«
Gustav hatte ihn da, wo er ihn haben wollte. »Abhauen, bevor sie uns schnappen!«
»Und wann?«
»Jetzt gleich.«
Nach einer Schrecksekunde hatte der Gedanke nichts Verrücktes mehr an sich.
»Aber wir brauchen doch Geld?«
Auch daran hatte Gustav schon gedacht. »Zuerst besuchen wir eine Tante von mir, draußen am Wörthsee, und klauen der die Geldbörse. Das ist sowieso nicht meine richtige Tante, ich sag nur so.«
Die alte Frau schmierte ihnen Brote. »Und sag deinem Papa liebe Grüße«, rief sie Gustav nach, als er mit dem anderen Jungen wieder verschwand.
Probst-Hansi kriegte den Mund nicht mehr zu, als Gustav in die Tasche griff. »Jetzt können wir richtig abhauen.« Die Beute betrug einhundertzwanzig Mark.
Damit war auch Probst-Hansi von der Idee einer Reise um die Welt völlig überzeugt. »Wir lernen reiten«, beruhigte er sich, als ihm einfiel, wie hart sein Vater ihn bestrafen würde, sollte er jemals wieder heimkommen.
»Und jetzt kassieren wir deine Oma ab!« Probst-Hansi hatte ihm erzählt, daß ihr am Ammersee ein Kiosk gehörte. »Die hat doch auch Geld, oder?«
Probst-Hansi war nur deshalb einverstanden, weil er Gustav, der zuerst gestohlen hatte, etwas schuldig war. »Brechen wir lieber ein, dann brauch ich ihr keine Lügen zu erzählen.«
Nachts war es einfach, den Kiosk zu knacken. Sie nahmen nicht nur Geld aus der Kasse, insgesamt neunzig Mark, sondern auch belegte Brötchen, Schokolade, zwei Flaschen Sprudel, Gummibärchen und Zigaretten mit – und liefen zu einer Scheune, wo Gustav schon einmal mit seinem Vater übernachtet hatte.
In einem Gasthof in Inning am Ammersee war die Reise am nächsten Mittag zu Ende. Sie hatten gerade eine Portion Schweinebraten bestellt, als die Tür aufging und zwei Polizisten hereinkamen.
Sie wurden in das Feuerwehrhaus der Gemeinde gesperrt und abends von ihren Eltern abgeholt.
Gustav wunderte sich, was mit seinem Vater los war. Es gab weder Prügel, noch hielt er ihm eine Standpauke. »Geh ins Bett!« war alles, was er sagte, bevor er sich vor seine Staffelei stellte.
Der Schuldirektor betrachtete den Fall nüchtern und hatte dabei in Josef Berger, den er zu sich gebeten hatte, einen Zuhörer, der ihm nicht widersprach: »Der Junge treibt hier alle zur Verzweiflung.«
»Wem sagen Sie das.«
»Seine Lehrer getrauen sich kaum noch in die Klasse, weil sie Angst haben. Sogar Schläge soll er, wie mir berichtet wurde, einigen schon angedroht haben. Sie werden verstehen, Herr Berger, daß wir uns das nicht länger bieten lassen können, auch wegen der Auswirkungen, die das auf andere Schüler hat.«
Josef Berger nickte. »Wird er denn seinen Abschluß überhaupt schaffen?«
»Nun«, sagte Dr. Stein und blätterte in seinen Unterlagen, »komischerweise könnte er es eigentlich schaffen. Wie gesagt, vorausgesetzt, wir bringen die Geduld auf, ihn bis dahin zu ertragen.«
»Ich werde mir meinen Sohn einmal richtig vorknöpfen«, schlug Josef Berger vor, »und zwar, wenn Sie gestatten, gleich im Schulhof. Sollen ruhig alle sehen, daß es eine Grenze des Zumutbaren gibt.«
Dr. Stein war Pädagoge genug, den Vorschlag ausgezeichnet zu finden. Eine öffentliche Züchtigung würde Gustav vor aller Augen lächerlich machen. Dr. Stein sah darin allerdings nur den ersten Schritt. »Außerdem werde ich mich mit seinen Lehrern dahingehend verständigen, daß der Junge fortan unbeachtet bleibt, keine Hausaufgaben, keine Beteiligung am Unterricht mehr, und die Schulbank hinten an der Wand, von den anderen getrennt.«
»Wie Sie wollen, jedenfalls bedanke ich mich, daß Sie meinem Sohn die Chance lassen, den Schulabschluß zu machen.«
»Was will er denn eigentlich nach der Schule anfangen?«
»Wenn’s nach ihm geht, eine Lehre bei Mercedes. Autoschlosser.«
»Da herrscht aber großer Andrang. Soviel ich aus den Berufswünschen meiner Schüler ersehen kann«, Dr. Stein studierte den Inhalt einer anderen Akte, die er erst aus einer Schublade seines Schreibtisches holen mußte, »haben sich von einhundertfünfzig Schülern der achten Klassen bereits siebzig bei Mercedes beworben. Und vergessen Sie nicht die Jahrgänge der anderen Münchner Schulen. Und dabei bietet Mercedes, soweit ich informiert bin, überhaupt nur dreißig Lehrstellen an.«
In diesem Moment läutete die Schulglocke.
Sie gaben sich die Hand. »Es tut mir leid«, sagte Dr. Stein, »der Junge braucht viel Glück im Leben.«
»Das wird ihm jetzt nichts nützen!«
Vor den Augen der versammelten Schüler verabreichte Josef Berger seinem Sohn eine solche Tracht Prügel, daß dem noch vier Tage lang davon schlecht war. Alles tat ihm weh, aber mehr als alles schmerzte ihn etwas anderes: daß alle ihn ausgelacht hatten.
Einen Monat vor der Überreichung der Zeugnisse fanden die Prüfungen bei Mercedes statt. Die Schulleitung hatte jedem Schüler, der sich um eine Lehrstelle beworben hatte, einen Tag freigegeben. Er mußte einen Fragebogen ausfüllen, einen Reaktionstest über sich ergehen lassen und dann einen Eisenwürfel feilen, danach wurde er mit der Bemerkung, man würde der Schule das Ergebnis mitteilen, nach Hause geschickt.
Gustav wollte alles andere als Mechaniker werden, freute sich aber trotzdem, in einer so berühmten Firma vielleicht angestellt zu werden. Vor allem imponierte ihm, daß sie Rennwagen produzierten. Jedes Kind kannte Stuck und Carraciola und ihren »Silberpfeil«, das Auto, mit dem sie Geschwindigkeitsrekorde aufstellten. Er gab sich also einigermaßen Mühe mit seinem Eisenwürfel. Daß er den Reaktionstest bestanden hatte, bezweifelte er nicht den Bruchteil einer Sekunde.
Als die Prüfungsergebnisse vorlagen, herrschte im Lehrerkollegium Ratlosigkeit. Nur zwei Schüler der Abschlußklassen waren genommen worden, und darunter ausgerechnet Gustav Berger. Alle fühlten sich vor den Kopf gestoßen. Nur mit Widerwillen nahmen sie zur Kenntnis, daß jenseits der Mauern, die einen Schulhof begrenzen, eine Welt wartete, die offenbar ganz andere Begabungen verlangte.
12
Egal, ob er gerade bei seiner Mutter oder seinem Vater übernachtete, stand Gustav jeden Morgen um sieben Uhr auf, wusch sich, frühstückte und verließ das Haus, war es aber bereits nach zwei Wochen leid, immer in die gleiche Richtung zu laufen. Er genoß lieber die späten, noch warmen Tage des Sommers unten an der Isar oder die Gesellschaft anderer Jungs, deren Treffpunkt der Bahnhof war. Manchmal tauchte er auch gleich nach dem Frühstück bei Hasenbergl-Rolfi auf und haute sich dort wieder ins Bett; dessen Bude war praktisch sturmfrei, weil sein Vater tot und die Mutter berufstätig war.
Nach fünf Wochen schickte Mercedes die Kündigung.
Ecke Dachauer Straße war eine Tankstelle, die ihn als Lehrling anstellte. Endlich konnte er sich austoben, ohne gleich etwas anstellen zu müssen. Er brachte die Kunden zum Lachen, weil er mit der Energie eines Irrwischs um die Autos tanzte, Scheiben und Kotflügel polierte, Wasser auffüllte und so lange Luft in die Reifen pumpte, bis das Trinkgeld stimmte.
Gustav prahlte aber so laut herum, wieviel er nebenbei verdiente, bis einem der älteren Lehrlinge, der die Waschanlage bediente, auffiel, daß er dort, wohin er abkommandiert worden war, nie Trinkgeld sah. Er schaffte es, den Chef zu überreden, den Neuen dorthin abzuschieben.
Dem werd ich’s zeigen, dem Arschloch, nahm sich Gustav vor. Am Freitag wurde der Lohn ausgezahlt. Jeder nahm eine mit seinem Namen beschriftete Tüte in Empfang, ging duschen und stritt sich dann um den besten Platz vor dem Spiegel, um sich die richtige Frisur für das Wochenende zu verpassen.
Als die Entenfrisur endlich glänzte, suchte das Arschloch seine Lohntüte, suchte alles ab, durchwühlte Gustavs Klamotten, fand nichts und trat wütend gegen den Spind. Gustav hörte das Kuvert, das er selbst wohlweislich erst einmal hinter den Spind geworfen hatte, an dessen Rückseite herunterrutschen. Irgendwo auf halber Strecke blieb es stecken. Um den Verdacht des Diebstahls nicht auf sich sitzenzulassen, holte Gustav den Chef und kehrte, um seine Unschuld zu demonstrieren, alle seine Taschen nach außen.
»So, und jetzt zu dir«, sagte Gustav, nachdem er das Arschloch am Montagmorgen in die Waschanlage gelockt hatte, sprang ihn von unten an, hob ihn aus und schlug ihn gegen das Bürstengestänge. Von außen schloß er die Tür und drückte Vollwäsche.
Seinen Job war er damit los, hatte aber endlich das nötige Geld für ein Paar spitze schwarzlackierte Spangenschuhe, das schönste Paar Schuhe der Welt. Nach dem Einkauf gönnte er sich bei seiner Mutter ein heißes Bad, gab die fünfzehn Mark ab, die er jede Woche zum Lebensunterhalt beisteuern mußte, und war wieder verschwunden.
Für alles brauchte man Geld. Gustav konnte gar nicht soviel auf anständige Art verdienen, wie er plötzlich brauchte. Er klaute sich erst einmal das Nötigste zusammen: aus einem Amischlitten vor der McGraw-Kaserne eine Bomberjacke, in einem Kaufhaus am Stachus ein zweites Paar Schuhe, eines, mit dem man tanzen konnte, in einem Bekleidungshaus in der Bayerstraße einen Pepita-Anzug und dazu gleich noch vier weiße Hemden mit Rüschen entlang der Knopfleiste und an den Manschetten. Alles an Gustav glänzte.
Zu Beginn des Sommers vermittelte ihn das Arbeitsamt an die Firma Arnimsberger & Herb, die Weihwasserkessel, betende Hände, Kruzifixe und Madonnenköpfe herstellte. Nachdem er seinen Vater bei einem ersten Vorstellungsgespräch als Porträtmaler hingestellt hatte und sich selbst als dessen eifrigsten Schüler, landete er, wie er gehofft hatte, bei den Madonnen. Er mußte mit einem Stahlbolzen die vorgefertigten Linien stanzen, also die Form herausarbeiten, was ihn bald derart langweilte, daß er selbst künstlerisch tätig wurde – und ihnen der Reihe nach ein frivoles Lächeln oder einen fragwürdigen Augenaufschlag verpaßte. Bald hatte er die Produktion umgestellt auf Schmollmünder und Schlafzimmerblick oder, wenn ihm wegen einer Schlägerei morgens noch der Schädel brummte, auf schiefe Nasen und schielende Augen. Die ganze Herrlichkeit war beim Teufel. Und wieder stand er vor dem Rausschmiß, gelobte aber Besserung, da die Lehrstelle für ihn im Moment ein paar praktische Vorzüge hatte: In der Werkstatt war es warm und trocken, während es draußen seit Wochen in Strömen goß; dazu kam, daß er seinem Vater imponieren konnte: schließlich übte er jetzt einen künstlerischen Beruf aus, was es leichter machte, wieder bei ihm in der Dachauer Straße wohnen zu dürfen, und von dort war es ein Katzensprung bis zum Bahnhof. Dort hatte er inzwischen Mann-Helli kennengelernt, auch ein Rumtreiber, der klauen ging. Er half ihm, sein erstes Moped kurzzuschließen, eine »Expreß-Radetzky«, mit der Gustav gegenüber vom »Scharfen Eck« gleich in einem Drahtzaun seines alten Fußballplatzes landete und sich dabei fast das Genick brach.
»Das wird schon noch«, lachte Mann-Helli.
Danach verging kein Tag mehr, an dem Gustav sich nicht ein Moped oder Motorrad besorgte. Allmählich hatte er den Dreh raus: kurzschließen, Tank leerfahren, stehenlassen.
Im Bahnhofsviertel lernte er schnell auch alles andere. Wichtig war die nächste Sekunde, der erste Schlag, das schnelle Abhauen. Wer an einem Zigarettenautomaten vorbeiging, ohne ihn auszuräumen, konnte nicht bei Verstand sein. Wer den Mut nicht hatte, nachts in Geschäfte einzubrechen, wurde verachtet. Wer bei Prügeleien nicht wenigstens ein blaues Auge riskierte, galt als Feigling. Bei den Mädchen hatten Feiglinge keine Chance; um bei ihnen landen zu können, mußte man außerdem auch noch tanzen können. Wer das konnte, in den verliebten sie sich am ehesten. Dabei interessierte Gustav weniger ihre Liebe als ihre Beine und das dazwischen. Er war noch zu jung, um Bescheid zu wissen, aber schon alt genug, um darüber Witze zu reißen. Und abgesehen davon, daß Mädchen für ihn Nebensache waren, waren sie die Hauptsache.
Stundenlang trainierte er beim Hasenbergl-Rolfi. Der hatte alle Platten von Elvis Presley, Gene Vincent, Buddy Holly und Chuck Berry – und aufdrehen konnte er die Scheiben auch, weil die Bude ja sturmfrei war. Gustav hatte sich einen Gürtel geklaut, der was aushielt, band ihn an die Türklinke und lernte Rock ’n’ Roll tanzen, zwanzigmal ›Johnny B Goode‹, bis er es drauf hatte.
Für eine ordentliche Berufsausbildung war keine Zeit mehr, und sein Chef wurde mit dem Resultat seiner Arbeit immer unzufriedener, kein Wunder, denn Gustav war dazu übergegangen, die Madonnen im Zwölfvierteltakt zu stanzen.
Seinem Vater hatte er zum Geburtstag ein besonders frommes Exemplar geschenkt, als Zeichen seiner moralischen Genesung – und klaute zwei Tage später, zusammen mit einem Freund, den Safe der Firma, eine Stahlkassette, die sie erst einmal auf ein Ruinengrundstück schafften und dort vergruben.
»So macht man das!« erklärte er fachmännisch.
Gustav war klar, daß ihn die Firma am nächsten Morgen als ersten verdächtigen würde. Um sich zu stärken, aß er brav sein Frühstück auf, kämmte sich ausnahmsweise sogar seine Haare und verzichtete, obwohl er aufgeregt war, auf die Zigarette, mit der er sonst immer in der Firma auftauchte.
»Du glaubst doch nicht, daß du mit deinen Ausreden durchkommst«, drohte ihm sein Chef. »Erst hast du dort oben das Fenster eingeschlagen, dann die Schublade aufgebrochen und dann die Kassette an dich genommen.«
Genau so hatten es der Kerbel-Seppi und er gemacht. Aber auch die Polizei konnte den Sachverhalt nur zu Protokoll nehmen, denn nachzuweisen war dem Beschuldigten vorerst nichts. Es stand Aussage gegen Aussage.
»Sie werden doch dem Wort eines ehrlichen Mannes glauben! Ich brauche es doch nicht zu beweisen, wo ich es ganz genau weiß. Und du, Junge, solltest es besser zugeben! Mit einem reinen Gewissen wäre dir sicher wohler.«
Die Stimme seines Gewissens hatte Gustav nur geraten, sich nicht schnappen zu lassen.
Wenn sie nicht die Bahnhofsgegend unsicher machten, trafen sie sich in diesem Sommer an der Isar. Ihr Revier war das Ufer zwischen der Reichenbach- und Wittelsbacherbrücke, im Volksmund auch »Arbeiterriviera« genannt.
Sie hatten inzwischen auch einen Namen. Man nannte sie Halbstarke. Und oben auf der Brücke stand immer mindestens ein Polizeiwagen, um das Ufer beobachten und, sollte es zu Krawallen oder Schlägereien kommen, was täglich passierte, Verstärkung anfordern zu können. Sie fuhren in Mannschaftswagen vor. Langsam bewegten sie sich dann auf die Horde der immer mindestens siebzig Mann starken Bande zu, versuchten sie so geschickt auseinanderzutreiben, daß sie immer einzelne verhaften und abtransportieren konnten.
Die Zeitungen sprachen von skandalösen Zuständen. Der Polizeipräsident war gezwungen, eine Pressekonferenz einzuberufen, und versprach den Bürgern, unnachsichtig gegen die Jugendbanden vorzugehen und die Zahl der Einsätze seiner Beamten zu verdoppeln. Aber worum sollten die sich eigentlich kümmern? Sollten sie alle Jugendlichen einfach einsperren!
»Du da«, deutete einer der Polizisten auf Gustav. »Komm mal her, aber nicht so langsam.«
»Was gibt’s, Herr Wachtmeister?«
»Nichts, nur daß du auch mit aufs Revier kommst.«
»Der hat mir zwischen die Beine gefaßt und mir meine Uhr gestohlen«, heulte eines der Mädchen. »Mir auch«, sagte ihre Freundin.
»Spinnt ihr?« wehrte sich Gustav. »Ich hab doch nur Fußball gespielt und bin dann geschwommen, und dann hab ich gesehen, wie einige Jungs Schokolade unter den Leuten verteilt haben. Da hab ich dort drüben gelegen.« Gustav deutete auf eine Stelle weit entfernt.
»Na, jedenfalls hast du gute Augen, und jetzt, Freundchen, mitkommen!« Die Polizisten waren zu viert, und jeder von ihnen hatte einen am Arm gepackt. Unterwegs zum Präsidium fiel Gustav ein, daß abends im Löwenbräukeller Rock ’n’ Roll gespielt wurde.
Mitten in das Verhör platzte ein Polizist, der ihn am Morgen bereits im Büro bei Arnimsberger & Herb vernommen hatte. »Dauerkunde, was?«
»Ich bin unschuldig«, beteuerte Gustav.
»Klar doch, schon wieder unschuldig.«
»Völlig unschuldig«, bestätigte Gustav.
»Beruf?«
»Mal da, mal da.«
»Ausbildung?«
»Mal dies, mal das.«
Der Beamte hob seinen Kopf. »Mal klauen, mal stehlen.«
Gustav schaute auf die Uhr an der Wand. In drei Stunden traten Peter Kraus und Tommy Kent auf.
»Mach nur weiter so, mein Junge«, bedauerte ihn der Beamte, bevor er ihn laufen ließ, »dazu sind wir ja schließlich da, um Typen wie dich aus dem Verkehr zu ziehen.«
Draußen warteten die anderen drei. Sie rannten zum Stiglmaierplatz, um ja nichts zu verpassen. »Ladies und Gentlemen, ich möchte Ihnen jetzt einen Song bringen, der eine kleine, sehr vernünftige Geschichte erzählt: Awopbopaloobop alopbamboom. Tutti frutti. All rootie …«
Drei Stunden wackelte die Welt. Gustav zeigte, was er inzwischen in der Wohnung von Hasenbergl-Rolfi alles gelernt hatte, und hörte erst auf zu tanzen, als der Streit anfing. Ohne Prügelei war so ein Abend sowieso nur das halbe Vergnügen. Fast hätte er den Rekord geschafft, an einem einzigen Tag gleich dreimal bei der Polizei zu landen.
13
Sein Vater weckte ihn. »Aufstehen und anziehen!«
Gustav sah einen fremden Mann im Zimmer stehen. »He, Pap, was ist denn los?«
»Zieh dich an. Du kommst ins Erziehungsheim!«
»Erziehungsheim?« Er gähnte und rieb sich die Augen. »Aber warum denn?«
»Weil du deinem Vater nicht gehorchst«, mischte sich der Mann ein. An Josef Berger gewandt, sagte er: »Hier unterschreiben!«
»Mal langsam«, beschwerte sich Gustav, »was soll ich denn jetzt schon wieder angestellt haben?«
»Dort, wo du hinkommst, wirst du genügend Zeit haben, darüber nachzudenken.«
Es wäre Gustav glatt ein Päckchen Zigaretten wert gewesen, hätte er jetzt nur eine Minute mit seiner Mutter sprechen können. »Weiß die Mama das?«
»Du kannst ihr ja einen Brief schreiben.«
»Ich hab nichts getan«, versuchte Gustav dem Mann, der ihn zum Bahnhof brachte, klarzumachen. »Mein Vater hat überhaupt nicht das Recht, mich …«
»Das Heim wird dir guttun, mein Junge.«
»Ich bin fünfzehn und erwachsen«, protestierte er. Er dachte daran, sich loszureißen, sagte aber nur: »Wetten, Sie würden mich nie einholen, wenn ich jetzt abhauen würde?«
Er wollte es gerade versuchen, als er plötzlich wie angewurzelt stehenblieb. Sie hatten um die Ruine, in der er die Stahlkassette versteckt hatte, einen Bauzaun errichtet und fingen an, die noch stehenden Mauern niederzureißen.