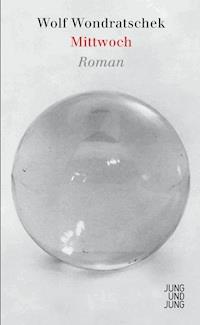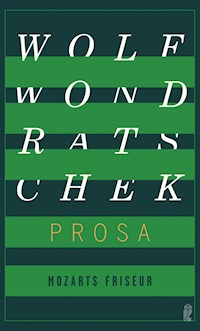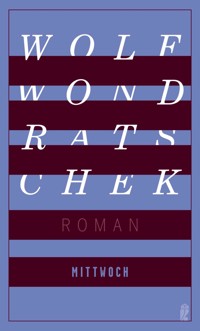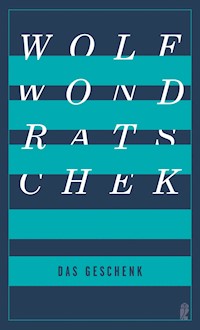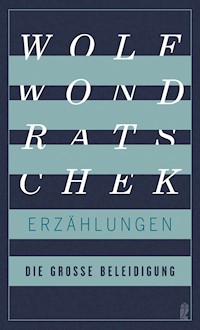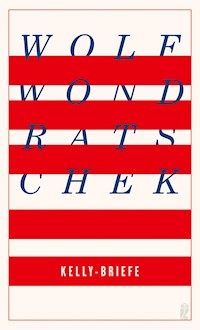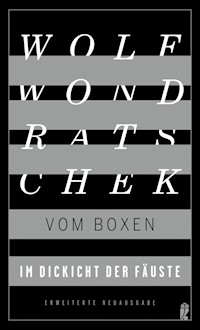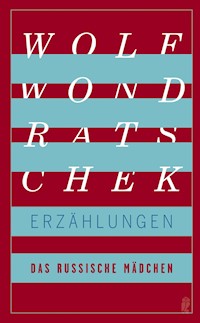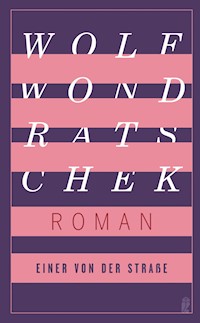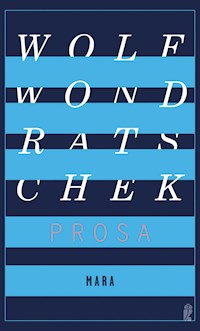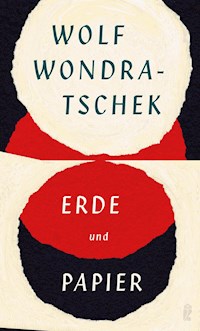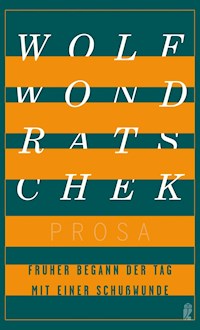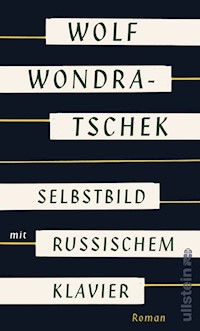14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Kunst ist kein Beruf, es ist die Art, wie man einen Beruf ausübt.« Wolf Wondratschek Wolf Wondratschek unterhält sich mit Nelson Algren über Simone de Beauvoir, sitzt bei Steffi Grafs erstem Wimbledon-Finale auf der Pressetribüne, trifft in Mexiko John Huston, lässt sich von kochendem Nudelwasser zu Gedanken zu Rossini inspirieren, verbringt in Paris einen Tag mit Veruschka, schreibt über den Ruhm und die ungeheure Einsamkeit Rainer Werner Fassbinders und darüber, wie Mozart seiner Frau gegenüber die Nerven verlor. Die weißen Jahre versammelt brillante Reportagen, die den Dichter als öffentlichen Redner und ungestört Staunenden zeigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die weißen Jahre
Der Autor
Wolf Wondratschek wuchs in Karlsruhe auf. Von 1962 bis 1967 studierte er Literaturwissenschaft, Philosophie und Soziologie an den Universitäten in Heidelberg, Göttingen und Frankfurt am Main. Seit 1967 lebte er als freier Schriftsteller zunächst in München. In den Jahren 1970 und 1971 lehrte er als Gastdozent an der University of Warwick, Ende der Achtzigerjahre unternahm er ausgedehnte Reisen unter anderem in die USA und nach Mexiko. Er lebt seit 1996 in Wien.
Das Buch
Wolf Wondratschek unterhält sich mit Nelson Algren über Simone de Beauvoir, sitzt bei Steffi Grafs erstem Wimbledonfinale auf der Pressetribüne, trifft in Mexiko John Huston, lässt sich von kochendem Nudelwasser zu Gedanken zu Rossini inspirieren, verbringt in Paris einen Tag mit Veruschka, schreibt über den Ruhm und die ungeheure Einsamkeit Rainer Werner Fassbinders und darüber, wie Mozart seiner Frau gegenüber die Nerven verlor.
Die weißen Jahre versammelt brillante Reportagen, die den Dichter als öffentlichen Redner und ungestört Staunenden zeigen.
Wolf Wondratschek
Die weißen Jahre
Reportagen und Stories
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© Wolf Wondratschek (2022)Neuausgabe der unter dem Titel Die weißen Jahre im Jahr 2005 erschienenen Textsammlung© dieser Ausgabe by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022Alle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: brian barth, berlinE-Book powered by pepyrus
ISBN 978-3-8437-2803-4
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
I
Ich habe einen Traum I
Ich habe einen Traum II
II
Meinen Sie München zum Beispiel?
Schwabing – Schreckbild einer Welt im tiefsten Frieden
Die Dachstube der toten Elefantenohren
Ich könnte mich verlieben, so still ist es
Affe beißt Banane blutig
III
Tortenschlacht mit tödlichem Ausgang. Elvis Presley
Das Duell. Mein Nachmittag in Wimbledon
Der Bauer von Babylon. Rainer W. Fassbinder
Der alte Mann und das Bier. Charles Bukowski
Ein Genie in Socken. Glenn Gould
5, avenue Marceau. Yves Saint Laurent
Lady Di revisited
IV
Für die Skroblin
Wie ich ausrastete. Wolfgang A. Mozart
Mozarts Friseur. Erich Joham
Eine Dame aus Milwaukee betritt das Hawelka
Mein Jahrhundertbuch. Orlando
Seerosen
V
Malcolm Lowry in Mexiko
Am Drehort. John Huston
Wo war Gorki?
Algren – wer?
VI
Blue Bayou
Miami Beach
Semproniano
Per favore
Tanzen
Bar
VII
Vibrato und Wodka oder: I shall not conduct Chopin
Ebbe und Flut – oder Nudelwasser? Rede zu Rossini
Rede zur Laienmusik
Kleine Rede an die Herren in den Flugzeugen
Rede für Werner Schroeter
Ich bin Veruschka
Ein paar Anmerkungen
Anhang
Anmerkungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
I
Widmung
»Er kannte die Wahrheit und suchte nach etwas Besserem.«
William Saroyan
Der Autor mit John Huston bei den Dreharbeiten zu »Under the Volcano« (Cuernavaca 1983)
I
Mir träumte von einem blendend aufgelegten, herzerfrischend unterhaltsamen, immer eine Blume, eine selbstgepflückte Blume im Knopfloch tragenden und einem auch sonst immerzu originellen, großzügigen Verleger.
Ich habe einen Traum I
Mir träumte von einem blendend aufgelegten, herzerfrischend unterhaltsamen, immer eine Blume, eine selbstgepflückte Blume im Knopfloch tragenden und einem auch sonst immerzu originellen, großzügigen Verleger.
Er führte mich zum Essen aus. Dabei leerten wir zwei Flaschen vom besten Burgunder. Dann orderte er noch eine und hob mit einem Schein, den er dem Kellner zusteckte, die Sperrstunde auf. Er tat das alles mit der Ruhe und Sorgfalt eines höflichen Menschen und dem Gefühl, ganz nach seinen Wünschen gehandelt und trotzdem etwas in der Welt in Ordnung gebracht zu haben.
Er erwähnte mit keinem Wort sein Sodbrennen, wie ich das im Wachzustand von jedem zweiten meiner Verleger gewohnt war, das und Schlimmeres, jammerte nicht über Buchhändler und den Rest der Menschheit, lehnte sich statt dessen zufrieden zurück, im Mund inzwischen eine Zigarre, und nickte.
Das war das Zeichen. Ich holte, wie versprochen, aus meiner Jackentasche ein Blatt Papier, entfaltete es und las, was ich geschrieben hatte, vor. Ein Gedicht! Die Sache war, naturgemäß, in weniger als zwei Minuten erledigt. Ich wartete auf seine Reaktion.
Normalerweise wacht man spätestens jetzt abrupt auf. Aus irgendeinem Grund jedoch schlief und träumte ich noch eine Weile weiter.
Er saß da und schüttelte lange und langsam den Kopf, was nicht weiter beunruhigend war, denn ich sah seine Augen! Sie strahlten, was ihn augenblicklich um Jahre verjüngte. Und mich gleich mit! Sein Blick war unwiderstehlich, eine Flamme, die sich auf einer Stahlklinge spiegelt, aber voller Farbe und Freude. Es war reine Nervensache, mir die eigene Freude nicht zu sehr anmerken zu lassen, was mir, glaube ich, ganz gut gelang.
Dann, nachdem er mich am Handgelenk gepackt hatte, nahm der Traum wieder Tempo auf. Er erhob sich, nein, so muß er als junger Mann aufgesprungen sein, als – wie man sich erzählt – der berühmte Autor X ihm, einem Anfänger, einem damals völlig unbekannten Verleger, im gleichen Restaurant angeboten hatte, sein Autor zu werden. Er umarmte mich, drückte mich und verfluchte, erleichtert aufatmend, allen Schund, der ihn erzürnte, diese Tonnen von literarischem Schund überall, diese Schiffsladungen von Scheiße in allen Verlagen, allen Buchhandlungen, allen Regalen. In bester Laune verfluchte er sein Schicksal, jeden Tag neuen Schund auch auf seinem Schreibtisch vorzufinden. Der Fehler so vieler Schriftsteller sei es, sagte er, nicht alles zu wollen, das aber mit zu vielen Worten. Er hob sein Glas und versicherte mir ohne jede peinliche Feierlichkeit, aber mit der Erleichterung eines Erlösten, er werde meine Verse »der Welt vor die Füße werfen«.
Denn wer bei seinem Tod einen schönen Vers hinterläßt, hat Himmel und Erde bereichert, zitierte ich Fernando Pessoa, einen portugiesischen Dichter, hob ebenfalls mein Glas und verzichtete erst einmal darauf, ihm Einzelheiten entlocken zu wollen. Wie stellte er sich die praktische Durchführung einer solchen Heldentat vor? Waren es nur Worte, wieder nur Worte, nichts als Worte? Und welchen Anteil mochte der Burgunder haben an dieser majestätisch donnernden Kriegserklärung, deren Kraft von ihm auf mich überströmte? Er gratulierte mir, erbat sich das Gedicht, las es noch einmal, faltete das Blatt auf die Größe eines Führerscheins zusammen und steckte es in seine Brieftasche. Es müsse, sagte er und schüttete Wein nach, das Glück eines Gedichts, seine Klarheit und sein Geheimnis ausreichen, die Moden müßiger Zerstreuung, des Selbstbetrugs und der Lügen zu zerstäuben. Ein Gedicht, golden wie der Glanz des Sonnenlichts auf dem Haar eines Mädchens, gefährlich wie die Ufer schwarzer Flüsse.
Ich war einverstanden. An nichts anderes hatte ich immer geglaubt.
Bis zu diesem ungemein geselligen Abend mit dem Verleger war ich, was meine Sicht dieser Dinge anging, so gut wie allein auf der Welt. Ich erinnere mich an die eine oder andere Geliebte, das schon, die mir an die Ufer schwarzer Flüsse gefolgt war, zur Not auch ohne schwimmen zu können. Es gab andere, die ich, nicht nur nachts, davon überzeugen konnte, das Unmögliche für möglich zu halten. Immer habe ich an die Literatur als etwas geglaubt, »was wild ist wie der Wind, heiß wie Feuer, schnell wie der Blitz; etwas Herumirrendes, Unberechenbares, Jähes« – wobei mir, liebe Miss Woolf, die Formulierung »schnell wie der Blitz« mißfällt. Die Schnelligkeit, mit der ein Raubtier auf Beute reagiert, wie wär’s damit? Nicht der Blitz ist Literatur, sondern seine Ankündigung, die Unruhe am Himmel und, fern oder nah, ein rollendes Donnern; es ist das Warten auf ihn, wie alles Warten ist, auch das Schreiben.
Und nun das: Mit mir am Tisch saß nicht eine von mir angebetete, zu den schönsten und schändlichsten Schmeicheleien fähige Freundin, sondern ein Genießer, ein Fachmann, ein Verleger, ein Traum von einem Verleger, bereit, meine Begeisterung eher noch zu überbieten. Kein Zweifel, ich war glücklich.
Wie auch nicht! Endlich ein Verleger, der davon absah, mir Erörterungen über den aktuellen Marktwert literarischer Erzeugnisse aufzudrängen, meinen Optimismus zu tadeln, meine finanziellen Ansprüche zurückzuweisen wie auch alle anderen Ansprüche: die an seine kostbare Zeit, seine endliche Geduld, seine Bereitschaft, mich besser zu verstehen, als er sich das sonst in Gegenwart eines Autors herauszunehmen je getrauen würde. Mit welchem Genuß er den Rauch seiner Zigarre am hinteren Gaumen nachbrennen ließ. Im Moment war, kein Zweifel, auch er glücklich und überfordert nur von einer Sache: der Vorstellung, morgen – das heißt in wenigen Stunden – wieder ins Büro zu müssen, zurück zu Zahlen, zu Mißverständnissen, seinem Sodbrennen und einer eines Tages gewiß tödlichen Erschöpfung.
Denn damit ging alles wieder von vorne los. Autoren wollen verhätschelt, Manuskripte abgelehnt, Rechnungen bezahlt, Kämpfe gekämpft werden. Es klingeln wieder die Telefone. Sekretärinnen melden sich schwanger. Von einer Schlamperei zur nächsten, so geht es dahin. Wieder war es ihm nicht gelungen, wenigstens ein halbes Dutzend der schlimmsten Kritiker vom Erdboden einfach verschwinden zu lassen. Die Dummheiten nahmen so wenig ein Ende wie die Ungerechtigkeiten, auch nach Feierabend nicht. Er war zurückgekehrt ins Zentrum des großen Radaus. Dabei sehnt er sich nach nichts so sehr wie nach Stille; er träumt von ihr wie von einer aus Armut, Lehm und Vogelstimmen zubereiteten Speise. Vormittags zwischen zehn und zwölf, gleich nach Durchsicht der Post und dem ersten Kaffee, hat er als inzwischen international erfolgreicher Geschäftsmann dann allerdings die Pflicht, von nichts als von Büchern zu träumen, von jenem einen, das gegen die Erwartung aller ein Verkaufserfolg wird und, mit noch mehr Freude, von dem Wunder der Konzentration, mit der ein jeder ebendieses (natürlich von ihm entdeckte und verlegte) Buch wird lesen wollen.
Er war heimgekehrt zu den Hundertschaften seiner toten und lebenden Autoren. Die toten liebte er, die lebenden waren die Hölle. Genies, die keine sind, sind lästig. Sie sind unfähig, sich den Terminkalender eines Verlegers, auch nur die Arbeit eines Tages vorzustellen, und belästigen ihn, drohend fast, mit der Bitte um ein Gespräch, einen Spaziergang, ein Abendessen. Sie fühlen sich bei Preisvergaben übergangen, insgesamt verkannt, auch von ihm. Auf der einen Leitung verhandelt der Verleger um eine Lizenz, auf der anderen versucht er halbherzig, einen seiner Autoren vom Selbstmord abzuraten. Er kommt nicht umhin, die Zeiten zu beneiden, als es weder Telefone noch Verleger gab – und die Dichter die meiste Zeit etwas Besseres zu tun hatten, als zu dichten. Minnedienst war anstrengend und, wenn man Pech hatte, zeitraubend. Und wie schnell so ein Leben um war. Viel Zeit für ein Alterswerk war da nicht.
Natürlich, das ist leider unumgänglich, ist der Verleger für seine Autoren da. Aber die wesentlichen Dinge, die einen Autor beschäftigen, als da wären: Einsamkeit, Verzweiflung, Selbstzweifel, Schaffenskrisen (oder umgekehrt: Anfälle überheblicher Euphorie), Geldnöte, sind nicht dazu angetan, sich auf das Zusammentreffen mit ihnen zu freuen. Wie satt er sie hat, diese Gemeinplätze jeder kreativen Existenz.
Meine Sorgenkinder, diese Dummköpfe, die alle Handfestes im Handgelenk hätten, die einen Tisch zimmern, ein Boot reparieren, ein Pferd beschlagen könnten, die Kinder großziehen und ihnen, wenn sie alt genug sind, behilflich sein könnten, gefahrlos einen Fluß zu überqueren, mit Freude ein Feuer zu machen und Fische darüber zu braten, die sie mit Kartenkunststücken oder zum Wachbleiben mit einer Gespenstergeschichte unterhalten könnten; sie könnten öfters ihre alte Mutter besuchen, einen Fremden umarmen oder, meine Güte, einfach mal die Füße hochlegen, mißachten aber all diese Dinge und decken statt dessen mich und alle Welt mit Manuskripten ein. Und glauben Sie, sie hörten zu, wenn man ihnen rät: schreiben Sie möglichst wenig, tun Sie alles, was Sie wollen, nur schreiben Sie so wenig, wie es irgend geht? Ich weiß nicht, um was für eine Krankheit es sich handelt, aber sie sind krank! Was da auf Halde liegt an Ausgedachtem! Postsäcke voller Papier. Als wäre ich der Direktor eines Museums für Erfolge!
Er wäre, das fühlte ich, zu rücksichtsloser, sogar physischer Brutalität fähig, bat aber statt dessen den Kellner, mit dem Käsewagen zu kommen. Sein Gesichtsausdruck verriet das Vergnügen, das er gleich haben würde, vermischt mit der Verwirrung, wie leicht es ihm fiel, das seinem Hausarzt (und hoch und heilig auch seiner Frau) gegebene Versprechen zu brechen, die Regeln einer fettfreien Diät einzuhalten, aber wie gut ihm diese Gleichgültigkeit gerade gefiel. War Gehorsam die Gegenleis-tung dafür, geliebt zu werden? Und seine Ehe, war sie nicht viel mehr durch ganz andere Enthaltsamkeiten gefährdet? Welches Gewicht hatte sie noch? Wieviel Körpergewicht? Wann war ihm das letzte Mal beim Betrachten seiner Frau nach einem Luftsprung zumute? Beim Betrachten irgendeiner Frau?
Er kennt die Stimmung, alles hinschmeißen zu wollen, auch aus seinem Privatleben, aber wenigstens die Wände anbrüllen kann er dann, wenn ihm danach ist.
Aber erst einmal genoß er die Freude, unter all den hochklassigen Käsesorten das Prachtexemplar eines Romero zu entdecken, für den er sich dann auch entschied, einen spanischen Schafsmilchkäse im Rosmarinmantel, eine Köstlichkeit.
Ein Schrei, dachte er danach weiter, wäre auch im Büro die halbe Miete, ein Schrei, ein scharf gewürztes, giftiges Gemisch aus Wut und Verzweiflung, der in manch anderem Zimmerchen seines Verlagshauses ganz sicher auf Zustimmung stoßen würde; und eigentlich sollte man gleich auch die Autoren, diese wahren Virtuosen der Verzweiflung, dazubitten. Was für ein Gedränge das wäre, was für ein Schreien! Jeder schreit, wie ihm ums Herz ist, die einen, um nicht völlig den Verstand zu verlieren, andere, weil sie die Stille fürchten, die danach eintreten könnte. Was dem Mund bitter ist, dröhnt aus dem Bauch, den Därmen. Es beben die Körper und mit ihnen das ganze vierstöckige Gebäude. Die Arbeit ruht. Niemand reagiert mehr auf Anrufe. Kein Mausklick, keine digitalen Konferenzen, keine Neuigkeiten. Der Markt nimmt, unbeachtet von der Ordensschar der Angestellten, seinen Lauf. Was soll’s, die Stubenhocker tanzen jetzt, der Mensch, das kleinste Teilchen der Maschine, glüht. Was für ein Licht! Nicht mehr reden, sich ausdrücken, sich erklären müssen! Nicht mehr denken, rechnen, urteilen müssen. Nicht mehr Bücher, die man nicht liebt, loben müssen. Nichts mehr verkaufen müssen. Nie mehr wie immer leben müssen.
Ich schlief, trotz des Lärms, immer noch; was nicht heißt, daß ich nicht zuhörte. Was anfangs aufgrund so vieler ungleicher Temperamente rauh und roh geklungen hatte, veränderte und beruhigte sich allmählich. Was ein Kampf, ein Wettkampf gewesen war, ein streitlustiges Durcheinander feuriger, klagender, drohender, dunkler und heller und, warum es verschweigen, kleiner spitzer, unanständig schamloser Schreie, als wären die Betreffenden, vor allem die jungen, sonst immer unauffälligen Damen, Opfer einer Teufelsaustreibung, klang bald wie ein einziges trauriges, lang anhaltendes Lamento, fast wie ein Lied, mit einer richtigen kleinen Melodie. Die ersten begannen, aus Gründen nachlassender Kondition, zu weinen, leise, ein wehmütiges Weinen, wie das Weinen von Kindern, die an die Nacht glauben, die Sterne, das Zauberwort. Einst bin ich ein Knabe, ich bin ein Mädchen gewesen, Busch und Vogel und Fisch …
Speziell seinen Südamerikanern, diesen ganz besonderen Burschen unter seinen Autoren, hätte vermutlich gefallen, was da treppauf, treppab bis hinein in jedes der Büros zu hören war; sie kannten das, seit sie auf der Welt waren, aus Erzählungen, die man in ihrer Heimat von jedem, der Hunger hatte, für eine Handvoll Mais zu hö-ren bekommen konnte. Manchmal entstieg so einer ei-nem Flugzeug und erzählte einem noch im Auto auf dem Weg ins Hotel, daß die Welt kleiner sei als der Raum in einer Hütte, mit dem heitersten Gesichtsausdruck! Der bittet dich nicht um Kopfschmerztabletten, sondern schleppt dich in die Hotelbar, und nach dem Essen in noch eine Bar. Unterwegs hat er dir seine Uhr geschenkt, ein richtig schweres, teures Stück, und das nur, weil du sie bewundert hast; und seine seidene Krawatte. Unmöglich, sie nicht zu mögen und am Ende nicht glauben zu wollen, daß der Schnabel eines Vogels genügt, um ein Glockengeläut in Gang zu setzen. Und Frauen mit von Schreien geschwollenen Mündern hat er auf Beerdigungen genug erlebt. Es wird, wo er herkommt, geboren und gestorben, das Leben wäre nicht auszuhalten sonst. Geburt und Tod, und daß danach nichts vorbei ist. Die Toten, wie jedes Kind es weiß, steigen nur der Hitze wegen tagsüber in ihre Gräber, mischen sich aber nach Einbruch der Dunkelheit wieder unter die Lebenden. Es gehört das Unglaubliche zur kollektiven Erinnerung, zum Reich des Geisterglaubens und der Heilkunde, ist Reinigung der Galle, Beschwörung guter und Austreibung böser Geister. Es läßt, wenn es gelingt, zufriedene Herzen zurück.
Nun fielen auch wir, ich und mein Verleger, zufriedenen Herzens der Müdigkeit anheim. Niemand außer uns war noch da. Und auch uns würde es bald nicht mehr geben; selbst in den Spiegeln schwand unser Bild.
Es sei besser, teilte er mir mit, bereits vereinbarte Abendessen zu verschieben, eventuelle Spaziergänge ganz zu streichen und die Gespräche, alle Gespräche, telefonisch zu erledigen, wobei es am besten war, eigentlich immer schon aus der Tür zu sein, wenn einer anrief. Wie ich ihn! Wie mich das zur Weißglut bringen kann, eine ahnungslose Sekretärin am Apparat, die verspricht, mich durchzustellen, mich, wie erst gestern wieder, warten läßt, um mich dann anzulügen. Im Hintergrund die Stimme des Verlegers. Ein Schriftsteller soll schreiben, nicht reden. Er soll liefern, nicht leiden. Reisen soll er und beten, die Natur erkennen, das eigene Verschwinden darin. Vor allem soll er, hörte ich ihn schreien, zu der Einsicht fähig sein, sein gutes Recht relativieren zu können.
Sind Autoren aber nicht! Was an Phantasie noch nicht aufgebraucht ist bei ihrer eigentlichen, ihrer künstlerischen Arbeit, nutzen sie, um Verleger zu quälen – und, was ihre nächtlichen Anrufe betrifft, deren Gattinnen gleich mit. Es kommt zu einer massiven Zusammenballung verblasener Forderungen, undurchführbarer Vorschläge, Illusionen – und irgendwann zur Detonation der Enttäuschung. Die Logik der Ökonomie ist das eine, die kostbare Kraft eines Adjektivs (das zu finden schon einen Mann vom Kaliber eines Flaubert Wochen kostete!) das ganz und gar andere.
Es war meiner Stimmung nicht zuträglich, aus meinem Traum erwachen zu müssen. »Ich werde diese Verse der Welt vor die Füße werfen!« Nicht einmal ein Echo war übriggeblieben. Ich taumelte ins Badezimmer, gurgelte mit Salz, spülte nach mit dem Rest, der noch in einem der zwei Weingläser war – zwei? Warum zwei? Wer war es, mit dem ich gebechert hatte?
(2006)
Ich habe einen Traum II
Als Junge verbrachte ich viele Nachmittage nicht auf der Straße, sondern im Keller der elterlichen Wohnung, saß da alleine, auf Bergen von Kartoffeln, und rezitierte Gedichte. Das machte mich glücklich – Poesie und ein Ort, wo mich niemand hörte und störte.
Kurz vor dem Abitur wurden wir Schüler nach unseren Berufswünschen gefragt. Einige wollten Architekten werden, andere Ärzte oder Juristen. Mir dagegen erschien ein Traumbild viel naheliegender zu sein als irgendein realistischer Vorschlag. Als ich an der Reihe war, sagte ich zum Erstaunen des Lehrers und zum Amüsement meiner Mitschüler, daß mein Berufswunsch folgender sei: Ob mit oder ohne Abitur, ich möchte Vorleser werden, Vorleser bei einer blinden russischen Großfürstin.
Genau so hatte ich das damals formuliert, und natürlich hat sich dieser Wunsch nicht im wörtlichen Sinne erfüllt. Doch ich bin meinem Traum treu geblieben. Ich übe ihn aus, bis heute, denn er enthält alle Ingredienzen, die mir etwas bedeuten. Insofern hat sich die Wahrheit dieses Traums über meine Zukunft gelegt. Er ist zur Folie meines Lebens als Schriftsteller geworden.
Mir gefällt die Vorstellung zu verschwinden. Ich möchte ein Niemand sein, mit einem Reichtum an Ruhe und Zeit. Und wenn es möglich ist, will ich nicht mit Geld in Berührung kommen. Ich halte Geld für das größte Übel. In meinem Traum kommt Geld nicht vor.
Die russische Großfürstin bezahlt mich in Naturalien. Ich darf im Westflügel ihrer Villa wohnen. Es wird für mich gekocht. Ich habe Zugang zu den großfürstlichen Kellereien. Auch alle anderen Wünsche werden erfüllt, soweit sie bescheiden sind. Etwa Zigaretten.
Der Traum handelt von einem Tauschgeschäft. Meine Gegenleistung besteht darin, daß die Fürstin mich, wann immer sie es wünscht, zu sich rufen darf und ich ihr vorlese. Sie sitzt in ihrem Sessel, nimmt Tee oder Schokolade zu sich und läßt sich von mir in das unendliche Reich der Weltliteratur entführen. Ich lese ihr Proust vor, Shakespeare, Dantes ›Göttliche Komödie‹ oder die Bibel. Ich lese für sie Joyce, Virginia Woolf, Joseph Conrad, Lion Feuchtwanger, Nabokov – Schriftsteller, die mir ohnehin wichtig sind. Nach drei oder vier Stunden wird sie langsam müde und schläft ein, und meine tägliche Pflicht ist getan. Ich empfinde es als wohltuend, daß die Fürstin blind ist und ich unsichtbar für sie bin. Sie kennt nur meine Stimme. Sie schätzt meine Stimme, und es gibt keine Vorschriften, wie ich auszusehen habe.
Dieser Job, der darin besteht, einer älteren Dame vergnügliche Stunden zu bereiten, ist aber noch nicht alles. Im Zentrum meines Traums steht die Frage: Was tue ich mit der restlichen Zeit – wenn ich nicht vorlese, schlafe, im Garten spazierengehe oder Musik höre? Die Antwort ist einfach, und so habe ich ja auch immer gelebt: Ich schreibe. Ich habe das große Privileg, mich meiner Arbeit widmen zu können, und ich bin nicht einmal darauf angewiesen zu publizieren. Das ist der entscheidende Vorteil: Man gibt sich ganz einer Sache hin und ist befreit von der Überlegung, wie man das zu Geld machen kann. Ich muß keinen Lärm produzieren, um Aufmerksamkeit zu erregen; ich muß weder Lügen erzählen noch jemand bestechen, um vorwärtszukommen. Das ist ein idealer Zustand, also wahrhaftig ein Traum. Und da ich nichts veröffentlichen muß, um leben zu können, wäre – ähnlich einer Idee von Flaubert – mein Debüt am Ende meines Lebens zugleich meine Gesamtausgabe. Zwei, drei, vier Bücher, ich hätte damit alles gesagt.
Ein weiterer Vorteil meines Traums besteht darin, möglichst wenig mit den Anforderungen der Gegenwart zu tun haben zu müssen. Die Gegenwart soll mich gefälligst in Ruhe lassen. Die hat sich nicht einzumischen in mein Leben. Ich brauche zum Beispiel die Kritiker nicht und brauche kein Feuilleton und auch keinen Gedankenaustausch mit anderen Schriftstellern. Ich könnte mich ja mit unserem Gärtner unterhalten oder einem Dienstmädchen.
Ich stelle mir vor, eines der Dienstmädchen hieße Nora. Sie ist keine literarisch oder intellektuell ambitionierte Person, die sich in höhere Regionen verirrt. Nora ist von einer tieferen Weisheit geprägt; von der Weisheit, nur die zu sein, die sie ist. Im übrigen würde ich ohnehin den Austausch von Gefühlen und Körpersäften dem Austausch intellektueller Ideen vorziehen, und auch in diesem Zusammenhang wäre es ein Vorteil, daß meine Chefin blind ist. Es wäre nicht einmal schlecht, wenn sie auch noch zu Schwerhörigkeit neigen würde.
Die Qualität meines zugegebenermaßen sehr exklusiven Traums basiert auch darauf, daß sich unter seinem Federkleid zahllose kleinere Träume verstecken, je nachdem wie man sich die Kulisse ausmalt. Man soll ja nicht kleinlich träumen. Man soll schon ins Offene hineinträumen. Es erscheint mir allerdings sehr wichtig, daß dieses erträumte Leben keineswegs ein paradiesisches ist, eine risikolose Existenz. Schreiben ist harte Arbeit. Die Großfürstin ist eine ältere Dame, die in absehbarer Zeit sterben oder mir aus einer Laune heraus die Stellung kündigen könnte. Oder sie kann plötzlich wieder sehen und braucht meine Dienste nicht mehr. Ich will meine nahezu perfekten Arbeitsbedingungen nicht bis in alle Ewigkeit verteidigen.
Vielmehr ist dieser Traum ein Bild vom radikalen Leben eines Schriftstellers, der zurückgezogen, aber in komfortablem Ambiente lebt und darüber hinaus sogar gezwungen ist, sich mit Literatur zu beschäftigen. Ich denke, manchmal sind Anteile von Zwang hilfreich und notwendig, um ins Wesentliche vorzudringen. Es ist so, als hätte man einen Coach in seiner Ecke, der einem sagt: Müde? Du hast nicht müde zu sein! Du boxt noch fünf Runden, dann kannst du müde sein. Und das gilt nicht nur für das Boxen, sondern auch für das Schreiben. Man muß trainieren – man muß lesen und schreiben.
Naiv wäre es, zu glauben, man müsse selbst tolle Geschichten erleben und könne sie dann einfach aufschreiben. Literatur kommt nicht aus dem Leben. Literatur entsteht aus Literatur. Finde also erst mal heraus, was Schreiben ist! Finde die Abenteuer deiner Kunst heraus!
Denn man erlebt ohnehin unentwegt etwas. Wir erleben viel zuviel. Schon ein Eremit hat unendlich viel zu tun, seine Erlebnisse zu verarbeiten. Und man denkt: Da passiert nichts, aber es passiert sehr viel. Ich behaupte, daß in der Stille eines Zimmers mehr passieren kann als in einer Bar in New York, ob mit oder ohne DJs. Aber man braucht natürlich lange – in meinem Fall 57 Jahre –, um das herauszufinden. Und noch immer hab ich es nicht ganz kapiert, weil ich eben dann doch wieder denke: Draußen tobt das Leben, und hier ist alles still und tot. Das Gegenteil ist wahr. Die Stille, die ich mir für meinen Traum ausgesucht habe, ist alles andere als ein Stillstand. Sie ist Ausdruck eines intensiven Lebens, und Intensität ist immer mit der Fähigkeit verknüpft, allein sein zu können. Deshalb habe ich in meinem Traum keine Familie. Ich bin nur meiner blinden russischen Großfürstin verpflichtet – und mir.
(2001)
II
Ahnungslos gegenüber der Kunst, hält sich der echte Münchner – in seiner populären Form als Sehenswürdigkeit – selbst für ein Kunstwerk.
Meinen Sie München zum Beispiel?
»Sie wollten leben wie bisher, breit, laut, in ihrem schönen Land, mit einem bißchen Kunst, einem bißchen Musik, mit Fleisch und Bier und Weibern und oft ein Fest und am Sonntag eine Rauferei. Sie waren zufrieden, wie es war. Die Zugereisten sollten sie in Ruhe lassen, die Schlawiner, die Saupreußen, die Affen, die geselchten.«
Darf ich mich vorstellen? Affe mein Name, zugereist, wenn auch in München nun bereits seit zwei Jahrzehnten ansässig. Zugegeben, es ist ein schönes Land, dieses Bayern. Da läßt es sich leben. Aber, ein bißchen Kunst? Ein bißchen Kunst ist keine! Ein bißchen Musik klingt nach Blaskapelle, Marschmusik intonierend – nicht gerade was für meine Ohren. Bier habe ich mir auch in zwanzig Jahren nie recht an-, Fleisch gerade erst wieder abgewöhnt. Und was die zitierten Weiber angeht, zähle ich sie höflicherweise am besten zur Folklore. Wie die vielfältigen Feste, die in München kein Ende haben dürfen. Das Raufen liegt mir nicht, ich bin Brillenträger. Außerdem bin ich, Künstlerpech, mit nichts und niemandem zufrieden, am allerwenigsten mit mir. Ich sollte also den Mund halten. Mich geschlagen geben wie Lion Feuchtwanger, dem ich das obige Zitat verdanke. Er mußte diese Stadt verlassen, als München nicht nur eine bayerische, sondern die arische Ruhe herstellen wollte. »Die schöne, träge, selbstgefällige Stadt vertrug keine Kritik; sie wollte verhätschelt, umschmeichelt sein wie eine Diva, und in jedem Tadel mußte verborgenes Lob stecken.«
In seelischer Not, aber freiwillig tat ein anderer nichts lieber, als abzureisen aus München. Der König, Ludwig der Zweite. München war ihm in allem ein Greuel. Eine Revue der politischen und gesellschaftlichen Intrigen. Eine Infamie insgesamt. Er sah kaninchenmäulige Professoren, beflissene Damen mit unbeherrschtem Innenleben, die Frackschöße der Akademien, sah die allgemeine Verderbtheit, den Unverstand. München war Gelärm bis hinein in die abseits gelegenen Seitenstraßen und Hinterhöfe mit ihrem eingesunkenen Kopfsteinpflaster.
Ahnungslos gegenüber der Kunst, hält sich der echte Münchner – in seiner populären Form als Sehenswürdigkeit – selbst für ein Kunstwerk. Bis heute!
Im Würgegriff der Tradition wird das Bier wuchtig hineingesoffen in die Bäuche, in denen es bald brodelt vor Lust auf Handfestes. Haben aber Männer eine Chance gegen die dralle, unkomplizierte Leibesfülle bayerischer Bedienungen? Also macht man Strittiges unter sich aus. In jedem Fall muß eine Ordnung her. Feinheiten hören sich da auf.
Daß in München ein Hofbräuhaus steht, weiß die Welt und weiß es zu schätzen. Verheißt dieses legendäre Bierbordell doch Menschen aller Hautfarben jene uneingeschränkte Seligkeit, die nur kollektiver Alkoholismus verspricht. Es werden tonnenweise Brezn und Würste und Gebratenes verschlungen, Schweinernes vor allem mit Pyramiden und Knödeln. Selbst die Blasmusik schmatzt. In allen Fäusten prahlt der schäumende schwere Maßkrug, Symbol der Unersättlichkeit, Fetisch der Potenz. Das Derbe, Dumpfe, Deftige, beim Herrgott! Es muß sein!
Berühmt sind sie, die Bayern. Sauberühmt sogar. Eine kolossale Attraktion. Dabei bleiben sie, seit alters mißtrauisch, am liebsten unter sich.
Die Bayern gehören zu einem Menschenschlag, dem sich unbegrenzte moralische Fähigkeiten nicht nachsagen lassen. Es scheint sie nicht einmal zu stören, daß dem so ist. Ganz im Gegenteil! Das Schlaue, Schlitzohrige ist dem Menschen dieser Region heilig. Mir san mir, sagen sie. Und: A bisserl wos geht imma … Geachtete Eigenschaften in einheimischen Augen.
Tatsächlich ist die Zufriedenheit der Menschen in (und mit) München bedrohlich. Manchmal, an langen Sommerabenden, stöhnt die ganze Stadt unter den Kastanien ihrer Biergärten auf vor Zufriedenheit. Mit zäher Ausdauer trinken sie. Dann wird gestritten, rechtschaffen, kantig, wortkarg. Die Verlumpung der Politik! Darüber wird es spät. Das Verkommene, Halbherzige, Schwächliche – das verdient einen Denkzettel. Dabei behält aber der Bayer durchaus seine Ruhe. Er haßt Hochfahrendes, verabscheut Dünkel und Geschwätzigkeit, noch dazu gescheite. Reden sollen die Nervösen. Zugereiste in der Regel. Stumm, fast gewalttätig einsilbig sind diese Exemplare in den Wirtshäusern an ihren Stammtischen auch heute noch anzutreffen, in ihrem Schweigen Monumente einer anderen Epoche, eine Menschen- und eine Welterkenntnis, daß jeder, der seine Heimat nicht spürt unter seinem Hintern, eine verlorene Existenz ist. Es gilt, Mittelpunkte zu meiden, sich zu begnügen mit den banalen Bestandteilen des menschlichen Glücks. Der Münchner, sofern er ein Bayer ist, hält seine Stadt für die schönste der Welt.
»Wo steckst du?« will einer, der mich für verschollen oder gar tot gehalten hat, wissen. Ich sag: »In München.« »Die unnötigste Stadt Deutschlands«, teilt er mir mit und dreht sich ab. Wahrscheinlich wär er mir noch gern auf die Zehen getreten, ganz leicht nur, nur um mir zu beweisen, daß er recht hat.
Hat er? Nutzloses ist ja nicht wertlos. Es kann schön sein, sehr schön sogar. Etwas aus der Mode gekommen, hat es dafür oft mehr Charme als etwas, das von der Strenge nützlicher Überlegungen geprägt ist. Es wächst Nutzloses gern am Rand. Genau dort liegt München, noch dazu an einem südlichen Rand. An schönen Tagen möchte man sich aufmachen zu einem Fußmarsch ans Mittelmeer. Man benutzt Nutzloses nicht, sondern hegt und pflegt es, sammelt und liebt es um seiner selbst willen. Ein bißchen kostbarer wird es allein dadurch, daß diese Art Leidenschaft keine Veränderung duldet.
In ihrem selbstverliebten Größenwahn hält sich diese Stadt für einen einzigen und unwiederholbaren Glücksfall. Gern noch immer das Dörfliche betonend, aber international gesellschaftsfähig, dabei arrogant rückständig, verbohrt knorrig, fast debil konservativ, das Erdreich, das Bäuerliche segnend, eingeschnürt in Bundhosen und Dirndl. Stolz auf ihren kaum zivilisierten Urzustand, trotzdem leichtlebig, wie es die Menschen (also Affen, Saupreußen, Geselchte) dem Italienischen abschauten, mit dem Dösen und Flanieren und Nichtstun, dem Hinhalten, dem Verschlenkern der Zeit. Ein Königreich gewiß, noch immer, in der Stadt mit breiten, flächigen Bauten, florentinischen Fassaden, Residenzen und Plätzen, so steht sie da, die Hauptstadt, in ihrer Größe menschenfreundlich und mächtig – und, jawohl, un-deutsch!
Ich kann schlechtgelaunte Leute nicht leiden, halte einen schlechtgelaunten Urmünchner aber für liebenswert, weil er in diesem Zustand sich und seinem dunklen, aber unkomplizierten Humor am nächsten ist. Als chronischer Grantler wurde er geboren, seine Lehrzeit in diesem Gemütszustand dauert bis zum Tod – und den erwartet er nicht vor dem letzten Schluck Bier.
Was ich an dieser Stadt besonders liebe, hat mit den Steinen zu tun, ihrer Farbe und Harmonie, wenn die Sonne schräg gegen die Monumente fällt, ihren vom wärmsten Licht gestalteten Schattierungen, den Halbtönen, die Musik sein könnten, stille, leise, verklingende Musik – immer vorausgesetzt, die Stadt ist menschenleer, entleert von ihren Bewohnern, die an den nahen Seen, in den nahen Bergen luft- und wasserwandeln. Der finstere Zustand der bayerischen Behaglichkeit ist dann überstrahlt von einem hohen, fernen Himmel und einer Sonne, die mehr leuchtet als glüht. Hier, denke ich dann, müßte man doch zurückfinden können zur Pforte des Paradieses.
Wer aber hält schon viel vom Paradies, wenn er eine Weltstadt will? München versteht sich als »Weltstadt mit Herz«. Nun gut, Hopfenduft, Weihrauch, Schwaden von Gegrilltem. Wer den Geruch der Unberechenbarkeit, des Unvorhersehbaren, der Überraschung sucht, muß München verachten und auswandern. Nach New York, Neapel, Mexico City. Oder ins wiedervereinigte Berlin! Wer unter seinen Absätzen das Pflaster der Großstadt spüren will, wenigstens hin und wieder, muß reisen. Wem es noch was bedeutet, daß ihm das Herz höher schlagen soll vor Erregung, eine große Stadt zu durchstreifen und, auch das, in Gefahr zu geraten, dabei verlorenzugehen, muß anderswo sein Glück suchen (oder sein Unglück herausfordern). München hat Kurqualität. Für Nachtschwärmer muß die Stadt einer Arrestzelle gleichen. Die Sperrstundenregelung erinnert an Ausgangssperre. Über das Pflaster haben sich, mit gärtnerischem Geschick, die Planer einer umfassenden Verkehrsberuhigung hergemacht. Es lebt sich leicht in München, allerdings auch leicht gelangweilt, einschläfernd, wie am Rande eben! Gefahr droht von den Ideologien der Mächtigen, nicht vom hungrigen Latino oder dem Straßenjungen, der auf schnellen Beinen kommt und auf noch schnelleren wieder verschwunden ist. Wenn New York besungen wird als »the city that never sleeps«, fallen mir zu München nur Gutenachtlieder ein. Das Flair des Lasterhaften ist nicht auszumachen, auch bei hoher Scheidungsrate nicht. Wer den Anblick eleganter Frauen in einer Stadt, einer Weltstadt zumal, für unverzichtbar hält, kann beruhigt die Augen schließen. Er wird sich mit Damen begnügen müssen, die Verdi für einen Modeschöpfer halten. Nur in München kein Doppelleben beginnen, dafür ist die Stadt zu übersichtlich, zu nachbarlich. Was Gerüchte, Klatsch oder üble Nachrede angeht, ist München keineswegs so nachsichtig, wie das in der Regel alle hier geschlossenen Freundschaften sind. »Viele Freundschaften«, schrieb Polgar über seine Heimatstadt Wien, »sind nichts als degenerierte Gleichgültigkeit.« Ich bestätige diese Behauptung über meine Wahlheimat München.
Warum ich trotzdem hier wohne, werden Sie sich fragen. Nun, lassen Sie mich einen Chinesen zitieren, der gesagt hat: »Der Mensch reifte zum Menschen, als ihm das Nutzlose unentbehrlich wurde.« Ich hoffe, meine allzu lange Anwesenheit in München ruiniert nicht den Ruf, den fernöstliche Weisheiten seit Jahrtausenden genießen.
(1993)