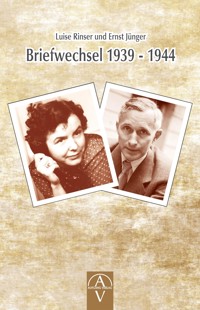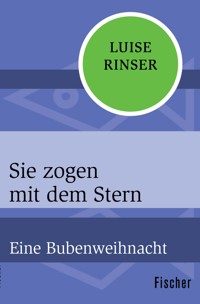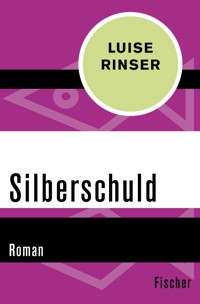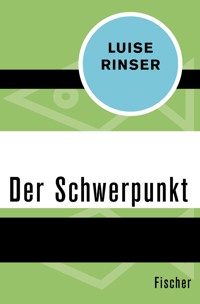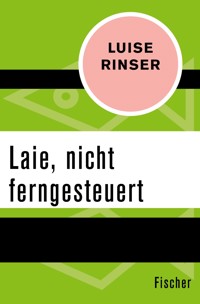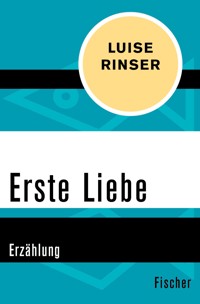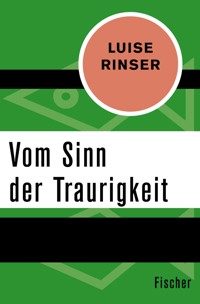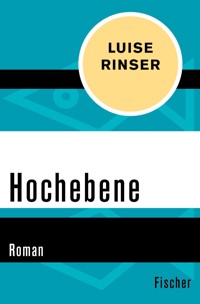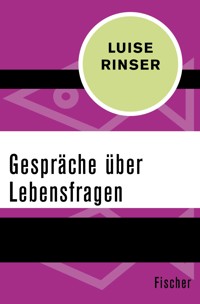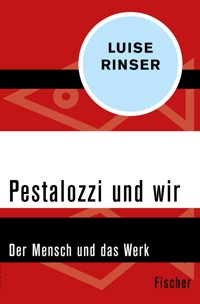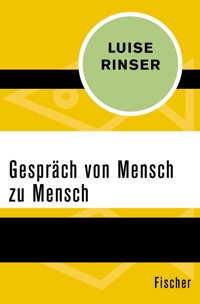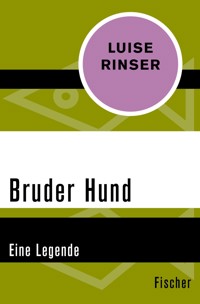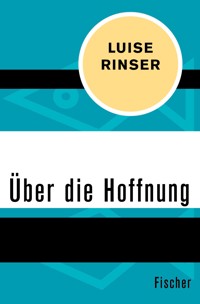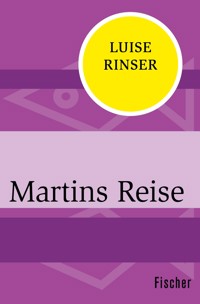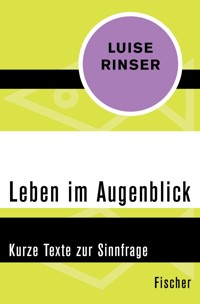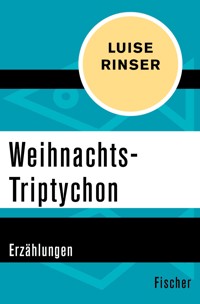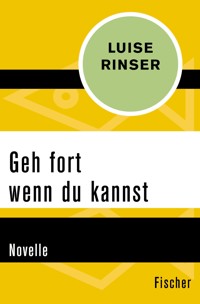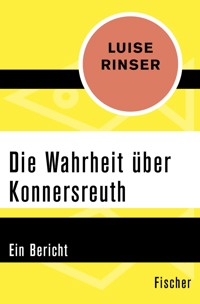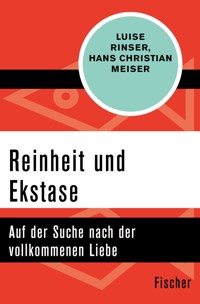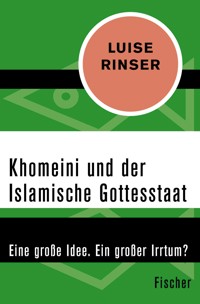14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Nachdem Luise Rinser zu Studienzwecken längere Zeit unter Leprakranken verbrachte, hat sie 1974 erstmals diese Dokumentation herausgegeben, um die Geißel der Menschheit zu analysieren und zur öffentlichen Diskussion zu bringen. "Dem Tode geweiht?" sprengt den Rahmen eines Reports. Es ist Bericht und Erzählung einzelner Schicksale, Anklage und Wegweiser. Es wird über medizinische Informationen, Ansteckung, Erscheinungsformen und über Heilungsmöglichkeiten gesprochen. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Luise Rinser
Dem Tode geweiht?
Lepra ist heilbar!
Über dieses Buch
Nachdem Luise Rinser zu Studienzwecken längere Zeit unter Leprakranken verbrachte, hat sie sich entschlossen, diese Dokumentation herauszugeben, um die Geißel der Menschheit zu analysieren und zur öffentlichen Diskussion zu bringen.
„Dem Tode geweiht?“ sprengt den Rahmen eines Reports. Es ist Bericht und Erzählung einzelner Schicksale, Anklage und Wegweiser. Es wird über medizinische Informationen, Ansteckung, Erscheinungsformen und über Heilungsmöglichkeiten gesprochen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Erschienen bei FISCHER Digital
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Copyright © by Christoph Rinser
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Montasser Medienagentur, München
Covergestaltung: buxdesign, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-561223-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Das Lied eines Leprösen
Erzählung des Leprösen Raffael
Geschichte dieser Reise
Watublapi und die indonesischen Probleme
Im Jeep durch Sümpfe und Bergflüsse
Auf der Lepra-Insel
Krankengeschichte I
Krankengeschichte II
Tagesabläufe im Leprosarium
Isabella und Gisela oder: Wie wird man Leprapflegerin
Krankengeschichte III
Was ist denn Lepra eigentlich?
Und wer bezahlt das alles?
[Bildteil]
Das Lied eines Leprösen
Ein Schiff fährt von Kupang nach Surabaja.
Es kämpft gegen Wellen und Wind.
Ich bin traurig, wem soll ich es sagen.
Ich bin allein.
Über den Bergen ist Regen und Sturm.
Unterschlupf haben die Hirsche, die Schafe.
Als es mir gut ging, hatte ich Freunde.
Jetzt bin ich allein.
Das Meer steigt, Mond kommt herauf
daheim weinen die Meinen um mich.
Reglos am Wasser das Krokodil.
Ich bin allein.
Vater ist tot, wo ist sein Grab
eingeebnet die Erde, lang schon.
Als ich klein war, trug mich die Mutter.
Jetzt bin ich allein.
Erzählung des Leprösen Raffael
Ich bin 1946 geboren und fünf Jahre zur Schule gegangen. 1961 fing ich an, auf den Molukken für eine japanische Holzfirma zu arbeiten. Dort war es, daß ich die ersten roten Flecken auf meiner Haut sah. Auch die Kameraden sahen sie, und sie meinten, das sei irgendein Ausschlag, aber es gab andere die sagten: das ist die Lepra. Und schon war ich gezeichnet, schon fingen die andern an, von mir wegzurücken. Da geschah etwas, das uns zur Flucht zwang: weil wir viel Arbeit, aber wenig Essen hatten, waren wir oft gereizt, einundvierzig Arbeiter waren wir, und es gab oft Streit, und eines Tages wurde einer davon umgebracht. Aus Angst flohen wir alle, auch jene, die gar nichts mit dem Totschlag zu tun hatten. Ich floh auch. Aber wofür eine Flucht! Drei starben vor Hunger und Erschöpfung, wir mußten sie sterben und liegen lassen. Endlich kamen wir bei einer Kokosplantage an und baten um Arbeit. Der Besitzer konnte uns gerade brauchen. Aber er mußte, uns anzumelden, zur Polizei, mit uns zusammen. Und da war es, daß der Beamte mich ansah. Du hast ja die Lepra! Also keine Genehmigung, keine Arbeit, kein Essen, kein Bleiben. Was tun. Ich stand da und dachte nach. Da kam ein junger Mann auf mich zu und sagte: was ist mit dir, du bist krank, nicht wahr, du hast die Lepra, komm mit mir, ich will dich kurieren, ich kann das. Ich ging mit ihm, so gern ging ich mit ihm, ich war nicht mehr allein, und jemand kümmerte sich um mich. Zwei Wochen ging es mir gut bei ihm. Da kam der Bürgermeister. Irgendjemand hatte ihm verraten, daß ich da bin und leprös bin. Also jagte man mich fort. Wohin? Der junge Mann, der mich nicht behalten durfte, gab mir noch rasch die Adresse seiner Verwandten auf der Insel Ambon. Ich kam auch wirklich dorthin und wagte es, zu diesen Menschen zu gehen. Aber sie sagten, wir haben kleine Kinder, du wirst sie anstecken, was tun wir mit dir, wir wollen dich nicht fortjagen, das nicht, aber im Haus können wir dich nicht haben, du begreifst, wir bauen dir eine Hütte hinterm Haus, da hast du einen Unterschlupf, aber komm uns nicht nahe. So hatte ich einen Unterschlupf, aber nichts zu essen, die Leute waren selber arm, und sie mochten auch nicht zu mir kommen, so sahen sie nicht, daß ich nichts zu essen hatte, sie meinten, der sucht sich schon selber etwas im Wald und auf den Feldern. Aber da war wenig und da war Gefahr, daß man mich sah. Und wirklich sah mich eines Tages der Mann, dem das Feld gehörte. Geh fort, schrie er und verjagte mich. Ich versteckte mich in der Nähe, ich meinte, man ließe mich wenigstens in der Hütte. Aber der Besitzer des Landes kam und verlangte, daß man mich vertrieb. Die Leute sagten: wohin sollen wir ihn jagen, er ist so krank und seine Familie so weit weg, wie soll er dahin kommen, was tun wir nur. Da ging ich weg und versteckte mich am Strand. Und eines Tages kam ein Schiff und es fuhr zu meiner Heimatinsel, was für ein Glück. Ich bezahlte die Fahrt und stieg ein. Da sagte der Kapitän: Aber du hast ja die Lepra, fort mit dir. Er jagte mich vom Schiff. Es fuhr ab, ohne mich. Dann kam einmal ein Flugzeug, das zu meiner Heimat flog. Aber der Kapitän sagte: Dich nehme ich nicht mit, du hast ja die Lepra. Und es flog ab. Dann fand ich eine Gruppe von Landarbeitern, denen schloß ich mich an, aber der Patron sah mich und rief: der hat die Lepra, fort mit ihm! Wohin nur. Da kam mir der Pastor in den Sinn. „Hilf mir, heimzukommen“, bat ich, und er versprach es mir. Komm morgen, sagte er, da geht ein Schiff nach Adonara. Aber ich will nicht nach Adonara, ich will heim, warum nach Adonara. Da ist ein Leprosarium, da heilen sie dich. Nun gut, es soll so sein. Aber als ich zum Hafen kam, war das Schiff abgefahren. Ich wartete und wartete, was sonst konnte ich tun als warten, auf irgend etwas, auf ein Schiff, ein Segelschiff, das mich heimbringt. Und eines Tages kam das Segelschiff, und es nahm mich mit, und ich kam heim! Als mich meine Eltern sahen, freuten sie sich, ich war so lange fortgewesen. Aber da sahen sie meine Krankheit und sie erschraken sehr. Warum nur bist du nicht früher heimgekommen?! Wie konnte ich früher heimkommen, wenn alles gegen mich verschworen war? Aber nun war ich daheim, und nun sollte alles gut werden. Meine Eltern brachten mich zum Medizinmann, er sagte, er heile mich, und er badete mich in Kräutersud und gab mir Kräutertee. Aber mir ging es schlechter und immer schlechter. Es liegt am Medizinmann, dachten wir, und meine Eltern suchten einen andern. Auch er versprach mich zu heilen, und er gab mir Bäder und Tee. Und er verlangte viel dafür. Aber er konnte nicht helfen. Wir gingen zu einem dritten und es war umsonst. Meine Eltern hatten schon ihre Kleider und ihr Vieh gegeben, und alles war umsonst. Da sagte mein Bruder: Ich habe gehört, auf Flores, in Larantuka, gebe es ein Krankenhaus, da haben sie andere Heilmittel, gerade gegen die Lepra. Und so fuhren wir mit dem Schiff, dem kleinen Fischerboot, nach Larantuka. Sie gaben mir Spritzen und Medizinen. Aber was war? Es ging mir noch viel schlechter. Ich dachte bei mir: Das ist die richtige Medizin nicht, das kann sie nicht sein. Aber sie gaben sie mir weiter und weiter, und ich dachte, ich müsse sterben. Da holten mich meine Eltern wieder heim, und nun begann alles von vorne: der erste Medizinmann verspricht Heilung, er hält das Versprechen nicht, und auch der zweite nicht, und der dritte nicht. Da hörte ich sagen, in Levoleba gebe es eine ganz neue Medizin, die sie in Larantuka nicht hatten. Ich fragte den Medizinmann und er sagte: Meine Medizin hilft auch, aber du darfst nie in Berührung mit dem Meer kommen, also auch nicht über das Meer fahren. Er wußte, daß ich übers Meer fahren mußte, um nach Levoleba zu kommen. Ich glaubte ihm, ich blieb, ich ging nicht ans Meer. Und ich wäre wohl immer daheim geblieben, wäre nicht etwas Schreckliches geschehen: eines Tages kamen die Eltern des Mädchens, das mein Bruder heiraten wollte, und sie sagte: Unsere Tochter will den Mann nicht mehr, der einen Leprösen zum Bruder hat. Da verstand ich, daß man mich umbringen wollte. Ich stand allen im Weg. Ich wollte nicht sterben, das nicht, obwohl es auch für mich gut gewesen wäre. Aber ich wollte doch leben. Da ging ich zum Pastor: Hilf mir, ich weiß nicht weiter, ich bin schuld am Unglück andrer. Du sollst gesund werden, sagte der Pastor, ich lasse dich nach Levoleba bringen, geh ins Leprosarium, da heilen sie die schwersten Fälle. Ich fuhr übers Meer, ich kam hier an, aber ich wagte nicht ins Leprosarium zu gehen. Da kam ein deutscher Arzt, der machte Kontrollen und suchte die Leprösen, er fand mich und gab mir Medizin, aber das war die gleiche wie in Larantuka, und sie hatte die gleiche Wirkung: sie machte mich sterbenskrank. Da schickte der Arzt mich hierher. Und da bekam ich das neue Mittel, Lamprene, das sollte helfen. Es half mir nicht, alle meine Wunden brachen auf, ich war eine einzige Eiterbeule, und ich wollte sterben. Da kam der junge javanische Arzt von der Poliklinik auf die Idee, mir Cortison zu geben, damit wenigstens die Nervenschmerzen aufhörten, ich konnte sie nicht mehr ertragen. Und das Cortison half. Als er es aber später weglassen wollte, bekam ich eine schwere Reaktion. So gab er’s mir wieder, zusammen mit Lamprene. Aber Cortison allein tat mir besser. So machen wir eben weiter und weiter, es geht mir besser, aber …
Geschichte dieser Reise
Wer heute sagt, er reise nach Indonesien, der meint Java oder Bali, und er meint exotische Ferien oder Handelsgeschäfte oder diplomatische Aufgaben. Wer aber reist nach anderen Inseln, etwa nach Flores oder gar nach Lembata? Und was täte man auch dort?
Man muß einen ganz besonderen Grund und Anlaß haben, dies zu tun. Ich hatte einen Grund, der mich schon lange bedrängte, und ich hatte einen Anlaß, der mich plötzlich, von einer Minute zur andern, auf diese Reise festlegte.
Solange sie in weiter unbestimmter Ferne lag, schien sie mir verlockend. Als sie, Hals über Kopf beschlossen, unmittelbar bevorstand, hätte ich sie gerne abgesagt. Es ging nicht mehr, ich hatte mich menschlich und vertraglich gebunden, leichtsinnig, wie ich zu meinen begann. In welches Abenteuer ich mich einließ, ahnte ich nicht, und das war gut, denn andernfalls hätte ich die Reise nicht gemacht, ich hätte mir die Kraft nicht zugetraut. Jetzt bin ich froh, das Wagnis auf mich genommen zu haben.
Der Grund zur Reise: vor sechs Jahren schrieb mir eine Leserin aus Indonesien, eine Deutsche, ausgebildete Leprapflegerin in Levoleba. Ihr Brief war zwei Monate unterwegs gewesen. Ich antwortete ihr und bat, weniger aus wirklichem Interesse, mehr aus Höflichkeit, um einige Auskünfte: wie lebt man denn in Levoleba, als Leprapflegerin, gibt es denn viele Leprakranke. So begann ein Briefwechsel, ein spärlicher, aber von beiden Seiten beharrlich weitergeführter. Viele sachliche Informationen bekam ich nicht, denn diese Deutsche, Gisela Borowka, war nicht sehr mitteilsam, sie hielt offenbar das, was sie erlebte, für nicht interessant genug, um es mir zu berichten. Einen ihrer Briefe setzte ich aber als letzte Eintragung in mein Tagebuch „Baustelle“, schrieb aber eine falsche Angabe dazu: „Ein Brief von G.B., die seit zehn Jahren auf Java (Levoleba) die leprakranken Kinder pflegt.“ Levoleba liegt nicht auf Java, es liegt auf Lembata, einer sehr kleinen Insel im Südosten Indonesiens, sehr weit weg, und Gisela pflegt nicht nur leprakranke Kinder, sondern auch Erwachsene, und sie leitet mit Isabella, einer Eingeborenen, zusammen das Leprosarium in dem Ort Levoleba.
Einige Sätze aus ihrem damaligen Brief:
Bei uns hat die Regenzeit begonnen, man trifft niemand mehr daheim an, da alle auf den Feldern sind, Mais und Reis wird gesät und die Leute warten schon so auf die ersten jungen Maiskolben. Überall herrscht Hunger. Viele Menschen sind krank vor Erschöpfung. Doch nun gibt es wieder neue Hoffnung … Auch unsere Leprösen sind dabei, zu säen und zu pflanzen … Für mich sind diese Menschen einfach so wie alle andern auch. Ich hab’ sie gern … Wenn ich manchmal lese, wie in den Kirchen und anderswo um Kleinigkeiten gestritten wird, denke ich mir, die Menschen haben doch keine Sorgen um all die Not und das Leid in der Welt.
Ich setzte diesen Brief an den Schluß meines Tagebuchs in der Absicht, dessen übrigen Inhalt damit zu relativieren und unsere westlichen intellektuellen Sorgen ein wenig zu ironisieren. Hatte ich auf rund dreihundertfünfzig Seiten von den politischen, philosophisch-theologischen, kirchlichen Problemen geschrieben, so sollte Giselas Brief zuletzt sagen: die wahren Probleme sind ganz einfach und ganz konkret, es geht um den Hunger in der Welt, um die Krankheiten, ums nackte Überleben.
Ganz so hatte es Gisela nicht gemeint, das weiß ich jetzt erst, aber damals glaubte ich, ihren Brief so verstehen zu sollen.
Eines Tages schrieb mir Gisela, sie haben nun ein Steinhaus gebaut für das Pflegepersonal, und darin sind auch zwei Gästezimmer, und es wäre eine große Freude für sie und die Kranken, wenn ich zu Besuch käme. Ich schrieb zurück, daß ich das gerne tun würde, und sie soll mir sagen, wann die beste Zeit für Indonesien sei, klimatisch, meinte ich. Sie schrieb: Im April, da ist die Regenzeit vorüber und die Hitze noch nicht groß und sie erwarte mich also in diesem Jahr. Später sagte mir Gisela, sie habe nicht zu denken gewagt, daß ich ihre Einladung ernst nähme. Ich legte den Brief beiseite. Unmöglich, dieses Jahr zu reisen, vielleicht ein anderes Mal.
Einige Zeit darauf war ich in München und der Verleger Rolf Schulz fragte mich, was ich ihm als nächste Arbeit anzubieten habe. Nichts, sagte ich, denn ich möchte nicht mehr soviel arbeiten, ich will reisen.
Wohin denn?
Ich hörte mich selbst sagen: Nach Indonesien.
Und warum gerade dahin?
Wiederum hörte ich mich etwas antworten, als sagte nicht ich selbst es: Ich gehe auf eine Leprastation.
Was? Aber da geht man doch nicht hin, da steckt man sich an, was fällt Ihnen ein! Aber was ist denn eigentlich Lepra? Wodurch wird sie erregt, ist sie erblich, kann man sie heilen, wie schützt man sich dagegen, wie leben Leprakranke … Er stellte spontan einen Katalog von Fragen auf und wir merkten beide, daß wir keine Antworten wußten.
Ja dann, sagte Rolf Schulz, dann fahren Sie hin und schreiben ein Buch darüber, ich zahle die Reise, das Reisebüro stellt die Flüge zusammen und besorgt die Hotelzimmer, also, der Vertrag ist gemacht?
Und ich sagte: Ja. Wieder hatte ich das Gefühl, nicht ich sagte das, sondern jemand anderer über meinen Kopf hinweg.
Das also war der Anlaß zu dieser Reise.
Ich schrieb sofort an Gisela, ich käme wirklich, ich wolle Ende März abreisen. Ich schrieb ihr das, um mich auch menschlich, sozusagen moralisch, zu binden. Und dann rollten die Vorbereitungen ab. Da Rolf Schulz das Buch bebildern wollte und ich nicht fotografiere und auch nicht so gern allein reiste, sollte mein ältester Sohn, Christoph, mitfliegen.
Wir ließen uns, wie vorgeschrieben, impfen: gegen die Pocken, die Cholera, den Typhus und Paratyphus und wir nahmen vorbeugend schon vierzehn Tage zuvor das Mittel gegen die Malaria, obgleich man uns gesagt hatte, es gebe auf Java keine Malaria. Aber wir gingen nicht nur auf die Insel Java, und wer weiß, ob es dort, wohin wir gingen, nicht doch Malaria gab. (Wir taten gut, so zu denken, denn wir kamen geradezu in ein Malariagebiet: das Küstenland von Flores.) Eine Schutzimpfung gegen die Lepra aber gab uns niemand, denn, so sagte man uns, die gebe es überhaupt nicht. (Auch das stimmt nicht ganz.)
Zufällig erfuhr ich, daß eben ein deutscher Missionar aus Indonesien in Hamburg sei. Ich bekam seine Adresse und rief ihn an. Wo ist denn dieses Levoleba, wie kommen wir hin?
Er sagte: Sie fliegen zuerst nach Jakarta, dann nach Bali, dann nach Maumere, oder Sie fliegen nach Jakarta und dann nach Surabaja, und von dort nach Kupang, und dann mit dem Schiff nach Lembata, das ist die Insel, auf der Levoleba liegt, oder Sie gehen von Maumere nach Larantuka und von dort mit dem Schiff nach Lembata.
Das hörte sich sehr kompliziert an, genau so kompliziert, wie es war.
Im Reisebüro sagte man mir, es sei nicht so schwierig. Wir sollten, um uns zu akklimatisieren und den Flug nicht auf einmal zu machen (runde zwanzig Stunden), erst nach Delhi fliegen und von Indien aus über Bangkok nach Java und zwar nach Jakarta, und von dort nach Bali. Die Reservierungen bis Bali zu bekommen war leicht. Aber zu erfahren, wann wir von Bali aus nach Maumere weiterfliegen könnten, erwies sich als unmöglich: weder Bali noch Maumere antwortete. Später lachten wir über die Vorstellung, daß man in Bali wissen konnte, wann genau ein Flugzeug nach Maumere gehe, und noch komischer erschien uns dann die Erwartung, Maumere müsse per Telex antworten. Nun, der Flug blieb also von Bali aus offen, es würde schon alles gut gehen.
Christoph kam von Köln über Frankfurt nach Rom, ich stieg in Rom zu, wir waren beide freudig erregt, doch gestanden wir uns bald, daß wir lieber daheim blieben. Zu spät – wir flogen.
Auf dem Weg über Delhi und Bangkok kamen wir in Jakarta an und flogen nach Bali weiter.
Erst in Bali begann das Abenteuer. Niemand dort wußte, wann je ein Flugzeug nach Maumere gehe, das auf der Insel Flores liegt, fünf Flugstunden entfernt. Irgendwann würde es schon ankommen und irgendwann auch abfliegen.
Wir hatten Glück: schon am übernächsten Tag hörten wir, das Flugzeug sei da und fliege in einigen Stunden ab.
Es war ein kleines Flugzeug, fast leer. Als wir wenigen Fluggäste bereits startbereit saßen, mußten wir wieder aussteigen, irgendetwas war kaputt. Wie lang wird es dauern?
Jetzt wissen wir: nur ein Europäer oder Nordamerikaner kann hier so eine Frage stellen. Er wird immer hören: bald.
Einige Zeit stand das Flugzeug verlassen auf der Piste und es schien, daß es auch weiterhin so stehen bleiben würde. Plötzlich, wie aus dem Boden gewachsen, waren einige Arbeiter und Techniker da und taten in stillem Eifer dies und das, und plötzlich schien es einem einzufallen, man könne den Propeller mit der Hand anwerfen, jedenfalls sah es so aus, was da geschah. Und der Propeller drehte sich. Einsteigen!
Die Indonesen, das erfahren wir in den nächsten Wochen, machen mit rätselhaften, sinnlos erscheinenden Hantierungen und mit einer beneidenswerten Langmut das unmöglich Scheinende möglich.
Wir flogen niedrig. Ein wunderbarer Flug über die leuchtend blaue Südsee und über einige hundert der 13000 Inseln, aus denen Indonesien besteht. Inseln mit rauchenden Vulkanen und Inseln mit erloschenen, bewaldete bergige Inseln und steppenartig kahle, und reich bebaute auch, flache Inselchen, die kaum über die Meeresoberfläche ragen und andere, die unter Wasser sind und nur an der hell smaragdgrünen Färbung des Wassers zu erraten sind, auch viele Atolle, Koralleninseln, die wie grüne Reifen daliegen, wir sehen auch viele Bohrtürme im Meer, Indonesien hat viel Erdöl, es wird immer mehr haben, es wird sehr reich werden, die große Konkurrenz der Araber. Genau gesagt, wird erst einmal Java reich werden. Ob der Reichtum je auf all diese Inseln gelangt, ist nicht zu ahnen. Wie arm sie sind, werden wir bald sehen.
Wir fliegen und fliegen, wie lang, das ist schon nicht mehr wichtig, Asien beginnt schon uns anzustecken. Auch meine Armbanduhr bleibt stehen, sie findet es hier unnötig zu funktionieren, sie bleibt stehen, solange ich in Indonesien bin.
Schließlich ist von Landung die Rede. Christoph sagt zum Spaß: Mir scheint, der Pilot findet die Piste nicht, er sucht so herum.
Beinahe war es so: die Piste, die einmal, zur Zeit der holländischen Kolonialherren, ein richtiges Rollfeld war, ist jetzt eine steppenartige Wiese. Der Pilot findet schließlich einen geeigneten Platz zum Aufsetzen, alles geht gut. Aber dann stehen wir da und wissen nicht weiter. Niemand kann Englisch oder sonst eine brauchbare Sprache, und wir hatten in der Eile der Reisevorbereitungen keine Zeit gehabt, um ein wenig Indonesisch zu lernen, und es wäre so leicht!
Wir waren entmutigt, es war heiß, feuchtheiß, anders als in Nordindien, wir waren in den Tropen, wir hatten den Äquator längst überflogen zwischen Bangkok und Java, wir waren bei den Antipoden und bei einem uns sehr fremden Volk, wie es uns schien. Aber bei diesem Volk ist immer alles möglich, und so stand auf einmal ein Mann da, der drei Worte Englisch konnte und begriff, daß wir zu einer Missionsstation wollten. Aber die lag weit weg. Kein Problem: es fand sich ein Jeep ein, von irgendwo her, und wir wurden in den Ort Maumere gebracht, zur Missionsstation der Steyler Schwestern, die dort eine große Schule haben. Die Oberin, einst eine sehr schöne Frau, man kann es erraten, ist von der Hitze und der Malaria ausgemergelt, sie ist Österreicherin, und wir erhoffen von ihr Unterkunft für die Nacht. Aber sie findet, in einem Mädchen-Internat könne der junge Mann, der mein Sohn ist, nicht nächtigen. Höflich-bestimmt schiebt sie uns ab. Es gebe da oben eine Missionsstation, die viel bequemer und gesünder sei. Sie besorgt uns einen Jeep und wir finden uns wieder auf der heißen Straße, mitten im malaria-trächtigen Küstengebiet. Aber der Weg führt bald aufwärts. Er scheint uns sehr schlecht. Er ist eine Staatsstraße im Vergleich zu dem, den wir am übernächsten Tag zurücklegen werden, um quer über die Insel Flores nach Larantuka zu kommen, dem kleinen Hafenort, von dem aus wir per Schiff nach der Insel Lembata und zum Leprosarium Levoleba fahren sollen.
Von Rom oder Frankfurt nach Java und Bali zu kommen, das ist ein Kinderspiel, ein langes zwar, aber ein leichtes. Die relativ kurze Strecke zwischen Bali und Lembata zurückzulegen, das braucht Zeit, viel Zeit, niemand kann vorher wissen, wieviel. Wir brauchten vier Tage, das war schier eine Rekordzeit. Wenn Gisela oder wenn einer der Ordensleute aus den Missionsstationen der Inseln nach Europa heimfahren will, so muß er damit rechnen, daß er zwar, wenn er einen Flugplatz bekommt, von Jakarta in rund zwanzig Stunden dort ist, aber er muß auch damit rechnen, daß er vierzehn Tage braucht, bis er von seiner Insel nach Jakarta kommt. Wir brauchten auf dem Rückweg von Lembata nach Rom insgesamt an reiner Fahr- und Flugzeit 44 Stunden. So weit ist man dort aus der Welt, die wir für die Welt halten, weil es die uns gewohnte ist. Wieviel Welt wir dort fanden, davon wird die Rede sein.
Watublapi und die indonesischen Probleme
Wenn ich nun meinem Bericht ein langes Kapitel einfüge, in dem fast nicht von der Lepra geredet wird, so hat das seinen Grund: auf Watublapi bekommen wir den ersten Anschauungsunterricht von der sozialen Lage Indonesiens außerhalb Javas. Diese allgemeine Situation erklärt vieles, was uns im Lauf der nächsten Wochen als ungelöste Probleme der Lepra-Fürsorge vor Augen kommt. Auf Watublapi sehen wir, inwiefern Indonesien ein Land der Dritten Welt ist, welche Schwierigkeiten es hat und welche Lösungen möglich und notwendig sind. Wir lernen, kurz gesagt, wie hier Entwicklungshilfe geleistet werden muß, welche Erfolge sie haben kann, welche Fehler man machen kann, welche Fehler auf unserer Lepra-Insel Lembata gemacht werden und wie sie im Positiven und Negativen mit der allgemeinen Entwicklungshilfe zusammenhängen.
Die Entwicklungshilfe des Flores-Timor-Planes (nach den beiden größten Inseln des Distrikts benannt) ist kirchlicher Herkunft, die Gelder kommen zum größten Teil vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, zum andern Teil von Misereor, zum kleineren Teil kommen sie aus privater Hand, zum Teil aus der „Holländischen Fasten-Aktion“.
Der Mann, der hier arbeitet, vorbildlich, wie wir sehen, ist Steyler Missionar, der Orden heißt abgekürzt S. V.D. Der Mann heißt P. Heinrich Bollen. Er ist ein Ereignis. Er wird uns nicht nur zur Quelle von wichtigen Informationen, die wir nirgendwo sonst bekommen hätten, er wird uns zum Freund, und der Ort seiner Arbeit zum Gleichnis: Inbegriff der beharrlichen Hoffnung und der klugen realistischen Sozial-Politik der kleinen Schritte.
Der Weg zu ihm führt von der Küste steil hinauf. Die Missionsstation liegt 500 Meter über dem Meer. Ein einfaches Steinhaus mit einer Veranda, einige Nebengebäude, eine Schule, eine einfache weiträumige Kirche (die Pfarrei hat 13000 Einwohner, der Distrikt, den P. Bollen zu betreuen hat, 300000).
Ferner gibt es da oben noch einige kleine Steinhäuser für die Büros der einzelnen Arbeitssektoren, zum Beispiel eines für Bau-Planung und Finanzierungsfragen, eines für landwirtschaftliche Pläne usw. Es gibt auch ein kleines Gästehaus und einige Bambushütten. Wo sind die 13000 Pfarrkinder? Ihre Hütten liegen in den Kokoswäldern versteckt, weitab, die Wege sind schlecht, in der Regenzeit kaum begehbar.
Als wir aussteigen, kommt uns aus dem Missionshaus ein Mann entgegen, drei Kinder mit ihm, die beiden kleineren hängen an seinem Arm. Der Mann trägt den Sarong der Eingeborenen, aber darüber ein europäisches Hemd, übrigens tragen das viele Leute hier so, er aber ist ein Weißer, könnte jedoch ein Mischling aus holländischem und asiatischem Blut sein; wenn er sitzt, erinnert er an eine Buddha-Figur: mächtig in sich ruhend. Die Kinder klettern auf ihm herum, er ist für sie der Vater, sie wissen kaum, daß sie einmal Eltern hatten, die beim großen Putsch ermordet oder sonstwie gestorben sind. Der Mann ist Deutscher; ich hielt seinen Pfälzer Dialekt für einen fremden Akzent. Der Umgang mit seinem holländischen Amtsbruder und die Anpassung an die primitive Grammatik der indonesischen Sprache hatten sein Süddeutsch zu einer Art Basic-Deutsch verändert. Wir werden diese Sprache bei allen Deutschen hören, die wir im Lauf der nächsten Wochen treffen. Ihnen selber ist die Veränderung nicht bewußt.
P.Bollen, dem wir so unangemeldet ins Haus fallen und der bei der Vorstellung unsere Namen nicht verstand, ist freundlich. Gastfreundschaft ist indonesisches Gesetz und ist auch Notwendigkeit hier, wo einer auf den andern angewiesen ist und wo es keine Hotels gibt. Wir werden es immer wieder erleben: wo und wann, auch zu nachtschlafender Zeit, wir in einer Missionsstation ankommen, wir werden immer herzlich aufgenommen und bewirtet, ohne viel gefragt zu werden, außer nach dem Woher und Wohin. P. Bollen bietet uns sofort sein kleines Gästehaus an und läßt uns Waschwasser bringen, das so kostbare Wasser aus der großen Zisterne, in der das Regenwasser aufgefangen wird.
Unvergeßlicher Blick: tief unter uns das indigoblaue Meer, das gegen Abend, nach kurzer Dämmerung, ehe das Licht ganz erlischt, tief violett wird, im Meer einige kleine Inseln, auf einer davon ein Vulkan, zwischen uns und dem Meer eine weite grüne hügelige Mulde, die Abhänge bestanden mit Kokospalmen und Bananensträuchern. Was uns, von Italien her daran gewöhnt, zunächst nicht auffällt: das abschüssige Land ist terrassiert, jedes Fleckchen Erde ausgenützt. Noch begreifen wir nicht, daß das hier etwas Besonderes und Neues und ungemein Wichtiges ist. Zunächst schauen und schauen wir nur. Watublapi ist einer der schönsten Plätze der Erde, meine ich, es ist, so scheint es uns, ein Paradies: keine Luft- und keine Wasserverschmutzung, keine Fabriken und keine Ölheizungen, wenige Autos (und das indonesische Benzin stinkt nicht, es ist rein, man hat es im eigenen Land, der Meeresgrund ist voller Vorrat), es gibt hier keine wilden Tiere, auch keine Giftschlangen. Die Menschen sind still, wir hören sie nicht, sie gehen lautlos, sie sprechen leise, sie bewegen sich ohne Hast, sie sind voller Anmut und sie wissen es nicht. Als wir Wochen später, auf der Heimreise, in Jakarta die ersten Touristen und europäischen, amerikanischen, australischen Geschäftsleute sehen, ist es ein Schock für uns: wie laut sie sind, wie dick, wie anmaßend sie auftreten, wieviel Platz in der Welt sie beanspruchen, sie sind häßlich und ohne Anmut. Unser Begriff von Kultur hat sich verändert. Wer einmal Asien, das nicht von uns verdorbene, in sich aufgenommen hat, der kehrt als ein Gewandelter nach dem Westen zurück.
Wir sind bei P. Bollen zum Abendessen eingeladen, natürlich. Jetzt erst will er wissen, was mich nach Indonesien trieb, und so nach und nach bringt er heraus, wer seine Gäste sind. Er hat einige meiner Bücher in seinem Regal, wo nicht allzu viele stehen. Ich muß sagen, daß es mir eine Freude besonderer Art war, hier, runde vierzehntausend Kilometer von zu Hause, gelesen zu werden. Es wurde ein schöner Abend und wir bekamen viele Informationen.
Das Paradies Watublapi ist ein Ort harter Arbeit, vieler Krankheiten, geringer Lebenserwartung und so großer Armut, wie ich sie selbst im armen Süden Italiens nicht fand, und die Erde hier ist getränkt mit dem Blut der 800 Menschen, die bei der Kommunistenverfolgung 1966 umgebracht worden sind. Die Gemeinde Watublapi selbst war freilich ein ausgesparter Ort, nicht weil es hier keine Opposition gegeben hätte, sondern dank der Klugheit P. Bollens, der in aller Eile die „Katholische Partei“ gegründet hatte und alle seine Pfarrkinder aufnahm. Einer katholischen Partei anzugehören und zugleich Kommunist zu sein, das schien den Verfolgern der Kommunisten unmöglich, so ließen sie Watublapi ungeschoren, nur 17 Menschen wurden umgebracht. Was nach dem Putsch blieb, war ein tiefes Mißtrauen gegen die Politik und eine Apathie, welche die Entwicklungsarbeit schwer lähmte. Es bedurfte der mitreißenden Energie P. Bollens, dieses geschlagene, verstörte, arme Volk zu aktivieren.
Als P. Bollen 1968 bei rund tausend Schulkindern seiner Gemeinde eine Umfrage machte, was sie denn zum Frühstück gegessen hätten, kam es heraus, daß 139 gar nichts bekommen hatten, 79 einige Früchte, 179 gekochten Mais, 63 gekochten Reis und 567 einige Maniokknollen (Süßkartoffeln). Das gleiche bekamen sie auch mittags und abends. Das Eiweiß fehlte ganz, die Kinder waren unterernährt, mager, mit hochgeschwollenen Bäuchen, sie starben zu Haufen weg, und auch die Erwachsenen lebten nicht viel länger als 40 Jahre.
Wie kann denn das sein in einem Land mit tropischer Fruchtbarkeit und mit einem Meer, das von Fischen wimmelt und also Eiweiß genug anzubieten hat? Die Gründe sind verschiedener Art: