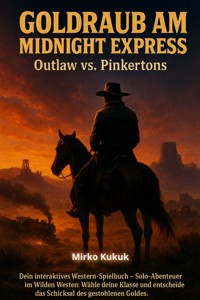Der Berliner Schattenfänger: Tauchen Sie ein in den Abgrund!
Kapitel 1: Die Schatten der Hauptstadt
Ein Hitzesommer lag wie eine bleierne Decke über Berlin. Die Luft stand schwer, erfüllt vom Summen der Klimaanlagen, dem Gemurmel der Touristen auf den Boulevards und dem fernen Rumpeln der U-Bahnen unter der Erde. Selbst um zwei Uhr morgens, als die meisten Bars ihre letzten Gäste hinausspuckten und die Spätis ihre Lichter dimmten, schien die Stadt nicht zur Ruhe zu kommen. Doch in einem schäbigen Keller in Kreuzberg, wo der Geruch von feuchtem Beton und altem Moder sich mit einem viel schärferen, metallischen Geruch mischte, herrschte eine ganz andere Art von Stille – eine tödliche, entsetzliche Ruhe.
Der junge Polizist, dessen Namen er später nicht mehr wissen würde, brach als Erster zusammen. Nicht physisch, sondern psychisch. Seine Augen weiteten sich, als er das sah, was früher einmal ein Mensch gewesen war. Es war seine erste Leiche, und dieser Anblick würde sich für immer in seine Netzhaut brennen, in seine Träume schleichen und seine Nächte bevölkern. Sein Kollege, ein älterer Haudegen mit jahrelanger Erfahrung im Berliner Nachtleben, legte ihm eine Hand auf die Schulter. „Atme, Junge. Atme.“ Aber selbst seine Stimme klang belegt, ein Echo des Schocks, der sich durch den muffigen Raum ausbreitete.
Das Opfer war eine junge Frau, vielleicht Mitte zwanzig. Ihre Kleidung, einst modisch und jugendlich, war jetzt zerrissen und mit Blut durchtränkt. Aber es war nicht das Blut allein, das den Raum mit einer unerträglichen Schwere erfüllte. Es war die Art der Verstümmelung, die jeden Atemzug stocken ließ. Präzise, fast chirurgisch wirkten die Schnitte, die Körperteile fehlten oder waren an makabren Stellen wieder angebracht worden. Es war kein wütendes Abschlachten, sondern eine grausame Inszenierung, ein morbides Kunstwerk aus Fleisch und Knochen. Ihr Gesicht war unkenntlich gemacht, ihre Augenlider entfernt – eine Geste, die den Anwesenden das Gefühl gab, selbst blind für die Schrecken dieser Welt zu sein.
Der Keller selbst war karg und verlassen. Ein paar leere Flaschen, Staub und Spinnweben. Nichts, was auf ein Verbrechen hindeuten würde, abgesehen von der entsetzlichen Präsenz der Leiche. Doch dann entdeckte einer der Forensiker ein Detail, das die Ermittler zunächst übersehen hatten, geblendet von der Brutalität des Anblicks. In die Haut des Opfers, direkt über dem Herzen, war ein seltsames Symbol geritzt. Es war keine einfache Kritzelei, sondern ein komplexes Muster aus verschlungenen Linien, das an alte germanische Runen erinnerte, aber doch anders war. Ein Kreis, durchzogen von zwei ineinandergreifenden Halbmonden, darüber ein stilisiertes Auge. Es schien fast zu leuchten in der spärlichen Beleuchtung des Kellers, ein brennendes Zeichen der Verachtung.
Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Erst nur ein Flüstern in den Funkgeräten der Einsatzkräfte, dann eine offizielle Bestätigung an die Presse. Die Polizei gab eine knappe Erklärung ab, riet der Bevölkerung zur Vorsicht. Doch die Gerüchte hatten bereits ihre eigene Dynamik entwickelt. „Serienmörder in Berlin!“ titelten die Boulevardblätter am nächsten Morgen, ihre Schlagzeilen fettgedruckt und reißerisch. Die Angst kroch in die Herzen der Berliner, legte sich wie ein unsichtbarer Schleier über die sonst so pulsierende Metropole. Menschen mieden abends dunkle Gassen, überprüften zweimal ihre Schlösser und blickten misstrauisch auf jeden Fremden, der ihren Weg kreuzte.
Im Polizeipräsidium herrschte Ausnahmezustand. Eine Sonderkommission wurde gebildet, angeführt von Hauptkommissar Klaus Riemann, einem erfahrenen, aber auch zynischen Ermittler, der schon zu viel gesehen hatte, um sich noch wirklich schockieren zu lassen. Doch dieser Fall, so spürte er, war anders. Die Brutalität, die Akribie, die fehlenden Spuren – es deutete alles auf einen Täter hin, der nicht nur mordete, sondern eine Botschaft übermitteln wollte. Und diese Botschaft war zutiefst verstörend.
„Keine Fingerabdrücke, keine DNA am Tatort, die nicht vom Opfer stammt“, berichtete der Forensiker mit müder Stimme. „Der Täter war akribisch. Hat alles gereinigt, bevor er den Leichnam zurückgelassen hat. Und die Art der Verletzungen… das ist kein Amateur.“ Riemann nickte, seine Augen auf die Fotos der Leiche geheftet. Das Symbol. Es ließ ihm keine Ruhe. Es hatte etwas Uraltes, etwas fast Spirituelles. „Hat jemand so etwas schon mal gesehen?“, fragte er in die Runde, aber nur Schweigen war die Antwort.
Die ersten Theorien machten die Runde: Ein psychisch Kranker, ein Ritualmörder, vielleicht sogar eine Art okkulter Kult. Doch nichts passte wirklich zusammen. Der Täter schien wie ein Geist zu agieren, unsichtbar und ungreifbar. Die Polizei stand vor einer Mauer, und die Zeit drängte. Die Angst in der Stadt wuchs mit jeder unbeantworteten Frage. Berlin, die Stadt der Freiheit und des Wandels, spürte plötzlich eine kalte Hand um ihr Herz – die Hand eines Jägers, der in den Schatten lauerte und bereit war, erneut zuzuschlagen. Die Ermittlungsleitung wusste, dass sie unkonventionelle Hilfe brauchten, um diesen Albtraum zu stoppen, bevor er sich zu einer wahren Katastrophe ausweitete. Der Schattenfänger hatte seine Jagd begonnen.
Kapitel 2: Lenas Ruf in die Dunkelheit
Der Anruf kam mitten in der Nacht, ein schrilles Geräusch, das die Stille von Lenas spärlich eingerichteter Wohnung in Berlin-Mitte zerriss. Sie fluchte leise, tastete nach ihrem Handy auf dem Nachttisch. Ihr Blick fiel auf die digitale Uhr: 3:17 Uhr. Niemand rief um diese Zeit an, es sei denn, es war wichtig. Oder schlimm. Sie war sich nicht sicher, welches von beidem ihr lieber war.
„Berg“, meldete sie sich, ihre Stimme noch rau vom Schlaf.
Am anderen Ende war eine tiefe, raue Stimme, die sie sofort erkannte: Hauptkommissar Klaus Riemann. Sie hatten vor Jahren bei einem Fall zusammengearbeitet – einem Fall, der Lena an ihre Grenzen gebracht hatte und Riemann dazu veranlasste, sie fortan als „die Frau, die in die Köpfe von Monstern sehen kann“ zu bezeichnen. Es war nicht immer ein Kompliment.
„Dr. Berg“, sagte Riemann, ohne Umschweife. „Ich brauche Sie. Wir haben einen Fall. Und der ist… anders.“
Lena spürte, wie eine kalte Welle der Vorahnung durch sie fuhr. Riemann war kein Mann, der sich leicht aus der Fassung bringen ließ. Wenn er das Wort „anders“ benutzte, bedeutete das in seiner Welt abgrundtief und verstörend. „Um was geht es?“, fragte sie, während sie sich aufsetzte und das Licht auf dem Nachttisch anschaltete. Der schwache Schein enthüllte Stapel von Fachbüchern, zerknüllte Notizen und eine Tasse kalten Tee. Ihr Leben war ihr Beruf.