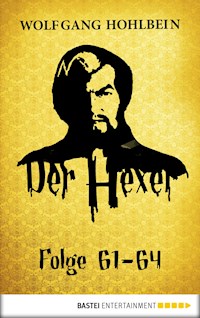
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Hexer - Sammelband
- Sprache: Deutsch
4 Mal Horror-Spannung zum Sparpreis!
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein - vier HEXER-Romane in einem Sammelband.
"Das Dorf der alten Kinder" - Folge 61 aus DER HEXER-Reihe - enthält das überarbeitete dritte Kapitel des Original-Taschenbuchs "Der Sohn des Hexers".
Der Wind heulte uns ein eisiges Willkommen entgegen, als wir auf den Bahnsteig herabtraten, und meine erste (und wie sich zeigen sollte, durchaus typische) Erfahrung mit Brandersgate war, dass eines der morschen Bretter des Bahnsteiges unter meinem Gewicht nachgab und ich jählings bis über den Knöchel in den morastigen Boden darunter versank.
"Der Opferturm" - Folge 62 aus DER HEXER-Reihe - enthält das überarbeitete vierte Kapitel des Original-Taschenbuchs "Der Sohn des Hexers".
Obwohl ich es bisher nicht für mögliche gehalten hatte, nahm der Sturm noch an Heftigkeit zu, während ich mich auf dem Rückweg nach Brandersgate befand. Der Himmel schien sämtliche Schleusen geöffnet zu haben, und aus dem Regen wurde ein Wolkenbruch, wie ich ihn selten zuvor erlebt hatte. Die Sturmböen erreichten eine Gewalt, dass ich mich kaum noch auf den Füßen zu halten vermochte, und mindestens ein halbes Dutzend Mal - wenn nicht öfter - verlor ich tatsächlich die Balance und stürzte, wobei es mir jedes Mal ein bisschen schwerer fiel, mich aus dem klebrigen Morast wieder emporzuarbeiten und weiterzulaufen.
"Stadt am Ende der Zeit" - Folge 63 aus DER HEXER-Reihe - enthält das überarbeitete fünfte Kapitel des Original-Taschenbuchs "Der Sohn des Hexers".
Ich befand mich in einem Teil der Stadt, den man nicht nur in jedem Fremdenverkehrsprospekt vergeblich gesucht hätte, sondern dessen bloße Existenz die Londoner Stadtverwaltung wohl am liebsten verleugnet hätte. Eigentlich hätte mich diese Umgebung nicht erschrecken dürfen. Und trotzdem tat sie es ...
"Dämonendämmerung" - Folge 64 aus DER HEXER-Reihe - enthält das überarbeitete sechste Kapitel des Original-Taschenbuchs "Der Sohn des Hexers".
Die Stadt brannte. An einem Dutzend Stellen schlugen turmhohe, weiß glühende Flammen in die Luft, als wären inmitten des Häusermeeres Feuer speiende Vulkane ausgebrochen, und der Himmel war hinter einer Decke aus schwarzen brodelnden Wolken verschwunden, aus denen sich Glut und brennende Trümmer über die Stadt ergossen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 702
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
DER HEXER – Die Serie
Über diese Folge
Über den Autor
Titel
Impressum
Der Hexer – Das Dorf der alten Kinder
Der Hexer – Der Opferturm
Der Hexer – Stadt am Ende der Zeit
Der Hexer – Dämonendämmerung
Vorschau
DER HEXER – Die Serie
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein kehrt wieder zurück! Insgesamt umfasste DER HEXER 68 Einzeltitel, die erstmalig als E-Books zur Verfügung stehen.
Über diese Folge
Dieser Sammelband beinhaltet die Hexer-Romane 61-64:
Der Hexer – Das Dorf der alten Kinder
Der Hexer – Der Opferturm
Der Hexer – Stadt am Ende der Zeit
Der Hexer – Dämonendämmerung
Über den Autor
Wolfgang Hohlbein, am 15. August 1953 in Weimar geboren, lebt mit seiner Frau Heike und seinen Kindern in der Nähe von Neuss, umgeben von einer Schar Katzen, Hunde und anderer Haustiere. Er ist der erfolgreichste deutsche Autor der Gegenwart. Seine Romane wurden in 34 Sprachen übersetzt.
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Folgen 61–64
BASTEI ENTERTAINMENT
Digitale Originalausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2012 by Bastei Lübbe AG
Erstmals veröffentlicht 1990 als Bastei Lübbe Taschenbuch
Titelillustration: © shutterstock / creaPicTures
Titelgestaltung: Jeannine Schmelzer
E-Book-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1583-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Vorwort Hexer Band 61
Mitautor Frank Rehfeld gibt in aufschlussreichen Vorworten Auskunft über Hintergründe und Inhalte der Hexer-Reihe. Seine Anmerkungen beziehen sich dabei in der Regel auf mehrere E-Book-Folgen. Hier das Vorwort zu Band 61.
Einer Katze werden im Volksmund neun Leben nachgesagt. Nun, diese Marke hat der Hexer noch nicht erreicht, schickt sich aber an, den eigenwilligen Vierbeinern Konkurrenz zu machen. Vielleicht liegt es daran, dass Wolfgang und Heike Hohlbein Katzenfans sind und sie züchten, jedenfalls scheint er im Hinblick auf die Abenteuer Robert Cravens ein Vorbild an ihnen genommen zu haben.
Zum ersten Mal erblickte der Hexer als einer von mehreren Helden innerhalb der Heftserie »Gespenster-Krimi« das Licht der (Verlags-)Welt. Acht Bände lang währte diese Kindheitsphase, wenn ich sie einmal so nennen darf. Dann wurde der Gespenster-Krimi eingestellt, was jedoch im Gegensatz zu den anderen Helden nicht das Ende des Hexers bedeutete, ganz im Gegenteil. Er erschien fortan als eigenständige Serie. In weiteren neunundvierzig Heftromanen wurden »Die phantastischen Abenteuer des Robert Craven«, wie der Untertitel lautete, beschrieben.
Nach knapp zwei Jahren, unmittelbar vor Erscheinen des Jubiläumsbandes 50, musste die Serie jedoch eingestellt werden. Sie hatte zwar von Anfang an eine begeisterte Leserschaft, doch war ihre Zahl leider zu gering.
Damit war auch der Plan vom Tisch, ähnlich wie bei John Sinclair eine zusätzlich zu den Heftromanen regelmäßig erscheinende Hexer-Taschenbuchserie herauszubringen, in der Roberts Vater, Roderick Andara, die Hauptrolle spielen sollte. Das endgültige Ende des Hexers schien gekommen; das erste Taschenbuch war zwar bereits fertig geschrieben, landete aber vorerst auf Halde.
Dann jedoch ereignete sich ein kleines Wunder. Die acht Hexer-Romane aus dem Gespenster-Krimi wurden in Form eines dicken Taschenbuch-Jumbos nachgedruckt – und es verkaufte und verkaufte sich, überflügelte binnen kürzester Zeit die Auflage der Hefte und mauserte sich zu einem regelrechten Bestseller. Anscheinend hatte die Serie mit ihrem anspruchsvollen Konzept erst im Buch ihre ideale Erscheinungsform gefunden; hinzu kam, dass diesmal Wolfgang Hohlbein als Autor auf dem Cover stand und er sich mit anderen Werken bereits eine treue Leserschaft erschrieben hatte, die erst jetzt, als das Pseudonym gelüftet war, auch auf den Hexer aufmerksam wurde. Völlig verblüfft über den unerwartet großen Erfolg lieferte der Bastei-Verlag rasch weiteren Lesestoff nach. Das bereits erwähnte Taschenbuch um Roderick Andara, das den ersten Band dieser Edition bildet, erschien und wurde ebenfalls ein Erfolg.
Weitere Jumbo-Bände mit Nachdrucken der Heftromane folgten, doch waren darin längst nicht alle Bände enthalten. Dafür war schlicht und einfach nicht genügend Zeit vorhanden, denn Wolfgang arbeitete bereits an einer Fortsetzung. Man wollte den Markt nicht mit mehreren Nachdrucken pro Jahr überschwemmen, weshalb in den vierten Jumbo-Band »Die sieben Siegel der Macht« nur die zum Verständnis der Gesamthandlung unbedingt nötigen Romane der Hefte 22 bis 49 aufgenommen wurden, an die mit einem neuen Buch angeknüpft wurde.
So feierte Robert Craven dann rund fünf Jahre nach der Einstellung der Serie mit »Der Sohn des Hexers« ein triumphales Comeback …
Frank Rehfeld
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Band 61Das Dorf der alten Kinder
Der Wind heulte uns ein eisiges Willkommen entgegen, als wir auf den Bahnsteig herabtraten, und meine erste (und wie sich zeigen sollte, durchaus typische) Erfahrung mit Brandersgate war, dass eines der morschen Bretter des Bahnsteiges unter meinem Gewicht nachgab und ich jählings bis über den Knöchel in den morastigen Boden darunter versank.
Mit einem zornigen Fluch stellte ich meinen Koffer ab, zog den Fuß behutsam aus den morschen Planken heraus und betrachtete missmutig den Morast, der an meinem Hosensaum klebte und meinen Schuh besudelte. Ich hatte die Schuhe erst vor drei Tagen gekauft, und sie hatten annähernd vierzig Pfund gekostet.
Hinter mir erscholl ein halblautes Lachen. Erbost fuhr ich herum und starrte Cohen an, aber das schadenfrohe Grinsen verschwand nicht von seinem Gesicht, sondern wurde eher noch breiter.
»Sie sind zu ungestüm, Robert«, sagte er spöttisch. Er schüttelte den Kopf. »Das ist typisch für euch Amerikaner. Sie werden noch eine Menge lernen müssen, wenn Sie länger in England bleiben wollen. Dies hier ist ein altes Land und viele von unseren Dingen sind ebenso alt. Aber sie sind nicht so alt geworden, weil wir grob mit ihnen umgehen.« Er trat an meine Seite, ergriff wortlos und ungefragt meinen Koffer und konnte sich nicht verkneifen, mit einem spöttischen Glitzern in den Augen hinzuzufügen: »Ihr Bruder hätte das gewusst.«
Ich bemühte mich, ihn mit Blicken aufzuspießen, während er an mir vorüberging, aber mir wurde auch schnell klar, dass mein Zorn nur Wasser auf seine Mühlen war, und so beherrschte ich mich, wischte den Schmutz von meinem Schuh, so gut es ging, und beeilte mich, ihm zu folgen. Dabei sah ich mich abermals und sehr aufmerksam auf dem Bahnhof um.
Nicht, dass es sonderlich viel zu sehen gegeben hätte. Der Bahnhof von Brandersgate machte auf den ersten Blick einen heruntergekommenen Eindruck. Der zweite Blick zeigte, dass dieser Eindruck nicht ganz richtig war: Brandersgate war nicht ziemlich heruntergekommen, er war vollkommen verwahrlost, baufällig, schmutzig und allem Anschein nach seit ungefähr einer Generation verlassen. Cohen hatte mich gewarnt und gemeint, dass dieser Ort schon bessere Zeiten gesehen hatte – aber wenn, dann musste das irgendwann vor der letzten Sintflut gewesen sein.
Es begann mit dem Bahnsteig, der aussah, als hätte ihn jemand als Zielscheibe für seine neu erworbene Gatlin-Gun missbraucht; offensichtlich war ich nicht der Einzige, dessen Gewicht zu viel für die morschen Bretter gewesen war. Aber dieser jämmerliche Eindruck setzte sich auch bei dem Haupt- (und zugleich einzigen) Gebäude fort. Die Bretter waren morsch, von Holzwürmern zerfressen, und wenn sie jemals einen Anstrich gehabt hatten, so musste das ungefähr hundertfünfzig Jahre her sein. Sämtliche Scheiben waren entweder blind vor Schmutz oder zerbrochen und mit Pappkarton geflickt, und aus dem Bahnhofsschild waren drei Buchstaben herausgefallen, sodass die Aufschrift nun BRNDRSGTE lautete. Ich vermutete, dass man es auch so ähnlich aussprach. Und was ich von der Stadt (Stadt?!) jenseits des Bahnhofsgebäudes erkennen konnte, das machte einen kaum Vertrauen erweckenderen Eindruck.
Hinter uns setzte sich der Zug wieder in Bewegung, und die Erschütterung ließ den gesamten Bahnhof erzittern. Die wenigen Scheiben, die noch in ihren Rahmen verblieben waren, klirrten hörbar. Ich betete, dass der Zugführer nicht etwa auf die Idee kam, seine Pfeife schrillen zu lassen. Vermutlich hätte das die ganze Bruchbude zum Einsturz gebracht.
Ich hatte Cohen endlich eingeholt. Er grinste noch immer über das ganze Gesicht und hielt mir meinen Koffer entgegen. Ich ignorierte es geflissentlich. »Wo bleibt Ihr Kollege?«, fragte ich. »Wollte er uns nicht am Bahnhof abholen?«
Cohen zuckte nur mit den Schultern. »Offensichtlich ist er nicht da«, antwortete er. »Dabei war der Zug doch pünktlich, oder?« Er warf einen Blick auf die Bahnhofsuhr, stellte fest, dass der große Zeiger fehlte und der kleine verbogen und auf der Zwölf stehen geblieben war, und setzte das Gepäck ab, um seine Taschenuhr aus der Weste zu ziehen.
»Auf die Minute«, sagte er, nachdem er den Deckel aufgeklappt und einen Blick auf das Zifferblatt geworfen hatte. Er klappte die Uhr wieder zu und ging weiter. Meinen Koffer ließ er stehen. »Vermutlich hat er sich nur verspätet. Aber das macht nichts. Schließlich ist die Stadt nicht so groß. Wir werden die Polizeiwache schon finden.«
Er hatte gut reden. Schließlich hatte er nur eine kleine Reisetasche in der Hand, während ich einen fast zentnerschweren Koffer mit mir schleppte. Cohen hatte schon während der fast achtstündigen Bahnfahrt hierher einige entsprechende Bemerkungen gemacht, und ich begann zu befürchten, dass er damit Recht gehabt hatte.
Allerdings muss ich zu meiner Ehrenrettung an dieser Stelle sagen, dass wir tatsächlich beide damit gerechnet hatten, am Bahnhof von einem seiner Kollegen abgeholt zu werden.
Cohen hatte eigens am Morgen noch einmal ein Telegramm an Constabler McGillycaddy – den zuständigen Polizeibeamten für diesen Bezirk – geschickt, in dem die genaue Ankunftszeit des Zuges gestanden hatte. Warum McGillycaddy nicht gekommen war, um uns wie erwartet abzuholen, war mir ein Rätsel.
Wenigstens so lange, bis wir das Bahnhofsgebäude umrundet hatten und Brandersgate zum ersten Mal zur Gänze sehen konnten. Ich war mit einem Male gar nicht mehr sicher, dass Telegramme hier auch pünktlich ausgeliefert wurden. Ich war mir nicht einmal mehr sicher, ob es hier so etwas wie eine Post gab; und wenn ja, ob die Bediensteten dort wussten, was ein Telegramm war.
Das mit Abstand beeindruckendste an Brandersgate war sein Name. Der Rest dieses gottverlassenen Kaffs bestand aus einer einzigen ungeteerten Straße, die sich bei jedem heftigen Regen in einen Sumpf verwandeln musste, einem knappen Dutzend windschiefer, hässlicher Häuser, deren Zustand sich nicht wesentlich von dem des Bahnhofes unterschied, und einer Kirche, der jemand den Turm gestohlen hatte; zurückgeblieben war nur ein hölzernes Skelett, das ganz so aussah, als würde es beim nächsten heftigen Windzug einfach umfallen.
Nun, dachte ich, zumindest in einem Punkt hatte Cohen Recht: Wenn es hier so etwas wie eine Polizeiwache gab, dann würden wir sie schnell finden.
Cohen trat auf die schlammige Straße hinunter und steuerte ein Gebäude auf der anderen Seite an, bei dem es sich wohl um eine Art Gemischtwarenladen handeln musste, denn hinter den schmuddeligen Scheiben stapelten sich Waren aller Art, und neben dem Eingang waren eine Anzahl Säcke und großer Holzkisten aufgetürmt.
Ich wartete vor der Tür, dass er zurückkam, und nutzte die Zeit, die kleine Ortschaft an der nördlichen Küste Schottlands einer zweiten, sehr viel eingehenderen und zumindest etwas objektiveren Musterung zu unterziehen.
Sehr viel mehr als vorhin gab es allerdings noch immer nicht zu sehen. Es war zu kalt für die Jahreszeit, und der böige Wind, der von der nahe gelegenen Küste her über die Ortschaft fauchte, tat ein Übriges, um die Menschen in die Häuser zurückzutreiben. Trotzdem spürte ich die neugierigen Blicke, die mich trafen. Das Auftauchen gleich zweier Fremder musste so etwas wie eine kleine Sensation bedeuten. Der Zugschaffner hatte uns verraten, dass nur äußerst selten Fahrgäste in Brandersgate ausstiegen; seit drei oder vier Jahren überhaupt so gut wie niemand mehr. Meistens hielt der Zug nicht einmal an. Wenn ich mich hier so umsah, konnte ich das auch gut verstehen. Ich wunderte mich sogar ein bisschen, dass ein Kaff wie dieses überhaupt einen Bahnhof hatte. Aber ich wunderte mich auch genauso darüber, dass ich überhaupt hier war. Zwar hatte ich keinen Grund, an Cohens Behauptung zu zweifeln, wonach Crowleys Spur direkt hierher führen sollte, aber wenn ich mich in dem gottverlassenen Kaff so umsah … Es passte einfach nicht.
Andererseits – wie gesagt – hatte ich keinen Grund, an Cohens Worten zu zweifeln. Scotland Yard arbeitete vielleicht manchmal ein wenig langsam, aber dafür mit gewohnter englischer Präzision. Und dieser düstere Hinweis war auch alles, was wir hatten. So hatten Cohen und ich kurz entschlossen den nächsten Zug bestiegen, der nach Norden ging, und waren hierhergekommen. Wenn ich bedachte, dass wir nicht einmal hundertprozentig sicher sein konnten, dass dieser Crowley auch tatsächlich unser Crowley war, dann hatte unser Vorgehen schon etwas von einer Verzweiflungstat an sich. Aber unsere Situation war auch ziemlich verzweifelt; vorsichtig ausgedrückt.
Seit Crowleys heimtückischem Anschlag auf mein Leben war etwas mehr als eine Woche vergangen, und ich hatte in dieser Zeit weder eine Spur von Howard noch von Gray, Rowlf oder Sill el Mot gefunden; und das, obwohl mir Harley, Grays Kutscher und Hausdiener, beim Leben seiner Mutter versichert hatte, alle vier in das niedergebrannte Haus am Ashton Place gehen gesehen zu haben. Und zusammen mit dem, was ich von Cohen erfahren und nach unserer Rückkehr aus den Kellern selbst in dem verwüsteten Haus gesehen hatte, ergab sich ein erschreckendes Bild: Howard und die anderen mussten erfahren haben, dass mich meine Schritte zu den Resten meines ehemaligen Zuhauses gelenkt hatten. Vielleicht hatten sie es sich auch einfach an den Fingern abgezählt, denn schließlich gab es nicht sehr viele Orte, zu denen ich gehen konnte. Gleichwie, sie waren mir gefolgt und offensichtlich in die gleiche Falle gegangen wie Matt, Thomas und ich. Harley hatte erzählt, dass irgendetwas mit dem Garten plötzlich nicht mehr in Ordnung gewesen sei, und dann waren Regen und Sturm so heftig geworden, dass er den Wagen vom Platz herunter hatte lenken müssen, aus Furcht, das Gefährt könne vom Sturm umgeworfen werden. Ich machte ihm keine Vorwürfe deswegen. Wahrscheinlich hatte ihm seine Vorsicht das Leben gerettet, denn was mit dem Garten plötzlich nicht mehr in Ordnung gewesen war, war klar: Harley hatte dasselbe Shoggotenmonster gesehen, das auch mich attackiert hatte. Das Haus war eine Falle, in die Howard und die anderen ebenso nichts ahnend hineingetappt waren wie ich.
Als Cohen kurz darauf ebenfalls dort eintraf, waren sie verschwunden gewesen. Wir hatten das Haus noch einmal gründlich durchsucht und waren auch in das hinaufgestiegen, was vom ersten Stock noch übrig geblieben war. Der Eingang zur ehemaligen Bibliothek war unbeholfen verbarrikadiert gewesen, also musste in der Zwischenzeit jemand dort gewesen sein, und es gab für mich keinen Zweifel, um wen es sich handelte. Im Raum selbst hatten wir weitere Spuren gefunden, die geradewegs auf die vermeintliche Standuhr zuführten, die sich wie durch Zauberei wieder an ihrem angestammten Platz befunden hatte. Howard und die anderen mussten durch das magische Tor in ihrem Inneren geflüchtet sein, aber es gab nicht den geringsten Anhaltspunkt, wohin ihre Flucht durch das Transportsystem der GROSSEN ALTEN sie verschlagen hatte.
Und von da ab war die Sache entschieden komplizierter geworden; und entschieden unerquicklicher. In Ermangelung einer anderen Unterkunft hatte ich mich zu Grays Haus begeben, wo ich von einer überglücklichen Mary Winden in die Arme geschlossen wurde. Ihre überschwängliche Wiedersehensfreude erschien mir ein wenig übertrieben; außerdem machte sie mich verlegen. Aber dann führte ich mir vor Augen, dass für mich subjektiv vielleicht nur wenige Stunden vergangen waren, seit ich sie das letzte Mal gesehen hatte, für sie (und den Rest der Welt) allerdings mehr als fünf Jahre, sah man von meinen kurzen Wachphasen während der letzten Tage ab, in denen ich kaum richtig zurechnungsfähig gewesen war.
Wie sich zeigte, hatte der gute Dr. Gray für alle Eventualitäten vorgesorgt; selbst für genau den Fall, der nun eingetreten war, nämlich den, dass ich plötzlich auf mich allein gestellt dastand. Dass ich mich für meinen eigenen Zwillingsbruder ausgab, musste er vorausgeahnt haben (was allerdings nicht besonders schwer war; schließlich hatte ich mich nicht so sehr verändert), denn in seinem Safe, den David für mich öffnete, befand sich nicht nur ein perfekt gefälschter amerikanischer Reisepass, der mich als Roderick Andara-Craven auswies, sondern auch alle anderen notwendigen Papiere, die es mir ermöglichten, in diese vorbereitete Rolle zu schlüpfen – und so ganz nebenbei auch über das ansehnliche Vermögen zu bestimmen, das mein »Bruder« mir hinterlassen hatte. Zumindest theoretisch. Praktisch würden wahrscheinlich noch Monate vergehen, bis ich den Kampf gegen die hundertköpfige Hydra der englischen Bürokratie gewonnen hatte und wirklich in meine neue Existenz schlüpfen konnte.
Aber das war im Moment meine allergeringste Sorge.
Das Einzige, was zählte, war, Howard und die anderen wiederzufinden. Und dabei traf ich auf einen völlig unerwarteten Verbündeten: Cohen.
Solange ich Chefinspektor Wilbur Cohen kannte, hatte er alles in seiner Macht Stehende getan, um mir und meinen Freunden Schwierigkeiten zu bereiten. Er glaubte mir kein Wort, aber aus irgendeinem Grund spielte er das Spiel zumindest nach außen hin mit und behandelte mich wie den Zwillingsbruder aus Amerika, der zu sein ich vorgab; wenn er auch keine Gelegenheit ausließ, mir durch die Blume klarzumachen, dass er mich durchschaut hatte. Trotzdem half er mir, nach dem geheimnisvollen Mr. Crowley zu suchen. Vermutlich hoffte er, dass er auf diese Weise auch Howards Spur wieder aufnehmen konnte, denn er war genauso versessen darauf, ihn wiederzusehen, wie ich. Wenn auch aus vollkommen anderen Gründen.
Aber so oder so – die Spur nach Schottland war vielleicht nicht mehr als ein Strohhalm, aber zugleich auch der einzige Strohhalm, den wir hatten.
Cohen kam zurück. Sein Gesichtsausdruck hatte sich verändert. Der Spott war von seinen Zügen verschwunden und hatte der verbissenen Selbstbeherrschung eines Mannes Platz gemacht, der soeben einen heftigen Streit hinter sich gebracht hatte. Aber er ignorierte meinen fragenden Blick und deutete stumm auf ein Gebäude am Ende der Straße. Es erhob sich unmittelbar neben der Kirche und war kaum weniger heruntergekommen und verfallen als der Rest der Ortschaft. Aber zumindest befanden sich noch alle Scheiben in ihren Rahmen.
Auf dem Weg dorthin begegneten wir dem ersten menschlichen Wesen von Brandersgate. Es war ein Junge von neun, vielleicht zehn Jahren. Er trat aus einem der Häuser heraus, machte einen Schritt auf die Straße und blieb abrupt stehen. Ein nachdenklicher Ausdruck erschien auf seinem Gesicht; ein Blick, der mich sonderbar berührte, denn er erschien mir um einiges zu ernst für einen Knaben dieses Alters. Er stand einfach nur da und blickte uns an, noch nicht einmal unfreundlich, aber eben auf jene Art, die mich schaudern ließ.
»Gab es Ärger?«, fragte ich.
»Im Laden?« Cohen zuckte mit den Schultern. »Kaum. Sie mögen keine Fremden hier. Und Engländer schon gar nicht.«
»Ich dachte, wir sind hier in England«, sagte ich spöttisch.
»Schottland«, verbesserte mich Cohen ruhig. »Hier ist jeder ein Ausländer, der weiter als zwei Meilen entfernt geboren wurde.«
Ich lächelte pflichtschuldig, aber wir sprachen nicht weiter, sondern legten den Rest des Weges schweigend zurück. Als wir vor dem bezeichneten Gebäude anhielten und Cohen anklopfte, drehte ich mich noch einmal herum und sah die Straße hinab.
Der Junge stand noch immer da und beobachtete uns. Aber er war nicht mehr allein. Auf beiden Seiten der Straße waren weitere Kinder aus den Häusern getreten. Es waren acht oder neun. Keines von ihnen war älter als zehn Jahre, und sie alle blickten uns auf die gleiche, beinahe Angst machende Art an.
»Es sind Fremde in der Stadt«, sagte Barney. Er sagte es ruhig, mit einem leisen Ton von Missbilligung, vielleicht sogar Misstrauen, und etwas Nachdenkliches schwang in seiner Stimme; und er sagte es ganz und gar nicht auf eine Art, auf die ein Fünfjähriger so etwas sagen würde. »Ich möchte wissen, was sie hier suchen.«
Der fremde Ton in der Stimme ihres Sohnes gab Alyssa einen tiefen, schmerzhaften Stich, und noch bevor sie sich vom Herd umwandte und in Barneys Gesicht sah, wusste sie, was sie darin erblicken würde, nämlich einen Ausdruck von Ernst und beinahe Verbissenheit, der ebenso wenig ins Antlitz eines Fünfjährigen gehörte wie dieser Klang in seiner Stimme. Aber sie waren nicht allein. Tom saß am Tisch und löffelte geistesabwesend die dünne Graupensuppe, die sie gekocht hatte, zwar den größten Teil seiner Konzentration auf die Titelseite der Zeitung verwendend, aber er hörte doch zu, und so zwang sie ein Lächeln auf ihre Züge und fragte nur: »So? Vielleicht sind sie ja nur auf der Durchreise.«
Wie sie erwartet hatte, ließ Tom ganz kurz seine Zeitung sinken und sah sie über den Rand der Gazette hinweg für eine Sekunde durchdringend an, ehe er sich wieder seiner Lektüre zuwandte, und Barney antwortete mit einem heftigen Kopfschütteln:
»Niemand kommt auf der Durchreise nach Brandersgate, das solltest du wissen, Mutter.«
Mutter. Schon dieses Wort allein machte es Alyssa schwer, weiter ihre Beherrschung zu bewahren. Ein Fünfjähriger sollte nicht Mutter zu seiner Mutter sagen. Mom, Mutti, Ma – aber nicht Mutter, nicht auf die Art, auf die Barney das Wort aussprach. Früher hatte er das nie getan.
Sie nahm den Topf mit dem Braten vom Herd, trug ihn zum Tisch und sah zu, wie Barney drei Teller und das Besteck aus dem Schrank holte. Er musste sich dazu auf einen Hocker stellen, denn er war viel zu klein, um an den Hängeschrank über dem Ofen zu kommen, aber seine Bewegungen waren schnell und präzise; nach wenigen Augenblicken standen die Teller an ihrem Platz und Tom faltete endlich raschelnd seine Zeitung zusammen und griff wie immer als Erster zu.
Früher hatte Barney das nie getan. Die Phase, in denen Fünfjährige ihren Müttern freiwillig bei der Hausarbeit halfen, ging meist ebenso schnell vorüber, wie sie aufkam, aber bei Barney nicht. Alyssa empfand wenig Dankbarkeit dafür. Ganz im Gegenteil machte ihr die Hilfsbereitschaft ihres einzigen Sohnes beinahe Angst. Barney ging ihr nicht mit der normalen Begeisterung eines Kindes zur Hand, das seine eigenen Fähigkeiten erforschte und dabei war, zu entdecken, dass etwas zu tun eine durchaus positive Erfahrung ist, die Last dieser Arbeit aber noch nicht empfindet, sondern tat es mit der beiläufigen Verbissenheit eines Erwachsenen, der Dinge eben tut, weil sie getan werden müssen, aus keinem anderen Grund.
Nachdem Tom sich seinen Anteil an dem Braten abgesäbelt und Kartoffeln, Gemüse und Bratensauce auf seinen Teller gehäuft hatte, sagte Barney plötzlich: »Sie sind zu McGillycaddy gegangen.«
Alyssa blickte scheinbar konzentriert auf ihren Teller, aber ihr Mann sah überrascht auf, und ihr entging auch keineswegs der rasche, fast misstrauische Blick, den er in ihre Richtung warf, ehe er sich wieder an seinen Sohn wandte. »Bist du sicher?«
Barney nickte. »Stan hat es gesehen. Nick auch. Und Estelle ebenfalls.« Er begann mit bedächtigen und ganz und gar nicht kindlichen Bewegungen zu essen und er kaute penibel den Mund leer, ehe er fortfuhr. Alyssa hätte viel darum gegeben, hätte er einmal mit vollem Mund geredet oder sich bekleckert oder auch einfach lustlos in seinem Essen herumgestochert, wie Kinder seines Alters es oft tun. »Sie haben in Cordwailers Laden nach dem Weg gefragt. Er sagt, sie wären … seltsam.«
»Seltsam?« Tom war nicht ganz so gut erzogen wie sein Sohn. Er sprach mit vollem Mund. »Hmwiemeinschudasch?«
»Seltsam eben«, erwiderte Barney mit einem Achselzucken und einem missbilligenden Blick auf den Streifen dunkler Bratensauce, der am Kinn seines Vaters herunterlief und sich anschickte, auf sein Hemd herunterzutropfen, auf dem sich schon eine ganze Anzahl Flecken der verschiedensten Herkunft befanden. »Gut gekleidet. Städter. Cordwailer meint, sie kämen aus London. Jedenfalls sprachen sie wie Städter.«
Tom schluckte heftig, schaufelte sich eine neue Gabel in den Mund und sagte: »Daschischnigut. Wirschollten …« Er schluckte, hustete und fuhr mit etwas verständlicherer Stimme fort: »Wir sollten Pasons Bescheid sagen, damit er sich die beiden einmal anschaut. Ich werde gleich nach dem Essen –«
»Estelle ist schon auf dem Weg zu ihm«, unterbrach ihn sein Sohn. »Und Nick und ein paar von den anderen behalten sie im Auge.«
Der Rest der Mahlzeit verlief in völligem Schweigen. Als sie fertig gegessen hatten, half Barney seiner Mutter, das Geschirr in die Spüle zu tragen und holte auch noch einen Eimer Wasser von der Pumpe, die auf dem kleinen Hof hinter dem Haus stand. Dann verabschiedete er sich – es war bereits nach eins, und in einer halben Stunde fingen die Exerzitien an; er musste sich sputen, um noch rechtzeitig am Turm zu sein.
Tom blickte seinem Sohn voller Stolz nach, als er das Haus verließ und mit schnellen Schritten – aber ohne zu rennen – in südlicher Richtung davonging. »Er ist ein richtiger Prachtkerl«, sagte er. Er schüttelte den Kopf. »Fünf Jahre! Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich es einfach nicht glauben. Wir haben wirklich Glück, einen solchen Sohn zu haben, nicht wahr?«
Alyssa nickte. Aber sie sah ihren Mann dabei nicht an, sondern konzentrierte sie ganz auf das schmutzige Geschirr, das Barney ihr in die Spüle gestapelt hatte.
Sie wollte nicht, dass Tom ihre Tränen sah.
Constabler McGillycaddy sah nicht aus, wie man es von einem Constabler der königlich-britischen Polizei erwartete. Er sah überhaupt nicht aus wie ein Polizist, sondern eher wie ein leicht verwirrter Weihnachtsmann, der sich sowohl in der Jahreszeit als auch in der Gegend vertan hatte: Er war so klein, dass er sich auf die Zehenspitzen hätte stellen müssen, um Cohen oder gar mir auch nur bis ans Kinn zu reichen, hatte schütteres weißes Haar, das eine Spur zu lang war, um noch gepflegt zu wirken, und rote Pausbäckchen, die von großer Gesundheit, ebenso gut aber auch vom zu ausgiebigen Genuss schottischen Whiskys herrühren mochten. Er trug keine Uniform, sondern einen abgewetzten roten Hausmantel, an dessen Bündchen und Kragen tatsächlich einmal ein weißer Fellbesatz gewesen sein musste, und dazu passende Hauslatschen, die an den Zehen durchgescheuert waren. Um das Maß voll zu machen, war die Polizeiwache keine Polizeiwache, sondern ein winziges, offensichtlich nur aus zwei Zimmern bestehendes Haus, in dem McGillycaddy wohnte.
»Ja?« Der Blick, mit dem er uns begrüßte, nachdem er Cohens energischem Anklopfen gehorcht und die Haustür geöffnet hatte, sprach Bände: McGillycaddy hatte nicht vergessen uns abzuholen. Er hatte nicht die geringste Ahnung, wer wir waren.
»Constabler McGillycaddy?«, vergewisserte sich Cohen, der offensichtlich nicht so recht glauben konnte, was er sah.
»Der bin ich«, antwortete McGillycaddy. »Und was kann ich …« Er stockte, blinzelte erst Cohen, dann mich und schließlich wieder Cohen kurzsichtig an und schlug sich dann mit der flachen Hand vor die Stirn, dass es klatschte.
»Sie müssen die Herren Cohen und Raven sein, aus London«, sagte er.
»Craven«, verbesserte ich ihn automatisch, und Cohen, der mittlerweile hörbare Mühe hatte, seine Contenance zu wahren, fügte mit bebender Stimme hinzu:
»Ganz recht. Und wir stehen uns seit geschlagenen zehn Minuten die Beine an ihrem famosen Bahnhof in den Bauch und warten darauf, dass uns jemand abholt.«
»Seit zehn Minuten?« McGillycaddy verdrehte sich den Hals, offenbar, um auf eine Uhr zu sehen, die irgendwo im Inneren des Hauses an der Wand hing. »Der Zug ist schon da?«
»Er war auf die Minute pünktlich«, antwortete Cohen. Sein Gesicht begann langsam rot anzulaufen.
»Aber das ist noch nie passiert!«, sagte McGillycaddy verblüfft. »Er war wirklich pünktlich? Sie sind ganz sicher?«
Cohens Gesicht begann sich immer dunkler zu färben, während ich immer mehr Mühe hatte, vor Lachen nicht laut herauszuplatzen. Ich war nicht einmal sicher, ob McGillycaddy uns nicht auf den Arm nahm – aber wenn, dann tat er es so bravourös, dass er allein dafür Bewunderung verdiente.
»So schlimm war es ja auch wieder nicht«, sagte ich hastig, ehe Cohen mit seiner unnachahmlich freundlichen Art lospoltern konnte. Immerhin waren wir hier, weil wir etwas von McGillycaddy wollten. »Gottlob ist Brandersgate ja nicht so groß, dass man sich hier verirren könnte. Und wir reisen mit leichtem Gepäck, wie Sie sehen.«
»Sicher«, antwortete McGillycaddy abwesend. »Und was kann ich jetzt für Sie tun?«
Cohens Unterkiefer klappte herunter, und ich sah, wie sich hinter seinen Augen ein Sturm zusammenbraute. McGillycaddy tat mir jetzt schon leid. Aber der erwartete Zornesausbruch kam nicht. Stattdessen sagte er mit überraschender Ruhe: »Unser Kommen ist Ihnen nicht angekündigt worden?«
»Kommen? Angekündigt?« McGillycaddy kratzte sich am Schädel, und dann hellte sich sein Gesicht auf. »O ja, jetzt erinnere ich mich. Da kam ein Telegramm, heute Morgen. Mit dem Frühzug, wissen Sie? Ich war noch erstaunt, dass er angehalten hat. Normalerweise fährt er einfach durch, aber heute hat er gehalten, und der Schaffner ist ausgestiegen und –«
»Haben Sie es zufällig gelesen?«, unterbrach ihn Cohen gepresst.
»Gelesen?« McGillycaddy musterte ihn vorwurfsvoll. »Selbstverständlich habe ich es gelesen, Inspektor Corben.«
»Cohen«, verbesserte ihn Cohen.
»Sag ich doch. Also – selbstverständlich habe ich es gelesen. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll …« Er verriet uns nicht, was er getan hätte, wenn er ganz ehrlich sein sollte (auch nicht, ob wir aus dieser Bemerkung etwa schließen konnten, dass er normalerweise nicht ganz ehrlich war), sondern kratzte sich abermals am Schädel, drehte sich plötzlich herum und öffnete die Tür. »Vielleicht treten Sie erst einmal ein. Es ist ungemütlich draußen. Ich habe gerade Tee gemacht. Vielleicht kann ich Ihnen und Mister Carven ja eine Tasse anbieten?«
Cohen und ich tauschten einen bezeichnenden Blick, und Cohen tippt sich mit dem Zeigefinger an die Schläfe. Ich grinste, ergriff meine Tasche und trat mit einem raschen Schritt an ihm vorbei durch die Tür.
Dahinter erwartete uns eine Gerümpelkammer. Jedenfalls hielt ich das, was ich sah, im ersten Moment dafür. Aber dann erblickte ich den Kamin, in dem ein behagliches Feuer brannte, den mit Papieren, Zeitschriften und Büchern übersäten Tisch und den abgewetzten Sessel davor und begriff, dass in diesem Tohuwabohu tatsächlich ein Mensch lebte.
»Ui!«, entfuhr es Cohen. »Ist das … das örtliche Revier?«
McGillycaddy sah ihn vorwurfsvoll an, bedeutete mir kopfschüttelnd, die Tür zu schließen, und begann mit flinken Bewegungen zwei Stühle aus dem Sperrmüll herauszusuchen, der das Zimmer fast bis in den hintersten Winkel füllte. »Das ist meine Wohnung«, sagte er. »Brandersgate ist ein kleiner Ort, Inspektor. So etwas wie ein Revier haben wir hier nicht. Wir brauchen es auch nicht.«
»Aber Sie sind der zuständige Constabler?«, fragte Cohen. »Ich meine, wir haben uns nicht in der Adresse geirrt?«
»Keineswegs.« McGillycaddy seufzte. »Ich sehe schon, Sie sind anderes gewöhnt. Wahrscheinlich ist das normal, wenn man aus der Stadt kommt, wie Sie und Mister Graver. Hier auf dem Land läuft eben alles etwas anders. Aber nehmen Sie doch Platz.«
Cohen gehorchte, während ich vergeblich versuchte, die Tür völlig zu schließen. Sie war verzogen. Ich wandte ein bisschen mehr Kraft auf – und blickte schuldbewusst auf den abgebrochenen Türgriff, den ich plötzlich in der Hand hielt.
»Hoppla«, sagte McGillycaddy. Mit zwei flinken Schritten war er bei mir, nahm mir den Griff aus der Hand und betrachtete ihn eine Sekunde lang.
»Das tut mir leid«, begann ich. »Ich werde selbstverständlich für den Schaden –«
»Es ist nicht Ihre Schuld, Mister Craber«, unterbrach mich McGillycaddy. »Dieses Haus ist alt. Wie alles hier.« Er seufzte. »Ich bringe das später in Ordnung.« Und damit schloss er die Tür mit einem wuchtigen Fußtritt und warf den zerbrochenen Griff einfach über die Schulter hinter sich. Er segelte um Haaresbreite an Cohens Gesicht vorbei, prallte gegen den Kaminsims und verschwand polternd in dem Krempel, der fast kniehoch überall auf dem Boden aufgestapelt war.
Ich setzte mich, nachdem McGillycaddy auch für mich einen Stuhl aus dem allgemeinen Durcheinander ausgegraben hatte; eingedenk meiner soeben gemachten Erfahrungen mit der Tür allerdings sehr vorsichtig.
»Um auf den Grund unseres Hierseins zu kommen –«, begann Cohen, wurde aber sofort wieder von McGillycaddy unterbrochen.
»Eines nach dem anderen, Mister Cohagen. Zuerst einmal lassen Sie mich Ihnen und Mister Crabbe eine Tasse Tee einschenken. Sie werden sehen, dabei redet es sich viel gemächlicher. Und wir haben Zeit. Der Abendzug kommt erst in vier Stunden. Vorausgesetzt, er ist pünktlich.«
Cohen verdrehte die Augen, aber er schien einzusehen, dass es vollkommen sinnlos war, so etwas wie ein vernünftiges Gespräch mit McGillycaddy führen zu wollen; jedenfalls nicht zu seinen Bedingungen. So beließ er es bei einem gequälten Lächeln und sagte nichts mehr, während McGillycaddy zwei Tassen aus dem Gerümpel auf dem Tisch ausgrub (er pustete hinein, um den Staub zu entfernen, besaß aber wenigstens den Anstand, noch einmal mit dem Zipfel seines Hausmantels hindurchzufahren), jedem von uns eine in die Hand drückte und kochend heißen Tee hineingoss. Ich nippte daran und verzog das Gesicht.
»Schmeckt er Ihnen?«, fragte McGillycaddy.
Ich beeilte mich zu nicken. Der Tee schmeckte so, wie er aussah – wie heißes Wasser.
»Nun aber zum Grund Ihres Besuches, Inspektor Corles«, sagte McGillycaddy.
»Cohen«, verbesserte ihn Cohen automatisch. »Ich verstehe Sie nicht ganz, Constabler. Sie haben unser Telegramm doch bekommen?«
»Sicher.« McGillycaddy setzte sich, trank einen Schluck von seinem Tee und verzog genießerisch das Gesicht. »Köstlich. Es geht doch nichts über eine gute Tasse Tee, nicht wahr?«
»Das Telegramm«, erinnerte Cohen vorsichtig.
»O ja, sicher, das Telegramm. Also, wie gesagt: Ich habe es gelesen, aber um ehrlich zu sein, ist mir nicht ganz klar, wie ich Ihnen behilflich sein kann, Inspektor Cluseau.«
»Aber Sie selbst haben doch –«
»Crowley«, unterbrach ich ihn. »Inspektor Cohen und ich sind auf der Suche nach einem gewissen Crowley.«
»Aha«, sagte McGillycaddy. »Und wie kann ich Ihnen dabei helfen?«
Cohens Augen wurden schmal. »Wollen Sie uns auf den Arm nehmen, Constabler?«, fragte er.
»Nichts liegt mir ferner«, antwortete McGillycaddy. »Aber ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen helfen könnte.«
»Constabler McGillycaddy«, sagte Cohen betont. »In meinem Büro in Scotland Yard liegt eine von Ihnen unterzeichnete telegrafische Auskunft, einen gewissen Crowley betreffend, der hier in Brandersgate lebt und auf den die Beschreibung eines Mannes zutrifft, den Mr. Craven und ich vor zwei Wochen in London getroffen haben.«
»Ich habe diesen Namen noch nie im Leben gehört«, versicherte ihm McGillycaddy. »Und ich habe auch keinen Bericht an Scotland Yard geschickt. Schon gar nicht telegrafisch.«
Cohen wollte auffahren, aber ich machte eine rasche, beruhigende Geste und versicherte mich damit gleichzeitig McGillycaddys Aufmerksamkeit. »Sind Sie ganz sicher, Constabler?«, fragte ich. »Es ist äußerst wichtig, müssen Sie wissen.«
»Hundertprozentig«, antwortete McGillycaddy. »Ich weiß genau, dass ich keinen Bericht an Scotland Yard geschickt habe, oder an sonst wen. Ich bin vielleicht etwas alt und vielleicht ein bisschen unordentlich, aber ich bin nicht blöd.«
»So war das nicht gemeint«, sagte ich hastig. »Ich verstehe das nur nicht, wissen Sie? Sie sind der einzige Polizeibeamte hier im Ort?«
»Der einzige im Umkreis von dreißig Meilen«, bestätigte McGillycaddy.
Cohen und ich sahen uns betroffen an.
»Aber … wenn Sie uns diesen Bericht nicht geschickt haben, Constabler, wer war es dann?«, murmelte Cohen schließlich. Darauf wusste keiner von uns eine Antwort.
»Wo, verdammich, simmer hier?« Rowlf sprach das aus, was ihnen wohl allen vier durch den Kopf ging, und sah sich dabei mit verdrießlichem Gesicht um.
»Jedenfalls nicht mehr am Ashton Place«, erwiderte Howard. Er fühlte sich benommen; auf jene sonderbare, kaum mit Worten zu beschreibende Art, die nur der Weg durch das Transportsystem der GROSSEN ALTEN zu verursachen imstande war und die wohl weniger körperlich als seelisch bedingt war; fast, als weigere sich etwas im menschlichen Teil seines Seins, jenes unsagbar fremde Universum zu akzeptieren, durch das sie gegangen waren.
Er drehte sich um. Wie nicht anders erwartet, war der wabernde Tunnel, der sie aufgenommen hatte, als sie in den Ruinen von Andara-House in die Standuhr getreten waren, verschwunden. Hinter ihnen erhob sich eine massive Felswand.
Sie befanden sich in einer gewölbeartigen Höhle, deren steinerne Decke sich Dutzende Yards über ihnen wie eine Kuppel spannte. Es gab zahlreiche kleine Löcher darin, durch die genügend Licht hereinfiel, dass sie ihre Umgebung wenigstens undeutlich erkennen konnten. Mehrere Stollen zweigten von der Höhle ab.
Howard strich mit den Fingerspitzen über die Wand. Das Felsgestein war rau, aber ohne Zweifel künstlich bearbeitet worden. Deutlich waren die Spuren von Werkzeugen zu erkennen.
Sill hatte sich inzwischen den mit Staub und feinem Geröll bedeckten Boden genauer angesehen. »Fußspuren«, sagte sie. »Und zwar ziemlich viele. Aber einige davon sind … sonderbar. Seht euch das an.«
Howard ging neben ihr in die Hocke. Tatsächlich waren die Abdrücke zahlreicher nackter Füße zu sehen, aber auch noch andere Spuren. Sie waren in dem Gewirr kaum zu erkennen, nur vereinzelt der Abdruck einer Ferse oder eines Zehs, die deutlich größer als die von Menschen waren. Sie ähnelten nichts, was Howard zuvor gesehen hatte, und der Anblick verstärkte noch das Unbehagen, das er empfand, seit sie diese Höhle betreten hatten.
»Still!«, sagte Sill plötzlich. Sie richtete sich auf, griff unter ihren Mantel und zog ihr Schwert, wobei sie die Klinge vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger durchgleiten ließ, um kein verräterisches Geräusch zu verursachen. Einige Sekunden lang blickte sie sich aufmerksam um.
»Was ist?«, raunte Howard.
»Ich dachte, ich hätte etwas gehört.« Sie fuhr urplötzlich herum und riss ihr Schwert hoch. Angestrengt starrte sie zu einem der Stollen hinüber. »Da ist etwas!«
Auch Howard sah in die angegebene Richtung, doch er konnte nichts entdecken. »Bist du sicher?«
»Völlig sicher. Da war eine Bewegung, eine Art … Huschen. Ich habe nichts Genaues gesehen, aber es war da.«
»Sehma doch nach«, schlug Rowlf vor. »Bleib du mittem Dokta bessa zurück, Howard.«
Sill und er näherten sich dem Stollen von verschiedenen Richtungen und trafen direkt vor dem Eingang wieder zusammen. Rowlf trat in den Gang hinein. Als er nach ein paar Sekunden zurückkam, zuckte er mit den Schultern.
»Nix zu seh’n«, verkündete er. »Außerdem isses stockfinster.«
Gleich darauf drang ein dumpfes Rumoren an ihre Ohren, gefolgt von einem Geräusch, das wie ein ferner, verzerrter Schrei klang.
»Was hat das alles zu bedeuten, Howard?«, fragte Gray nervös. Die Angst des Anwalts war unübersehbar. »Seit ich dich kenne, habe ich ja schon eine Menge seltsamer Sachen erlebt, aber das hier … Ich weiß nicht mal, wo wir überhaupt sind.«
Howard musterte ihn einige Sekunden ernst. »Vielleicht ist es besser, wenn ich dir die Wahrheit sage«, antwortete er dann. »Ich fürchte, die Frage ist nicht nur, wo wir sind, sondern auch, wann. Ich bin schon ein paar Mal durch die Standuhr getreten, damals, als das Transportsystem noch richtig funktionierte. Aber etwas war diesmal anders. Wir haben uns nicht nur durch den Raum bewegt.«
»Ach«, sagte Gray. »Worin kann man sich denn sonst noch bewegen?« Er lächelte, aber es wirkte sehr nervös.
»In der Zeit«, antwortete Howard. »Ich fürchte, wir haben uns auch durch die Zeit bewegt.«
Gray starrte ihn ungläubig an. Obwohl es in der Höhle kühl war, perlte Schweiß auf seiner Stirn. »Das … ist ein Scherz, nicht wahr?«, fragte er.
Howard schüttelte den Kopf. »Ich fürchte, nein«, sagte er. »Die Uhr war die ganze Zeit über da, weißt du?«
»Da?«
»In der Bibliothek«, erklärte Howard. »Sie … war gar nicht weg. Wir konnten sie nur nicht sehen. Ich weiß, wie phantastisch sich das anhört, aber es ist die Wahrheit. Sie war … in der Zukunft verborgen. Sill hat mir geholfen, sie zurückzuholen.«
Gray erbleichte noch ein bisschen mehr. Beinahe Hilfe suchend sah er zu Sill hinüber, aber die dunkelhaarige Araberin nickte nur. Gray fuhr sich nervös mit der Hand über das Kinn und wandte sich wieder an Howard: »Und … wie lange? Ich meine … wie weit?«
»Ich weiß es nicht«, gestand Howard. »Es war nur ein flüchtiger Eindruck, aber ich konnte deutlich spüren, wie die Mauern der Zeit für einen Moment eingerissen wurden. Es kann sich um Minuten handeln, möglicherweise aber auch Stunden oder sogar Tage. Ich glaube jedoch nicht, dass der Sprung besonders groß war.« Den letzten Satz fügte er eindeutig nur hinzu, um Gray zu beruhigen. Und ein bisschen auch sich selbst.
Erneut ertönte der unheimliche Schrei und ließ sie zusammenschrecken.
»Das kam aus dem Stollen, in dem ich die Bewegung gesehen habe«, sagte Sill. Sie hielt ihr Schwert fest umklammert. Immer wieder glitt ihr Blick zu dem runden Loch in der Felswand.
»Wir sollten nachsehen gehen«, erklärte Howard. »Das ist auf jeden Fall besser, als einfach hier herumzustehen. Also müssen wir uns sowieso für einen der Stollen entscheiden.«
»Is vielleicht bessa, wennich mit Sill allein gehn tu«, nuschelte Rowlf.
Howard schüttelte den Kopf. »Solange wir nicht wissen, wo wir sind, bleiben wir zusammen«, entschied er. »Falls es hier irgendwelche Gefahren gibt, können wir ihnen auf diese Art besser begegnen. Aber zunächst brauchen wir Licht.« Er sah sich suchend um und entdeckte in einer Ecke einige trockene Äste, aus denen er zwei dicke, knapp armlange Stöcke heraussuchte. »Sill, ich brauche ein Stück von deinem Mantel.«
Die Araberin riss einen breiten Streifen vom Saum des Kleidungsstückes ab. Howard zerriss das Stück noch einmal und wickelte die beiden Streifen um die Enden der Stöcke. In seiner Tasche fand er Streichhölzer. Das erste Hölzchen brach ihm ab, doch mit dem zweiten gelang es ihm, die Stofffetzen in Brand zu stecken. Knisternd fing das trockene Holz Feuer. Er reichte eine der Fackeln an Rowlf weiter und zog seinen Revolver. »Gehen wir.«
Als erster trat er in den Stollen hinein. Die Decke war gerade hoch genug, dass er aufrecht gehen konnte, ohne mit dem Kopf anzustoßen. Sill folgte ihm dichtauf, dann kam Gray, und den Abschluss bildete Rowlfs hünenhafte Gestalt.
Immer noch drang leise das dumpfe Rumoren an ihre Ohren, und der Boden vibrierte fast unmerklich unter ihren Füßen, als würden irgendwo tief im Leib der Erde gewaltige Maschinen arbeiten. Davon abgesehen war es totenstill, nur das Geräusch ihrer eigenen Schritte war zu hören. Wenn hier wirklich jemand gewesen war, wie Sill behauptete, so war er verschwunden.
Ein warmer Luftzug wehte ihnen aus dem Stollen entgegen und brachte die Fackeln zum Flackern. Geisterhaft glitt das Licht über die unebenen Wände, brach sich in Ritzen oder an winzigen Vorsprüngen und warf tanzende Schatten, die Howard die Illusion von Bewegung vorgaukelten und Leben zu erschaffen schienen, wo keines war.
Der Stollen fiel in sanfter Neigung ab. Glücklicherweise gab es keine Abzweigungen, sodass nicht die Gefahr bestand, sich zu verirren, wobei Howard sich keine Illusionen machte. Es war völlig egal, ob sie zu der Höhle zurückfanden. Der Weg, auf dem sie hergekommen waren, war hinter ihnen erloschen. Was sie finden mussten, war ein Ausgang aus diesem unterirdischen Labyrinth.
Das Rumoren wurde lauter, je weiter sie vordrangen, und auch Howards Unbehagen steigerte sich mit jedem Schritt. Keiner von ihnen sprach ein Wort, und am liebsten hätte er immer wieder zurückgeblickt, um sich zu vergewissern, dass seine Gefährten noch hinter ihm waren.
Aber nicht nur diese Umgebung war für seine wachsende Nervosität verantwortlich. Er hatte den anderen nicht die ganze Wahrheit gesagt, um sie nicht unnötig zu beunruhigen, doch sich selbst konnte er nicht belügen. Seine Aussage, er glaube nicht, dass sie sich weiter als ein paar Stunden in der Zeit bewegt hätten, war lediglich eine aus der Luft gegriffene Behauptung gewesen, für die es keinerlei Beweis gab. Er hatte nur gespürt, dass sich die Zeitebenen verschoben hatten, alles weitere blieb Spekulation. Es konnte sich um Stunden handeln, wie er behauptet hatte, aber ebenso gut auch Jahre oder theoretisch sogar Jahrzehnte. Er wusste ja nicht einmal, in welcher Richtung sie sich bewegt hatten, ob in die Vergangenheit oder die Zukunft. Es war Besorgnis erregend genug, dass es überhaupt geschehen war. Die Tor e, das jahrmillionenalte Transportsystem der GROSSEN ALTEN, war schon vor Jahren weitgehend zusammengebrochen, zumindest so unsicher geworden, dass jede Benutzung ein unkalkulierbares Risiko darstellte. Niemand vermochte mehr den Endpunkt eines Durchgangs vorauszusagen, falls man überhaupt irgendwo herauskam und nicht auf ewig in den Korridoren zwischen den Dimensionen verschollen blieb.
Trotzdem hatte sich das Transportsystem bislang hauptsächlich durch den Raum erstreckt, nicht durch die Zeit. Diese Veränderung zeigte deutlich, welchen Erschütterungen das gesamte Raum-Zeit-Kontinuum in den letzten Jahren unterworfen war. Das nur mit knapper Not verhinderte Erwachen der GROSSEN ALTEN hatte größere Veränderungen mit sich gebracht, als es zunächst schien, und diese Veränderungen waren immer noch im Gange.
Howard verdrängte diese Gedanken; sie brachten ihn im Moment nicht weiter.
Immer tiefer führte der Stollen in die Erde hinab. Einmal glaubte Howard, in der Dunkelheit außerhalb des Lichtscheins der Fackel vor sich eine flüchtige Bewegung wahrzunehmen, war sich jedoch nicht sicher, ob sie real gewesen war oder ob seine überdrehten Sinne ihm nur einen Streich gespielt hatten. Noch vorsichtiger als bisher ging er weiter.
Nach einer Strecke, die ihm wesentlich länger vorkam, als sie in Wahrheit vermutlich war, endete der Gang plötzlich. Das dumpfe Rumoren war inzwischen zu einem lauten Dröhnen angewachsen.
Vor ihnen erstreckte sich eine weitere Höhle, die riesig zu sein schien, doch in völliger Dunkelheit dalag. Das Licht der Fackel reichte gerade aus, einen wenige Yards durchmessenden Halbkreis aus der Schwärze zu reißen. Ein Stück vor sich sah Howard ein einzelnes, rot glühendes Raubtierauge, das ihn anstarrte. Er erschrak, schalt sich jedoch gleich darauf selbst einen Narren, als er begriff, dass es sich lediglich um ein Kontrolllämpchen handelte. Es gehörte zu einer ganzen Reihe von Maschinen, die sich wie eine Wand aus Metall durch einen Teil der Höhle zogen. Als er näher trat, entdeckte er Apparaturen und hohe säulenförmige Maschinen, die sich wie Pumpen auf und ab bewegten und dabei das grollende Stampfen verursachten, das sie hörten.
Er näherte sich dem Ende der Maschinenreihe. Als er die Ecke erreichte, nahm er aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahr, doch es war zu spät, um noch zu reagieren. Ein harter Schlag traf seinen Arm und prellte ihm die Fackel aus der Hand. Gleich darauf ging er unter dem Aufprall eines schweren Körpers zu Boden. Inmitten eines Gesichts, das geradewegs einem Albtraum entsprungen zu sein schien, sah er gierig gebleckte Raubtierzähne, die sich seiner Kehle näherten.
McGillycaddy hatte noch eine Zeit lang versucht, uns dazu zu überreden, mit dem Abendzug wieder zurück nach London zu fahren, denn zweifellos handelte es sich bei der vermeintlichen Nachricht nur um ein Missverständnis, das wir zu Hause in der Stadt ja viel rascher aufklären konnten als hier, und außerdem sei Brandersgate kein Ort, an dem zwei an ein gewisses Minimum an Komfort gewöhnte Männer wie wir sich wohl fühlen konnten. Zumindest bei Letzterem stimmte ich ihm uneingeschränkt zu. Aber trotzdem beharrten Cohen und ich mit Nachdruck darauf, zumindest diese eine Nacht hier zu verbringen. Ich bedankte mich für McGillycaddys Sorge, erklärte ihm aber, dass wir beide es durchaus gewohnt seien, uns zu bescheiden, und auch mit einem einfachen Quartier vorlieb nehmen würden.
Da kannte ich Cordwailers »Hotel« noch nicht …
Brandersgate war mit seinen knapp dreihundert Einwohnern nicht groß genug, als dass sich ein Hotel oder auch nur ein Gasthaus rentieren würde, und so begleitete uns der Constabler zurück zu dem kleinen Kolonialwarenladen gegenüber des Bahnhofes, in dem sich Cohen vorhin nach dem Weg erkundigt hatte. Cohens Gesichtsausdruck verdüsterte sich, als ihm klar wurde, wo unser Ziel lag, aber er sagte nichts, und ich erfuhr auch später nie, was in jenen wenigen Minuten zwischen ihm und Cordwailer vorgefallen war. Allerdings gehörte auch nicht sehr viel dazu, den Unmut Wilbur Cohens zu erregen. Manchmal reichte es schon, im falschen Moment einfach da zu sein.
McGillycaddy erklärte uns, dass Cordwailer in seinem Laden manchmal Bier ausschenkte und das Geschäft – das mit Ausnahme der Kirche das größte Haus in Brandersgate darstellte – auch ganz allgemein als Treffpunkt und – bei Bedarf – auch Versammlungsort diente. Früher habe er auch Zimmer vermietet, dies aber irgendwann aufgegeben, weil immer weniger Fremde in die Stadt kämen; seit ein paar Jahren eigentlich gar keine mehr. Trotzdem seien die entsprechenden Räumlichkeiten noch vorhanden, und McGillycaddy war sicher, dass Cordwailer uns für eine Nacht aufnehmen würde, wenn er ein gutes Wort für uns einlegte. Cohens Miene verdüsterte sich bei dieser Ankündigung noch weiter, aber er hüllte sich auch jetzt noch in eisiges Schweigen.
Ich konnte seinen unübersehbaren Widerwillen ein wenig besser verstehen, nachdem wir den Laden betreten hatten und ich einen ersten Blick in die Runde geworfen hatte.
Cordwailers Gemischtwaren und Spezialitetenhandel (das handgemalte Schild über der Tür zeugte nicht nur von den mangelnden Orthografiekenntnissen, sondern auch vom gesunden Selbstbewusstsein seines Besitzers) ähnelte auf verblüffende Weise McGillycaddys Wohnung. Er war zwar nicht ganz so unordentlich wie diese, aber alles hier war alt und wirkte auf eine schwer zu greifende Weise verfallen. Hinter der zerschrammten Theke, die eine ganze Hälfte des Raumes einnahm, erhob sich ein Regal, dessen Fächer mit allem möglichen Zeug vollgestopft waren. Nur bei dem Allerwenigsten vermochte ich überhaupt zu erkennen, worum es sich handelte, und noch weniger davon erschien mir geeignet, von irgendjemandem gekauft zu werden. Dutzende von Gläsern, Schachteln, Kästen und Kistchen drängelten sich auf der Theke, und dazwischen erhob sich ein wahres Monstrum von Registrierkasse, auf dem wahrscheinlich schon die alten Ägypter ihre Steuereinnahmen zusammengezählt hatten.
Die andere Hälfte des Raumes wurde von drei wackeligen Tischen und einem Dutzend kaum Vertrauen erweckend aussehenden Stühlen eingenommen, die wohl die Brandersgate-Version einer Schänke repräsentierten. Die Scheiben waren blind vor Schmutz, sodass das hereinfallende Tageslicht grau und irgendwie trüb wirkte, und in der Luft hing der Geruch von abgestandenem Zigarren- und Pfeifenrauch und altem Bier.
Cordwailer selbst – ein verhutzeltes kleines Männchen mit einer Hakennase und einer großen Narbe auf der Stirn – stand hinter seiner Theke und kritzelte mit einem kaum zwei Zoll langen Bleistiftstummel in ein zerfleddertes Heft, als wir eintraten, und in seinen Augen blitzte es kampflustig auf, kaum dass er Cohen erblickte. Aber McGillycaddy kam dem drohenden Streit zuvor. Mit einem raschen Schritt trat er an die Theke, wedelte mit beiden Händen, um Cordwailers Aufmerksamkeit zu erwecken, und erklärte dann unser Problem. Cordwailer lehnte es rundheraus ab, uns aufzunehmen, aber McGillycaddy ließ nicht locker, und auch wenn man es ihm nicht ansah: Er schien doch über eine gewisse Autorität zu verfügen, denn schließlich willigte Cordwailer ein, wenn auch sichtlich widerstrebend.
»Aber nur für eine Nacht«, sagte er. »Und Frühstück gibts nicht. Meine Frau – Gott hab sie selig – ist vor drei Jahren gestorben, und ich stehe nicht vor zehn auf.«
Dieses Geständnis machte mir den Alten schon bedeutend sympathischer. Auch ich pflegte – wenn es irgendwie ging – selten vor zwölf aus den Federn zu kriechen, und Störungen vor zehn Uhr vormittags betrachtete ich als vorsätzliche Körperverletzung. Überhaupt war ich schon vor Jahren zu der Überzeugung gelangt, dass der Mensch in Wahrheit ein nachtaktives Geschöpf ist und Tageslicht nicht nur ungesund ist, sondern auch dem natürlichen Lebensrhythmus unserer Spezies zuwider.
»Das macht nichts«, sagte ich. »Wir kommen schon zurecht.«
Cordwailer spießte mich mit Blicken regelrecht auf, aber er sagte nichts mehr, sondern bedeutete uns mit rüden Gesten, an einem der Tische Platz zu nehmen. Dann knurrte er, dass wir uns noch einen Moment gedulden sollten; er müsse rasch nach den Zimmern sehen und sich überzeugen, dass die Bettwäsche noch sauber sei. Ich dachte daran, dass McGillycaddy uns erzählt hatte, dass er die Zimmer das letzte Mal vor Jahren vermietet hätte, zog es aber vor, den Mund zu halten, und setzte mich.
McGillycaddy wechselte noch ein paar belanglose Worte mit Cordwailer, dann verabschiedete er sich und ging, und auch Cohen nahm neben mir Platz. Der Stuhl ächzte hörbar, als er sich darauf sinken ließ, und Cohen erstarrte für eine Sekunde mitten in der Bewegung. Äußerst behutsam führte er sie zu Ende, hielt sich aber vorsichtshalber mit beiden Händen an der Tischkante fest, falls der Stuhl doch noch unter ihm zusammenbrechen sollte. Nicht, dass der Tisch einen wesentlich stabileren Eindruck gemacht hätte.
»Was für eine Bruchbude«, sagte er kopfschüttelnd – aber vorsichtshalber erst, nachdem Cordwailer den Raum verlassen hatte. Wir hörten ihn irgendwo über unseren Köpfen lautstark herumpoltern.
»Ja. Aber sie passt hierher.« Ich nickte und sah mich mit gerunzelter Stirn ein weiteres Mal um. »Ich habe ja schon viel erlebt – aber eine Stadt wie diese noch nie.«
»So?«, fragte Cohen. »Was haben Sie denn schon so alles erlebt, Roderick?«
Ich setzte zu einer Antwort an, klappte den Mund aber dann wieder zu, als ich das spöttische Glitzern bemerkte. Cohen nannte mich abwechselnd Robert und Roderick – wahrscheinlich war das seine Art, mir zu verstehen zu geben, was er von meiner Geschichte über den so plötzlich aufgetauchten Zwillingsbruder aus Amerika hielt. Wieder einmal war ich nahe daran, ihm die Wahrheit zu sagen (er wusste sie ohnehin), und wieder besann ich mich im letzten Moment eines Besseren. Menschen waren manchmal komplizierte Individuen – wir wussten beide, wie haarsträubend die Geschichte war, die ich ihm und dem Rest der Welt aufgetischt hatte, und wir taten seit gut zwei Wochen unser Bestes, dem jeweils anderen glaubhaft zu machen, dass wir ihm sein Pharisäerlächeln abnahmen.
»Nichts«, sagte ich nach ein paar Augenblicken. »Es war nur so eine Redensart.« Ich wechselte das Thema: »Vielleicht war es wirklich nur eine Verwechslung.«
Cohen sah mich verständnislos an.
»Die Information über Crowley«, erklärte ich. »Ein Irrtum, möglicherweise.«
»Scotland Yard unterlaufen keine Irrtümer.« Cohen zog eine Grimasse. »Jedenfalls nicht solche.«
»Aha«, sagte ich.
»Die Information war zu eindeutig«, beharrte Cohen im Ton einer trotzigen Verteidigung. »Im Ernst, Robe … ich meine Rode –«
»Wie wär’s mit Roberick?«, witzelte ich.
Cohen fand das anscheinend nicht sehr komisch. Seine Blicke wurden eisig. »Ein Irrtum ist ausgeschlossen«, wiederholte er. »Die Nachricht war sogar namentlich an mich gerichtet. Der von Ihnen gesuchte Rev. Crowley befindet sich zurzeit in Brandersgate, Schottland. Gezeichnet Constabler McGillycaddy«, zitierte er.
»Rev.?«, hakte ich nach.
Cohen zuckte die Schultern. »Reversham, Reva … ich habe keine Ahnung, wie dieser Crowley mit Vornahmen heißt.«
»Reverend?«, schlug ich vor.
Cohens Blick machte deutlich, dass er diese Möglichkeit auch schon erwogen hatte. Aber er hatte die verfallene Kirche schließlich ebenso gesehen wie ich.
»Ich finde schon heraus, was hier läuft«, versprach er düster. »Irgendwas stimmt hier nicht, und ich gebe Ihnen mein Wort, dass ich herausbekomme, was es ist. Und ich komme auch Ihrem Freund Lovecraft und seiner Bande auf die Schliche.«
»Roberts Freund, meinen Sie«, verbesserte ich ihn betont. Cohens Augen blitzten. Er schwieg.
»Aber Roberts oder mein Freund, Inspektor«, fuhr ich fort. »Ich habe über das nachgedacht, was Sie mir erzählt haben: über den Angriff auf das Gefängnis und alles andere. Ich kann mir immer weniger vorstellen, dass Howard wirklich für den Überfall verantwortlich ist. Vielleicht galt der Angriff in Wahrheit ihm, nicht dem Gefängnis oder Ihnen. Dieses Ding, das Sie mir beschrieben haben, hatte doch ziemliche Ähnlichkeit mit dem Ungeheuer in der Kanalisation.«
»Es war dasselbe«, knurrte Cohen missgelaunt. »Und stellen Sie sich vor, das habe ich auch schon gemerkt. Das ist übrigens der einzige Grund, aus dem ich hier bin. Irgendwas ist an dieser ganzen Geschichte oberfaul. Wenn ich herausfinde, dass Ihr Freund tatsächlich unschuldig ist, werde ich ihm helfen. Aber wenn nicht, bringe ich ihn eigenhändig dorthin zurück, wo er vor zwei Wochen schon einmal war.«
Ich schluckte meine spöttische Antwort herunter, als ich eine Bewegung an der Tür gewahrte. Ein vielleicht sechs oder siebenjähriger Junge hatte den Laden betreten. Mit schnellen, aber eher zielsicheren als hastigen Schritten näherte er sich der Theke, wobei er Cohen und mich aufmerksam im Auge behielt. Ich war ziemlich sicher, dass er nicht zu den Kindern gehörte, die uns vorhin auf dem Weg zu McGillycaddys Haus auf so sonderbare Weise angeblickt hatten – aber auch er musterte Cohen und mich. Auf eine Art, die fast unheimlich war.
»Hallo«, sagte ich.
Der Junge nickte. »Guten Tag, Sir«, antwortete er.
Ich bemerkte aus den Augenwinkeln, wie Cohen leicht zusammenfuhr. Und auch ich konnte mich eines sanften Schauderns nicht erwehren. Der Knabe war nicht einfach nur gut erzogen. In seiner Stimme lag der gleiche, durch und durch unkindliche Ernst, der auch seinem Blick innewohnte. Ich hatte nicht das Gefühl, einem Kind gegenüberzustehen, sondern vielmehr einem kleinen Erwachsenen.
»Ist Mister Cordwailer nicht hier?«, fragte der Junge und sein Blick fügte fast schon hörbar hinzu: Was zum Teufel sucht ihr denn hier, noch dazu allein?
»Er kommt gleich zurück.« Ich deutete nach oben, von wo noch immer das Poltern und Rumoren erklang. Anscheinend zog Cordwailer Bettwäsche aus massivem Gusseisen auf. »Wie ist dein Name, mein Junge?«
»Joshua, Sir«, antwortete der Junge. »Joshua Pasons.« Sein Blick blieb kalt, abschätzend, und ich begann mich in zunehmendem Maße unwohler darunter zu fühlen.
»Lebst du hier in Brandersgate?«, fragte ich.
Joshua nickte. »Ja, Sir. Mit meinen Eltern und meiner jüngeren Schwester.«
»Dann kennst du doch sicher jeden, der hier wohnt«, sagte Cohen.
»Selbstverständlich, Sir. Ich nehme an, Sie sind extra aus der Stadt gekommen, weil Sie jemanden suchen.«
»Aus London, ja«, bestätigte Cohen. »Wir sind auf der Suche nach einem gewissen –«
»Aus London?«, unterbrach ihn Joshua. »Onkel Fred war einmal in London, aber das ist zwanzig Jahre her. Muss eine verdammt große Stadt sein.«
»Das ist sie«, sagte Cohen. Er klang nun schon ein ganz kleines bisschen ungeduldig. »Was den Mann angeht, den wir suchen –«
»Ich wusste gar nicht, dass jemand aus Brandersgate Verwandte in London hat«, fuhr Joshua in aller Seelenruhe fort. »Das ist seltsam. Normalerweise weiß hier jeder alles über jeden.«
»Wer hat etwas von Verwandten erzählt?«, sagte Cohen, nun schon hörbar ungeduldig. »Wir suchen einen gewissen Crowley.«
»Den Namen habe ich noch nie gehört, Sir«, antwortete der Junge. »Und selbst wenn es nicht so wäre, dürfte ich Ihnen nichts sagen, wenn Sie wirklich keine Verwandten von ihm sind.«
Cohens Augen wurden schmal, aber Joshua hielt ihrem Blick gelassen stand. »Meine Mutter hat mir verboten, mit Fremden zu reden«, fuhr er fort. »Sie sagt, man wüsste schließlich nie, wer käme und Fragen stellte und was er mit den Informationen anfinge.«
»So?«, fragte Cohen, dessen Gesicht schon wieder einen verdächtig roten Farbton anzunehmen begann. Jeder Tag in Brandersgate, schätzte ich, würde ihn ein Jahr an Lebenszeit kosten. »Hat sie das?«
Er beugte sich vor, griff in die Tasche und zog die rindslederne Mappe hervor, in der sich sein Dienstausweis befand. »Dann hat sie dir vielleicht auch gesagt, was das hier ist, oder?«
Er klappte den Ausweis direkt vor Joshuas Gesicht auf. Der Junge musterte ihn ein paar Sekunden lang aufmerksam und schüttelte dann den Kopf. »Nein, Sir«, sagte er. »Das hat sie nicht. Was ist es?«
Cohen schluckte hart. »Du kannst doch lesen, Bursche, oder?«
»Nein«, antwortete Joshua. »Das kann ich leider nicht, Sir. Ich bedaure.«
»Wie bitte?«, raunzte ihn Cohen an. »Willst du mich auf den Arm nehmen, Bürschchen?«
»Du kannst tatsächlich nicht lesen?«, vergewisserte ich mich rasch, bevor Cohen endgültig explodieren und noch mehr Schaden anrichten konnte. »Aber habt ihr denn keine Schule hier?«
»Wir sind nur fünfundzwanzig Kinder in Brandersgate«, antwortete Joshua. »Eine Schule lohnt sich nicht. Mister Hennessey unterrichtet uns manchmal; drüben, im alten Leuchtturm.«
»Und was bringt er euch bei? Doch bestimmt Lesen und Schreiben.«
»Nein, Sir. Es gibt wichtigere Dinge im Leben als Bücher und Rechnungen.«
»Ja, und das hier gehört dazu.« Cohen wedelte angriffslustig mit seinem Ausweis. Ich hätte ihn fressen können. Ich war gerade dabei gewesen, wirklich etwas von dem Jungen zu erfahren. »Wir sind von der Polizei, mein Junge. Und wenn deine Mutter dir so kluge Ratschläge gibt, dann hat sie dir doch ganz bestimmt auch gesagt, dass man der Polizei Rede und Antwort zu stehen hat.«
»Selbstverständlich, Sir«, antwortete Joshua. Er blieb ganz ruhig und das war einfach nicht richtig. Siebenjährige Jungen bleiben nicht ruhig, wenn sie von einem Polizisten verhört werden. Sie haben entweder ein schlechtes Gewissen, oder sie betrachten das Ganze als Abenteuer, aber sie sind auf jeden Fall aufgeregt. Joshua nicht.
»Was kann ich für Sie tun, Sir?«, fragte er.
»Crowley«, wiederholte Cohen, aber Joshua schüttelte auch jetzt den Kopf.
»Es tut mir leid, Sir. Ich habe diesen Namen noch nie gehört.«
Diesmal gelang es mir, Cohens Aufmerksamkeit zu erhaschen und ihn mit einem fast beschwörenden Blick zum Schweigen zu bringen, ehe er wieder lospoltern konnte.
»Ihr habt doch sicher einen Pastor in der Stadt«, sagte ich.
»Nein, Sir. Die Kirche ist vor fünf Jahren niedergebrannt und Mr. Stone, der Pastor, ist weggegangen. Seither unterrichtet uns Mr. Hennessey in geistlichen Dingen.«
»Dieser Mr. Hennessey scheint ja ein sehr wichtiger Mann zu sein«, sagte ich. »Kannst du mir verraten, wo ich ihn treffen kann?«
»Im alten Leuchtturm«, antwortete Joshua. »Er wohnt dort. Aber Sie können jetzt nicht dorthin. Erst morgen früh wieder. Oder heute Nacht.«
»Wieso?«
»Der Turm ist nur bei Ebbe zu erreichen. Früher gab es einen Steg, aber der ist eingestürzt, und seither ist der Turm bei Flut von der Küste abgeschnitten.«
Schritte polterten die Treppe herab, und einen Augenblick später kam Cordwailer herein. Als er Joshua erblickte, stockte er mitten im Schritt. Und für einen Moment erschien ein erschrockener Ausdruck auf seinem Gesicht.
»Benötigen Sie sonst noch irgendwelche Auskünfte, Sir?«, fragte Joshua. »Wenn nicht, dann würde ich jetzt gerne wieder gehen.«
»Nein, nein«, sagte Cohen verstört. »Schon in Ordnung. Geh ruhig. Und vielen Dank.«
»Gern geschehen, Sir«, antwortete Joshua. Er verabschiedete sich mit einem artigen Kopfnicken zuerst von Cohen, dann von mir, dann drehte er sich um und verließ mit gemessenen Schritten den Laden. Ich blickte ihm verwirrt nach. Dieses Kind war mir … unheimlich. Ich hatte gespürt, dass Joshua uns nicht belog, sondern jede unserer Fragen wahrheitsgemäß beantwortete. Und trotzdem … irgendetwas stimmte nicht mit diesem Jungen.
Und da war noch etwas, aber das wurde mir erst klar, als Cordwailer mit schlurfenden Schritten wieder hinter seiner Theke verschwand und uns von dort aus feindselig musterte, wie ein Raubritter hinter den Zinnen seiner Burg hervor.





























