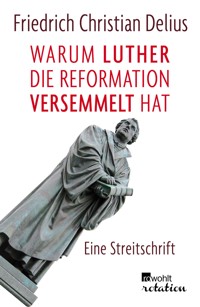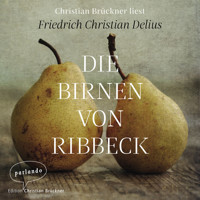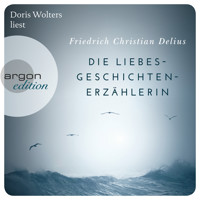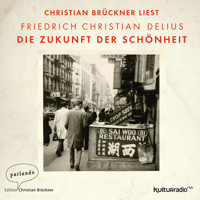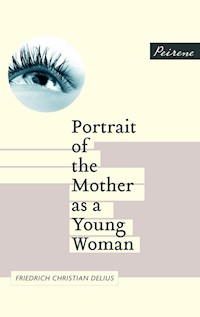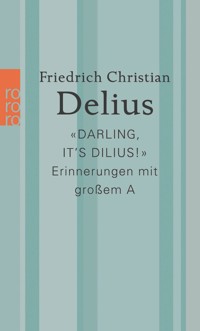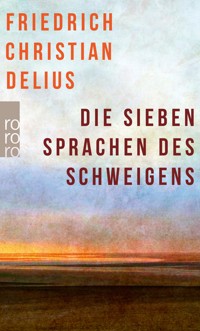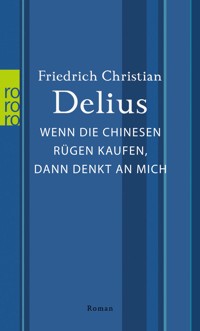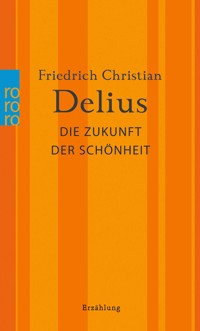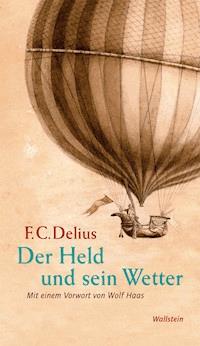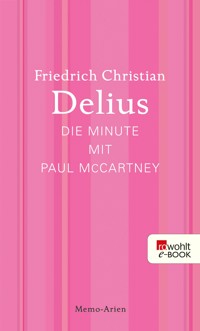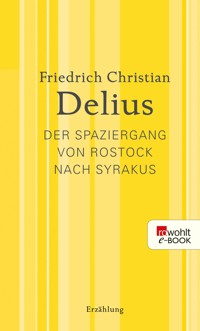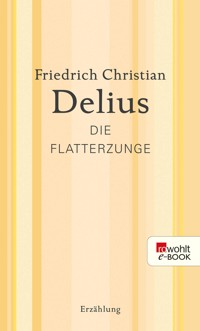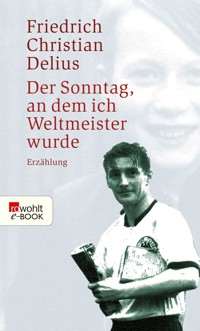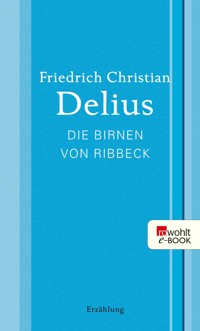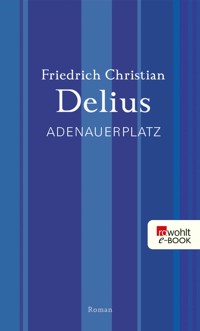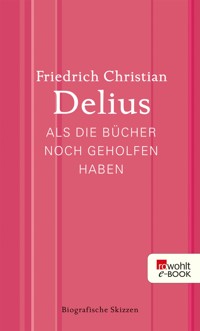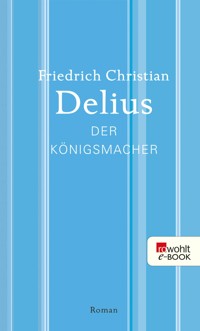
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Delius: Werkausgabe in Einzelbänden
- Sprache: Deutsch
Albert Rusch, ein Schriftsteller mit wenig Erfolg, will endlich einen Bestseller schreiben. Da stößt er auf eine alte Familiengeschichte: Seine Urururgroßmutter war das uneheliche Kind einer Berliner Tänzerin und des Prinzen von Oranien, der später als Willem I. den holländischen Thron bestieg. Adel und Boheme, Macht, Liebe, Geld, Intrigen, Leidenschaft, Tod – ideale Voraussetzungen für einen auflagenträchtigen Frauenroman. Rusch identifiziert sich im Zuge der Recherchen mehr und mehr mit seiner Rolle als Nachfahre der Preußenkönige. Er avanciert zum Medienstar und Genie der Selbstvermarktung. «F.C. Delius bricht eine Lanze für die preußische Popliteratur.» (FAZ) «F.C. Delius ist mit ‹Königsmacher› ein großer Wurf gelungen. Im Gewand eines rührseligen historischen Romans nimmt er das Geschäft von Leuten aufs Korn, denen Grundsätze, Überzeugungen und intellektuelle Redlichkeit abhandengekommen sind.» (Berliner Morgenpost) «Hier bekommt man mehr als einen historischen Roman, nämlich eine Satire auf den Literaturbetrieb und eine Parabel auf die Nichtplanbarkeit von künstlerischem Erfolg.» (Literarische Welt)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Friedrich Christian Delius
Der Königsmacher
Roman
Über dieses Buch
Albert Rusch, ein Schriftsteller mit wenig Erfolg, will endlich einen Bestseller schreiben. Da stößt er auf eine alte Familiengeschichte: Seine Urururgroßmutter war das uneheliche Kind einer Berliner Tänzerin und des Prinzen von Oranien, der später als Willem I. den holländischen Thron bestieg. Adel und Boheme, Macht, Liebe, Geld, Intrigen, Leidenschaft, Tod – ideale Voraussetzungen für einen auflagenträchtigen Frauenroman. Rusch identifiziert sich im Zuge der Recherchen mehr und mehr mit seiner Rolle als Nachfahre der Preußenkönige. Er avanciert zum Medienstar und Genie der Selbstvermarktung.
«F.C. Delius bricht eine Lanze für die preußische Popliteratur.» (FAZ)
«F.C. Delius ist mit ‹Königsmacher› ein großer Wurf gelungen. Im Gewand eines rührseligen historischen Romans nimmt er das Geschäft von Leuten aufs Korn, denen Grundsätze, Überzeugungen und intellektuelle Redlichkeit abhandengekommen sind.» (Berliner Morgenpost)
«Hier bekommt man mehr als einen historischen Roman, nämlich eine Satire auf den Literaturbetrieb und eine Parabel auf die Nichtplanbarkeit von künstlerischem Erfolg.» (Literarische Welt)
Impressum
Der Autor dankt dem Deutschen Literaturfonds e.V. für die Förderung, Irmgard von der Lühe und Josef Keunen für umfangreiche Vor-Recherchen, der Max Kade Stiftung für produktive Wochen am Dickinson College in Carlisle, PA, sowie Alexander von Bormann, Siv Bublitz, Beverley Eddy, Sabine Herken, Hilde von Massow, Klaus Modick und Wolfgang Müller für wichtige Anregungen.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Februar 2015
Copyright © 2001 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung any.way, Walter Hellmann
ISBN Buchausgabe 978-3-499-26915-8 (1. Auflage 2015)
ISBN 978-3-644-11271-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Dies Buch hat Albert Rusch
Stammbaum
Wind weht vorüber, ...
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
93. Kapitel
94. Kapitel
95. Kapitel
96. Kapitel
97. Kapitel
98. Kapitel
99. Kapitel
100. Kapitel
101. Kapitel
102. Kapitel
103. Kapitel
104. Kapitel
105. Kapitel
106. Kapitel
107. Kapitel
108. Kapitel
109. Kapitel
110. Kapitel
111. Kapitel
112. Kapitel
113. Kapitel
114. Kapitel
115. Kapitel
116. Kapitel
117. Kapitel
118. Kapitel
119. Kapitel
120. Kapitel
121. Kapitel
122. Kapitel
123. Kapitel
124. Kapitel
125. Kapitel
126. Kapitel
127. Kapitel
128. Kapitel
129. Kapitel
130. Kapitel
131. Kapitel
132. Kapitel
133. Kapitel
134. Kapitel
135. Kapitel
136. Kapitel
137. Kapitel
138. Kapitel
139. Kapitel
140. Kapitel
141. Kapitel
142. Kapitel
143. Kapitel
144. Kapitel
145. Kapitel
146. Kapitel
147. Kapitel
148. Kapitel
149. Kapitel
150. Kapitel
151. Kapitel
152. Kapitel
153. Kapitel
154. Kapitel
155. Kapitel
156. Kapitel
157. Kapitel
158. Kapitel
159. Kapitel
160. Kapitel
161. Kapitel
162. Kapitel
163. Kapitel
164. Kapitel
Editorische Notiz
Rich times for historical fiction
Friedrich Christian Delius: Die unechte Tochter
Rezensionen
Friedrich Christian Delius
Dies Buch hat Albert Rusch geschrieben, von der ersten bis zur letzten Seite. Jener Albert Rusch, der vor ungefähr zwei Jahren vom erfolglosen Autor zum Medienstar aufstieg, dann für ein paar Wochen in der Psychiatrie landete und immer noch den Schutz vor der Öffentlichkeit braucht. Er hat mich gebeten, seine Geschichte vorläufig unter meinem Namen herauszugeben.
Welche Gründe ihn dazu trieben, erklärt sich aus dem Lauf der Handlung und den letzten Seiten. Ich habe dem Drängen meines Freundes nach langem Zögern nachgegeben, obwohl seine Schreibweise in vielem völlig anders ist als meine.
Was mich trotzdem bewogen hat, Albert Ruschs Bericht veröffentlichen zu helfen, will ich hier nicht ausführen. Wer diese Geschichte zu lesen beginnt, wird solche Begründungen ohnehin bald vergessen.
F. C. D., 21. März 2001
Wind weht vorüber, ein kühler Oktoberabend, und wer aus der Untergrundbahn steigt, landet auf einer langgestreckten Brücke. Hallesches Tor, 20 Uhr 41, die gelben Wagen fahren weg ins Dunkle Richtung Warschauer Straße, der Boden vibriert. Ich will nicht nach Osten, nicht nach Westen, ich folge den Leuten nicht die Treppen hinab.
Umsteigen bitte, ehe die Musik des Eisens wieder anhebt. Ich bleibe am Halleschen Tor am Ende des Bahnsteigs und gebe Befehle.
Denk dir die U-Bahn weg, die Eisengerüste, die Hochhäuser mit Küchen- und Wohnzimmerlicht, den Kanal unten, alles weg. Hör den Autolärm nicht, die fernen Sirenen, die nächste U-Bahn. Die Stadt schweige. Rieche den gepflügten Acker, die feuchten Wiesen, nicht Benzin, Fettdunst, Hundekot. Lass die Leute verschwinden oder verkleide sie, wenn du kannst.
Umsteigen bitte, fast zweihundert Jahre zurück, ungezählte Stufen in die Vergangenheit hinunter.
Es ist ganz einfach. Eine neue Landkarte aufschlagen.
Stille. Wind weht vorüber, ein kühler Oktoberabend zwischen acht und neun.
Ich höre: Hufe schlagen auf einen feuchten Sandweg.
Ich sehe: Ein Pferd galoppiert von Süden heran, den Kreuzberg hinunter. Den Reiter umweht ein weiter schwarzer Mantel. Vor dem Wachtposten am Halleschen Tor öffnet er sein Gewand, darunter blitzt eine Generalsuniform auf, der Posten salutiert. Der Reiter passiert das Rondell und wendet von der Friedrichstraße nach rechts in die Jacobstraße. Kein Mensch zu sehen, die Straßen dunkel, hinter den Fenstern hier und dort Kerzenlicht. Es ist nicht die Gegend, in der hohe Militärs sich aufhalten. Vor einem der einfachen Häuser steigt der Reiter ab, bindet das Pferd an und klopft an die Tür der Nummer 21. Er ist etwa Mitte dreißig, sieht erschöpft aus, geschlagen, gejagt. Eine ältere Frau öffnet, erkennt ihn, er tritt ein.
1
– Wo ist Marie?
– In Küstrin, die sind alle nach Küstrin.
– Das ganze Theater?
– Ja. Der König ist doch abgehaun … geflohen, meine ich.
– Das weiß ich, ich muss auch weg. Der ganze Hof soll auf der Flucht sein, aber warum denn das Hoftheater, was für ein Unsinn!
– Die Franzosen kommen.
– Ich weiß, ich weiß. Franzosen, überall Franzosen. Deshalb muss doch Marie nicht …
– Es ging so schnell, fünf Minuten gepackt, weg war sie.
– Frau Hoffmann, lassen Sie Marie holen, sagt der General nach kurzem Überlegen, schicken Sie Gottfried! Er legt Geld auf den Tisch.
– Jawohl.
Die Mutter ruft ihren Sohn herbei, einen stämmigen Burschen, und gibt den Befehl weiter.
– Wenn ick noch die letzte Chaise kriege, antwortet der.
– Mit dem Geld bestimmt!
– Sind schon alle weg, die Herrschaften, sagt Gottfried. Untern Linden sind se alle weg, nur noch Dienstboten in den Häusern. Sogar der Stadtkommandant, vorgestern Ruhe ist die erste Bürgerpflicht, heute ab und nischt wie zum Tore hinaus.
– Red Er nicht, hol Er seine Schwester, befiehlt der General.
Gottfried geht. Frau Hoffmann bietet dem Gast das Nebenzimmer an. Alles ist ärmlich, Kontrast zur glänzenden Uniform.
– Napoleon hat mich verbannt, nach Posen. Ich darf mich in Berlin gar nicht aufhalten. Und keine drei Tage, dann sind sie da, die Franzosen.
– Sie können hier warten, Herr Wilhelm.
– Auf schnellstem Wege, hat er gesagt.
– Wer?
– Der Kaiser, der uns alle niedertrampelt. Auf schnellstem Wege ab nach Posen, Herr Generalmajor! Ab mit Ihnen!
– Marie wird sich freuen.
Der General holt das Pferd in die Remise, bringt Stroh, Heu, einen Eimer Wasser. Er wartet, bis das Tier gesoffen hat, geht ins Haus zurück, zieht Stiefel, Uniformjacke und Hose aus und schläft sofort ein.
Traumbilder: Gewehre, Bajonette, Kürasse liegen weggeworfen am Feldrand – überall Verwundete, die nicht aufhören zu schreien – mit blutenden Köpfen, abgehauenen Armen, Bauchwunden – in den Gräben verlassene Kanonen und Munitionswagen – verbündete Soldaten, Preußen und Sachsen, prügeln sich um verschimmeltes Kommissbrot – Franzosen von rechts und links und von vorn rücken mit Bajonetten an – gezückte Säbel, Todesschreie, Kanonendonner – ein kleiner Trupp der Preußen irrt auf dem Schlachtfeld umher – Gemetzel, Gedrängel neben Pferdekadavern – Wimmern, Heulen, Jammern, Flüche von allen Seiten – die Armee völlig zerrieben, keiner kämpft, wer noch nicht tot ist, rennt und flieht – Leichen, überall Leichen – ein Franzose mit wilder Frisur sticht zu: solche Bilder könnten durch den Traum eines Generals ziehen, der mit 40000 Preußen und Sachsen gegen Napoleons Armee verloren hat.
Er steht auf, lugt zum Fensterladen, es ist taghell, er geht in die Küche, taucht einen Krug in einen Eimer Wasser, trinkt den Krug leer, geht ins Zimmer, schläft wieder ein.
Marie, eine dunkelblonde Schönheit, neunzehn Jahre, steht vor seinem Bett, weckt ihn mit Küssen. Zärtlichkeiten.
– Mein lieber, lieber Wilhelm.
Sie zieht ihn aus.
Auch nach dem Beischlaf hören sie mit den Zärtlichkeiten nicht auf. Er genießt es, wenn sie ihm die Zehen küsst.
– Gehen der König und die Königin etwa ins Theater in Küstrin?
– Natürlich nicht. Alles drunter und drüber, weiß doch keiner was. Und die Königin Luise ist ja erst gestern angekommen.
– Ein Desaster, Preußens Untergang, der König flieht, und das Ballett, das Hoftheater flieht hinter ihm her!
– Der Intendant hat uns geschickt, der König hat das nicht befohlen. Er war wütend, als er uns in Küstrin sah, aber er wollte uns auch nicht zurückschicken.
– Ach, mein lieber Schwager reitet uns alle ins Verderben und kann sich wieder mal nicht entscheiden.
– Wo ist deine Frau?
– Bei Luise, bei der Königin, nehm ich an. Ich weiß nicht, wie lang ich jetzt weg sein werde, Marie.
– Wir sehn uns wieder, ich weiß es.
So etwa dachte ich anzufangen, mit einem schlichten Handlungsgerüst, kurzen Dialogen und Skizzen. Erst einmal sollten alle Szenen oder Kapitel in dieser Rohform bleiben, ohne Wetter, Landschaften und längere Herzensergießungen, ohne Kostüme, Kutschen und Kronleuchter. Figuren ausmalen, Gesichter beschreiben und Blicke deuten, längere Konversationen, innere Monologe, all das wollte ich für die späteren Fassungen aufheben.
Es wäre keine Kunst, die Kostüme ausführlicher zu schildern, die Zimmer mit schmückenden Worten wohnlicher einzurichten, die Gebäude farbiger zu gestalten. Auch das Schlachtengemälde von Jena und Auerstedt ließe sich leicht mit blutigen und brutalen Details bereichern. Natürlich müsste mit mehr Sex gewürzt werden – a little sex never hurts. Aber im Großen und Ganzen, dachte ich, könnte der Anfang so aussehen, könnten die Figuren ungefähr in diesem Takt aufeinander losmarschieren, der Prinz und die Tänzerin ihre wilde und tragische Geschichte beginnen.
Zuerst nur die Skizze der Story, so locker wie möglich entworfen, um sie später in jede gewünschte Richtung auszubauen. Drei Wege, drei Formen gab es, doch die Entscheidung hielt ich einstweilen offen: einen schmissigen Unterhaltungsroman, eine nüchtern-kritische Zeitstudie oder einen Drehbuchentwurf für einen Kinofilm.
Nichts ist fiktiver als die Vergangenheit. Wie die Vorstellung auch immer gesteuert wird, sie bleibt eine Vorstellung. Das Vergangene, schreibt Harry Mulisch, ist ebenso unsicher wie die Zukunft. In der Zukunft kann (fast) alles noch geschehen – doch auch in der Vergangenheit kann (fast) alles geschehen sein.
Was vergangen ist, wirkt so oder so wie ein Filmstreifen: Bekannte Bilder mit neuen Bildern geschnitten, die auch nur eine neu geschnittene Mischung aus alten Bildern sind.
2
Landgut bei Posen, Winter 1807. Willem mit seiner Frau Wilhelmina, genannt Mimi, und zwei Söhnen am Esstisch. Trauerstimmung, steif. Langes Schweigen. Der jüngere Sohn fragt:
– Ist Pauline wirklich im Himmel?
– Ja, im Himmel, sagt die Mutter und kämpft mit Tränen.
Langes Schweigen.
– Ich will wieder nach Berlin, sagt der Ältere.
– Wir gehen bald wieder nach Berlin, antwortet der Vater.
Später die Eltern allein.
– Sind Sie so sicher?, fragt Wilhelmina.
– In Berlin haben sich die Franzosen anständig aufgeführt, einigermaßen. Jena und Auerstedt sind abgebüßt. Napoleon hat die Verbannung nicht aufgehoben, aber er hasst Leute, die vor ihm kneifen. Ich muss ihm endlich zeigen, dass ich kein Vasall Ihres lieben Bruders bin, der sich nach Königsberg verzieht und seine Niederlage hinnimmt wie eine Strafe Gottes. Wenn wir Luise nicht hätten, wär er bis Sibirien geflohen. Sagen Sie ihm das bloß nicht, Mimi.
– Ihre Frau verrät Sie nicht.
– Napoleon wird noch lange herrschen, aber ich bin immerhin der Statthalter, und wenn er im Staub liegt eines Tages, der größte Feldherr aller Zeiten, dann werden wir in Den Haag einziehen. In zehn Jahren, in zwanzig Jahren, wir werden das noch erleben, Mimi. Ich werde ihm schreiben, dem großen Weltenlenker, und um Rückkehr aus der Verbannung bitten. In Berlin zu wohnen kann er uns nicht verweigern, nachdem er mich schon einmal zum Fürsten gemacht hat.
– Fürst von Fulda und Dortmund!
– Fulda war keine schlechte Lehre. Er liebt die Taktierer mehr als die Feiglinge.
– Ihr Wort in Don Näppels Ohr.
3
Berlin, Sommer 1809. Niederländisches Palais Unter den Linden. Auf der Straße viele Franzosen, auf dem Brandenburger Tor fehlt die Quadriga. Willem im Arbeitszimmer mit seinem Berater, Oberleutnant von Fagel.
– Ich fahre übermorgen.
– Ich wäre froh, wenn Sie sich heraushielten, wenn es doch wieder zur Schlacht kommt.
– Sie bleiben ein Diplomat, Fagel. Ich kann nicht ewig Bücher lesen, Staatswissenschaft studieren, Gesetze und Philosophie und hier rumlungern und meine Güter im Osten verwalten. Ich kann nicht immer grübeln und auf den richtigen Zeitpunkt warten. Ich muss was tun, Fagel. Mein Volk will sehen, dass der Prinz von Oranien für die Freiheit kämpft.
Willem, einfach gekleidet, an der Tür, als Mimi hinzukommt.
– Ich muss noch mal zum österreichischen Gesandten.
Mimi sieht aus, als glaube sie ihm nicht.
– Passen Sie auf die französischen Spione auf, Willem.
– Keine Sorge.
Vor dem Bühneneingang des Hoftheaters warten mehrere Herren, drei oder vier im Hintergrund möchten nicht erkannt werden. Die Damen vom Ballett kommen einzeln und zu zweit heraus. Willem und Marie finden sich trotz seiner Verkleidung schnell.
In Maries Stube in der Taubenstraße, beide im Bett.
– Übermorgen muss ich nach Österreich. Endlich haben wir eine Chance, ihn zu schlagen.
– Ich hab Angst, wenn du in die Schlacht ziehst.
– Du hältst dich da raus! Kein Wort zur Politik, das war vereinbart!
Er ist verärgert. Sie steigt aus dem Bett, tritt ans Fenster.
– Die Wohnung ist auf drei Jahre bezahlt, mach dir keine Sorgen. Außerdem komm ich wieder, Liebste. Keine küsst so wie du, das lass ich mir nicht entgehen. Das ist mein bester Schutz gegen die französischen Kugeln.
Sie lächelt.
– Tanze!, befiehlt er.
Sie, im Nachthemd, tanzt einige schöne Figuren. Er lächelt.
– Küss mich, befiehlt er.
4
Berlin, Januar 1810. Niederländisches Palais. Willem mit bandagiertem Bein auf dem Sofa, Bücher neben ihm, er liest. Mimi auf einem Sessel, stickend.
– Ich bin guter Hoffnung, Willem.
– Ach, Mimi, ich hab mir das so gewünscht!
– Ich hoffe, es wird eine Tochter.
– Es wird eine Tochter! Ich möchte das so gern erleben, wie ein Kind ein Mädchen und ein Mädchen eine Frau wird. Ich muss oft an Pauline denken. Sie wäre jetzt …
– Lassen Sie, Willem.
Königin Luise kommt hereingestürmt, zwei Hofdamen im Gefolge, Mimi steht auf, auch Willem versucht sich zu erheben.
– Bleiben Sie bitte, bitte liegen, Willem!
– Tut mir leid, dass ich noch nicht meine Aufwartung machen konnte.
– Wenn mein Schwager nicht zu mir humpeln kann, dann komm ich zu ihm, die zehn Schrittchen über die Straße müssen Sie mir erlauben. Wie geht es?
– Gut.
– Was meinen Sie mit gut?
– Es ist nur das Bein.
– Sagte der Held von Wagram.
– Den Helden können Sie streichen, solange dieser Monsieur Empereur lebt. Übrigens, ehe der Hofklatsch nach nebenan dringt: Mimi erwartet ein Kind.
– Ihr Glücklichen! Wie weit?
– Im vierten, sagt Mimi.
– Dann wünsch ich uns allen einen glücklichen … Juni, sagt Luise.
5
Berlin, Juli 1810. Wohnung der Hoffmanns. Vater und Mutter Hoffmann, Marie, ihr Bruder Gottfried. Man streitet sich, geladene Atmosphäre, der Vater angetrunken.
– Schaff endlich mal wieder ein paar Groschen ran, du Suffkopp!, sagt die Mutter.
– Wat kann ick denn dafür, antwortet der Vater. Bäcker werden nicht mehr gebraucht.
– Besoffene Bäcker werden nicht mehr gebraucht.
– Seit die Franzosen in der Stadt sind …
– Red dich nicht raus mit den Franzosen! Musst eben Weißbäcker werden! Wenn du nicht aufhörst mit dem Saufen, schmeiß ich dich raus! Wir leben nur von Marie und ihren schönen Beinen, und wer weiß, wie lang das gut geht.
– Er liebt mich, Mama.
– Hohe Herren lieben nicht lange, pass auf, Mädchen.
– Da kannste Gift drauf nehmen, Marie, sagt Gottfried.
Zur Tür herein kommt aufgeregt Lina, Maries und Gottfrieds Schwester:
– Die Königin ist tot!
– Det gibts doch nicht, sagt Gottfried.
– Die janze Stadt spricht davon, ruft Lina.
– Armer Wilhelm, flüstert Marie.
6
Berlin 1810, Sommer. Maries Wohnung. Marie und Willem im Bett.
– Ich hab dich gesehen, Willem, auf der Schlosstreppe neben dem Sarg. Ich hab geweint.
– Ich mochte sie, ich hätte sie auch so geliebt wie Friedrich Wilhelm. Aber sie mochte mich nicht besonders, der Hof hat es nicht so gern, dass ich lieber bei der schönsten Hoftänzerin liege als bei meiner Frau und Cousine. Der König hat es nicht so gern, wenn seine Schwester betrogen wird, und Luise, die treue Seele …
– Was wissen sie von uns?
– Fast nichts, aber es reicht. Unser König ist ein Idealist, er hasst das Spitzelwesen, nur weil Napoleon zehntausend Spitzel hat. Aber für dich und mich braucht er keine Spitzel.
– Und sie sagen nichts, dass du mit mir …
– Sie haben mir nichts zu erlauben! Ich bin der Statthalter der Niederlande, der Erbprinz von Oranien, und eines Tages werde ich König sein …
Marie lacht.
– Was machst du dann mit mir?
– Betten gibt es auch in Holland, und eine Bühne zum Tanzen auch.
– Ich erwarte Ihre Befehle, Majestät.
Nie wieder 1439 Exemplare!, das ist, offen gesagt, die einfachste Antwort auf die Frage, warum ich mich in die Geschichte von Willem und Marie verbissen habe.
Ein uraltes Familiendrama, von dem ich gerade erst gehört hatte und das mich in direkter Linie von meiner Mutter über meinen Großvater zu einem Nachkommen von Willem und Marie und ihrer Tochter Wilhelmine beförderte. Eine Geschichte mit romantischer und monarchischer Schwerkraft, mit der ich für immer abheben wollte, aufsteigen aus allen Misserfolgen, Depressionen, Niederlagen.
Ich war am Tiefpunkt meiner Karriere. Fühlte mich geschlagen, am Boden liegen, zerstört von der tückischen Idylle des Buchmarktes und verletzt von den wechselnden Winden der Moden. 1985 (welche Leser werden sich noch erinnern?) war ich für Fasching mit Elvis als Debütant gefeiert worden, dann ging es Schritt für Schritt bergab. Die nächsten beiden Romane wurden freundlich besprochen und schlecht verkauft, doch mit dem letzten erlebte ich die schrecklichste Pleite – und das ausgerechnet mit einem aktuellen Stoff, mit einer Ost-West-Liebesgeschichte, mit dem allseits erwarteten Roman zur deutschen Einheit: Die Fähre von Caputh.
1439 Exemplare, das sollte es nie wieder geben.
Junger Autor, das war der Bonus, von dem ich lange gezehrt hatte. Lob, Tätscheln, kleine Preise und mickrige Stipendien, diese Phase war lange vorbei. Nun war ich vierzig geworden, also plötzlich alt, aber nicht respektiert wie die Alten über sechzig, sondern im schlimmsten aller Zwischenzustände: ein alt gewordener Jungautor, ein junger Greis, ein Mann von gestern, ein Versager – auf der Höhe seiner Kräfte.
Was war mein Fehler, wenn es mein Fehler war?
Vielleicht, überlegte ich, hatte ich nach dem ersten Buch zu sehr auf das geschielt, was der Markt oder das Publikum angeblich verlangten, hatte teils aus Berechnung, teils aus Instinkt und manchmal vom Verlag gedrängt sogenannte gängige Themen gewählt, zuletzt die Ost-West-Geschichte, und war damit aufs schändlichste gescheitert.
Ein Opfer der guten Ratschläge, ein Opfer der deutschen Einheit.
Nur beim ersten Roman hatte ich mich an keinen Rat gehalten. Elvis Presley in Bad Nauheim, geschrieben aus der Perspektive eines Zahnarztes, seines Nachbarn, da waren alle Freunde und Fachleute einig gewesen: das interessiert doch keinen, Elvis ist überholt, ausgelutscht, Elvis-Fans lesen keine Bücher, und so weiter – es ist mein einziger Erfolgstitel geworden, Fasching mit Elvis.
Und nun 1439 Exemplare, tiefer konnte ich nicht sinken.
Wie fängt man wieder von vorne an? Ich sah nur eine Möglichkeit: auf keinen guten Rat, auf keine Marktanalyse hören. Das Heil in den sicheren Gefilden der Vergangenheit suchen. Es gab nur einen Weg nach oben: die gängigen Themen vergessen, also ihnen voraus sein.
Gerade weil das frühe 19. Jahrhundert niemanden interessiert, überlegte ich, ließe sich hier anfangen. Gerade weil die Familien zerbrechen, eine dramatische Familiengeschichte aus dem Dunkel des 19. Jahrhunderts graben. Weil nur noch starke Frauen Romanheldinnen sein dürfen, mal wieder ein Opfer zeigen. Alle setzen auf den neuen Markt, den neuesten Trend. Darum wäre es schlau, in den alten, den uralten Markt einzusteigen.
Also begann ich mit den am wenigsten gefragten Werten zu spekulieren: vaterländische Kriege, Leidenschaften der Könige, das Trio Pflicht, Tugend, Etikette und das romantische Märchen von Prinz und Bäckerstochter. Weil diese alte Zeit nicht aktuell ist, hoffte ich, und nicht alle Köpfe besetzt, warten hier die schönsten Freiheiten, der weiteste Horizont für Phantasie, der ferne Erfolg.
Und ich fasste die tollsten Vorsätze: So eine Pleite wie mit der Fähre wird mir nie wieder passieren! Ich, der Ururururenkel von König Willem, lasse mich nicht mehr kleinkriegen! Mit erhobenem Haupt werde ich vor das Publikum treten! Als schreibender Königssohn muss die Auflage um das Zehnfache, das Hundertfache steigen!
Für alle, die sich schon an dieser Stelle über meine Naivität wundern: Ohne Größenwahn läuft in unserem Gewerbe sowieso nichts. Der fällt normalerweise gar nicht auf.
7
Berlin, Winter 1811. Enge, dunkle Kneipe. Willem mit zwei Brüdern von Maltzahn, trinken. Drei junge Huren bei ihnen. Scherze und Knutschen. Willem lacht und trinkt mit, wehrt aber die Avancen einer Blondine ab.
– Hat keenen Sinn bei dem, Else, sagt der jüngere Maltzahn, der hat schon eine Mätresse.
– Zu einem anständigen Offizier gehört mindestens eine anständige Mätresse, sagt Willem.
– Und zwei unanständige, sagt der ältere Maltzahn.
Lachen.
8
A little sex never hurts:
Willem und Marie im Bett. Sie entzieht sich seiner drängenden Umarmung und beginnt ihm die Füße zu massieren. Sie nimmt seinen rechten Fuß und streicht mit dem Daumen von der Ferse bis zu den Zehen hinauf und hinunter, mal fest, mal mit zartester Berührung. Mit den Handflächen reibend, mit Zeigefingern und Mittelfingern zupackend, mit dem kleinen Finger kitzelnd fährt sie über die Fußsohle, bearbeitet die Zehen, erst einzeln vom kleinen bis zum großen, dann alle zusammen. Willem liegt mit geschlossenen Augen und streckt sich. Mit der gleichen Ruhe und Beharrlichkeit bestreicht sie den linken Fuß und erregt alle seine Nervenbahnen. Marie küsst seine Zehen, beginnt an ihnen zu lutschen und zu saugen und wird nicht müde, auch den anderen Fuß mit ihren Lippen zu umschmeicheln, als sei dies die höchste ihrer Begierden.
Willem regt sich, um mit Zärtlichkeiten zu antworten, aber schon liegt Marie auf ihm und küsst seine Beine, umgeht das Geschlecht, stürzt sich auf seine Brustwarzen und steigert ihr Lippen- und Fingerspiel. Sie saugt an seiner Brust, leckt, knabbert, beißt mit der zärtlichsten Folter. Er stöhnt, er stammelt, er liegt wie betäubt. Sie lässt nicht nach, sie zeigt keine Eile, sie hört nicht auf.
9
Berlin, Juni 1812. Jerusalemskirche, leer. Orgel spielt Choral. Nur am Taufstein eine Gruppe von fünf Personen: ein Pfarrer, Willem, Marie, Herr von Fagel, Lina Hoffmann.
– Und ich taufe dich auf den Namen Wilhelmine Marie, sagt der Pfarrer.
Hand des Pfarrers trägt Datum und Namen in das Taufbuch ein:
29. Juni 1812, Wilhelmine Marie von Dietz. Vater: Wilhelm Friedrich von Dietz. Mutter: Maria Dorothea, geborene Hoffmann.
Bei der Rubrik «Ehelich oder unehelich» zögert er und füllt sie nicht aus, schreibt weiter. Prediger: Stegemann. Taufzeugen: Oberst-Lieutenant Ruprecht von Fagel, Demoiselle Caroline Wilhelmine Hoffmann.
10
Berlin, Juni 1812. Niederländisches Palais. Willem mit Fagel in seinem Arbeitszimmer.
Es klopft. Gouvernante mit der zweijährigen Marianne kommt herein.
– Verzeihen Sie.
– Nein, ich verzeihe nicht. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich jeden Abend, wenn ich zu Hause bin, meiner Tochter einen Gutenachtkuss geben will. Da gibt es nichts zu verzeihen, Frau Lunow!
Willem lacht und küsst seine Tochter.
Gouvernante und Marianne gehen hinaus.
– Das haben Sie gut gemacht, Fagel.
– Es war Ihre Idee.
– Auf von Dietz hätte jeder kommen können. Irgendeinen Vorteil muss es ja haben, ein Nassauer zu sein. Nein, ich meine, dass der Pfarrer einen unverdächtigen Eintrag gemacht hat, das haben wir Ihnen …
– Ihr Diener, mein Prinz.
– Ich baue auf Ihr Schweigen, Fagel.
– Mein Ehrenwort.
11
Berlin, September 1812. Maries Wohnung. Willem kommt herein, umarmt Marie, sieht sich um.
– Wo ist das Kind?
– Bei meiner Mutter. Lina passt auf.
– Das gefällt mir nicht. Ich möcht sie doch sehen, die kleine Minna.
– Entschuldige, aber immer allein mit dem Kindchen, das geht nicht. Ich …
– Aber jetzt weiß es die ganze Jacobstraße und bald die ganze Stadt.
– Ach was, in jeder Straße gibts mindestens ein Dutzend, die was Kleines haben von einem Vater, der weg ist. Fast alles Franzosenkinder, die Franzosen, die waren ja auch nicht faul. So viel Aufsehen macht das nicht.
– Aber bei euch kommen die Nachbarn vorbei und schauen sich das Kind an?
– Unser Kind, ein schönes Kind.
– Und sie fragen nach dem Vater?
– Natürlich fragen sie nach dem Vater. Der Offizier von Dietz, 4. Artillerie-Regiment.
– Hab ich je was vom Statthalter gesagt?
– Nein.
– Vom Prinzen von Oranien?
– Nein, Wilhelm.
– Du weißt, wenn es Gerüchte gibt, kriegst du nur die Hälfte. Ich kann Gerüchte nicht brauchen. Sag das auch deiner Mutter.
– Meine Mutter sagt nichts.
– Du gehst alle Vierteljahr ins Palais zum Finanzrat Boyer und kriegst fünfzig Friedrichsdor.
– Fünfzig! Du bist so gut, Wilhelm.
Er zieht sie aus, sie ihn.
– Du kannst eine Amme nehmen und wieder tanzen gehen. Für dich ist gesorgt, für die Kleine auch. Ich muss nach England.
– Ich danke dir. Es ist so schön, dass sie deinen Namen hat und meinen.
– Wir werden uns wiedersehen.
– Mein lieber, lieber Wilhelm!
Sie stürzen ins Bett.
Meiner Freundin, die ich hier Jutta nenne, verriet ich lange nichts von Wilhelmine. Einige Monate lang hatten wir uns nur selten gesehen, Jutta suchte Distanz, und wieder einmal war die Literatur schuld an allem. Sie hatte sich in der Fähre von Caputh zu deutlich abgezeichnet gefunden, ihre Kindheit in Wismar, das Studium der Sinologie, ihre Arbeit am Rand des Neuen Forums, die mühsamen Anfänge 1990 als Journalistin bei einer Potsdamer Zeitung, ihre Entlassung wegen eigener Meinung und der vorläufige Abstieg in ein Rundfunkarchiv. Die spärlichen Details aus ihrer Biographie waren es nicht allein, mehr noch fühlte sie sich verraten von einigen Schilderungen ihrer Gewohnheiten und Empfindungen. Selbst das Motto von Albert Einstein: Komm nach Caputh, pfeif auf die Welt, hatte sie nicht versöhnt.
Ich verteidigte mich: Ich hätte nur die Ost-West-Klischees vermieden, die in jedem Fernsehfilm vorkommen.
«Wie jemand sich an einem Waldsee auszieht, Kaffee schlürft, mit welchem Vokabular Vorlieben für bestimmte Filme begründet werden, in solchen Einzelheiten», hatte ich erwidert, «und nur in solchen Einzelheiten, stecken die Rätsel, die Farben der Figuren, sogar die kleinen Gegensätze zwischen Ost und West. Mit dir hat das nichts zu tun.»
Das ließ Jutta nicht gelten. Fiktion und Fakten werden immer noch gern verwechselt. Um des Friedens willen habe ich jedoch nach und nach zugegeben, zu viel von ihrer Geschichte in das Buch hineingewoben zu haben, und am Ende musste mir Goethe mit seinem Satz beistehen: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.
Juttas Groll war im Lauf der Zeit verflogen, was nicht meinen Argumenten, sondern dem grandiosen Misserfolg des Romans zu verdanken ist. 1439 Käufer, da musste sie nicht allzu viel Aufsehen befürchten.
Wie es dann zu der neuen Annäherung zwischen uns gekommen ist, will ich hier nicht preisgeben, das gehört nicht in dieses Buch. Trotz allen Feuers war ich jedoch vorsichtig geblieben und vermied jedes Gespräch über meine Pläne. Ich wollte nicht schon wieder über meine Arbeit streiten. Jutta ist eine etwas überkritische Begleiterin, kann als DDR-Kind dem 19. Jahrhundert wenig abgewinnen und irgendwelchen versunkenen Monarchen erst recht nichts. Ihre Vorurteile sind die üblichen, ihre historischen Kenntnisse auch. Ich sage das so offen, weil es bei mir genauso war, ehe ich mich mit Wilhelmine und ihrer Zeit beschäftigte.
Ich fürchtete Juttas Spott über meine Königstochter. Und über meinen Forschungseifer mit dieser geheimnisvollen Urgroßmutter des Vaters meiner Mutter.
Doch ich täuschte mich. Ich holte aus, erzählte an einem langen Abend alles, was ich in Erfahrung gebracht hatte und was in den späteren Kapiteln geschildert wird. Die Story vom Schicksal des armen reichen Mädchens verfehlte ihre Wirkung nicht.
Jutta spürte sofort: Minna taugt prächtig als Identifikationsfigur.
Wir saßen in einem Lokal mit einfacher italienischer Küche, die meisten Frauen um uns herum sahen wie Lehrerinnen aus.
«Schau sie dir an», sagte sie, «welche Frau möchte nicht eine Königstochter sein! Welche Frau fühlt sich nicht verraten und verkannt, verkauft und verschoben wie deine kleine Wilhelmine! Eine Frauenstory, das wollen sie doch, die Leserinnen, eine Königstochter, die aus der Gosse aufsteigt, ein feines Mädchen, das zum tragischen Fall wird.»
«Meine Meinung, du sagst es!»
Sie erkundigte sich, wie ich das alles aufbauen, zubereiten und erzählen wolle.
«Genau so, dass jede dieser Lehrerinnen folgen kann», sagte ich. «Sehr konventionell, mit vielen Kutschen, Kronleuchtern, Kostümen und Küssen. Viel Kulisse, viel Staffage. Und alles hübsch der Reihe nach, keine Rückblenden. Eindeutige Charaktere, einfache Sätze, nicht zu kurz, nicht zu lang.»
«Wird das nicht ein bisschen viel auf einmal?»
«Ich muss nur umdenken. Früher hab ich gelernt: Kunst ist Weglassen. Jetzt werd ich das Gegenteil probieren: ausschmücken, ausstaffieren, ausstopfen, übertreiben.»
Als ich das sagte, schwindelte ich. Denn ich fertigte nichts weiter als die Rohschrift der Geschichte. Zum Schmücken, Ausstaffieren und zum sogenannten Gestalten wollte ich mich nicht entschließen. Höchstens aus Spaß, hin und wieder.
«Und», fragte Jutta, «wirst du das Wort Schicksal verwenden?»
Ihre Ironie war nicht zu überhören. Schon bei der Fähre von Caputh hatte sie sich über meine Anpassung an die Erwartungen des Publikums, des Verlages, der Kritiker lustig gemacht. Ich aber mochte in dieser frühen Phase der Arbeit nicht über Formfragen streiten, wollte mir nicht die besten Möglichkeiten zerreden lassen, meinen Stoff auf den Markt zu werfen.
12
Berlin, September 1812. Niederländisches Palais. Mimi und Willem.
– Friedrich Wilhelm hat es nicht gern, dass Sie gehen.
– Ihr Bruder trauert immer noch, ich verstehe das, wir alle vermissen Luise, aber er ist im Augenblick überhaupt nicht fähig zur Politik.
– Willem, Sie mögen sich nicht, aber …
– Darum geht es nicht, Mimi. Napoleon wird sich an Russland die Zähne ausbeißen, da müssen wir vorbereitet sein. Und ohne England kommen wir nie zurück nach Den Haag. Unser Sohn in Oxford wird seinen Vater verachten, wenn der nicht für den Thron kämpft, für meinen und seinen. Und Ihren!
– Ich weiß.
– Was hab ich meinen Alten verachtet, den Zögerer, den Nichtstuer. Das Vergnügen werd ich meinem Sohn nicht gönnen.
– Passen Sie auf, mein Lieber.
– Ich passe auf.
– Und lassen Sie mich keine Gerüchte hören aus London.
– Was für Gerüchte?
– Ach, Sie verstehen mich schon.
– Ich kenne keine Gerüchte.
– Sie wissen ja auch mehr als ich.
Er küsst ihr die Hand.
– Ich liebe Sie, Mimi.
– So wie man Cousinen eben lieben kann.
– Wir werden bald bessere Zeiten erleben, die Verbannung wird aufhören.
– Wir werden nicht jünger.
Oder lieber so:
Wilhelmine, die Prinzessin von Oranien, war eine Frau von fast orientalischem Typus, mit hagerem Gesicht, Ende dreißig und sichtlich mitgenommen von fünf Geburten, den Aufregungen des Krieges und dem Verlust ihrer liebsten Schwägerin und Freundin. Die Langsamkeit ihrer Bewegungen und ihrer Sprechweise, die von einer asthmatischen Kränklichkeit herrührte, ergänzte sich mit ihrer stillen Vornehmheit zu einer Achtung gebietenden Erscheinung. Sie saß mit ihrer verhältnismäßig schmalen und sehr geraden Taille da und sah Willem leidenschaftslos mit einem von langen Wimpern verschatteten Blick an.
– Friedrich Wilhelm hat es nicht gern, dass Sie gehen.
– Ihr Bruder trauert immer noch, ich verstehe das, wir alle vermissen Luise, aber er ist im Augenblick überhaupt nicht fähig zur Politik.
Willem rückte sich einen Sessel heran, spreizte mit einer munteren Bewegung die Beine und legte die Hände auf die Knie, alles mit der Miene eines Menschen, der gern lebt und zu leben versteht, vielleicht auch nur, um den schicklichen Abstand zu seiner Gemahlin zu wahren. Er wiegte sich vielsagend hin und her.
– Willem, Sie mögen sich nicht, aber …
– Darum geht es nicht, Mimi. Napoleon wird sich an Russland die Zähne ausbeißen, da müssen wir vorbereitet sein. Und ohne England kommen wir nie zurück nach Den Haag. Unser Sohn in Oxford wird seinen Vater verachten, wenn der nicht für den Thron kämpft, für meinen und seinen. Und Ihren!
– Ich weiß, sagte die Prinzessin.
Doch mit dem Neigen ihres Kopfes deutete sie ihre stille Ablehnung an. Sie hatte nie in Holland gelebt, und der Zustand des Exils in Preußen, so wenig erfreulich er war, schien ihr immer noch angenehmer als die Aussichten auf den Thron in einem fernen Land. Bisher war ihr das Schicksal der Königstöchter erspart geblieben, aus strategischen Gründen an einen befreundeten Thronerben verheiratet und an einem fremden Hof in fremder Sprache kaltgestellt zu werden. Sie seufzte und warf einen Blick auf das Jugendbildnis ihres Vaters, des späteren Wüstlings, das über ihrem Teetisch hing. Die roten Wangen des jungen Vaters zeugten von einer beneidenswerten Gesundheit. Sie seufzte noch einmal.
Der Prinz sah ihren Blick und hielt es für ratsam, seine politischen Überlegungen fortzusetzen.
– Was hab ich meinen Alten verachtet, sagte er, den Zögerer, den Nichtstuer. Das Vergnügen werd ich meinem Sohn nicht gönnen.
Die Linien seines Mundes waren ungewöhnlich fein gezogen. Die Oberlippe senkte sich wie ein spitz zulaufender Keil auf die kräftige Unterlippe herab, was dem Mund einen Ausdruck von Energie verlieh, und in den Mundwinkeln bildete sich beständig so etwas wie ein zwiefaches Lächeln. Alles zusammen, besonders in Verbindung mit dem festen, klugen Blick, war so eindrucksvoll, dass sogar seine Gemahlin hin und wieder diesem Charme erlag.
– Passen Sie auf, mein Lieber.
Sie lächelte.
– Ich passe auf, versprach er.
– Und lassen Sie mich keine Gerüchte hören aus London.
– Was für Gerüchte?
– Ach, Sie verstehen mich schon.
– Ich kenne keine Gerüchte.
– Sie wissen ja auch mehr als ich.
Der Prinz erhob sich mit der Miene eines zwar ermüdeten, in der Erfüllung seiner Pflichten aber unerschütterlich genauen Menschen und küsste seiner Gemahlin die Hand.
– Ich liebe Sie, Mimi.
Sie schlug die Augen nieder.
– So wie man Cousinen eben lieben kann.
Er verbeugte sich, lächelte, schritt zur Tür des Salons und drehte sich noch einmal um.
– Wir werden bald bessere Zeiten erleben, die Verbannung wird aufhören.
13
Berlin, März 1813. Unter den Linden. Plakat des Königs Friedrich Wilhelm III. «An Mein Volk». Leute davor, einige Tänzerinnen des Balletts, die lesen:
So wenig für Mein teures Volk als für Deutsche, bedarf es einer Rechenschaft, über die Ursachen des Krieges, welcher jetzt beginnt. Klar liegen sie dem unverblendeten Europa vor Augen.
Wir erlagen unter der Übermacht Frankreichs. Der Frieden, der die Hälfte Meiner Unterthanen mir entriß, gab uns seine Segnungen nicht; denn er schlug uns tiefere Wunden, als selbst der Krieg. Das Mark des Landes ward ausgesogen … Gedenkt des großen Beispiels unserer mächtigen Verbündeten, der Russen, gedenkt der Spanier und Portugiesen, selbst kleine Völker sind für gleiche Güter gegen mächtigere Feinde in den Kampf gezogen und haben den Sieg errungen, erinnert euch an die heldenmüthigen Schweizer und Niederländer.
Marie löst sich aus der Gruppe.
– Die heldenmütigen Niederländer.
14
London, Oktober 1813. Willem mit einer Dame im Bett.
– Kiss my toes!
Sie küsst ihm die Zehen, unbeholfen.
Er ist unzufrieden.
– Thank you!
Er komplimentiert sie hinaus.
Willem im Buckingham-Palast. Er stößt mit seinen englischen Vettern auf die Niederlage Napoleons bei Leipzig an. Sein Sohn Willem Frederik tritt neben ihn. Sie lösen sich aus der Gruppe.
– Wir haben Fortschritte gemacht, Willem. Nächste Woche können wir die Verlobung bekannt geben.
– Ich danke Ihnen, Vater.
– Wenigstens du auf einem Thron, ein Trost für deinen alten Vater.
– Ich danke Ihnen, Vater.
– Ist sie dir zugetan, die schöne Charlotte, ich meine körperlich?
– Ich habe einmal ihre Hand berühren dürfen.
– Bis zur Hochzeit, Willem, halt dich zurück.
– Ja, Herr Vater.
15
Berlin, Winter 1813. Niederländisches Palais. Büro. Finanzrat Boyer zahlt Marie 50 Friedrichsdor aus, legt ihr eine Quittung hin.
Sie zögert, unterschreibt.
– Darf ich noch was fragen?
– Bitte.
– Wissen Sie, wann der Prinz zurückkommt?
– Er ist zurück, er ist endlich zu Hause, in Den Haag. Außerdem, Frau Hoffmann, er ist Fürst, seit dem zweiten Dezember ist er der souveräne Herrscher der Niederlande, Willem I.
– Mein Gott!
– Für Sie bleibt er von Dietz! Die Zeit des Prinzen ist vorbei, ein für alle Mal. Haben Sie das verstanden? Jetzt mehr denn je: ich vertrete hier Herrn von Dietz, und niemanden sonst. Haben Sie das verstanden? Wenn wir hören, dass Sie andere Namen nennen, werden die Alimente gekürzt. Haben Sie das verstanden, Frau Hoffmann?
– Ja.
«Wunderbar!», sagte mein Freund, dessen Spitznamen Schoppe ich nicht erfunden habe. Für alte Familiengeschichten ist er immer zu begeistern, aber ich habe ihn noch nie so aufmerksam lauschen sehen wie in den zwei Stunden, als ich ihm von Minna, Willem und Marie erzählte.
Schoppe ist Schweizer, und zu seinen liebsten Nebenbeschäftigungen gehört es, deutsche Autoren um die deutsche Geschichte zu beneiden. Die mitteleuropäischen Katastrophen und Turbulenzen der letzten zweihundert Jahre hätten den Deutschen die verrücktesten, wildesten und tragischsten Storys beschert, aus denen die Autoren nur zu schöpfen brauchten.
«Jeder Weltkrieg eine Fundgrube, der Kalte Krieg eine noch kaum erschlossene Goldmine, jede Familie eine Dramenbühne, jeder deutsche Großvater literaturtauglich.» Jeder Deutsche jeder Generation sei auf jeweils andere Weise von der Geschichte geprägt, berührt, durchgeschüttelt, erhoben und geschlagen.
«Und auch deine Generation, Albert», sagt Schoppe gerne, «mit euren Nachkriegseltern, euren verspäteten Demonstrationen, euren Dauerskandalen kann ich nur beneiden. Eure Politik regiert in alle eure Biographien hinein. Die siamesische Verbindung zwischen den Menschen und der Geschichte gibt es in der Schweiz nicht, nur ausnahmsweise, das ist ein Glück und ein Pech. Deshalb ist Deutschland, und erst recht nach dem Fall der Mauer, ein Schlaraffenland für Schriftsteller – und das Beste ist, dass die das nicht einmal merken.»
Er weiß natürlich, in der Kunst ist das Thema Nebensache. Trotzdem besteht er darauf: Im fetten Frieden der Schweiz könne man nur über Bauern, Bürger, Banken, Berge und immer die gleichen Sonderlinge schreiben, da entstehe nur betuliche Literatur.
Schoppe ist, man hört es seinen Sätzen fast immer an, ungefähr fünfzehn Jahre älter als ich. Er hat sein 68 in Basel verpasst und sucht nun seine Stoffe und Aufregungen in Berlin. Inzwischen kann er von kunsthistorischen Sachbüchern leben und bastelt seit zehn Jahren an einem Fünfhundert-Seiten-Roman über die letzten Tage des Malers Max Liebermann.
«Wunderbar!», sagte er. «Eine Kindesentführung mit königlichen Mitteln, und das vor dem Hintergrund der Befreiungskriege gegen Napoleon, das will ich lesen! Und wir ziehen an einem Strang, merkst du das? Du am einen Ende der Linden mit deinem Niederländischen Palais und ich mit dem Liebermann-Haus am andern Ende!»
16
Brüssel, Winter 1814. Im Schloss Willem und sein Geheimsekretär Hofman. Vor den Fenstern Jubel, Feuerwerk.
– Ein glänzender Tag, Hoheit. Die Brüsseler lieben Sie.
– Ja, das tut gut. Aber nun wieder an die Arbeit, Hofman.
– Zu Diensten.
– Was ich Ihnen noch anvertrauen muss, ist Folgendes. Ich habe in Berlin ein kleines Geheimnis, Sie verstehen, was ich meine. Das Kind ist anderthalb, die Mutter kriegt von mir 50 Friedrichsdor im Quartal. Alles wird geregelt vom Finanzrat Boyer in Berlin. Die gute Frau heißt übrigens Hoffmann, ein f und ein n mehr als Sie. Nein, keine Angst, Sie sollen sie nicht heiraten. Ich will nur, dass Sie die Korrespondenz mit Boyer führen. Ich will alles wissen über Mutter und Kind, Sie legen mir die Briefe Boyers vor, Sie schreiben ihm nach meinen Anweisungen, Sie führen die Akten. Ich befehle Ihnen. Sie befehlen Boyer, ohne dass von mir die Rede ist.
– Ja, Hoheit.
– Sie sind in den siebzehn Provinzen der Vereinigten Niederlande außer mir der Einzige, der von der Sache weiß.
– Ja.
– Ein großer Tag. Brüssel jubelt. Ich werde nach meiner Gemahlin sehen.
– Ja, Hoheit.
17
Berlin, September 1814. Bühneneingang des Theaters, abends. Schauspieler und Tänzerinnen kommen heraus. Als Marie erscheint, tritt ein Herr auf sie zu.
– Nein, Herr von Maltzahn.
– Sie sind die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe, Marie. Ich bin jetzt Oberstleutnant, es geht wieder aufwärts … Ich …
– Lassen Sie mich!
18
Den Haag, November 1814. Ratszimmer im Schloss. Willem, Außenminister Graf Hogendorp, Geheimsekretär Hofman.
Willem von innen: Der hats gut, der darf reisen. Ich beneide ihn, meinen Minister, eine einzige Aufgabe, ein einziges Ziel, die Souveränität der Vereinigten Niederlande, ansonsten Champagner, Walzer, junge Mädchen, morgen reist er ab. Es ist alles besprochen, draußen warten die Kanalbaumeister. Wir sind uns einig, aber er redet immer noch, vornehm und umständlich, als müsste er auch mir den Diplomaten vorspielen. Reisen, Wien, dinieren und intrigieren, reisen, Berlin, ab in die Kutsche mit dir. Die Verbündeten sind einig, Metternich stört unsere Kreise nicht, zwei Minuten geb ich ihm noch, dann steh ich auf. Hogendorp soll sich endlich verabschieden, abreisen und mir die Krone besorgen. Draußen warten die Kanalbaumeister, von morgens bis abends muss ich mich mit Ingenieuren, Bankleuten und Straßenplanern herumschlagen, mit der unglücklichen Mimi, die lieber in Berlin geblieben wäre bei ihrem Bruderherz. Und ich, keiner fragt mich, wo ich am liebsten wäre, ich tu meine Pflicht, wer fragt nach mir. Wie gern wär ich mal wieder in Berlin, ein Stündchen mit Marie, Berlin, wenigstens ein Umweg über Berlin. Ach, Marie, es gibt Tage, an denen ich wünsche … Was hat er da gesagt? Gott segne unser kleines Land. Ja, ja, schon gut. Hogendorp, helfen Sie ein bisschen mit beim Segnen. Immerhin, er lacht, ein lachender Minister. Ein Brief an Marie, nein, immer noch kein Geld für ein Theater, nein, ich werde mich nicht kompromittieren, Spione sind überall, aber ich sollte ihr die Alimente erhöhen, 15 Goldstücke mehr, werde Hofman befehlen, wenn der Herr Diplomat endlich aus der Tür, Ihre Hoheit können beruhigt sein. Ja, ja, ja, ich bin beruhigt, ich habe alles in der Hand, draußen warten die Kanalbaumeister, die Kanäle …
19
Berlin, Ende Dezember 1814. Niederländisches Palais. Büro, Finanzrat Boyer zahlt Marie 65 Friedrichsdor aus.
– Fünfzehn mehr, von jetzt ab.
– Darf ich fragen, warum?
– Anweisung des Herrn von Dietz.
Boyer legt ihr die Quittung hin. Sie zögert.
– Ich … ich will das nicht unterschreiben.
– Sie müssen das unterschreiben.
– Es ist wie verkaufen.
– Wir verkaufen hier nichts, das sind ganz normale Alimente.
– Es sind keine ganz normalen Alimente.
– Frau Hoffmann, hier wird unterschrieben, nicht disputiert!
– Ich will nicht.
– Dann geben Sie das Geld her! Frau Hoffmann, ich sage Ihnen eins. Wir wissen von Ihren Männerbekanntschaften. Falls Sie hier irgendwelchen Einflüsterungen nachgeben oder falls Ihre Familie da etwas im Schilde führt, wird Sie das teuer zu stehen kommen.
Marie unterschreibt die Quittung.
20
Den Haag, Januar 1815. Ratszimmer. Willem und Hofman.
– Was Boyer da schreibt, gefällt mir nicht. Sie will nicht mehr unterschreiben, sie will sich nicht fügen. Sie hat einen Neuen, Maltzahn, ich kenne diesen Gauner. Das erfordert eine neue Strategie. Wir müssen das Kind aus der Familie holen. Der alte Hoffmann ein Trunkenbold, die Mutter streitsüchtig und die arme Marie mit Maltzahn, das ist nicht mehr der richtige Ort für meine Tochter. Was schlagen Sie vor?
– Vielleicht Boyer.
– Ja, Boyer soll das Kind an sich nehmen. Die Boyers sind stille, gute Leute und mir zugetan, sie haben einen kleinen Sohn und genug Platz im Palais. Also, schreiben Sie …
Willem und Mimi beim Tee.
– Nachrichten aus Wien?, fragt sie.