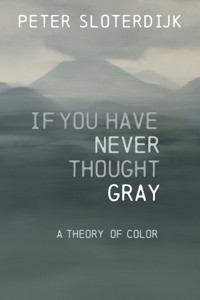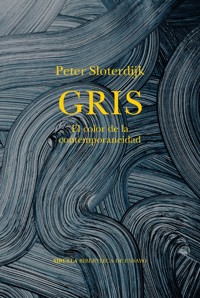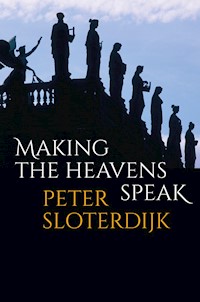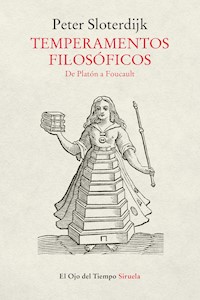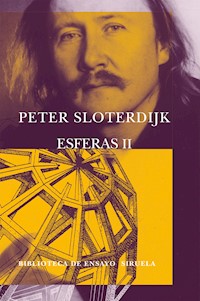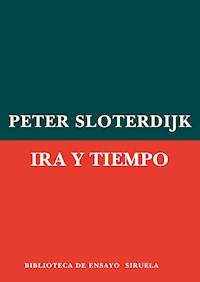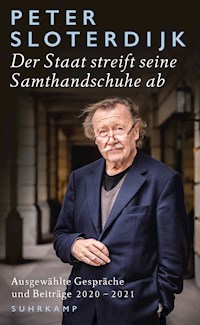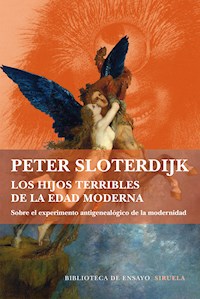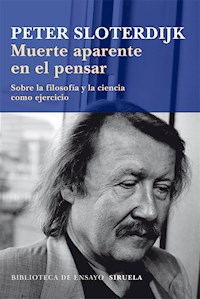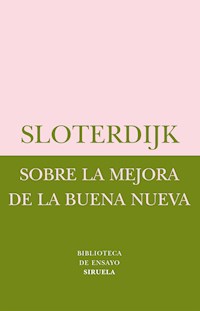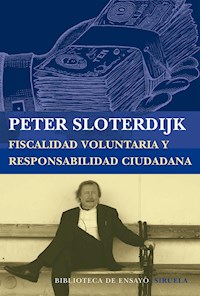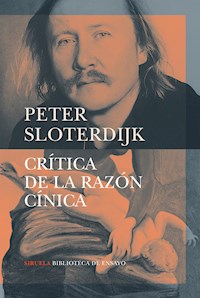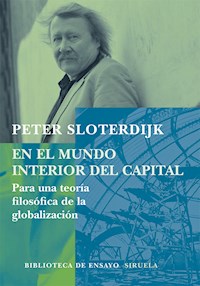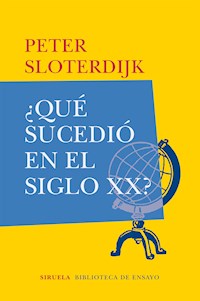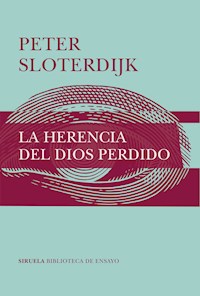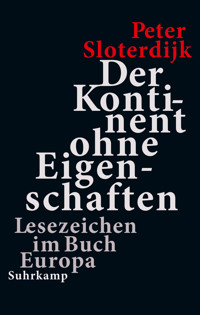
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Über Europa sind viele Bonmots und Untergangsdiagnosen im Umlauf. Man wisse nicht, unter welcher Nummer man Europa erreichen könne, seine Bewohner seien dekadent, der Halbkontinent, der einst den »Rest der Welt« kolonisierte, sei nun seinerseits in den Rest geraten etc.
Doch wie im Fall Mark Twains erweisen sich Nachrichten vom Ableben der »Alten Welt« regelmäßig als stark übertrieben. Gleichwohl sind sich die Europäer ihrer Eigenschaften nicht mehr sicher: »Sie wissen nicht, woher sie kommen, erst recht nicht, wohin die Reise geht.« Um Orientierung zu stiften, blättert Peter Sloterdijk im Buch Europa einige Lesezeichen auf, etwa das des Kulturphilosophen Eugen Rosenstock-Huessy, der die »Autobiografie des westlichen Menschen« als Sequenz politischer Revolutionen erzählte. Sloterdijk öffnet auch das »Buch der Geständnisse«, aus dem sich ein bezeichnender Geist der Selbstkritik erklärt. Und er zitiert aus dem »Buch der Ausdehnungen«, das Europas Missionen im Zeitalter der nautischen Globalisierung illustriert.
Was ist Europa also? Jedes Gemeinwesen, das sich in der Tradition Roms sieht? Ein sich selbst verstärkender Lernzusammenhang? Das wahre Europa, so Sloterdijk, findet sich überall dort, wo die schöpferischen Leidenschaften denen des Ressentiments den Rang abgelaufen haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cover
Titel
Peter Sloterdijk
Der Kontinent ohne Eigenschaften
Lesezeichen im Buch Europa
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Der Text »Erste Eröffnungsrede: Ausreden, Nekrologe, Aprèsludes« ist eine bearbeitete Version der Antrittsvorlesung, die Peter Sloterdijk am Donnerstag, den 4. April 2024 am Collège de France gehalten hat und die von den Éditions du Collège de France 2024 unter dem Titel »Le continent sans qualités: des marque-pages dans le livre de l’Europe« als Einzelausgabe veröffentlicht wurde. Die digitale Ausgabe ist verfügbar als Freemium Open Access auf OpenEdition Books: https://books.openedition.org/cdf/156
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2024
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5537.
© Suhrkamp Verlag GmbH, Berlin, 2024
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
eISBN 978-3-518-78043-5
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Erste Eröffnungsrede Ausreden, Nekrologe, Aprèsludes
Zweite Eröffnungsrede Lateineuropa Der Kontinent, das
imperium
und seine Übertragungen
Lektion eins Die Grande École der Welt Europa als Lernzusammenhang: Aus dem Buch der Steigerungen
Lektion zwei
Out of Revolution
Wie ein deutscher Historiker den Europäern ihre Autobiographie schreibt
Lektion drei Geschichte
a priori
: Das Buch der Endspiele – Spenglers Prophezeiung und wie sie sich erfüllte
Lektion vier
Dire vrai sur soi-même
Das europäische Buch der Geständnisse
Lektion fünf
Geht, setzt die Welt in Brand!
Aus dem Buch der Ausdehnungen
Lektion sechs
Lose Fische
Von Schiffen, Globen und überzähligen Söhnen
Lektion sieben
Get a-way, you old peoples!
Aus dem Buch der Gegenstimmen: Europa im Akkusativ
Dank
Fußnoten
Informationen zum Buch
Phorkyas:
Habt ihr Geduld, des Vortrags langgedehnten Zug
Still anzuhören? Mancherlei Geschichten sind's.
Chor:
Geduld genug! Zuhörend leben wir indeß.[1]
Erste Eröffnungsrede Ausreden, Nekrologe, Aprèsludes
Unter all den Vorwürfen, die gegen das seltsame politische Gebilde namens Europa und seine Bewohner in jüngeren Tagen laut geworden sind – sie ergäben eine lange Litanei, wollte man sie vollständig hören –, dürfte der mildeste jener sein, wonach es durch seine telefonische Unerreichbarkeit auffalle. Man hat dem altgedienten, im November 2023 verstorbenen Politologen Henry Kissinger, einem vormaligen Außenminister der USA, das Scherzwort zugeschrieben, er wisse nicht, welche Nummer er wählen könnte, falls er Europa an die Leitung bekommen wollte. Die Geschichte ist zu gut erfunden, als daß man sie nicht gern weitererzählte, ungeachtet der Tatsache, daß Kissinger sich nicht erinnern konnte, dergleichen je gesagt zu haben. Er meinte, ein irischer Kollege sei es gewesen, der das Bonmot aufbrachte – was mit Rücksicht auf die etwas marginale Lage von Dublin nicht ganz unplausibel klingt. Gegen die Zuschreibung der Anekdote habe er, Kissinger, sich nie gewehrt, weil es doch eine »gute Geschichte« sei.
Der leise Tadel an der Entrücktheit Europas in eine noble Adress-Schwäche, die fast als Sklerose zu deuten wäre, kehrte im Herbst des Jahres 2012 wieder, als der Europäischen Union von der Kommission in Oslo der Friedensnobelpreis zugesprochen wurde. Man lobte die EU dafür, daß sie seit mehr als sechs Jahrzehnten für Frieden und Wohlstand gesorgt habe, auch unter Nationen, die sich vormals gegenseitig für Erbfeinde gehalten hatten – das Lob verbarg ein leises Staunen darüber, daß moderne Staaten nebeneinander existieren können, ohne, wie in historischer Zeit üblich, pro Generation mindestens einmal übereinander herzufallen. Offenbar konnte man sich in der norwegischen Hauptstadt nicht entscheiden, an wen genau die gute Nachricht zu übermitteln wäre – vielleicht an das europäische Parlament? Dann wäre der Deutsche Martin Schulz der zuständige Empfänger des Anrufs gewesen. Oder man hätte es bei der Europäischen Kommission versuchen können, vertreten durch den Portugiesen José Manuel Barroso, eventuell auch beim Europäischen Rat – in diesem Fall hätte das Telefon des Belgiers Herman Van Rompuy klingeln müssen. In Oslo zog man es vor, niemanden zu informieren, angeblich, weil man nicht wollte, daß die Nachricht vorzeitig durchsickerte. Man verließ sich darauf, die Europäische Union, wenn sie sich schon kein Telefon für Überraschungsanrufe von außerhalb leiste, werde aus der Zeitung oder aus den Abendnachrichten rechtzeitig von ihrer Ehrung erfahren.
Ist Europas Erreichbarkeit schon auf der Ebene seiner höchsten politischen Vertretungen, um das mindeste zu sagen, etwas instabil, so verwundert es erst recht nicht, wenn Versuche, Europa auf Volksebene, sozusagen an seiner sozialen Basis, zu erreichen, fürs erste wenig erfolgversprechend scheinen. Ein Volk als ganzes beziehungsweise eine Bevölkerung, ob europäisch oder nicht-europäisch, ist naturgemäß nie dazu geeignet, unter einer postalisch oder telefonisch exakten Adresse erreicht zu werden. Man könnte sich, um dem abzuhelfen, auf ein statistisches oder besser ein aleatorisches Verfahren einigen, das geeignet wäre, die Bewohnerschaft dieser Weltgegend, dargestellt durch einen typischen Vertreter, an den Apparat zu bekommen: Stellen wir uns vor, es könnte gelingen, eine einzelne Person auszusondern, die imstande wäre, als vox populi für die Menge von ihresgleichen zu sprechen! Sie dürfte diese Rolle übernehmen, sofern sie all die Merkmale in sich vereinigte, die den »mittleren Europäer« des Jahres 2024 ausmachen, wie ihn Adolphe Quetelet (1796-1874), der belgische Meisterdenker der Mittelwerte, als die regional typische Version des homme moyen konzipieren würde, könnte er mit diesem Auftrag noch betraut werden. Durchschnittlich ist ein Individuum nicht, wenn es sich, wie Robert Musils Romanheld, in die Abgründe der Eigenschaftslosigkeit versenkt; die Verklärung in der Durchschnittlichkeit erlangt es, indem es die lokal und global relevanten Eigenschaften im Modus wohltemperierter Unauffälligkeit in sich vereinigt. Am mittleren Europäer steht nichts ab – von den Ohren bis zu den Ansichten und den Leidenschaften ist bei ihm alles auf Medianwerte abgerundet. Die gesuchte Person hätte den gemittelten Europäer zu verkörpern, von dem es in statistischen Jahrbüchern heißt, er konsumiere im Jahr 11 Kilogramm reinen Alkohol, 6,2 Kilogramm Brühwurst und 900 Gramm Honig, er leiste eine Lebensarbeitszeit von 35,9 Jahren, setze 0,75 bis 0,85 Nachkommen in die Welt, von denen inzwischen jeder zehnte in einem Ikea-Bett gezeugt wird, er lege im Jahr 12 000 Kilometer zurück, verursache 7,8 Tonnen CO2 und wende 13 Prozent seines Budgets für Mobilitätskosten auf.
Nun müßte man bloß noch einen mit allen in Frage kommenden Kontaktdaten gefütterten Zufallsgenerator auftreiben, dem man die Aufgabe stellen dürfte, den mittleren Europäer aufzuspüren, ohne Zorn, Präferenz und Eifer. Man wählte für den Anruf am besten eine unverdächtige Tageszeit, um Personen mit der Neigung zu späterem Eintreffen in der wachen Welt nicht zu diskriminieren; auch Bürger, die durch die südeuropäische Siesta-Kultur geprägt sind, sollten nicht von vornherein benachteiligt sein. Es ist soweit, der Versuch wird gestartet, die elektronische Kugel rollt, sie ermittelt, desinteressiert und überpersönlich, binnen weniger Minuten aus dem Pool virtueller Erreichbarkeit einen von 450 Millionen Kandidaten. Irgendwo in der Eurosphäre klingelt ein Empfangsgerät. Der Benutzer hebt ab, und zu niemands Überraschung stellt er die naheliegenden Fragen, jenseits von Irritation und Neugier: Wer ruft an? Worum geht es denn? Man erklärt ihm, der Anruf komme von einem Büro außerhalb Europas, dort möchte man einen Europäer kennenlernen, einen wirklichen Europäer, einen normalen Bürger dieser Weltgegend, gewissermaßen repräsentativ für seinesgleichen, jedoch ohne offiziellen oder gar politischen Auftrag. Man würde gern eine Stimme aus der Bevölkerung des Kontinents hören, der seit den Tagen der Kolumbusfahrten die »Alte Welt« heißt, einen Einzelnen, mit dem man sich wie mit einem Exponenten der lokalen Mitte im günstigsten Sinn des Wortes verständigen könne, so unbefangen wie möglich, frei von Hintergedanken beliebiger Tendenz. Selbstverständlich würde man als erstes gern wissen, wer es sei, den anzutreffen man das Glück habe.
Geben wir dem Angerufenen einige Sekunden Bedenkzeit, in der er die Entscheidung trifft, in der Leitung zu bleiben oder aufzuhängen. In diesen Sekunden, so unsere Suggestion, öffnet sich eine Spalte im Inneren des alteuropäischen Gedächtnisraums – und verborgene, seit langem abgelegte Erinnerungen steigen auf. Der mittlere Europäer ahnt, man hat nichts Gutes mit ihm vor, wenn man so plötzlich und unvermutet ihn aus der Menge von seinesgleichen herausgreift. Ihm ist mit einem Mal zumute, als vernehme er dumpfe Geräusche aus einer fernen dunklen Höhle. Instinktiv begreift er: Wer dich so unerwartet anruft, um nach deiner Identität zu fragen, will dir ganz sicher eine Falle stellen. Wenn nach dir gesucht wurde, dann wahrscheinlich, um jemanden zu haben, an den man Vorwürfe richten kann. Man kontaktiert dich, um eine Adresse zu erhalten, an die sich Anschuldigungen zustellen lassen. Doch warum? Was könnte unsereinem vorzuwerfen sein? Wessen könnte man uns bezichtigen wollen? Nun ja, da draußen auf einer Insel voller Gefahren haben wir einen einäugigen Riesen betrunken gemacht, lange ist es her; ihn zu blenden war unser gutes Recht, denn wir wollten nicht wie einige unserer Gefährten in seiner Höhle zugrunde gehen. Gewiß, wir hätten nicht wenige bedenkliche Taten zu gestehen, die auf den Fahrten um die Welt von uns begangen wurden – wenn dies der Augenblick für Geständnisse wäre; davon jedoch kann hier nicht die Rede sein.
Wie soll der mittlere Europäer sich aus der Affaire ziehen? Vielleicht hat er eine homerische Erinnerung parat, und mit ihr die rettende Ausrede? Wie Odysseus könnte er antworten: Niemand ist mein Name! Ich heiße Outis. Tatsächlich, ich bin kein anderer als Niemand – »so nannten mich Vater, Mutter und all meine Gefährten«.[2]
Das älteste Lesezeichen im Buch »Europa«, von dem hier (und auf den kommenden Seiten) einige Kapitel aufgeblättert werden sollen, liefert den Hinweis auf die erste Ausrede, die ein später so benannter Europäer benutzte, um nach dem Zusammenprall mit der Zivilisation der Zyklopen die eigene Haut zu retten. Indem Odysseus der Rache Polyphems und seiner Verbündeten durch einen Namenstrick entging, lieferte er ein unvergeßliches Beispiel dafür, wie auch im frühen Europa, chinesischen Denkmustern vergleichbar, die List (metis, mechané) als Vorspiel zur diskursiven Vernunft – und als ihre ständige Begleiterin – die Bühne betrat.[3]
Blickt man von einem heutigen Standort aus auf die Lage Europas im großen Ganzen, drängt der Eindruck sich auf, die Bewohner des Halbkontinents hätten seit einer Weile die List des Odysseus erneut angewandt, um sich nach der von ihnen ausgelösten Sequenz von Ereignissen, die man die »Weltgeschichte« nannte, in die Niemandsposition zurückzuziehen. Diesmal jedoch will die Allianz der Polypheme sich nicht noch einmal täuschen lassen. Auch wenn die Schiffe der Europäer sich in eigene Gewässer gerettet haben, setzen ihre Verfolger ihnen bis nach Hause nach. Mehr noch, die Angreifer, die gegen die Alte Welt einiges auf dem Herzen haben, die Erniedrigten und Beleidigten aus den verflogenen Zeiten okzidentaler Vormacht, rekrutieren ihren Nachwuchs inzwischen bei den Bewohnern des Niemand-Landes selbst und bei ihren amerikanischen Partnern. Während die mittleren Europäer zwischen Lissabon und Stettin sich zunehmend der Verniemandung überlassen, bilden ihre Feinde von Peking bis Ankara eine Polyphemische Internationale.
Im übrigen hieße es die europäische Situation verharmlosen, wollte man an ihr nur die Flucht in die Ausrede hervorheben, oder, um psychologisch zu reden: das Ausweichen vom Unbehagen in die Desidentifikation. Der Fall Europas nach seiner Herausrückung aus der politischen Mitte der Welt ist ernster als die Verlegenheit eines Bloßgestellten. Um es deutlich zu sagen: Viele Europäer haben aufgehört, sich für sich selbst zu interessieren; sie winken ab, wenn es gilt, aus den Resten des alten Kontinents ein neues Projekt zu formen. Sie würden, wenn sie könnten, sich selbst gegen irgendeinen Anderen austauschen – vielleicht so, wie Giorgio Agamben es im Sinn hatte, als er den Vorschlag machte, den citoyen, der durch das Recht seiner Geburt auf dem Boden einer europäischen Nation zum Träger unveräußerlicher Ansprüche wurde, durch die Figur des Flüchtlings zu ersetzen.[4] Es wäre leichtfertig, solche Äußerungen nur mit dem koketten Extremismus zu erklären, der sich im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts durch das wiederauflebende Interesse an Fragen der politischen Theologie Gehör verschaffte. Man begreift, daß die subtile Europaverachtung, die in Agambens Sätzen zu bemerken ist[5] , aus einer Verachtung älteren Ursprungs schöpft; sie war in spätantiker Zeit von den orientalischen Rändern der mittelmeerischen Welt in die Sphäre der christlichen Rechtgläubigkeit eingedrungen. In den Augen ihrer Vertreter war die Welt ein Ort, der keine Einwohner mit stärkeren Bleiberechten kennen sollte; allenfalls solle er das Nötige bieten, um Menschen auf der Durchreise zu beherbergen; Neugeborene wären hier folglich nicht anders als illegale Einwanderer zu behandeln, mögen auch die einen über diverse Mittelmeerrouten ankommen, die anderen durch das notorische Mutterportal. Was die Tiefe der Verachtung für europäische und allgemein weltliche Zustände angeht, kann sich Alain Badiou mit Agambens Vorliebe fürs Extreme messen – er meint das aktuelle Europa insgesamt in Langeweile versunken zu sehen, ja, er will in ihm nichts anderes erkennen als »ein flüchtiges Gefüge aus diversen Konservatismen«.
Äußerungen dieser Tendenz sind nicht erst von den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts an im Umlauf, bereits in früheren Jahrzehnten waren ähnlich dunkle Töne zu hören gewesen. Aus dem Konzert der Absagen an die westliche Zivilisation zu beiden Seiten des Atlantiks sticht immer noch das im Winterheft 1967 der Partisan Review publizierte Diktum der jungen Susan Sontag (1933-2004) grell hervor: »Die weiße Rasse ist der Krebs der Menschheit.«[6] Da war es ausgesprochen und hingeschrieben, was in Kürze zu einem Leitmotiv okzidentaler Selbstverneinung avancierte – da war er gedruckt und in Umlauf gesetzt, der vom Geist der New Yorker Gnosis beflügelte Satz, den man im Quartier Latin nicht besser hätte formulieren können. Susan Sontags frivoler Ausspruch – der getragen war von der Gewißheit, die Übertreibung sei die Muttersprache genialer Mädchen – hat die Welt umrundet, er hat sich, vor allem im sogenannten Globalen Süden, zu einem stabilen Axiom der Leukophobie verfestigt – des Hasses gegen die Farbe Weiß –, auch dient er mittelbar als Codewort für judenfeindliche Regungen, weil man die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs – die Rachels, Ruths und Mirjams inbegriffen – zumeist ohne weiteres dem genetischen Pool der Weißhäutigen zurechnet, ohne Rücksicht auf die philologisch und phänomenologisch bemerkenswerte Tatsache, daß die biblische Genesis keine Farbwörter kennt.
Die in Europa einheimische Europhobie, manchmal ermäßigt zur Skepsis gegen das Eigene, hatte nicht auf den Beistand von Intellektuellen der amerikanischen Ostküste warten müssen. Es war nicht nur das »Gespenst des Kommunismus«, das seit dem mittleren 19. Jahrhundert in der Alten Welt umging; ein noch unheimlicheres Gespenst, mit dem Namen »Dekadenz«, trieb zur selben Zeit in dieser Weltgegend sein Unwesen. Es präsentierte sich nicht ungern in nationalen Kostümen – wie bei Maurice Barrès (1862-1923), der sich über die dénatalité seines Landes ebenso viele Sorgen machte wie über die fortgehende Schwächung des »sozialen Bandes«, das er sich nur resolut national denken konnte. Gleichwohl trat der Spuk als übernationale Größe in Erscheinung. Über ethnische Grenzen hinweg artikulierte sich eine vage Dekadenzfurcht als Sorge über den vorgeblich allzu sichtbaren »Verfall« der oft mit »Rassen« gleichgesetzten Völker – einen fatalen Vorgang, den man zumeist auf schädliche Mischungen mit Fremdem und Fremden zurückführte. Die von skurrilen Theoremen beflügelte Sorge um die »gefährdete Substanz« stürzte sich in sinistre Spekulationen über die nicht mehr aufzuhaltende Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten, Lungenleiden, Neurasthenien und weiblichen Widerspenstigkeiten, von denen die damals viel kommentierte Hysterie nur eine Vorbotin war. Ein unbestimmter Altersschwächeverdacht breitete sich über den Kontinent aus, die britische Insel nicht verschonend. Der Fin-de-siècle-Akkord aus schleichendem Lebensüberdruß und technischer Bravour verschaffte sich allenthalben Gehör; in ihm regte sich etwas von dem, was Nietzsche »neue Musik für neue Ohren« genannt hätte. Über der erstaunten Hauptstadt der Franzosen ragte der Eiffelturm empor, pünktlich zur Jahrhundertfeier der Französischen Revolution in Auftrag gegeben, als solle er das letzte Wort Europas sprechen, was sein konstruktives Wollen und Können betraf. In den Romanen der Zeit, etwa bei Joris-Karl Huysmans (1848-1907), dessen À rebours 1884 erschienen war, lernte man Männer kennen, die zu verfeinert waren, um eine Fahrt von zu Hause zum Bahnhof zu überstehen. Man leistete sich Kolonien und Migränen, indes man ahnte, beides würde früher oder später ausmünden in das, was man nicht anders als unhaltbare Zustände nennen konnte.
Der Ideenhistoriker Michel Winock (*1937) hat die Gewächshäuser der nationalen Ermattungen in Frankreich vor der Wende ins 20. Jahrhundert ausführlich beschrieben, die erotischen Versuchungen der »schwarzen Romantik« inbegriffen.[7] Es waren die scheinbar glücklichen Jahrzehnte, in denen Europa verstehen Frankreich verstehen hieß. Und doch: Hatte nicht der große Ernest Renan einem jungen Scharfmacher namens Paul Déroulède bereits um 1880 den Rat erteilt: »Frankreich liegt im Sterben. Junger Mann, stören Sie seinen Todeskampf nicht!«[8]
Bis 1914 trugen die Europäer ihr Unhaltbares vor sich her. Spätestens mit der Befreiung von Paris im August 1944 hatten sie die Vorräte ihrer anmaßenden Schwächen aufgezehrt. Und doch, bis heute fehlt es nicht an Nachzüglern, die sich darin gefallen, die dunklen Diagnosen von 1918 wie Nachrichten des Tages zu wiederholen – der erste Band von Oswald Spenglers Der Untergang des Abendlandes war in jenem Jahr erschienen; im übrigen hätte das Buch der Ansicht des Verfassers zufolge ebenso »Die Vollendung des Abendlandes« heißen können. In jüngerer Zeit betätigen sich eine Reihe von Autoren, nicht unbedingt solche ersten Ranges – von Jean-Marie Benoist über Henryk M. Broder bis Douglas Murray –, als Redner am offenen Grab Europas, wobei manche die Dahingegangene als Selbstmörderin[9] bezeichneten – man weiß nicht, ob vorwurfsvoll oder bedauernd. Der Romancier Michel Houellebecq ließ sich im Oktober 2018 den Preis der im belgischen Limburg ansässigen Oswald-Spengler-Gesellschaft verleihen – vielleicht in Würdigung seiner 1998 getätigten Äußerung, wonach der Okzident im Verschwinden sei, jedoch müsse sein Dahingehen eher als »eine gute Sache« aufgefaßt werden. Was beiläufig zeigt, wie in Frankreich, Belgien und einigen deutschen gestrigen Zirkeln der Deklinismus immer noch seinen Mann ernährt. Daß auch Michel Onfray als Epigone Spenglers »unserer judäo-christlichen Zivilisation« jüngst nachsagen konnte, sie sei »tot«, verwundert nicht wirklich. Immerhin bleibt zwischen einer Totsagung in Anwesenheit von Presse und Fernsehkameras und der Ausstellung eines Totenscheins durch Personal mit Leichenhallenerfahrung ein Unterschied, den man nicht ganz außer Acht lassen sollte.
Fassen wir uns kurz: Was wir hier aus Gründen praktischer Vereinfachung »Europa« nennen, stellt ein überaus kompliziertes, vielfach zusammengesetztes Gebilde von einiger zeitlicher Tiefe dar. Je nach Temperament und Schule läßt man es mit dem Sieg der Griechen in den Perserkriegen beginnen oder mit der Krönung Karls des Großen oder mit dem Ausgriff iberischer Seefahrer auf den Atlantik und der schicksalhaften Entdeckung seiner anderen Küste. Die Wortführer dieses politisch-zivilisatorischen Gebildes werden, wie eben bemerkt, seit einer Weile durch Ausreden auffällig, was ihre »Identität« betrifft, auch tun sie sich vielfach durch Nekrologe und Betrachtungen in aprèsludischer Stimmung hervor. Ja, dieses Merkmal läßt sich seit geraumer Zeit in die Bestimmung der »Sache selbst« einbeziehen.
Quasi definitorisch darf man sagen, daß das Europa, das wir auf Anhieb erkennen, sobald von ihm die Rede ist, in dem Moment entstand, in dem es begann, sich zu mißfallen. Wie unvermeidlich richtet sich hier der Blick zurück auf die vor Empörung vibrierenden Zeilen, mit denen der Ire Edmund Burke (1729-1797), der Stifter des modernen Konservatismus, die entwürdigende Behandlung der französischen Königin durch den Pariser Pöbel kommentierte. Wie anders hätte er seinen Befund vortragen sollen als im epilogischen Ton und mit Verachtung für das, was sich im moralgetriebenen Schrecken angekündigt hatte, um wenig später in bourgeoiser Banalität zu enden?
Aber die Zeiten der Rittersitte sind dahin. Das Jahrhundert der Sophisten, der Ökonomisten und der Rechenmeister ist an ihre Stelle getreten, und der Glanz von Europa ist ausgelöscht auf ewig.[10]
An dramatischen Worten hat es den Verfassern von Nachrufen nie gefehlt, auch nicht an gelehrten Diagnosen für die langen Krankheiten der Alten Welt. Vor allem von Nietzsches Befunden sind einige aktuell geblieben, wenngleich der forciert neo-aristokratische Ton seiner Urteile über die beginnende Massenkultur den meisten heutigen Lesern fremd geworden sein dürfte. Hellsichtig scheinen noch immer seine Aussagen, die den nach 1850 Gestalt annehmenden Zeitgeist betrafen. In den »positivistischen Systemen« jener Jahre, ob sie von Franzosen wie Auguste Comte oder Engländern wie John Stuart Mill und Herbert Spencer vorgetragen wurden, spüre man doch, so der Kulturpsychologe auf Sils-Maria-Höhe, sechstausend Fuß jenseits von Rentenreform und sozialer Frage, die Suche labiler Subjekte nach letzten Haltegriffen in der Sphäre des Tatsächlichen – getrieben von »Müdigkeit, Fatalismus, Enttäuschung, Furcht vor neuer Enttäuschung«, begleitet von demonstrativ ausgestellten Zügen wie »Ingrimm, schlechter Laune, Entrüstungs-Anarchismus«, »und was es alles für Symptome oder Maskeraden des Schwächegefühls gibt«.[11] Daher das Bonmot: »Der Mensch strebt nicht nach Glück – nur der Engländer thut das.«[12] In psychodynamisch dunklere Zonen reicht der in Jenseits von Gut und Böse getroffene Generalbefund über das zeitgenössische Dasein:
Der Mensch aus einem Auflösungs-Zeitalter, welches die Rassen durcheinander wirft [an späterer Stelle heißt es: »der europäische Mischmensch«; P. Sl.], der als solcher die Erbschaft einer vielfältigen Herkunft im Leibe hat […] ein solcher Mensch der späten Kulturen und der gebrochenen Lichter wird durchschnittlich ein schwächerer Mensch sein: sein gründlichstes Verlangen geht darnach, daß der Krieg, der er ist [seiner Teilhabe an einander widersprechenden Erbschaften wegen; P. Sl.], einmal ein Ende habe; das Glück erscheint ihm […] vornehmlich als das Glück des Ausruhens, der Ungestörtheit, der Sattheit, der endlichen Einheit, als ›Sabbat der Sabbate‹, um mit dem heiligen Rhetor Augustin zu reden, der selbst ein solcher Mensch war.[13]
In diesen Sätzen scheint der Umriß des Nachkriegseuropäers auf, des damaligen wie des kommenden – indessen das Wort »Nachkrieg«, après-guerre, post-war etc. hier nicht nur den langen Frieden des european way of life meint, wie er sich nach 1945 verwirklichte und durch den Nobelpreis von 2012 gewürdigt wurde; es bezeichnet die vor langem – gewiß schon bald nach der Schlacht von Waterloo – begonnene innere Abrüstung von Menschen, die nicht mehr in eigener Person als Schauplätze von Prinzipienkämpfen und kollidierenden Weisen der Welterzeugung existieren wollten. Eher begnügten sie sich damit, in Zukunft und alle Zeit harmlos und gut zu sein. Mit dem demonstrierenden Finger deutete Nietzsche auf seinen Zeitgenossen, den eine unkompensierte Kriegsmüdigkeit befallen hatte. Ecce homo europaeus![14] Sein Profil war deutlich umrissen, lange bevor er in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts massenhaft in Erscheinung trat. Was der europäische Mensch – in Recheneinheiten Quetelets dargestellt – an erster Stelle für sich fordert, ist Urlaub von allem, was einmal eigene große Geschichte war. Nichts scheint ihm nötiger, als zwischen sich und die Tumulte seiner Vergangenheit den größten Abstand zu legen. Die »Posthistoire« genannte Epoche wurde von hochgradig europäisch empfindenden Autoren wie Arnold Gehlen (1904-1976), Vilém Flusser (1920-1991) und Jean-François Lyotard (1924-1998) ins Gespräch gebracht, um den kognitiven Bedürfnissen einer Population von Welt- und Selbstmüden entgegenzukommen. Es war, als ob von nun an der Satz gelten sollte: On a raison d'être fatigués. Namentlich Gehlen hatte in der »Nach-Geschichte« nicht weniger als eine Ära der »Kristallisation« erkennen wollen. Ihr Inhalt bestünde in den bunten Variationen invariabler Ergebnisse und in der fortgehenden Neu-Inszenierung von Stürmen, zu deren Austragung nicht mehr als Wassergläser und Parlamente nötig seien. Große Geschichte hatte es für Menschen gegeben, die sich in Heldenrollen einberufen ließen. Die Nachgeschichte feiert den langen Abschied von den Helden. Man hat diese Epoche, mit einer Wikipedia-würdigen Wendung, als »die Ausfahrt aus der Weltgeschichte in die Ferien« definiert. Sie ist im übrigen, unter dem Titel »Privatleben«, Europas erfolgreichstes Exportprodukt geworden – in allen Weltteilen wird es mit Eifer konsumiert. Zu seiner Ausbreitung trägt bei, daß überall, wie Nietzsche konstatierte, »immer schon eine neue Generation da ist, die sich im Gegensatz […] fühlt«[15] – nicht nur zu den soeben ins Gestrige zurückweichenden Verhältnissen, sondern zu jeder Vergangenheit. Demnach wäre Europa nicht nur ein Produkt erfolgreicher »Verharmlosung« – ein deutsches Wort, dessen Sinn und Klang von französischen und britischen Ausdrücken wie banalisation, minimalisation, trivialisation nur unvollkommen wiedergegeben wird. Ginge es nach den Vorlieben der Europäer – und ihrer sensiblen Jugendlichen vor allem –, würde von höchster Stelle ein allgemeines Ernstfallverbot verhängt. Für sie kommt jeder reale Notstand einem Verfassungsbruch gleich, jeder Starkregen einem Anschlag auf die Menschenwürde. Nach ihrem scheinbar definitiven Eintritt in die Krieglosigkeit sind die Zimmertemperaturen der Europäer auf »verringerte Daseinsbewährung« eingestellt.
Es wäre ungerecht, den Europäern unserer Tage nachzusagen, sie hätten keine leitenden Ziele mehr. Ihr nicht erloschener Ehrgeiz besteht darin, dafür zu sorgen, daß der Unterschied zwischen Politik und Verwaltung beziehungsweise Demokratie und Versorgungswesen auch künftig sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt so verkleinert, wie man es von den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts an bis zur Implosion des »Ostblocks« um 1990 erlebt und cum grano salis begrüßt hatte.
Der wachsenden sekuritären Ambition der Europäer haben sich nach dem 11. September 2001 unerwartete Hindernisse in den Weg gestellt – sie müssen hier nicht erörtert werden. Noch immer fällt es uns nicht leicht, zu erklären, woran wir mit uns selbst und dem Rest der Welt sind. Die superbe Formel »Rest der Welt« klingt im Mund von Europäern unserer Tage anachronistisch, auch etwas Bitterkeit schwingt noch mit: Der Eindruck läßt sich nicht abweisen, »Welt« ereigne sich seit längerem anderswo, und wir selbst seien in den Rest geraten.
Jacques Derrida hat sich in seinem Essay Das andere Kap (1992), der kurz nach dem Fall der Berliner Mauer anläßlich einer Tagung in Turin entstand, der Sorge gewidmet, ob nicht noch aus der Restlichkeit Europas – gleich ob man sie »Dezentrierung« oder »Provinzialisierung« nennen will – eine neue Monstrosität erwachsen könnte. Tatsächlich schien es einen Augenblick lang plausibel zu fragen, ob nicht »dem Westen« insgesamt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion neue Drachenköpfe sprießen würden.[16] Es war, als hörten wir eine strenge Mahnung, uns vor den Gedanken in acht zu nehmen, die sich in unseren Köpfen wie unvermeidlich regen mußten, nachdem der Koloß im Osten von seinen tönernen Füßen gestürzt war! Es könnten Drachengedanken sein, die im Hintergrund lauerten, um von der ersten Gelegenheit zur Wiederkehr Gebrauch zu machen. Derridas Warnung kam wie auf Zehenspitzen und wollte doch dringend wirken. Damit das Europa der Zukunft richtig begriffen werde, müsse man es wie mit abgeschnittenem Kopf denken. Der Drachenkörper von dereinst, zusammengesetzt aus einem Dutzend sogenannter Mutterländer mitsamt ihren kolonialen Extensionen, dieses monströse multi-imperiale Kompositum, das wir spätestens vom »afrikanischen Jahr« 1960 an[17] , allerspätestens mit den Unterschriften von Evian im März 1962, die das Ende des Algerienkriegs bezeugten, abgestorben glaubten, sollte doch endgültig begraben und unter einer massiven Platte versiegelt bleiben. Daß der Halbkadaver des imperialen Rußlands von den Konvulsionen des Wiedererwachens durchzittert werden könnte, nachdem er sich 69 Jahre lang unter sowjetischer Hülle totgestellt hatte, das durfte uns inmitten der Genugtuung über den Gang der Dinge ebenso wenig beirren wie der Triumphalismus amerikanischer Liberaler, die mit einem Mal den Weg zur alleinigen Weltherrschaft der Vereinigten Staaten frei sahen.[18]
Die Ideen, die im abgeschnittenen Kopf eines nicht mehr monströsen Europa aufkeimen sollten, würden ihre Kraft aus anderen Quellen ziehen müssen als denen der ersten Seefahrerzeit und ihrer Expansionsprogramme. Es läßt sich im kritischen Blick zurück nicht leugnen: In der Ära der nautischen Globalisierung hatte man allzu unbefangen aus christlichen Motiven und zivilisatorischen Phantasmen geschöpft, um für die Ambitionen europäischer Staaten die besten Plätze unter den Sonnen Amerikas, Asiens und Afrikas zu fordern. Das Papsttum höchstselbst, in exemplarischer Korruptheit verkörpert durch Alexander VI. (1431-1503) aus dem Haus der spanischen Borja, hatte die Aufteilung der Welt zwischen den Plünderer-Entdeckern aus Portugal und Kastilien mit dem Vertrag von Tordesillas im Sommer 1494 abgesegnet. Wir wissen, daß sich die Folgen dieser Aufteilung nach einer Serie von Unruhen konsolidierten[19] ; seit den Tagen Simón Bolívars sucht das südliche Amerika, das man oft das lateinische nennt, einen modus vivendi jenseits der Kolonialität, obgleich sein »Befreier«, der Libertador, unter dem Eindruck der Ideen von 1789 und im Fahrwasser der Aktionen Napoleons fast ausschließlich in europäischen Kategorien agierte. Es wäre zu früh für die Behauptung, das südliche Amerika lebe jenseits des antieuropäischen Ressentiments – wer Beispiele für dessen Fortleben sucht, braucht nur die Zeitungen vom Tage zu öffnen.
Was das politisch auf sich selbst reduzierte Europa als Kontinent ohne Kolonien angeht, wird niemand behaupten, daß die alternativen Quellen zur Stunde besonders kräftig fließen. Warum ihr Zufluß nicht notwendigerweise versiegen wird, läßt sich gleichwohl erklären. Der abgeschnittene Kopf hat sich innerhalb einiger Jahrzehnte – von oben her und ohne spezifische Energie von unten – mit einem komplizierten, doch nicht mehr monströsen Körper aus 27 Organen verbunden – noch sucht man Namen und Begriffe, um das Unding zu bezeichnen, für das es in der Geschichte politischer Großkörper kein Vorbild gibt. Noch immer haben diverse Versuche, dem Novum eine Kontur zu geben – etwa seine Bestimmung als »stille Macht«[20] –, zu keinen überzeugenden Ergebnissen geführt. Derridas Meditationen von 1990, unter dem Eindruck des Neuen im Osten entstanden, lesen sich heute als Meisterwerk der Undeutlichkeit – es bildete den Versuch, hypothetische Imperative und preziöse Konjunktive als formale Garanten der historisch gebotenen Umsicht und Vorsicht zu präsentieren. Derrida gehörte zu den Denkern, die im Ernst zu glauben schienen, von einem übereilten Wort aus dem Mund eines Philosophen könnten – wie Beispiele aus dem 19. Jahrhundert gezeigt hatten – auf dem Umweg über ideologische Multiplikatoren und passende machtpolitische Konstellationen erneute Großkriege, ja Weltkriege ausgehen. Er wählte die Tonart eines Sicherheitsberaters für ein Phantom, das seine Verkörperung nur zögernd erstreben sollte. Im guten wie im schlechten Sinn bleiben Derridas gewundene Ausführungen und seine etwas schalen Spiele mit den Wörtern Kap, Kapital und Kapitale von zeugnishaftem Wert für die Verlegenheiten dieser Region, die aus der Sequenz des Doppelkrieges von 1914 bis 1945 als eine gebrochene Größe hervorgegangen war. Derrida stellte die rhetorische Frage:
Hat es […] Europa jemals gegeben? Wir gehören jedoch zu jenen jungen Menschen, die sich im Morgengrauen schon alt und müde von ihrem Lager erheben. Wir sind bereits erschöpft.[21]
Demnach lebten wir in dem stark kompromittierten Teil der Welt, wo jedem Versuch des Neubeginns die Lasten einer überschweren Geschichte zuvorgekommen sind. Wer sich in solcher Lage der Aufgabe, Europa neu zu denken, zuwendet, muß wissen, es wird darum gehen, Begriffe für ein politisches und kulturelles Novum zu bilden, dessen Existenz unter großteils noch unbekannten Vorzeichen steht: Begriffe für einen Kontinent ohne Eigenschaften.
Von einer halben Milliarde Menschen bewohnt und als Zufluchtsort unzähliger potentieller Zuwanderer begehrt, sucht er seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach einer neuen Bestimmung für sich und seine Völker, die man vorsichtshalber »Bevölkerungen« nennt, damit ihnen ihre populus- oder demos-Eigenschaften nicht zu Kopfe steigen. Ihm ist in der Gestalt der Europäischen Union eine politische Improvisation gelungen, die in den Drehbüchern der Weltgeschichte nicht vorgesehen war. Der Quasi-Kontinent hat einen politischen Großkörper geschaffen, der ungeachtet seines Umfangs weder die Gesinnungen noch das Gebaren eines Imperiums an den Tag legt. Seine Hauptstädte mögen alle Vorzüge urbanen Lebens aufweisen, sie haben die phallische Strahlkraft aufgegeben, die vormals den Metropolen kolonienbildender Mächte zukam. Sie ziehen Touristen an, ohne Sendestationen größerer Missionen zu sein. Die Bewohner Europas honorieren den Zustand ihrer askriptiv zugeteilten neuen Europäität durch die hartnäckige Gewohnheit, den Wahlen zum europäischen Parlament zur Hälfte fernzubleiben – nur Belgier und Luxemburger votieren bei Europawahlen so fleißig, als ob es nationale Abstimmungen wären. Und obschon die Bürger des neuen Konstrukts durch ihre Mitgliedschaft in dem schwer begreiflichen Großgebilde in klarer Mehrheit auf der gewinnenden Seite stehen, fällt es sehr vielen noch schwer, das Abstraktum mit den Affekten auszukleiden, die einer gefühlten Heimat entgegengebracht würden. Darin spiegelt sich die Tatsache wider, daß das postimperiale Europa, das von den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts an in den dürftigen Umrissen eines Verbandes für die Interessen der Bergbauindustrien, Montanunion genannt, aufgetaucht war, von Anfang an ein Projekt besorgter, hoffnungsstarker und weitblickender Eliten war. Deren Nachfolger wollen sich noch immer – obwohl Bergbau inzwischen eher eine un-europäische Tätigkeit geworden ist – in ihrem Glauben nicht beirren lassen, die Mehrheiten würden folgen, sobald die Vorteile des neuen modus vivendi allgemein spürbar würden.
Man muß befürchten, Dostojewskij sei es gelungen, den zeitgenössischen Menschen dieses Erdteils unter der Optik des orthodoxen Christentums dank einer plötzlichen Intuition zu definieren, als er in seinen Aufzeichnungen aus dem Kellerloch – jener grausamen Novelle von 1864, die das Ressentiment auf die Bühne der Weltliteratur katapultierte – den Protagonisten sagen ließ, der Mensch sei ein zweibeiniges undankbares Tier.[22]
Der durchschnittliche Europäer von heute, der mit seinem nicht immer unberechtigten Groll gegen die oft undurchsichtigen, nahezu extraterrestrischen Vorgänge in Brüssel und Straßburg vor sich hin lebt, ohne die Prämissen seines Daseins zu bedenken, ist die Inkarnation der Undankbarkeit – sofern sie bedeutet, in der Drift quasi-posthistorischer Befindlichkeiten zu treiben und nicht zu wissen, geschweige denn wissen zu wollen, aus welchen Quellen der gegenwärtige modus vivendi hervorgegangen ist. Allzu oft ist der Europäer von heute der Endverbraucher eines Komforts, von dessen Entstehungsbedingungen er nicht mehr den geringsten Begriff hat. In seinem von Erinnerungslücken perforierten Dasein ist der Satz des Stephen Daedalus wirklich geworden: »Geschichte ist der Albtraum, aus dem ich zu erwachen versuche.«[23]
Wir wollen im folgenden den Versuch machen, dem Geist der Undankbarkeit ein wenig das Wasser abzugraben. Dabei gehen wir von der Annahme aus, Undankbarkeit sei nur ein Synonym für Unbelesenheit und ein heilbares Symptom derselben. Wir definieren Europa hier als ein Buch, das von denen, die es angeht, zu wenig gelesen wird, und in dem seine Hasser nur blättern, um ihre Anklagen zu dokumentieren. Die anschließenden Kapitel sind als Lesezeichen in einem Band von nahezu entmutigendem Umfang zu verstehen. Sie heben darin einige Stellen hervor, indem sie bei einem zerstreuten Publikum für die markierten Seiten um eine Minute Aufmerksamkeit bitten.
Zweite Eröffnungsrede Lateineuropa Der Kontinent, das imperium und seine Übertragungen
Eine Erdgegend wie Europa einen »Kontinent« zu nennen scheint fürs erste eine sprachliche Konvention ohne Risiko zu sein. Sie profitiert von dem seit dem 18. Jahrhundert eingeschliffenen Irrtum von Kartenzeichnern und Geographen, zusammenhängende Landmassen als Kontinente zu bezeichnen, als ob die ausgedehnten Festlandböden Behälter wären, die das, was in ihnen liegt und auf ihnen errichtet wird, zu »Inhalten« machten. Seit der durch die Fahrten von Kolumbus und Magellan eröffneten planetarischen Moderne sollten wir wissen, warum das Verhältnis von Inhalt und Behälter sich umgekehrt darstellt. Die effektiven Behälter, die den Namen continens, »das Zusammenhaltende«, verdienen, sind die globalen Meere, die man nach dem griechischen Weltfluß okeanos benannte, indessen die großen Landmassen, richtig verstanden, nicht Kontinente, Behälter, container sind, sondern Inhalte, contents, vom Meer umspülte Zusammenhänge aus Böden und Populationen.
Suchen wir für den Inhalt »Europa« nach geeigneten Bezeichnungen, so stoßen wir auf ein ausweichendes Phänomen, dem man vergebens eine »Identität« anzuheften versucht. Was ist denn Europa? Hat dieses Gebilde ein Wesen, einen Kern, eine Substanz? Die verneinenden Antworten auf die oft gestellten Fragen sind zu zahlreich, um sie im einzelnen zu rekapitulieren. Ist Europa, abgesehen davon, daß es den als eigenen Kontinent mißverstandenen westlichen Anhang der asiatischen Landmasse bildet – aus der Sicht Valérys deren agiles »Vorgebirge«, in Derridas Augen das »andere Kap«, nach der Auffassung des Slawophilen Danilewski nicht mehr als ein konfuses Aggregat aus Halbinseln –, dennoch irgend etwas Reales, woran man seine Bestimmung festmachen könnte? Wir möchten uns hier – nach mehr als einhundert Jahren kontroverser Reden über die »Natur«, das »Wesen«, die »Substanz«, die »Grenzen«, die »Mission«, die »Bürde«, die »Passion« oder das »Erbe« Europas zu einem strikt pragmatischen Zugang bekehren. Statt essentialistische Phantome zu jagen, begnügen wir uns mit der Frage: Was tut Europa, wenn es am meisten bei sich selbst ist? Dies kommt der Frage gleich, ob es etwas gibt, woran man Europäer erkennt, sobald sie sich als typische Agenten ihres kulturellen Pols verhalten?
Kurzum, wir bekennen uns zu der Notwendigkeit, daß, wenn man von Europa reden will, ein Übergang vom essentialistischen oder substantialistischen zum dramaturgischen oder szenographischen Denken zu vollziehen ist. Was man Intelligenz oder »die Fähigkeit, zu verstehen«, nennt, bezieht sich von alters her nicht nur auf Zeichen, Wörter und Sätze, wie es unter modernen Sprachphilosophen common sense wurde, es bezieht sich seit jeher auch auf Gesamtlagen aus bedeutungsgeladenen Situationen, die man unter Theaterleuten »Szenen« nennt. Intelligenz zeigt sich nicht zuletzt in der Fähigkeit, in Szenen zu lesen oder Lagen zu erfassen. Europa dramaturgisch und szenisch zu denken – das impliziert die Aufgabe, einen privilegierten Ort innerhalb dieses Weltteils zu bezeichnen, in dem das Drehbuch und die Regieanweisung für das später Folgende aufgesetzt wurden.
Wenn wir im Folgenden vom »Buch Europa« sprechen und ankündigen, in ihm sollten einige Lesezeichen eingelegt werden – und dies, wie man sehen wird, bevorzugt an wenig gelesenen Stellen –, sollten wir uns über die Metapher des Buchs verständigt haben. Bücher und Kulturen haben das Merkmal gemeinsam, daß in ihnen das »Umblättern« und die Fortsetzung von Lebensweisen in folgenden Generationen formale Äquivalente bilden. Zwischen Kulturen und Büchern bilden die Modi des Lesens beziehungsweise die Formen des Re-Inszenierens eine dritte Größe. Sie sorgen dafür, daß es zu Wiederaufführungen früherer, zu »Stücken« geronnener Elemente einer Kultur kommen kann. Re-Inszenierungen bilden die aktive Mitte zwischen dem Umblättern und der Fortpflanzung. Der nächsten Seite entspricht die nächste Generation.
Vergegenwärtigen wir uns für einen Augenblick die Bedeutsamkeit der Geste des Umblätterns für das historische Bewußtsein im allgemeinen, ja für den Sinn von Kohärenz und Reihenfolge überhaupt. In seiner 1975 publizierten Erzählung »Das Sandbuch« (»El libro de arena«) hat der argentinische Dichter Jorge Luis Borges den Albtraum jedes Historikers geschildert, mehr noch den eines jeden Menschen, der sich der Ordnung der Dinge unter dem Gesetz des Nacheinander vergewissern möchte.
Eines Tages klingelt es an der Tür des Erzählers, ein Fremder nordländischen Aussehens stellt sich vor mit dem Anliegen, Bibeln zu verkaufen – er habe aber noch ein anderes heiliges Buch in seinem Besitz, das für einen Liebhaber vermutlich von Interesse sei. Der Bibelhändler fügt hinzu, er habe das Buch in Indien bei einem Unberührbaren, der nicht lesen konnte, im Tausch gegen einige Rupien und eine Bibel erworben. Tatsächlich findet sich auf dem Buchrücken die Inschrift Holy Writ und der Name des Verlagsorts: Bombay. Der Vorbesitzer habe behauptet, das Buch heiße das »Sandbuch«, weil weder dieses Buch noch der Sand Anfang und Ende hätten.
Der Erzähler berichtet nun, er sei bei seinen Versuchen, die erste oder die letzte Seite des Werks aufzuschlagen, mehrmals gescheitert: Es blieben zwischen dem blätternden Finger und dem Buchdeckel stets ein paar Seiten, die aus dem Buch hervorzuquellen schienen. Als der Erzähler es irgendwo in der Mitte aufschlägt, erscheint auf der linken Seite die Paginierung 40 514, rechts gegenüber steht die Zahl 999. Blättert er um, zeigt sich auf der folgenden Seite eine achtstellige Zahl. Es erweist sich als unmöglich, eine einmal geöffnete Seite wiederzufinden.
Dem Ausruf des Erzählers: »Das ist nicht möglich«, erwidert der Verkäufer mit leiser Stimme:
– Das ist nicht möglich und dennoch ist es so. Die Zahl der Seiten dieses Buchs sind exakt unendlich. Keine ist die erste, keine die letzte. Ich weiß nicht, warum sie auf so willkürliche Art numeriert sind. Vielleicht um auszudrücken, daß die Elemente einer unendlichen Reihe auf absolut beliebige Weise beziffert werden können.
Dann fügte er, als ob er nachdächte, hinzu: – Wenn der Raum unendlich ist, sind wir an einer beliebigen Stelle im Raum. Wenn die Zeit unendlich ist, dann sind wir an einer beliebigen Stelle in der Zeit.[24]
Wie kaum eine andere Geschichte weist das böse Märchen vom Sandbuch auf das humane Interesse an der Endlichkeit hin. Nur in endlichen Verhältnissen läßt sich sinnvoll von Reihenfolgen, Konsequenzen und Proportionen sprechen; sie bilden die Grundfiguren dessen, was gegeben sein muß, damit die wohltätige Fiktion von der Erzählbarkeit einzelner Lebensgeschichten und umgreifender Kollektivgeschichten in Kraft bleibt. Das Sandbuch bedeutet die Unmöglichkeit, eine Geschichte zu erzählen; es impliziert die Vergeblichkeit jedes Versuchs, mit Hilfe des Lesezeichens eine bestimmte Seite wiederzufinden.
Man sollte hier wohl daran erinnern, daß in der antiken Gattung der bioi die europäische Utopie des »Seins zum Buche« aufgetaucht war. Sie spiegelte sich in der von Plinius dem Jüngeren geprägten, von den Humanisten des 16. Jahrhunderts gern zitierten Devise des Lebens im Licht der Bemerkenswürdigkeit: aut scribenda agere aut legenda scribere. »Man handle so, daß es sich lohnt, es aufzuschreiben, und man schreibe so, daß es sich lohnt, es zu lesen!«
Wird Europa als »Buch« vorgestellt, ist eo ipso ein geskriptetes Produkt gemeint. Als gültiges Skript zeichnet es den Vorgängen, von denen es handelt, mehr oder weniger feste Plätze in einer nicht umkehrbaren Zeitreihe vor. Manche Skripte jedoch – auch das hier besprochene – weisen die Merkwürdigkeit auf, daß, wer sie liest, es unversehens riskiert, in eine Neuauflage einbezogen zu werden, und dies nicht bloß zufällig. Sie werden verfaßt, um dem Leser mit einem resoluten tua res agitur! – es geht um dich selbst! – die Illusion der unbeteiligten Lektüre zu rauben.[25]
Was die Härte von Machtgebilden im politischen Raum mit der Sphäre des Buches verbindet, ist das, was man die symbolische Funktion nennt. Als soft-power-Gebilde gehören Bücher der Dimension der Zeichen an. Der Primus unter den Zeichen ist der Befehl, der im Modus Imperativ übermittelt wird. Während Bücher als Agenten sanfter Gewalt Vorschläge machen, die angenommen oder mißachtet werden können, gehen von den Mächten der harten Gewalt Befehle aus, die mit Sanktionsmacht unterlegt sind. Imperare bedeutet in der Sprache der Römer herrschen. Der Imperativ ist das grammatische Sediment der Erfahrung, daß befehlende und motivierende Kräfte – als zielsetzende Stimmen und richtunggebende Signale – in der Welt sind. Sie bilden die Brücke von den Worten zu den Taten und den Tatsachen. Imperium nannte man seit den Tagen der Republik die zeitlich und räumlich präzis beschränkte Befehlsgewalt des Oberkommandeurs römischer Truppen. Imperium hieß schließlich der Gesamtraum, in dem von Rom ausgehende Befehle befolgt werden mußten. Aus dem Befehl über Truppen war mit der Zeit die Zentralmacht in der res publica geworden, kulminierend in der Figur des Imperators. Nach dem Sieg Octavians im römischen Bürgerkrieg nannte man die höchsten Befehlsgeber die Caesaren, weil der junge Mann im Testament von Gaius Julius Caesar als dessen namentragender Erbe adoptiert worden war. Aus dem Eigennamen ging ein Allgemeinbegriff hervor.
Das originale Stück, um dessen Wiederaufführung es in »Europa« gehen wird, heißt imperium romanum. Im Heldenepos Vergils ermahnt der Vater des Aeneas den »frommen« Sohn, der ihn in der Unterwelt aufsucht, um sein Mandat zu erhalten, er möge, »als Römer« ante litteram, immer bedenken, die Völker durch seine Befehlsmacht zu lenken.[26] Europa verstehen bedeutet daher zunächst: die Metamorphosen eines Gebildes verstehen, in dessen Zentrum die imperative Funktion Roms am Werk blieb.
Um es ohne weitere Herleitung zu statuieren: Aus dramaturgischer Sicht ist Europa das Wirkungsgebiet von Re-Inszenierungen römischer Befehlssysteme. Aus diesen sind – mit einer Verspätung von eintausend Jahren und mehr – die neuzeitlichen europäischen »Staaten« hervorgegangen, zumeist als »Nationalstaaten« aufgemacht, mit der Helvetischen Konföderation als bedeutsamer Ausnahme. Sie stellen politische Systeme dar, die dazu verurteilt sind, früher oder später auf ihre Weise zu erfahren, was schon in alten Tagen das römische Dilemma war: die imperiale Überdehnung – wobei sich zeigt, daß auch Nationalstaaten für Überdehnungen anfällig sind. Von der Augustus-Zeit an war das italische Kernland befugt, befähigt, willens und genötigt, über Probleme zu entscheiden, die es sich infolge seiner hybriden Ausdehnung nach Syrien, Palästina, Ägypten, Nordafrika, Spanien, Gallien, Germanien und Südbritannien zugezogen hatte. Das Konzept »Imperium« implizierte auf der Höhe seines Erfolgs das Programm »Befehl ohne Grenzen«, von dem man ohne Erläuterung versteht, warum es an sich selbst scheitern mußte.
Es erübrigt sich hier, die hundertmal erzählte Geschichte vom Untergang Roms und seiner Aufspaltung in den weströmischen Verfallsraum und die tausendjährige oströmische Verfallsverlängerungszone zu rekapitulieren. Für die Geschichte des Weltteils, der später Europa heißen würde, ist hier nur die Verschiebung des Motivs der befehlenden Gewalt nach Norden und Westen von Bedeutung.
Sollte man sagen, wann und wo das Europa, in dem wir noch immer leben, entstanden ist, ist auf eine Szene zurückzugehen, deren Vergessenheit im starken Widerspruch steht zu ihrem Reichtum an Folgen, den symbolischen wie den faktischen: Ambrosius (339-397), der Bischof von Mailand, hatte im Jahr 390 dem Kaiser Theodosius den Zutritt zur Kirche dort verweigert, weil dieser noch nicht Buße getan hatte für das Massaker von Thessaloniki (in der römischen Provinz Macedonia), das man ihm zur Last legte – in jener Stadt waren, wie es hieß, Tausende Besucher des Hippodroms auf kaiserlichen Befehl hin von gotischen Truppen niedergemetzelt worden, nachdem eine aufgebrachte Menge einen beliebten Wagenlenker, der festgesetzt worden war, mit Gewalt hatte befreien wollen – Theodosius hatte die Unruhen der Massen persönlich genommen und als Aufstand gegen seine kaiserlichen Würden gedeutet. Die Urszene Europas bezeugt Europas Besonderheit: Von Anfang an macht sich die Spaltung der obersten Autoritäten geltend. Politische und geistliche Macht, obschon zumeist aufeinander angewiesen, sprechen in dieser Weltgegend nie ganz die gleiche Sprache. Die Lehre Augustins von der »civitas Dei«, die dem irdischen Staat bis zum Ende der Zeit gegenüberstehe, sollte nur wenig später die Dualität von politischer und spiritueller Macht für die kommenden anderthalb Jahrtausende befestigen.[27] Was Europäer für ihre »Freiheit« halten, resultiert aus ihrem verlegen machenden Privileg, zu jeder Zeit zwei Herren dienen zu dürfen – dem Kaiser und Gott beziehungsweise dem Vaterland und der Wahrheit. Ambrosius hatte die Möglichkeit, die später Europa hieß, in die Welt gesetzt, als er auf seiner Pflicht beharrte, den Kaiser einen Sünder zu nennen. Der Kaiser seinerseits hatte dieser Möglichkeit erlaubt, Wirklichkeit zu werden, indem er sich dem Ritual der Buße unterzog, das nur als hohles Theater zu bezeichnen ein modernes Mißverständnis wäre. Die im monistischen Klima des spä