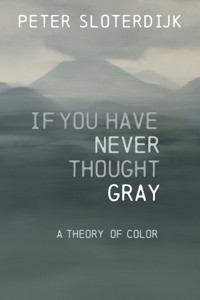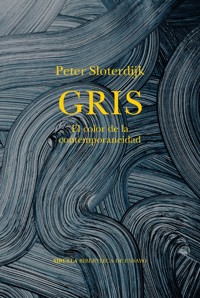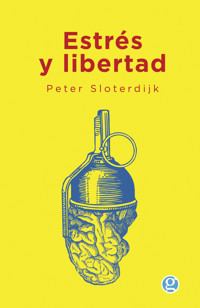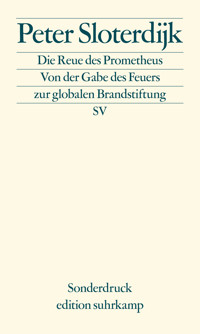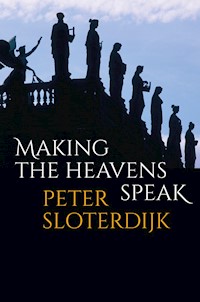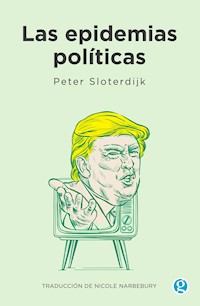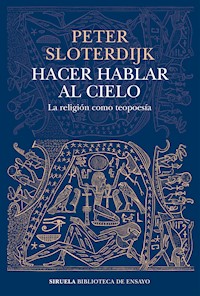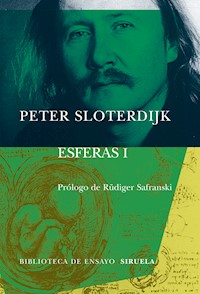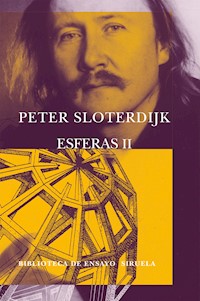17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
1983 trat der »philosophische Schriftsteller« Peter Sloterdijk mit der zweibändigen Kritik der zynischen Vernunft hervor. Seitdem hat er Untersuchungen zu so unterschiedlichen Themen wie Europa und Eurotaoismus, Nietzsche und Heidegger, Psychologie und Politik veröffentlicht. 2004 ist der letzte Band seines großen Sphären-Projekts erschienen.
In sechs großen Wechselreden mit Hans-Jürgen Heinrichs legt Sloterdijk hier den roten Faden frei, der sein Werk durchzieht, erläutert die existenziellen und philosophischen Beweggründe seiner Entdeckungsreisen und erklärt die wichtigsten Thesen seiner Bücher. Somit erlaubt Die Sonne und der Tod nicht nur eine genaue Verfolgung der Sloterdijkschen Denkbewegung, sondern bietet auch die Möglichkeit einer ersten kompakten Orientierung in seinem Gesamtwerk.
»Eine unerhört anregende, auf höchster Reflexionsstufe angesiedelte tour d’horizon durch nahezu alle großen Themen der Gegenwart.« Albert von Schirnding, Süddeutsche Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Peter Sloterdijk Hans-Jürgen Heinrichs
Die Sonne und der Tod
Dialogische Untersuchungen
Suhrkamp
Inhalt
I Für eine Philosophie der Überreaktion
II Die Sonne und der Tod. Die Menschenpark-Rede und ihre Folgen
III Zur allgemeinen Poetik des Raums. Über »Sphären I«
IV Ich prophezeie der Philosophie eine andere Vergangenheit. Über »Sphären II«
V Arbeit am Widerstand
VI Amphibische Anthropologie und informelles Denken
Literatur
Namenregister
I Für eine Philosophie der Überreaktion
Die Schrecknisse der eigenen Epoche im Ohr
Hans-Jürgen Heinrichs Herr Sloterdijk, der Titel Ihres Buches Selbstversuch von 1996 hat für mich etwas Unheimliches an sich, er erinnert an die Kälte eines Laboratoriums, in dem Selbstverstümmelungen möglich sind, vielleicht sogar Selbsttötungen. Es scheint ein Versuch auf Leben und Tod gemeint zu sein.
In den Ecrits der Schriftstellerin Laure, der Lebensgefährtin von Georges Bataille, gibt es eine Erzählung, in der sie berichtet, daß sie sich als kleines Mädchen oft vor den Spiegel ihrer Mutter gesetzt hat. Dieser Spiegel bestand aus drei Teilen, die man gegeneinander verdrehen konnte. Mit Hilfe dieser Vorrichtung zerlegte sie ihren Körper und setzte ihn wieder neu zusammen. Sie hat diese existentielle Erfahrung der Zerstükkelung und Wiederzusammensetzung als die Vorbedingung ihres Denkens und Schreibens begriffen. Wenn man etwa die Arbeiten von Unica Zürn, von Hans Bellmer oder die Schriften von Lacan heranzieht, findet man dieses Element der Selbstzerlegung, des verstümmelten und zerstückelten Körpers wieder. Hat Ihre Art des Philosophierens ebenfalls die Quelle in einer solchen Dimension von persönlicher Erfahrung mit Zerrissenheit und Ganzheit?
Peter Sloterdijk Ganz sicher, denn ohne den existentiellen Antrieb wäre die Philosophie eine schale Affaire. Zugleich bin ich der Meinung, daß Sie mit dieser hoch ansetzenden Kontextuierung des Ausdrucks »Selbstversuch« ein wenig über das Ziel hinausschießen, das ich mir mit dieser Formulierung gesetzt hatte. Ich bin kein Liebhaber des deutschen Expressionismus, in dem die Haltung des Philosophierens auf Leben und Tod gängig war. Diese Gestik machte vielleicht Sinn, als man 1918 aus den Schützengräben stieg und ahnte, daß man nie mehr so richtig nach Hause kommt, wie Hermann Broch eine seiner Figuren in den Schlafwandlern sagen ließ. Wenn ich von Selbstversuch spreche, denke ich nicht an vivisektorische Experimente am eigenen Leib, auch nicht an die Psychose-Romantik der französischen Psychoanalyse. Mit diesem Wort schließe ich weder an Camus an, der behauptet hatte, es gebe nur ein wirkliches Problem in der Philosophie, den Selbstmord, noch an Novalis, von dem die aufschlußreiche Bemerkung stammt, die Selbsttötung sei die einzige »ächt philosophische« Handlung. Ich nehme eher Bezug auf ein Phänomen in der Geschichte der neuzeitlichen Medizin, die homöopathische Bewegung, die auf Samuel Hahnemann zurückgeht. Dieser erstaunliche Kopf hat im Jahr 1796 – das ist jetzt fast genau 200 Jahre her – erstmals das Prinzip des effektiven Heilmittels formuliert. Zudem war er einer der ersten Heiler, die auf die moderne Ungeduld der Patienten mit adäquaten ärztlichen Angeboten zukamen. Seiner Überzeugung nach bestand für den Arzt die Notwendigkeit, sich selbst mit allem zu vergiften, was er später den Kranken zu verordnen gedenkt. Von dieser Überlegung stammt das Konzept des Selbstversuchs:Wer Arzt werden möchte, muß Versuchstier sein wollen.
Der tiefere Grund für diese Wendung zum Experimentieren am eigenen Leib ist in der romantischen Idee des aktiven Bezugs zwischen Bild und Sein zu finden. Hahnemann war der Ansicht, daß die Wirkungen der Dosis beim Gesunden und beim Kranken sich spiegelbildlich zueinander verhalten. Dem liegt eine anspruchsvolle Semiotik des Arzneimittels zugrunde: Der große optimistische Gedanke der romantischen Medizin, zu der die Homöopathie wesentlich gehört, besteht ja darin, daß eine Abbildbeziehung zu unterstellen sei zwischen dem, was die Krankheit als Phänomenganzheit ist, und den Effekten, die ein pures Mittel am gesunden Körper hervorruft. Die Homöopathie denkt auf der Ebene einer spekulativen Immunologie. Und insofern Immunprobleme immer mehr ins Zentrum der künftigen Therapeutik und Systemik rücken werden, haben wir es mit einer sehr aktuellen Tradition zu tun, obschon die Wirkungsweise der homöopathischen Dosen weiterhin im dunkeln bleibt.
So gesehen gehört die Formulierung meines Buchtitels eher in die Tradition der romantischen Naturphilosophie, genauer der deutschen Krankheitsmetaphysik, als in die Linie der französischen Diskurse über den zerstückelten Körper. Aber mehr noch geht er natürlich auf Nietzsche zurück, der gelegentlich mit homöopathischen und häufig mit immunologischen Metaphern gespielt hat. Nicht umsonst läßt Nietzsche seinen Zarathustra zur Menge sagen: »Ich impfe Euch mit demWahnsinn«; auch das ominöse »Was mich nicht umbringt, macht mich stärker«, hat einen durch und durch immuntheoretischen Sinn. Nietzsche sah sein ganzes Leben als eine Impfung mit Dekadenzgiften an und versuchte, seine Existenz als integrale Immunreaktion zu organisieren. Er konnte sich nicht mit der gepanzerten Harmlosigkeit des letzten Menschen abfinden, durch die sich dieser gegen die Infektionen der Zeitgenossenschaft und der Geschichte abschirmt. Daher trat er in seinen Schriften als ein Provokationstherapeut auf, der mit gezielten Vergiftungen arbeitet. Diese Konnotationen klingen in meinem Titel mit. Das schließt nicht aus, daß die Bilder oder die Assoziationen, die Sie herantragen, andere Obertonbereiche treffen und für diese Bedeutungsschichten richtig sind.
H.-J.H. Von Hahnemann zu Nietzsche – das ist ein weites Feld. Zwischen den homöopathischen Kügelchen, die zur Gesundung führen sollen, und den philosophischen Gedanken, die wohl nicht so direkt heilsame Wirkungen entfalten können, besteht auf jeden Fall eine große Kluft. Doch erscheint mir in dem, was Sie gesagt haben, ein Aspekt besonders wichtig: dieses Infiziert-Sein, diese quasi psychosomatische Teilhabe an den Gebrechen der eigenen Zeit. Dieser Gedanke taucht in Ihrem Buch Selbstversuch an einer Schlüsselstelle auf – wo Sie in einer Anmerkung zur Polemik um Botho Strauß Ihre Idee der Autorschaft definieren. Diese Passage hat bekenntnishafte Züge. In Ihrem Plädoyer erklären Sie, daß es für den Autor die Pflicht zu gefährlichem Denken gibt. Der Schriftsteller, sagen Sie, ist nicht dazu da, Kompromisse mit der Harmlosigkeit zu schließen, Autoren, die zählen, denken wesenhaft gefährlich. Ihre experimentelle Philosophie setzt also mehr als nur ein metaphorisches Verständnis von Homöopathie voraus. Sie wäre vielleicht besser zu charakterisieren durch Ihr Verhältnis zu den künstlerischen und philosophischen Avantgarden des 20. Jahrhunderts.
P. S. Das kann man so sehen. Auch muß man zugeben, daß die Homöopathie aufgrund ihres Zusammenhangs mit den reformistischen Lebensphilosophien des Kleinbürgertums eine Imago besitzt, die mit gewagtem Denken schlecht verträglich ist. Dennoch zeigen sich im Hinblick auf Hahnemanns Person auch andere Züge. Er war ein Virtuose der Selbstvergiftung. Er hat seinen Körper geprüft, getestet, belastet, aufs Spiel gesetzt in einer Weise, die aus ihm eine große Orgel der Krankheitszustände gemacht hat. Er hat die Dekonstruktion der Gesundheit als psychosomatisches Experiment an sich selber durchgeführt. Das hat eine Dämonie eigenen Ranges, die sich schwerlich vergleichen läßt mit den geborgten Unheimlichkeiten, mit denen manche Autoren der Moderne ihre Exzesse ausmalen. Ich warne vor der Unterschätzung des Gefährdungspotentials der homöopathischen Medizin. Es ist ein sehr komplexer und durchaus nicht harmloser Ansatz, der sich unter einer biederen Maske verbirgt.
Andererseits haben Sie recht, es geht mir nicht um Homöopathie als solche. »Selbstversuch« ist eine Metapher, die aus der medizinphilosophischen Sphäre stammt, aber sich nicht in ihr erschöpft. Sie hat auch eine zufällige Seite: Ich habe die homöopathische Terminologie zur Zeit im Kopf, weil ich vor kurzem, im September 96, in der Frankfurter Paulskirche die Festrede zum 200jährigen Jubiläum der homöopathischen Bewegung gehalten habe und zu diesem Zweck in die Geschichte der frühbürgerlichen Medizin-Ideen eingetaucht bin. Mir ist bei dieser Gelegenheit bewußt geworden, in welchem Ausmaß die Geschichte des modernen Denkens von Heilungsphantasmen und ärztlichen Metaphern durchzogen ist. Die wirkungsmächtigste Idee des 19. und 20. Jahrhunderts, das Konzept Entfremdung, zielt auf eine universale Therapeutik. Über weite Strecken laufen Politik und Klinik parallel, selbst die Antipoden Marx und Nietzsche haben dies noch miteinander gemeinsam.Was mein Buch angeht, bleibt es in jedem Fall ratsamer, an Nietzsches Devise vom Leben als dem »Experiment des Erkennenden« zu denken. Ich wollte mit dem Titel an Bedingungen von Zeitgenossenschaft erinnern. Man muß die Traumüberschüsse der eigenen Epoche und ihren Terror in sich spüren, um als zeitgenössischer Intellektueller etwas zu sagen zu haben. Man redet in gewisser Weise mit einem Sprechauftrag des Staunens und des Schreckens oder, allgemeiner gesagt, der ekstatischen Potentiale der eigenen Zeit. Wir haben keine anderen Mandate. Als Schriftsteller von heute sind wir nicht durch einen Gott und nicht durch einen König in unseren Beruf eingesetzt.Wir sind nicht die Briefträger des Absoluten, sondern Individuen, die die Detonationen der eigenen Epoche im Ohr haben. Mit diesem Mandat tritt der Schriftsteller heute vor sein Publikum, es lautet in der Regel nur »eigene Erfahrung«. Auch diese kann ein starker Absender sein, wenn sie ihr Zeugnis vom Ungeheuren ablegt. Sie ermöglicht unsere Art von Mediumismus.Wenn es etwas gibt, wovon ich überzeugt bin, dann davon, daß es nach der Aufklärung, wenn man sie nicht umgangen hat, keine direkten religiösen Medien mehr geben kann, wohl aber Medien einer historischen Gestimmtheit oder Medien einer Dringlichkeit.
H.-J.H. Da Sie jetzt selbst auf das religiöse Feld angespielt haben, würde ich gerne gleich auf ein Phänomen zu sprechen kommen, das in diesem Bereich ein Jahrzehnt lang für Aufsehen gesorgt hat, auf Bhagwan Shree Rajneesh oder, wie er sich später nannte, Osho, den Sie für eine der größten spirituellen Gestalten des Jahrhunderts hielten und dem Sie während eines längeren Aufenthalts in Indien vor nicht ganz zwanzig Jahren persönlich begegnet sind. Ihm ist eine der für mich interessantesten Passagen Ihres Selbstversuchs gewidmet. Sie nennen ihn den »Wittgenstein der Religion« und führen inwenigen Strichen aus, daß ihm zufolge die historischen Religionen nur durch »aktive Religionsspiele« neu formulierbar werden. Sie zeigen, auf welche Weise Osho seine Religionsexperimente durchgeführt hat, und erläutern in diesem Zusammenhang, daß wirkliche Untersuchung der Religion nur im Experiment entsteht und nicht so sehr durch die theoretische oder diskursive Kritik. Bei Osho, diesem großen Religionsentertainer, konnte man eine Art von Religionskritik lernen, wie sie in theologischen Seminaren nicht möglich ist. Unter den wichtigen Autoren der letzten Jahrzehnte war es bei uns nur Luhmann, der auf eine analoge Weise – aber mit völlig anderen Mitteln – gezeigt hat, daß die Religion nach allen Versuchen, sie zu überwinden oder aufzulösen, als ein irreduzibles Phänomen angesehen werden muß. Sie verschwindet unter modernen Bedingungen nicht nur nicht, wie oft behauptet wurde, sondern wird in ihrem Eigensinn noch deutlicher profiliert als in der Zeit der traditionellen Hochkulturen, wo die Religion sich mit allen anderen Lebensaspekten vermischte, besonders mit der Politik und der Moral. Diesen irreduziblen Kern hat Osho, wie Sie darlegen, in experimentellen Formen herausgearbeitet. Er hat die Religion in einem chemischen Sinn »radikalisiert«. Er war in gewisser Weise der extremste und ironischste Buddhist des Jahrhunderts. Offenbar hatte er die Ambition, die Prinzipien der Avantgarde auf das religiöse Feld anzuwenden.
Das ist ein Zug in Ihrem Denken, der mir sehr sympathisch ist: wie kompromißlos Sie sich mit den maßgeblichen Figuren des 20. Jahrhunderts befassen und wie radikal Sie sich dem Werk der innovativsten Autoren ausgesetzt haben. Sie erwähnen in diesem Zusammenhang noch einen anderen Entertainer: Jacques Lacan. Mir schien, Sie spielten sogar die beiden gegeneinander aus, wobei man den Eindruck gewinnt, daß bei Ihnen Lacan schlechter abschneidet.
Aber ich will meine Eindrücke von der Lektüre Ihres Buchs ein wenig ordnen: Auf der einen Seite gibt es jenes leichtfüßige Umgehen mit schweren Gewichten, auf der anderen verbinden Sie ein sehr ernstes philosophisches Anliegen mit dem eigenen existentiellen Experiment. Sie sagen in diesem Zusammenhang, daß Sie eigentlich einen Roman oder eine Erzählung über Ihre indische Exkursion hätten schreiben sollen. An diese Anspielung auf ein literarisches Genre möchte ich meine nächste Frage anschließen, die nach den Darstellungsformen und nach dem Zusammenhang zwischen Denken und Schreiben: Wie ist beides für Sie miteinander verknüpft? Ich stelle die Frage noch einmal anders: Ist das Denken wesentlich ein Schreiben-Über, also eine Operation, die vom Autor kontrolliert wird? Ist also das Verfassen eines Textes primär eine Ich-Leistung? Oder empfinden Sie sich – Sie sind ja auch ein Meister der Sprache wie Lacan und Osho – eher als ein Medium, durch das hindurch etwas sich spricht?
P. S. Es ist gut, daß Sie die Namen von Lacan und Rajneesh gleich zu Beginn erwähnen. Beide markieren einen Raum, den ich in früheren Jahren frequentierte und aus dem ich einige entscheidende Lektionen mitgenommen habe. Außerdem sind solche Namen nützlich im Sinne der Vorsortierung von Begegnungschancen. Wenn man sie nennt, melden sich sofort eine Menge Leute ab, mit denen man seine Zeit verloren hätte. Das gilt vor allem für den zweiten von den Genannten. Es ist eine bedauerliche Tatsache, daß die große Mehrheit der deutschen Intellektuellen, zumal der Philosophieprofessoren, an außereuropäischen Kulturen absolut nicht interessiert ist und mit Wut und Hochmut reagiert,wenn man sie daran erinnert, daß es ein so komplexes Universum wie das des indischen Denkens und Meditierens gibt, das dem alteuropäischen in vielen Hinsichten ebenbürtig, in manchen vielleicht überlegen war und mit dem man sich wohl auseinandersetzen sollte, wenn man sein Metier ernst nimmt. Sie meinen, ihre eigenen Versuche, die abendländische Metaphysik zu überwinden, bedeuten automatisch einen Freibrief, die großen Systeme anderer Kulturen ignorieren zu dürfen. Sie möchten nichts davon hören, daß eigensinnige indische Wege in die Moderne existieren, sogar ein indischer Typus von romantischer Ironie, ein indischer Surrealismus, ein indischer Ökumenismus, ein indischer Dekonstruktivismus. Sie wollen nur in Ruhe ihre häuslichen Diskurspartien spielen und die Grenzen dicht halten. Alles, nur keine Ost-Erweiterung der Vernunft! Solange diese Abwehr überwiegt, ist es klug, es vermeintlichen und wirklichen Gegnern leicht zu machen. Ein Name genügt, und sie drehen ab. So können diese Leute weiter in ihrem Hochmut rotieren und aufgrund falscher Überlegenheitsgefühle glücklich sein. Es wäre unphilosophisch, sie dabei zu stören.
Um Ihr Stichwort »Beschäftigung mit großen Gestalten« aufzunehmen:Wollte ich autobiographisches Material über meine Anfangszeit zusammentragen, so müßte ich zunächst vor allem Namen wie Adorno und Bloch nennen, die ich in meiner Studienzeit völlig absorbiert habe, obschon die Spur ihres Einflusses in meiner Arbeit nur noch indirekt nachzuweisen ist. Von einer höheren Abstraktionsebene her gesehen bleibe ich trotzdem mit diesen Autoren verbunden, weil ich nie aufgehört habe, mich für den versöhnungsphilosophischen Impuls zu interessieren, der vom messianischen Denken ausgeht. Auch ist die von Bloch begonnene politische und technosophische Tagtraumdeutung weiter aktuell, weil man als philosophischer Zeitdiagnostiker sich für das Visionsmanagement und die Illusionswirtschaft der Massenkultur interessieren muß – ich sehe darin immer noch einen Teil meines Berufs. Doch weil Vereinigungs- und Versöhnungsphilosophien im eigentlichen Wortsinn theologische Voraussetzungen machen, die ich nicht teile, habe ich über nicht-theologische Äquivalente für diese Begriffe nachgedacht. Man kann in meinem Buch Weltfremdheit von 1993 sehen, wie ich die theologischen Motive der kritischen Theorie durch eine Anthropologie der Weltabgewandtheit zu ersetzen versuche. Auf eine etwas andere Weise habe ich mich durch Husserl und weitere Figuren aus der phänomenologischen Tradition hindurchgebissen, und schließlich bin ich in Foucault eingetaucht, von dem noch immer erst wenige erkannt haben, was für einen Einschnitt sein Werk bedeutet.
Der Hinweis auf den Roman, den ich meinem Publikum über das indische Abenteuer möglicherweise schuldig geblieben bin, zielt aber schon richtig. Es gibt in bezug auf diese Dinge ein tiefsitzendes Darstellungsproblem. Es ist fast unmöglich, die eigenen Erfahrungen nicht zu karikieren, wenn man die üblichen Formen heranzieht, die für die Mitteilung gruppendynamischer oder meditativer Erlebnisse zur Verfügung stehen.Von daher glaube ich, daß es gut gewesen wäre, in größerer zeitlicher Nähe an diesen Komplex heranzugehen, mit den Mitteln des modernen Romans, mit der Technik des Bewußtseinsstroms und der multiplen Perspektiven – aber das hätte, wie gesagt, gleich nach 1980 geschehen müssen . . . Jetzt ist es dafür zu spät, weil der Wind in jeder Hinsicht gedreht hat. Die Worte, die damals zu formulieren gewesen wären, sind heute irgendwo zerstreut. Der Zeitgeist ist ein epochal anderer geworden. Wir lebten damals in der Illusion, man könnte die Gesellschaft mit einer Freundschafts- und Freundlichkeitsethik umstimmen. Es war die Zeit der offensiven Kleingruppenträumereien.
Was das sprachphilosophische Motiv Ihrer Frage anbelangt, so glaube ich, daß Sie im Prinzip recht haben. Ich verstehe mich als einen Menschen, der unter technischen Medien wie ein Medium zweiten Grades funktioniert, falls man so etwas sagen darf. Man muß bedenken, daß der Begriff des Mediums zwei grundsätzlich verschiedene Bedeutungen hat – die übrigens umgangssprachlich leichter zu fassen sind als theoretisch. Es gibt apparative Medien, die Programme übertragen, und es gibt personale Medien, sprich Menschen mit einer gewissen Durchlässigkeit, die Epochenaufgaben oder Zeitstimmungen übertragen. Zieht man diese beiden Medienbegriffe zusammen und wendet sie auf die eigene Rolle an, so kann man zu einer Art von Apparatverdacht gegen sich selbst kommen. Die jüngere Literatur- und Medientheorie redet über den Autor wie über eine neurologische Schreibmaschine, und das entspricht manchmal der Selbsterfahrung in der auktorialen Position. Ich würde mich am liebsten mit einem Klavier vergleichen, das plötzlich von selber zu spielen anfängt. Ein automatisches Klavier des Zeitgeistes. Ich nehme Stimmungen leicht auf, aber ich sortiere ziemlich streng.
Auf der anderen Seite bin ich immer auch bereit gewesen – das möchte ich hinzufügen, um jetzt nicht das Klischee von einem, dem alles leichtfällt, zu bestätigen –, den Preis für neue Erfahrungen zu entrichten. Das ging öfter, als mir lieb war, bis an die äußersten Grenzen. Man kann sich heute nicht mehr vorstellen, mit welchem Radikalismus man sich noch in den späten siebziger Jahren in Exerzitien und Begegnungsgruppen stürzte. Da war immer ein Hauch von Weltrevolution in der ersten Person im Spiel. Als ich nach Indien gefahren bin, war ich genau in dieser Lage. Ich war ideologiekritisch aufgekratzt, psychologisiert und moralisch erregt, wie es dem Geist der Zeit entsprach, ich war ein mehr oder weniger typischer Adept der älteren Frankfurter Schule und der Siebziger-Jahre-Alternativszene, ein Teilnehmer an dem depressiv-aggressiven Komplex, der damals als die Linke auftrat. Aber ich wußte, Rajneesh hat nicht vor, nach München zu kommen, und wenn ich herausfinden will, was es mit ihm auf sich hat, dann ist es an mir, mich zu bewegen. Die Frage, ob sechs- oder siebentausend Kilometer Anreise für ein paar lectures und einige Blickkontakte nicht zu weit sind, hat sich für mich keine Sekunde gestellt. Ich habe nie daran gezweifelt, daß Menschen sich dorthin auf den Weg machen müssen, wo die nächste Seite ihres Lebens geschrieben werden kann. Das ist der Sinn von Mobilität. Meine Reise wurde entscheidend, weil sie zur richtigen Zeit stattgefunden hat. In Indien ist ein neues Kapitel aufgeschlagen worden, ich habe eine radikale Umstimmung erlebt, ich habe Impulse aufgenommen, von denen ich bis auf den heutigen Tag lebe, besser gesagt: von den Metamorphosen dieser Impulse, denn die Anregungen von damals sind längst wieder anonym geworden, sie haben sich ein paarmal gedreht und sich in eine eigensinnige Richtung entwickelt.
Eines ist sicher: In Indien war ich einer Einstrahlung ausgesetzt, die lange nachwirkte. Ohne die Alchemie, die dort vor sich gegangen ist, dieses Herausspringen aus der alteuropäischen Melancholie und aus dem deutschen Masotheorie-Kartell wäre meine Schriftstellerei in ihrer Anfangszeit nicht zu denken. Es gibt in ihr, besonders in den Büchern der achtziger Jahre, eine Art von Hintergrundstrahlung, ein Echo auf den vitalen Urknall, der damals passiert ist. Seither sende ich auf einer Frequenz, auf der die deutsche akademische Intelligenz nicht empfängt, auch die dominierende Publizistik nur zum Teil, wohl aber das breitere Publikum. Als die Kritik der zynischen Vernunft erschien, da wurde sichtbar, daß es möglich war, nach langer Zeit wieder andere, hellere Tonarten in die Philosophie zu bringen, ohne in Naivität zurückzufallen. Darum tobten seinerzeit viele der alten Genossen vor Zorn, besonders die Brüder und Schwestern vom Beschädigten Leben, die mir meinen Verrat an den Ordensregeln jahrelang nachtrugen, manche von ihnen grollen sogar bis heute. Sie konnten und wollten um nichts in der Welt zugeben, daß Aufklärung etwas mit dem Aufklaren der sozialen und individuellen Stimmung zu tun hat.Wie gesagt, das hätte alles ein Thema für eine romanhafte Darstellung sein können. Vielleicht wird es in zehn oder zwanzig Jahren wieder möglich, darüber zu schreiben. Dann könnten sich diese Substanzen in irgendwelchen vorbewußten Kellerabteilen so abgeklärt haben, daß sie wieder sprachfähig werden. Im Augenblick sieht es nicht danach aus. Das Beste, was ich a posteriori sagen konnte, habe ich vielleicht im Selbstversuch angedeutet, wo ich unter dem Eindruck von Carlos Oliveiras Fragen ein wenig zu plaudern angefangen habe.
H.-J.H. Ich möchte zwei Begriffe aufgreifen, die Sie eben verwendet haben, Einstrahlung und Echo. Lassen Sie mich mit ihrer Hilfe die Vorstellung vom personalen Medium und vom »Es, das schreibt«, noch einmal näher kommentieren. Lévi-Strauss spricht gelegentlich davon, daß er sich wie eine Tür empfinde, durch die die Mythen der fremden Kulturen hindurchgehen. Somit wäre der Autor – und das findet man bei vielen Schriftstellern und Philosophen von Rang – ein Kanal, durch den, wenn er offen ist, die Gedanken fließen. Ich erinnere auch an eine Formulierung von Wittgenstein, der sagte: Man sollte Abschied nehmen von einer Formulierung wie »ich denke« und statt dessen sagen, »dies ist ein Gedanke«, und ich sehe zu, wie ich zu diesem Gedanken in Beziehung trete. Im Ernstfall wird man von dem Gedanken »ergriffen«.
In einem Roman von Yoko Tawada fand ich die bezeichnende Formulierung: »Man lehrte mich in Deutschland, wenn man von sich selbst spricht, Ich zu sagen.« Das gibt einen Hinweis darauf, wie sehr dieses Ich eine kulturelle Konvention ist. Ich lese Ihr Buch als einen Versuch, Ihren Abschied von diesem konditionierten, lokal verengten und aggressiven Ich zu kommentieren. In dem Gespräch mit Carlos Oliveira gibt es eine Reihe von Formulierungen, ob von Ihnen oder von Ihrem Gesprächspartner, die diesen Grundgedanken bestätigen. Es bildet sich in Ihrem Dialog mit dem jungen spanischen Philosophen ein Raum heraus, in dem Formeln auftauchen konnten wie »nomadischer Zombie in der Ego-Gesellschaft« – das war eine Pointe von Oliveira, oder: »Designer-Individualismus«, eine Wendung, mit der Sie die jüngste Wendung der Alltagskultur charakterisieren.
Mir scheint, man kann in solchen Formulierungen ein gewisses dekonstruktives Engagement wahrnehmen. Das regional fixierte Subjekt steht radikal in Frage: In dieser Einsicht spiegelt sich Ihre langjährige Auseinandersetzung mit den östlichen Traditionen. Auf der anderen Seite konvergiert dieser Befund mit Tendenzen der westlichen Theorie-Avantgarde zwischen Lacan und Luhmann. Vielleicht ist vor diesem Hintergrund Ihre für mich zunächst irritierende Bemerkung in Selbstversuchzu verstehen, Lacans Faszination sei für Sie erloschen. Die Äußerung wäre erstaunlich, wenn sie einen wirklichen Gegensatz oder gar einen Bruch mit Lacans Revision der Psychoanalyse ausdrücken wollte, denn in gewisser Hinsicht führen Sie Grundeinsichten Lacans auf einer philosophischen und kulturtheoretischen Ebene fort. Es zeigt sich hieran wohl nur, daß Namen von einem bestimmten Moment an unwichtig werden. In Ihrem Buch finden sich Formulierungen wie die von dem »möblierten Nichts«, in dem die Modernen sich aufhalten, oder von der »Nullpunkt-Situation« nach der Auflösung der Subjektillusion – Wendungen, die von der Lacan-Tradition mit angeregt sein könnten.
P. S. Aus meiner Sicht ist die polemische Intention bei dem Vergleich zwischen Lacan und Rajneesh anders zu gewichten. Ich wollte meinen intellektuellen Freunden signalisieren, daß sie unrecht haben, immer nur den einen zu zitieren und den anderen zu ignorieren. Man weiß doch, wie das Spiel bei uns läuft: Ein Lacan-Zitat bringt intellektuelles Prestige ein, mit einem Rajneesh-Zitat macht man sich unmöglich. Nun muß ich zugeben, daß ich mich seit jeher eher für Möglichkeiten, sich unmöglich zu machen, interessiert habe. In dieser Hinsicht gibt es keine besseren Lehrer. Ich bin überzeugt, daß die beiden eng zusammengehören, weil sie eine ähnliche Arbeit in Angriff genommen haben, nur daß Rajneesh noch viel weiter gegangen ist als sein europäischer Kollege. Im übrigen hat man auch die Lacanianer als satanistische Sekte bezeichnet, um die Parallele zu komplettieren. Kurzum, ich sehe die beiden als Figuren an, die sich gegenseitig erläutern. Bei beiden gab es diese Synthese aus Psychoanalyse, Theatralität und spiritueller Provokation – zwei zukunftweisende Arten, sich unmöglich zu machen. Ich meine, wir sollten auch im Skandalösen ökumenischer denken.Wenn ich den indischen Meister auf Kosten des französischen maître absolu herausgehoben habe, dann war dies ein Bekenntnis zu meiner Dankbarkeit, die gegenüber ihm, trotz unvermeidlicher Nachfragen und Abweichungen, intensiver ist als gegenüber Lacan, von dem ich immer nur Leser war – obendrein ein Leser, der die Chance der Lektüre oft mit gemischten Gefühlen bezahlte, weil ich von manchen abstoßenden Komponenten in seinem Stil und Habitus nie ganz habe absehen können. Es gibt bei ihm einen Zug zur Verkalauerung des Unbewußten, der mir auch auf theoretischer Ebene problematisch erscheint. Daß wir uns nicht mißverstehen: Ich habe mein Exemplar der Ecrits im August 1969 in Paris gekauft. Ich hätte über Lacan fast nur Rühmendes zu sagen, aber wir leben nun einmal nicht in einer Kultur, die lobt. Außerdem lobt man einen Autor am besten dadurch, daß man anknüpft und weiterdenkt. Ich werde mich in meinem Buch Sphären I mit Lacans Theorie des Spiegelstadiums auseinandersetzen und dabei einen Vorschlag zu einer Neuformulierung dieses Theorems vortragen, die darauf hinausläuft, daß wir die Überbewertung des Imaginären, die für die Wiener Psychoanalyse und ihre französische Nachfolge typisch ist, einschränken und statt dessen die psycho-akustischen Grundverhältnisse ausführlicher reflektieren. Ich möchte dazu anregen, ein Sirenenstadium an die Stelle des Spiegelstadiums zu setzen. Das Theorem vom Spiegelstadium ist zwar der berühmteste Punkt des Lacanschen OEuvres, aber zugleich der schwächste – deswegen sollte man, wenn möglich, den großen Impuls, den das Theorem enthält, konstruktiv umformulieren.
Bei einem Lehrer, der als spiritueller Meister auftritt, ist die Anknüpfung in gewisser Hinsicht viel einfacher. Auch die Abwicklung des Mißtrauens gegen einen solchen Lehrer folgt einer offeneren Logik. Man sieht von Anfang an, daß man selber die Entscheidung trifft, ob man es für attraktiver hält, ihn zu entlarven und seiner Verführung zu widerstehen oder mit seinem Angebot zu arbeiten. Man übernimmt die Verantwortung für die eigene Interpretation – etwas, das westlichen Intellektuellen schwerfällt, die ihre Verdächtigungen habituell am Objekt festmachen. Trotz seiner Originalität und seines radikalen Nonkonformismus steht Rajneesh-Osho in einer Tradition der metaphysischen Ego-Kritik, die im Osten seit Jahrtausenden besteht. Man muß nur an die buddhistische Anatman-Doktrin denken, an den Vedanta, an die unzähligen yogischen und tantrischen Schulen der älteren Zeit, an den islamisch-hinduistischen Synkretismus in der jüngeren nordindischen Mystik sowie an einflußreiche Gestalten der indischen Spiritualität in diesem Jahrhundert wie Yogananda, Meher Baba, Ramana, Aurobindo und Krishnamurti, um einige Namen zu nennen, die bis in den Westen gewirkt haben. Die ganze indische Kultur ist mit Non-Ego-Theorien vollgesogen, die gewissermaßen nur darauf warteten, von einem Genie neu kombiniert zu werden. Was also die bei uns seit ein paar Jahrzehnten so genannte Subversion des Subjekts angeht, hatten die Europäer zunächst einmal Rückstände aufzuholen.
Von der Notwendigkeit einer alternativen Revolutionsgeschichtsschreibung
H.-J.H. Ich möchte diese Überlegungen nun auf einen anderen Aspekt verlagern, nämlich auf die Frage, ob in der modernen Welt überhaupt noch soziale und spirituelle Revolutionen möglich sind. In diesem Kontext könnte man Lacan neu lesen, etwa von seiner Formulierung her, daß das Ich die Geisteskrankheit des Westens ist. Das hat durchaus einen kulturrevolutionären Ton. Wenn man diese These ernst nimmt und einsieht, daß Lacan auf eine Art von Buddhismus hinaus will, dann erweisen sich vor allem seine frühen Schriften als ein bedeutsamer Schritt aus der idealistischen und subjektivistischen Tradition heraus. Es scheint, das alltägliche Ich mußte erst in seiner Selbstherrlichkeit zerstört werden, bevor sich ein befreiter Zugang zu einer nicht ich-bezogenen Funktionsweise des Seelischen umschreiben ließ. In diesem Kontext finde ich Ihren Begriff des Sirenenstadiums interessant, der mich an Michel Serres’ Neuinterpretation der Odyssee erinnert.
Ich schlage vor, daß Sie Ihre Anregung präzisieren, die Philosophie wieder enger an das Abenteuer der politischen und mehr noch der technischen Revolutionen zu binden. Es ist, sagen Sie, Ihre Ambition, so etwas wie eine nach-marxistische Revolutionstheorie zu erarbeiten. Sie sprechen in diesem Zusammenhang von einem Weltform-Umbruch, der sich in unserer Zeit vollzieht. Die Frage bleibt: Ist Revolution, so wie Sie sie interpretieren, überhaupt noch das, was man in der politischen und ästhetischen Tradition der Moderne unter diesem Begriff verstanden hat? Eines Ihrer früheren Bücher trägt den Titel Weltrevolution der Seele, ein umfangreiches, zweibändiges Lese- und Arbeitsbuch zur Gnosis, das 1991 erschien, mit Einleitungsessays von Thomas Macho und Ihnen, in denen Sie, wahrscheinlich zur Überraschung Ihrer bisherigen Leserschaft, mit einer weitgespannten religionsphilosophischen These auftraten. Sie erklären in diesem Text, an Thesen des jungen Hans Jonas anknüpfend, daß die metaphysische Revolution der Gnosis und des frühen Christentums zu einer Art von Ausbruch aus dem antiken Weltgefängnis führt, und zeigen, wie diese Sprengung ideengeschichtlich weiterwirkte. Sie ziehen die Linien durch bis in die moderne messianische Linke und die zeitgenössischen Alternativkulturen.Wie steht es nach diesen Begriffsausweitungen mit dem Zusammenhang zwischen den politischen, den kulturellen, den ästhetischen, den ökologischen Revolutionen? Soll man in diesen Phänomenen nur Partialansichten eines umfassenderen revolutionären Geschehens erkennen?
P. S. Zunächst einmal ist es nötig, sich zu vergegenwärtigen, wie es kam, daß der Begriff der Revolution in seiner modern politischen und soziökonomischen Bestimmung so eng gefaßt werden konnte. Wir dürfen hier die astronomische Vorgeschichte des Begriffs revolutio als Gestirnsumlauf beiseite lassen. Seit der Französischen Revolution verstehen wir unter Revolution einen Umsturz der Machtverhältnisse in der Gesellschaft zugunsten einer aufrückenden Mittelschicht, die sich stark genug fühlt, nach einer gewaltsamen Entfernung der alten Herren selbst die Macht zu kontrollieren. Diese numerisch relativ kleine Mittelschicht arbeitet zunächst mit einer charakteristischen rhetorischen Strategie: Sie tritt unmittelbar und ohne Umschweife als die Menschheit auf und gibt sich als der Teil, der das Ganze ist. Auf diese Weise verkörpert sie das real existierende Paradox einer »universalen Partei«. Hier hat die klassische Ideologiekritik ansetzen müssen, mit den Argumenten, die man sich bei einer solchen Sachlage leicht vorstellen kann. Man wird Anstoß nehmen an der Pseudouniversalität der Bourgeoisie ebenso wie an der Pseudoinklusivität der bürgerlichen Gesellschaft. Solange die Spannung zwischen einer inklusiven Rhetorik und einer exklusiven Politik fortbesteht, zieht sich die revolutionäre Uhr immer wieder von selber auf. Die politische Urszene – der Eintritt der bisher Ohnmächtigen und Ausgeschlossenen in Machtpositionen und Mittelstellungen – wird seither mit allen möglichen Akteuren ständig von neuem nachgespielt. Das heißt, daß alle Gruppen und Klassen der Gesellschaft darauf aus sein müssen, Mittelschicht zu werden. Folglich wird die durchrevolutionierte Gesellschaft nur noch aus Mitte bestehen. Umgekehrt gilt,wo es nur noch Mitte gibt, ist die Zeit der Revolutionen, und in diesem Sinn vielleicht sogar die politische Geschichte überhaupt, vorbei. Die Mitte ist der Ort ohne Transzendenz. Alle streben zu einem Ort, von wo aus es nicht weitergeht.
Der geistreichste christliche Revolutionstheoretiker, Eugen Rosenstock-Huessy, hat schon um 1930 die Serie der europäischen Revolutionen – unter äußerst idealistischen, genauer teleologischen Vorzeichen – als eine Prozession in die Mitte interpretiert. In der befreiten Gesellschaft, sagt er, werden alle Gruppen oder »Stände«, vom Hochadel bis zum Proletariat, ihren politisch starken Augenblick gehabt und die Freiheitsgeschichte weitergeschrieben haben. Erst nachdem also alle »Stände« und Kollektive in der öffentlichen Arena aufgetreten sind, wenn alle gekämpft und ihre Sache geltend gemacht haben, wenn alle sich im erfolgreichen Aufstand selbst konstituiert haben und den Stolz kennen werden, ein kompetenter Akteur und ein politisches Subjekt geworden zu sein,wenn also alle Klassen und Gruppen die Passion des Auftretens und Selbst-Werdens auf der politischen Bühne konkret erfahren hätten, erst dann, und keinen Augenblick früher, könnte der Zyklus der Revolutionen zu seinem Ende gelangt sein. Nun dachte Rosenstock tatsächlich, daß mit der russischen, der angeblich proletarischen und damit letzten Revolution, die eigentliche pneumatische Weltgeschichte an der Basis angekommen sei und daß das Reich Gottes unter den Menschen dabei sei, sich zu vollenden – zwar im atheistischen Incognito, aber immerhin.
Man darf diese Konstruktion ruhig für das nehmen, was sie ist, ein höheres Märchen, wie Theologen es früher gern erzählt haben. Aber selbst wenn es die Wahrheit wäre: Gerade Theologen könnten ahnen, daß es mit den menschengemachten Revolutionen eine eigene Bewandtnis haben wird. Im Revolutionsbegriff selbst schwingt ja eine Obertonreihe mit, die auf die religiöse Tradition zurückverweist. Schauen wir näher hin, so entdecken wir, daß die Grammatik des Begriffs Revolution eine Familienähnlichkeit mit dem Begriff der Konversion aufweist – insbesondere in der Bestimmung, die Augustinus dem Ausdruck gegeben hat. Konversion, radikal verstanden, ist etwas, was die Menschen nicht von sich aus vollziehen können, sondern etwas, was ihnen allein durch die Gnade zustößt. So will es zumindest die Orthodoxie. Demnach ist Konversion ein Terminus, der nicht in eine Grammatik des Handelns paßt. Sie müßte vielmehr als »Ereignis« gedacht werden. Zieht man nun die Analogie zum Phänomen Revolution, dann wäre auch diese etwas, was Menschen nicht aus eigenen Stücken machen können, wie die Modernen glauben möchten, sondern müßte etwas sein, das mit den Menschen geschieht. Der ontologische Revolutionär Heidegger hat das in seinem Begriff der Kehre angedeutet und sich vom Konzept der gemachten und zu machenden Revolution zunehmend entfernt – zumal nach seinen üblen Erfahrungen mit der »nationalen Revolution« von 1933, von der ergriffen zu sein er vorgegeben hatte.Wenn es darum geht, große Umwendungen zu deuten, nach denen sich der Sinn von Sein im ganzen neu darstellt, dann braucht man ein Konzept von Bewegung, das mächtiger ist als der konventionelle moderne Revolutionsbegriff. Ich sehe in dem Ausdruck Kehre die Modernisierung des augustinischen Konversions-Gedankens in Verbindung mit einer Aktualisierung des platonischen Motivs der Umdrehung, das wir aus dem Höhlengleichnis kennen.
Mit dem erweiterten Begriff von Revolution als Umdrehung, Weltwende, Konvertierung aller Texte kommen wir nolens volens auf augustinisches Terrain und eo ipso in die heiße Zone der christlichen Geschichtstheologie. Sie ist als Korrektiv gegen die Naivitäten der schlicht modernen Auffassungen vom revolutionären Handeln noch immer nützlich, auch wenn sie im übrigen für Menschen, die von dieser Welt sein wollen, unannehmbar ist. Nach der Auffassung des Augustinus ist das Revolutionsgeschehen durch die Menschwerdung Gottes in Gang gesetzt worden. Die Revolution Gottes läge dann freilich für uns zweitausend Jahre zurück – in ihr hätte der radikal transzendente Gott beschlossen, sich mehr als bisher auf die Welt einzulassen.Vor diesem Hintergrund erscheint die Weltgeschichte als die Geschichte der Konterrevolutionen des Menschen gegen die Revolution Gottes. Ein analoger Sachverhalt ließe sich im Blick auf den Osten konstatieren: Dort wäre Geschichte die Konterrevolution der seinsverhafteten Menschen gegen die Revolution des Nichts, die der Buddhismus vollzogen hat.Wenn ich heute dazu neige, den Revolutionsbegriff so weit zu fassen, dann wohl auch deswegen, weil ich durch religionsgeschichtliche Studien im Lauf des letzten Jahrzehnts dazu verleitet worden bin, mit einem sehr extensiven Gegenwartsbegriff zu operieren. Ich empfinde Autoren, die erst zweitausend Jahre alt sind, noch wie Zeitgenossen – und Zeitgenosse ist jemand, der keine Zeit hatte, eine Autorität zu werden. Aus dieser Optik folgt, daß man die größten geschichtlichen Namen wie die von Kollegen und nicht von Autoritäten behandelt. Das ist sicher eine berufliche Deformation des historischen Bewußtseins, aber ich kann nicht mehr anders. Wenn man sich erst einmal durch Religionsgeschichte, Ethnologie und andere kulturhistorische Disziplinen an ein Denken in großen Zeiträumen gewöhnt hat, dann erscheint einem ein Begriff von Revolution sehr kurzatmig, der solche Umbrüche in der Ökologie des Geistes, wie es das Aufkommen der Hochreligionen gewesen ist, nicht umfaßt.
Daher mache ich in Selbstversuch den Vorschlag, eine veränderte Revolutionsgeschichtsschreibung zu beginnen und mit der metakosmischen Revolution der Denkungsart in der Achsenzeit einzusetzen. Es kommt darauf an zu zeigen, wie Menschen den Respekt vor dem Sein verloren haben – und wie sie das Wünschen gelernt haben, das in die Technik führt. Man könnte im übrigen noch weiter gehen und Technik schlechthin als Aufstand gegen die Natur definieren – wobei Technik ein Geschehen bezeichnet, das bis in sehr alte Evolutionsstufen zurückreicht. Aber für den Augenblick genügt es, bei dem metakosmischen Einschnitt, das heißt beim Aufkommen des idealistischen Dualismus und beim Protest der Apokalyptik gegen die bestehende Welt, Halt zu machen. Die Gnosis-Studien, die Thomas Macho und ich anfangs der neunziger Jahre veröffentlicht haben, gehören in diesenKontext. Darum haben wir unser Buch unter dem anzüglichen Titel Weltrevolution der Seele publiziert. Darin ist so etwas wie eine metaphysische Deduktion des »Prinzips links« enthalten – ironischerweise auch eine Urgeschichte der Frankfurter Schule, eine feine, verwikkelte Linie, die von Alexandria ins Institut für Sozialforschung und den Hörsaal VI der Johann Wolfgang Goethe-Universität führt. Ich brauche nicht zu erklären, warum die Begeisterung der Betroffenen wie der konventionellen Linken im allgemeinen über diese Zuordnungen sehr verhalten ausgefallen ist.
Lob der Übertreibung
H.-J.H. Sie sprechen in Ihrem Buch Selbstversuch davon, daß sich die Revolution auch als Wiederholung der eigenen Geburt auf einer anderen Bühne vollziehen könne. Zudem erinnern Sie an den platonischen Seelen-Umschwung, durch den die Menschen sich »entirren«. Das scheinen schwere, unhandliche Begriffe mit einem großen therapeutischen und ideengeschichtlichen Tiefgang zu sein. Zugleich habe ich wie viele Leser Ihrer Schriften den Eindruck, daß in Ihrer Schreibweise eine ironische Gebrochenheit vorherrscht und eine satirische Spitze, stellenweise sogar ein gewisser Zynismus. Gibt es nicht doch auch so etwas wie ein Pathos oder einen hintergründigen Idealismus bei Ihnen? Haben Sie also eine verdeckte Vision, die Sie, aus welchen Gründen auch immer, nicht ungeschützt exponieren mögen?
P. S. Dazu möchte ich zwei Dinge sagen. Erstens: Ich habe ein Pathos, einen gewissen Sinn für die Kantilene, auch mitten im Argument. In den meisten meiner Bücher ist eine Belcantostelle zu finden, hier und da auch eine lyrische Insel und ein langsamer Satz, wenn ich so sagen darf. Zweitens: Ich gehe mit Pathosmitteln sparsam um. Schon mit den wenigen Lyrismen, die ich mir erlaubt habe, habe ich eher schlechte Erfahrungen gemacht. Es gibt in unserem Land einen Habitus, sich auf ungeschützte Stellen zu stürzen und ihren Autor für blamiert zu halten. Oft meint man, ein Autor sei widerlegt, wenn man ihn bei zu schönen Formulierungen überrascht. Ich selber prüfe die Zulässigkeit von Pathoswendungen aus dem Kontext. Wenn er stimmig ist, gebe ich nach, allerdings nur zu Bedingungen, die literarisch überschaubar bleiben. Ich gehe nie so weit wie Ernst Bloch, der als Pathosmeister der deutschen Philosophie im 20. Jahrhundert allein dasteht. Hohe Töne in der philosophischen Prosa sind ein Kunstmittel, um Existenz in großen Kontexten sprachlich zu markieren, das hat mit messianischen Aufwallungen und universalistischen Anmaßungen nichts zu tun. Im übrigen tut die Ironie das Ihre, um die schweren unhandlichen Begriffe in Fluß zu halten.
Was nun die sogenannte visionäre Komponente der philosophischen Arbeit anbelangt, so steht diese auf einem ganz anderen Blatt. Ich bin kein Idealist, aber noch weniger ein Zyniker, allenfalls ad hoc. Diesen beiden Fallen entgehe ich durch eine einfache Überlegung. Ich definiere den Philosophen als jemanden, der wehrlos ist gegen Einsichten in große Zusammenhänge. Das genügt völlig, um Idealismus zu ersetzen. Mir scheint, daß bekennende Idealisten, Neoplatoniker oder Denker des angestrengt holistischen Typs allesamt von der Illusion befallen sind, sie müßten zu den Problemen, die ihnen zu denken geben, noch einen Zusatz an eigener Aufgeregtheit oder gutemWillen hinzufügen. Diese Illusion oder besser diese Vornehmtuerei des Denkens kommt mir seltsam vor, mir fehlen die Mittel, dergleichen wirklich zu verstehen. Ich neige eher zu der Auffassung, daß Menschen Wesen sind, die, sobald sie zu denken anfangen, eine Art Geiselnahme durch große Themen erleiden. Sobald wir unser Gehirn öffnen, erleben wir, daß wir Geiseln von Problemen geworden sind, die uns irgendwohin verschleppen. Nietzsche hat in einem Brief an Overbeck sinngemäß geschrieben, es sei sein Schicksal, an ein Rad von Problemen gebunden zu sein. Ich denke, das ist eine deutliche Formulierung.
Da stellt sich die Frage, wie wir mit den Problemen, die uns kidnappen, umgehen. Ich finde, es ist eine Überforderung, wenn man seine Entführer auch noch lieben soll. Wenn ich mich darauf einlasse, über politische Philosophie für die postimperiale Weltform zu diskutieren oder eine neue Version von historischer Anthropologie zu entwickeln, dann fühle ich mich ohnehin wie von Aliens entführt. Es wäre zuviel verlangt, auch noch so zu tun, als wäre man erfreut, solche Probleme zu haben. Philosophie heute ist die Kunst, unmittelbar zum Überkomplexen zu sein. Das ist eine athletische Aufgabe, die ein einigermaßen belastbares Gemüt voraussetzt. Dafür ist es nicht notwendig, zusätzlich als Visionär aufzutreten und eine Extraportion Idealismus zu bestellen. Verfügbarkeit für große Fragen ist schon genug. In meinen Augen reicht es vollauf, wenn ein Mensch sich in der Wehrlosigkeit gegenüber den großen Themen einigermaßen anständig verhält, indem er seinen Beitrag zur Entidiotisierung des eigenen Ich leistet.
Die Probleme, die uns heute entführen und mitnehmen, sind, wie gesagt, sehr großräumig, zudringlich, beängstigend und komplex. Es geht dabei darum, daß Menschen aus ihrer kleinräumigenWunsch- und Phantasiestruktur, aus ihrer regionalen und nationalen Identitätsverfassung herausgebrochen werden – ob sie wollen oder nicht. Die Seelenformen des Bürgertums und Kleinbürgertums in der Ersten Welt werden aktuell umformatiert.Wir werden umgeprägt von einem humanistischnationalistischen Welthorizont auf einen ökologisch-globalen. Wir stecken in Bildungsprozessen, die uns verwickeln in die Synchronwelt des Kapitals, des globalen Waren- und Informationenverkehrs, also in das, was man die Weltwirtschaft nennt. Nicht weil wir Idealisten wären, sondern weil wir Realisten werden wollen, suchen wir nach Formen von Denken und Verhalten, die uns in der aktuellen Globalwelt zur Verkehrsfähigkeit verhelfen.
Es gibt hierfür eine antike Analogie: Ganz ähnlich hat Platon mit der Gründung der Akademie rechtzeitig den Bedarf an einem neuen Menschentypus erkannt, der in der Großwelt der sich ankündigenden hellenistischen Kultur verkehrsfähig werden sollte. Sein Idealismus war ein pädagogischer Realismus. Gut eine Generation nach der Gründung der Akademie war durch den Aufstieg des mazedonischen Reiches die Konjunktur voll entwickelt. Der Ernstfall für die megalopsychische Persönlichkeitsstruktur war eingetreten. Natürlich erschienen auf dem Erziehungsmarkt dann auch gleich die konkurrierenden Anbieter, die Peripatetiker, die Skeptiker, die Stoiker, die Epikuräer. Wir wissen, daß es nicht die Platoniker waren, die sich auf dem antiken Markt der Persönlichkeitsbildung durchgesetzt haben, sondern die Stoiker. Im antiken Ideenwettbewerb wurden Trainingsprogramme für Seelenformen lanciert, die im neuen ökumenisch-imperialen Horizont verwendbar und belastbar werden sollten. Man darf nicht vergessen, daß die antike Philosophie ein mentales work-out war – Pierre Hadot hat das überzeugend aufgezeigt. Die logischen Formen dienten in ihr als Übungsgeräte. Wir erleben heute, daß die soziale Evolution uns wieder eine solche Größerformatierung abverlangt – eine neue Bemühung um Verkehrsfähigkeit mit allen möglichen koexistierenden Kräften in einem globalisierten Großraum. Die Philosophie ist heute ein super-work-out für die kommunikativen Energien, die weltweit Anschlüsse finden. Darin steckt schon ein so anspruchsvolles pragmatisches Programm, daß ich für Idealismus keine Verwendung sehe.
H.-J.H. Ich möchte bei den drei Ausdrücken Vision, Pathos, Erkenntnis doch noch einmal nachfassen. Zunächst das Visionäre. Vielleicht müssen wir visionär denken, wenn wir überhaupt denken wollen. Ich habe etwa die buddhistische Ethik im Blick mit ihrer Aufforderung, sich immer an einer besseren Welt zu orientieren, selbst wenn man in einer verdorbenen Umwelt lebt. Eine ähnliche Anmerkung möchte ich bezüglich Ihrer Einstellung zum Pathos machen. Ist ein Denken, das authentisch zu sein versucht, nicht immer notwendigerweise pathetisch? Ist nicht das Pathos eine Erkenntnisqualität? Ist es vielleicht nur in unserem akademischen Betrieb, in unserer Kulturindustrie, zu einem Symptom von Irrationalität oder Naivität degeneriert? Nehmen Sie einen Schriftsteller wie Hans Henny Jahnn, dessen Literatur ohne das Pathos nicht denkbar wäre. Oder erinnern Sie sich an das, was Roland Barthes über Jules Michelet gesagt hat: daß die von ihm inaugurierte Geschichtsschreibung einen »Exzeß der Wörter« biete. Denken Sie an das, was Rancière in einer jüngeren Arbeit die »Poetik des Wissens« nennt: Muß man dann nicht von der Einsicht ausgehen, daß ein Denken, das überhaupt noch welthaltig sein will, per se eine Übersteigerung vollzieht? – eine Übersteigerung ins Visionäre oder ins Pathetische oder ins Poetische. Ist also nicht das Denken als solches immer schon trans-, transrational, transsubjektiv, transroutiniert, in welcher Richtung auch immer?
P. S. Nun, in diesem Sinne bin ich als Pathetiker überführt. Meine ganze Arbeit bewegt sich in solchen Trans-Dimensionen, sie wandert ständig zwischen den Fächern, den Sprachen, den Aspekten. Man könnte das als literarische Materialisierung eines erweiterten Aufklärungsbegriffs verstehen. Außerdem gibt es in vielen meiner Texte wohl diesen erwähnten existentialistischen Faktor, beinahe hätte ich jetzt die alte 68er-Formel von der »Wissenschaft in der ersten Person« benutzt. Aber der Ausdruck ist falsch, weil es nicht angeht, für die Ich-Form die erste Stelle zu fordern. Ich bin beeindruckt durch die Kritik, die Eugen Rosenstock-Huessy an der alexandrinischen Schulgrammatik geübt hat, die der Ich-Fom des Verbums die Stelle der »ersten Person« in der Konjugationsreihe zusprach – ein Brauch, der sich bis heute behauptet hat. Rosenstock-Huessy hält das für den Sündenfall der Linguistik schlechthin, und auch für den der Philosophie, weil die wahre und wirkliche »erste Person« des Verbums natürlich der Appellativ ist, die Anredeform. Alles andere kann erst auf diese folgen. Ein nichtverrücktes Ich entsteht nur, wenn ihm jemand zuvorgekommen ist, der in der richtigen Weise Du zu ihm sagte. Insofern ist jede Form von Denken, die dieses Gezeichnetsein durch etwas Vorausgehendes, Zuvorkommendes, Ernennendes anerkennt, ein pathetisches. Unter diesem Blickwinkel bin ich mit der Verteidigung des Pathos völlig einverstanden.
Doch was Sie mit dem Begriff »Übersteigerung« andeuten, scheint mir noch wichtiger zu sein. Der Ausdruck gefällt mir, weil er die Transzendenz auf die Übertreibung zurückführt. Er signalisiert, daß die Rhetorik ihre Rechte gegenüber der Philosophie wiederherstellt. Vor allem widerspricht er dem biologischen Positivismus, der alle Kultur- und Lebensphänomene immer nur unter dem Gesichtspunkt von Anpassung beschreibt. Der Affe paßt sich an die Savanne an, der Künstler paßt sich dem Publikumsgeschmack an, die Orthographie paßt sich dem Sprachgebrauch an. Und wenn all diese Anpassungsdiskurse nur Produkte einer optischen Täuschung wären – Projektionen des Lebensgefühls von Angestellten auf die Evolution? Die Wahrheit ist doch viel eher, daß Leben von Grund auf Überreaktion ist, eine Expedition ins Unverhältnismäßige, eine Orgie an Eigensinn. Der Mensch ist das Überreaktionstier par excellence. Kunst schaffen heißt überreagieren, denken heißt überreagieren, heiraten heißt überreagieren. Alle entscheidenden menschlichen Tätigkeiten sind Übertreibungen. Schon der aufrechte Gang war eine Hyperbel, die sich nie ganz in biologische Vorteile aufrechnen ließ. Da ist von vorneherein ein Zug ins Verrückte, Überhöhte im Spiel. Jedes Menschenwort ist ein Schuß ins Offene. Das haben die älteren Anthropologien noch viel klarer im Auge gehabt und aus Einsicht in die Allgegenwart des Übertriebenen im menschlichen Verhalten das Maß und die Zurückhaltung gepredigt. Man muß so verkorkste Konzepte wie »kommunikative Kompetenz« ersetzen durch eine Theorie der anschlußfähigen Übertreibungen. Im übrigen ist Ironie eine Überreaktion auf die Dauerbelästigung durch Tatsachenbehauptungen.
Erst auf diesem Niveau könnte die Rede von Kommunikation vielleicht wieder aufregend werden. Ich habe in meinen Frankfurter Poetik-Vorlesungen Zur Welt kommen – Zur Sprache kommen – das war im Jahr 1988 – das Bild vom »tätowierten Autor« verwendet. Ich habe gesagt, ein Autor ist eine verrückte Silbe, ein Wortstück, das nach Mit-Silben sucht, um Platz in einer Sinnkette zu finden. Daraus ergibt sich wie von selbst, daß man subjektzentrierte Strategien aufgeben muß, wenn man nicht einsilbig und autistisch bleiben will.
Von Europa und seinem Trauer-Monopol
H.-J.H. Gestatten Sie mir eine Ausweitung unserer Überlegungen ins politische Gebiet. Mein Stichwort lautet hier »Europa«. Sie zitieren Albert Camus, der nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bemerkte: »Das Geheimnis Europas ist, daß es das Leben nicht mehr liebt.« Vielleicht, so heißt es bei Ihnen, finden manche Europäer von heute in den Kommentaren des indischen Mystikers Osho zu Nietzsches Also sprach Zarathustra Anregungen für eine neue »Religion der Liebe zum Leben«. Ich frage mich: Wie hätte man sich das vorzustellen, eine neue Religion der Liebe zum Leben?
P. S. Habe ich das wirklich gesagt? Dann wollen wir hoffen, daß es einen tieferen Sinn hat. Nimmt man die Formulierung zum Nennwert, ist sie tautologisch. »Liebe zum Leben« genügt in jeder Hinsicht, der Zusatz »Religion« ist überflüssig. Die Formulierung ist ein indirektes Zitat, wie Sie wissen, ich spiele auf den Untertitel von Hans Peter Duerrs Sedna an – ein Buch, das eine kulturphilosophische Abrechnung mit dem metaphysischen Pessimismus enthält, eine bedeutende Arbeit. Offen gesprochen, »Religion der Liebe zum Leben« kann nur ein Reklamespruch sein. Warum habe ich davon geredet? Sinnvoll wird eine solche Wendung vielleicht unter der Prämisse, daß Religionen wie Theorien und Kunstwerke im Lauf des 20. Jahrhunderts Handelsgüter und Dienstleistungen geworden sind und sich als solche auf allgemeine Marktbedingungen einlassen müssen. Man muß Theologien mit Verlagsprogrammen vergleichen. Die Einsichten Adornos über den Einfluß der Warenform auf das Kunstwerk treffen, wenn man näher hinsieht, auch auf die Religion zu und ebenso auf den Moralismus: Alle diese hehren Geistesphänomene existieren heute wie seit jeher in erster Linie als Betriebe, es fragt sich nur, ob als Monopolbetriebe oder als Wettbewerbsbetriebe, als Monopolprodukte oder als konkurrierende Produkte. Es ist vor allem die Entdeckung der Konkurrenz, die in diesen Dingen noch immer schockierend wirkt.Wir haben das ganze 20. Jahrhundert gebraucht, um uns an den Gedanken zu gewöhnen, daß diese bisher für transzendent und autonom gehaltenen Sphären bis ins Innerste durchdrungen sind von dem, was Karl Mannheim seinerzeit subversiv den »Einfluß der Konkurrenz im Gebiete des Geistigen« genannt hat. Die aktuellen Medienanalysen machen klar, daß man den Moralmarkt und Weltbildermarkt genauso kühl untersuchen muß, wie man es beim Kunstmarkt schon seit längerem tut. Auch bei den Religionen in der Moderne hat man es mit Produkten zu tun, die sich bei den Klienten bewähren müssen. Nun sind Religionen, solange sie dominieren, es nicht gewohnt, sich als Dienstleistungen zu präsentieren. Sie tun sich schwer damit, Angebote zu machen, die mit anderen verglichen werden können. Sie begründen sich von oben und nicht von Bedürfnissen her, in diesem Punkt sind sie wie Suhrkampbücher. Aber wo die Bewährungsprobe auf dem Markt explizit verweigert wird, ist das ein Indiz dafür, daß sich ein träger Monopolist um die Leistungs- und Attraktivitätsbewertung durch nicht von ihm unterworfene Instanzen herumschwindeln möchte.
Der Satz von Camus gibt einen Hinweis auf diese Zusammenhänge:Was heißt das denn – »das Geheimnis Europas ist, daß es das Leben nicht mehr liebt«? Zunächst ist dieser Ausspruch nichts anderes als die Paraphrase eines zorniges Worts von Georges Clemenceau über den deutschen Charakter, der angeblich das Leben nicht liebt. Der kriegerische Franzose hatte sein Staunen über die deutsche Kultur und Unkultur in diesem Satz zusammengefaßt und somit die unheimlichen Nachbarn moralisch an den Rand der Menschheitsfamilie verbannt. Er hat die Deutschen gleichsam auf einer völkerpsychologischen Ebene zu Feinden des Menschengeschlechts erklärt. Indem Camus das Wort Clemenceaus auf die Europäer insgesamt bezog, gab er zu verstehen, daß sich der Gegensatz zwischen Frankreich und Deutschland in diesem Punkt nicht länger aufrechterhalten läßt. Darum ist die These von Camus in meinen Augen ein Schlüsselwort der Nachkriegszeit, sie vollzieht die deutsch-französische Versöhnung in einer gemeinsamen Verdüsterung. Sie resümiert eine Epoche, in der sich die Europäer im Namen von anmaßenden Abstraktionen gegenseitig zerfleischt hatten. Aber Camus spricht nicht nur von diesem »Zeitalter der Extreme«, als welches man das 20. Jahrhundert bezeichnet hat. Er hat ein europäisches Kontinuum im Auge, das viel weiter zurückreicht. Er stellt fest, daß die Europäer die Freude aus der Welt vertrieben und auf irgendein nebelhaftes Danach, ein Jenseits oder eine Endzeit, vertagt haben. Dieses Zitat, das ich häufiger anführe, weil es übertrieben genug ist, um wahr zu sein, nimmt eine von Nietzsche formulierte Einsicht auf. Nach dessen Diagnose haben die europäischen Christen durch eine tausendjährige Praxis des Lebensaufschubs die Fähigkeit verloren, die Welt und das Dasein in ihr umfassend zu bejahen. Sie sind infolgedessen – immer noch in Nietzsches Terminologie gesprochen – décadents oder, wie man nationalökonomisch sagen würde, Monopolisten. Décadence – man sollte das nicht vergessen – ist nur ein anderes Wort für Lebensbedingungen unter einem schützenden Monopol. Der typische décadent ist auf Subventionen angewiesen und lebt in einer wettbewerbsfreien Nische. Denn für das Gute gibt es keinen Ersatz, nicht wahr? Das heißt, es gibt keine Vergleichsmöglichkeit.
Ohne Zweifel war es Nietzsches entscheidende Intuition, daß er zuerst bei Platon, dann bei Paulus, bei der katholischen Kirche und weiter bei Aufklärern einer bewußten Art diesen bequemen Rückzug auf das konkurrenzlos Gute gewittert hat. Er hat den Moralwahnsinn durchschaut, der zu einer Besessenheit durch das bloße Gute führt und davon träumt, man könne für dieses ein Monopol einführen und die im Realen wie im Logischen unüberwindliche Bipolarität von Gut und Böse eben doch nach einer Seite auflösen. Im Grunde ist die ganze europäische Metaphysik ein Monopolisten-Delirium gewesen. Die moralisierenden Metaphysiker sind in Nietzsches Augen wie Schiffbrüchige, die glauben, dem Meer Bedingungen stellen zu dürfen. Mehr noch, sie beschließen, während sie untergehen, das Meer trockenzulegen. Klassisch ausgedrückt ist dieses Motiv in der Johannesapokalypse, wo es an einer entscheidenden Stelle heißt, daß nach der Wiederkunft des Messias auch das Meer nicht mehr sein werde. Die moraldämonische, vom Guten besessene Haltung kommt mit dem antiken Idealismus und Prophetismus auf und lebt in christlichen Mutationen weiter, sie setzt sich fort bei den modernen Philanthropen, bei den Sozialdemokraten des 19. Jahrhunderts, bei der deutschen Reichspost, beim Roten Kreuz, bei der sowjetischen Psychiatrie, in der jüngeren Kritischen Theorie, mit einem Wort bei all denen, die von ihrem eigenen Gut-und-vernünftig-Sein auf ihre Monopolberechtigung schließen.
Man könnte also sagen, daß Nietzsches Leistung in der Wiedereinführung des Wettbewerbsgedankens in die Kultur liegt und eo ipso in der Wiederherstellung der Einsicht in den polarischen Charakter von Gut und Böse, man könnte auch sagen in die Mehrwertigkeit der moralischen Sachverhalte. Dieser Impuls läßt sich in die Frage fassen:Wie kommen die Europäer zu einem fünften Evangelium? Nietzsche hat in einem Brief an seinen Verleger sein Werk Also sprach Zarathustra mit diesem eher ungewöhnlichen Ausdruck beschrieben. Aber was in aller Welt ist ein fünftes »Evangelium«? Nach meiner Meinung wird man dieser Formulierung gerecht, wenn man sie als Auftakt zu einer Epoche der Evangelienwettbewerbe liest:Was künftig als gute Botschaft gelten darf, kann nur noch agonal, im Wettstreit zwischen guten Botschaften, ermittelt werden. Vergessen wir nicht, alle Gesellschaften klimatisieren sich selbst durch Kommunikationen über ihre Hoffnungen und Verheißungen – aber erst für die moderne Welt gilt explizit, daß keine Monokultur der guten Botschaft mehr akzeptabel sein kann, weder christlich, noch völkisch, weder sozialistisch, noch liberalkapitalistisch.Wenn die Vier die Zahl des Monopolisten war, dann ist die Fünf die Zahl des freien Geistes, genauer: des Unternehmers der eigenen Überzeugung, des Künstlers. Damit ist die Initiative des Zarathustra definiert: Nietzsche wirbt für einen Menschentypus, der auch in Sinn-Angelegenheiten an eine frühgriechische Grundhaltung anknüpft – an den Wettbewerb, die agonale Gesinnung, die Freude am Kräftemessen. Er feiert die Differenz, die sich offen zeigt, er praktiziert die Großzügigkeit, die in der freimütigen Selbstmitteilung liegt. Man darf sich nicht davon beirren lassen, daß bei Nietzsche die Reklame noch Verkündigung heißt.Vielmehr kann man bei ihm rückwirkend lernen, daß die sogenannte Verkündigung nichts anderes war als die Reklame des Monopolisten.
H.-J.H. Das klingt so, als wollten Sie sagen, daß nur der Wettbewerb der Lebensformen das ist, was uns Europäer kulturell verjüngen könnte.
P. S. Jedenfalls bricht er das depressive Kartell auf. Zahllose Europäer sind 1914 in einen Maelstrom hineingerissen worden, aus dem sie, wenn man sich’s recht überlegt, erst heute, am Ende des Jahrhunderts, wieder anfangen aufzutauchen. Die Ereignissequenzen von 1914-1918 und von 1939-1945 bezeichnet manals den Ersten und Zweiten Weltkrieg,als wären die Zahlen eins und zwei Behälter, in denen kategorial verschiedene Ereignismengen aufbewahrt werden. In Wahrheit bilden beide eine zusammenhängende Sequenz, einen einunddreißigjährigen Krieg, dessen Kernschatten bis 1990 reicht. Diese kommunizierenden Röhren der Gewalt, des Wahnsinns, des Rachebedürfnisses und des Traumas durchziehen das Jahrhundert bis an sein Ende. Sie übergreifen mehrere Generationen und erzeugen komplizierte psychische Erbgänge. Man muß berücksichtigen, daß in sozialpsychologischer Sicht Nachkriegszeiten länger dauern als die Kriege selbst. Das 20. Jahrhundert ist ein kurzes Jahrhundert genannt worden, das »inhaltlich« von 1917 bis 1991 dauert, so lange wie das sowjetische Experiment. Das ist nicht schlecht gesehen. Doch auch in einem kurzen Jahrhundert altern die Menschen überdurchschnittlich, wenn sie, wie die Europäer, speziell die Deutschen und mehr noch die Osteuropäer, allen voran die Russen, eine Folge von vier verlorenen Generationen durchlebt haben.
H.-J.H. Haben Sie selber eine Alternative gefunden? Gibt es ein Mittel gegen die Vergreisung?
P. S. Auf Privatrezept, vielleicht. Ich bin 1947 geboren, ein typisches Nachkriegsgewächs. Ich habe die Nachkriegsluft in unserem Land geatmet bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das Glück hatte, durch erste Reisen andere Atmosphären zu entdecken. Es sind nicht andere Länder, die man durch Reisen kennenlernt, sondern andere Freiheitszustände. In den sechziger Jahren fing das mit der italienischen Freiheit an, dann kam die provençalische Freiheit dazu, zuletzt die nordamerikanische. Ich habe durch das Atmen in fremder Luft bemerkt, was Entgiftung bedeutet. Danach habe ich mich systematisch entgermanisiert. Ich habe dem heimatlichen Maso-Patriotismus den Rücken gekehrt. Psychisch war ich unter meiner deutschen Adresse lange nicht mehr erreichbar.
H.-J.H. Das Rezept hieße demnach reisen und Abstand erzeugen?
P. S. Nicht nur. Das beste Gegenmittel gegen die Depressionsmonopolisten und die Ressentimentverwalter bleiben die Klassiker. Sie sind das Ausland gegenüber der eigenen Zeit. Auch die wesentlichen Autoren des 20. Jahrhunderts muß man ständig im Auge behalten. Nicht daß wir sie direkt nachahmen könnten. Das ist unmöglich, weil unsere Lage so völlig anders ist als die ihre. Aber in einem Punkt bleiben wir mit ihnen verwandt. Auch sie haben Werke geschaffen in einer Zeit, als es schon hieß,Werke seien nicht mehr möglich.
Blickwechsel zwischen Napoleon und Hegel
H.-J.H. Ich frage mich, ob das, was Sie eben gesagt haben, die sozialpsychologische These bestätigt, daß wir erst jetzt, in den späten neunziger Jahren, das Ende der Nachkriegszeit erreichen. Oder unterstützt es eher die Theorie vom »Ende der Geschichte«, die seit dem Kollaps der Sowjetunion erneut zu zirkulieren begann?
P. S. Nach meiner Meinung trifft das erste unbedingt zu. Man muß sich an den sehr harten Gedanken gewöhnen, daß eine Nach-Weltkriegszeit zwei volle Generationen dauert, in manchen Ländern sogar länger. Nach Dramen von der Größenordnung dessen, was die Mitteleuropäer in diesem Jahrhundert erlebt haben, müssen mindestens fünfzig Jahre vergehen, bevor eine Nach-Nachkriegszeit beginnen kann. Es sieht so aus, als sei die deutsche Gesellschaft gegenwärtig zum ersten Mal in der Verlegenheit, sich eine Definition geben zu müssen, die nicht mehr nur von der festgehaltenen Nachkriegssituation geliehen ist.
Was das »Ende der Geschichte« angeht, so bin ich als Zeuge für Aspirationen dieses Typs nur bedingt tauglich, weil ich mit Hegelianismen der bisherigen Machart nichts im Sinn habe. Man sollte die Tatsache im Auge behalten, daß dieses Theorem auf Alexandre Kojève zurückgeht, einen Emigranten aus dem revolutionären Rußland, der vor seiner Naturalisierung in Frankreich um 1930 Kojewnikow hieß, bei Jaspers studiert und über russische Theosophie promoviert hatte und in einer undurchsichtigen Beziehung zum KGB stand. Kojèveve nimmt an, daß in Hegels Phänomenologie des Geistes, wie in der späteren Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, so etwas wie ein prinzipielles Ende der Geschichte erreicht worden sei – was immer »prinzipiell« hier heißen mag. Als es zum virtuellen »Blickkontakt« zwischen Hegel und Napoleon gekommen war, nach der Schlacht von Jena, war Kojève zufolge die Geschichte in ihrer »Substanz« vollendet. Die französische Gegenwart hatte über die preußische Vergangenheit gesiegt, auch im Denken des Philosophen. Die letzten weltgeschichtlichen Individuen, Napoleon und Hegel, wirkten also auf gleicher Höhe. Ihre Spiegelung hätte gegenseitig sein können, wäre Napoleon auf die Idee gekommen, bei Hegel sein Portrait zu bestellen. Nach diesen beiden Endgestalten der notwendigen Geschichte gibt es nur noch beliebige Subjektivitäten ohne historisches Gewicht, mit einer einzigen Ausnahme, und die meint Kojève entdeckt zu haben. Sie ist natürlich niemand anders als Stalin. Am Verhältnis zwischen Napoleon und Hegel nimmt Kojève Maß, um sein Verhältnis zum Führer der Sowjetunion zu bestimmen. Das Theorem vom Ende der Geschichte ist also in einem sophistischen Stalinismus zu Hause, erst später mutiert es zum Lob des siegreichen Liberalismus. Stalin war in Kojèves Augen das letzte Individuum, das in einem weltgeschichtlichen Skript agierte und darum einen ebenbürtigen Interpreten brauchte. Nach Stalins Tod hat Kojève sein Theorem über die finale universal-homogene Gesellschaftsordnung von der Sowjetunion auf die USA und teilweise auf eine lateinisch dominierte europäische Union verschoben. Fukuyama mußte keinen neuen Gedanken denken.
Man kann der Meinung sein, daß diese fabelhafte Konstruktion eine Anmaßung ausdrückt, wie sie für Berufsmegalomanen typisch ist. Ich glaube trotzdem, daß das Theorem vom Ende der Geschichte suggestive Seiten hat oder, um vorsichtiger zu reden, daß es sich lohnt, es ernst zu nehmen, bis man ganz sicher ist, Besseres zu wissen.
Der Gedanke, der sich in Kojèves Hegeldeutung artikuliert, läßt sich in einer sehr freien Umschreibung etwa so wiedergeben: Die modernen Gesellschaften sind in ein Stadium eingetreten, in dem es keine grundlegenden Innovationen mehr geben kann, sondern nur noch Steigerungen oder Variationen innerhalb von gut abgegrenzten und ausgebauten Dimensionen. Die heutige Weltgesellschaft ist wie ein Feld von Mara