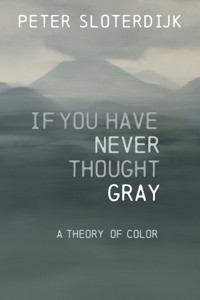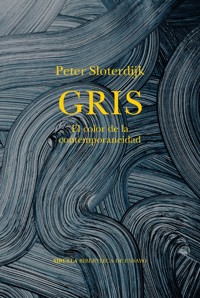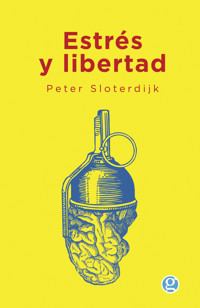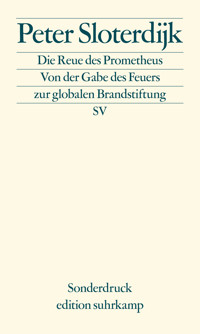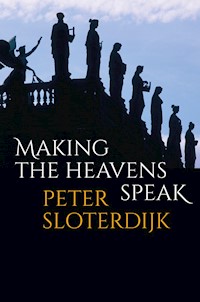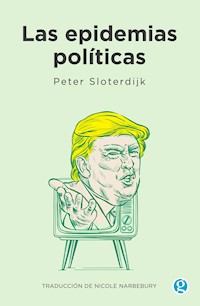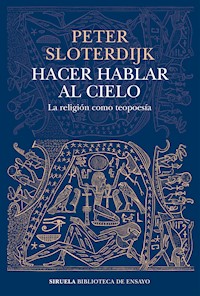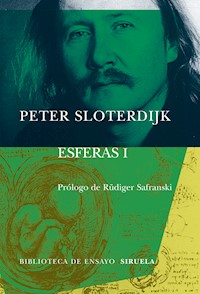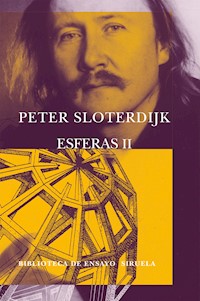15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Solange man kein Grau gemalt habe, sagte Paul Cézanne einmal, sei man kein Maler. Wenn Peter Sloterdijk diesen Satz auf die Philosophie überträgt, mag dies wie eine maßlose Provokation klingen. Warum sollten Philosophen eine einzelne Farbe denken, anstatt sich mit Ethik, Metaphysik oder Logik zu beschäftigen?
»Ist Lebenskunst nicht mehr als ein leicht gesagtes Wort für die schwer zu erwerbende Disziplin der Grauzonenkunde?«, fragt Peter Sloterdijk und folgt dem grauen Faden durch die Philosophie-, Kunst- und Mentalitätsgeschichte. Er befasst sich mit der Rotvergrauung der Deutschen Demokratischen Republik, mit Graustufenphotographie und lebensfeindlichen Landschaften in der Literatur. Indem er das Grau als Metapher, als Stimmungsindikator und als Anzeige politisch-moralischer Zweideutigkeit erkundet, liefert er eine Vielzahl bestechender Belege für die titelgebende These.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Titel
Peter Sloterdijk
Wer noch kein Grau gedacht hat
Eine Farbenlehre
Suhrkamp
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
Umschlagabbildung: Gerhard Richter, Italienische Landschaft, 1967, Öl auf Leinwand, 105cm x 100cm, WV-Nr. 167-2, © Gerhard Richter 2021 (0157)
eISBN 978-3-518-77237-9
www.suhrkamp.de
Widmung
»Wer sagt denn, daß die Welt schon entdeckt ist?«
Peter Handke, Die Stunde der wahren Empfindung (1978)
Man möchte gerade so viel schreiben, daß die Worte einander ihr Leben leihen, und gerade so wenig, daß man sie selber noch ernst nimmt.
Elias Canetti, Die Provinz des Menschen. Aufzeichnung (1943)
Für Beaim Morgenlicht
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Prolog: Unter fahlem Segel über die Gewässer der Gewöhnlichkeit
1. Das Ge-gräu: Platons Höhlenlicht, Hegels Dämmerung, Heideggers Nebel
Erste Digression: Kafkas Korridore
2. Erweiterung der politischen Farbenlehre: Die grauen Fahnen flattern uns voran
Zweite Digression:
Zones grises
3. Spektrales Grau: Vom alten Leiden des Lichts beim Abstieg ins Dunkel und seinen neueren Großtaten auf Salz und Silber
Dritte Digression: Von Grau und Frau
4. Graues, das dich berührt: im Sturm – im Norden – am Meer – in den Bergen
Vierte Digression: Was es mit Cézannes Grau auf sich hat
5. Die grauen Ekstasen: Mystischer Rap, laue Drift, schöpferische Indifferenz und die Schwierigkeit, Gott gegen den Verdacht der Gleichgültigkeit zu verteidigen
Fußnoten
Informationen zum Buch
Prolog: Unter fahlem Segel über die Gewässer der Gewöhnlichkeit
Wer, gleichsam einer Laune nachgebend, sich von der Neigung erfassen ließe zu behaupten, das Phänomen »Grau« – als Farbe an Dingen, als Schattierung der Raumbeleuchtung oder als Stimmung des Daseins – verdiene eine eingehendere Betrachtung, als es sie bisher in den Sphären der ästhetischen und philosophischen Theorie gefunden hat, könnte sich von dem Ausspruch Paul Cézannes: »Solange man nicht ein Grau gemalt hat, ist man kein Maler«,[1] zu einer komplementären Behauptung herausfordern lassen: Solange man das Grau nicht gedacht hat, ist man kein Philosoph.
Was Cézanne im Sinn hatte, als er ein Grau forderte, das den Maler ausweise, soll sich an späterer Stelle verdeutlichen.[2] Daß bei dem Wort »grau« etwas zu denken sei, das mehr bedeute als nur einen quasi neutralen, zwischen Schwarz und Weiß liegenden Farbwert oder einen Hinweis auf Unbuntes und Unentschiedenes – für diese These sollen die folgenden Ausführungen eine Reihe von Indizien zusammentragen.
Das Etwas, das beim Grau zu denken wäre, findet sich, wie zu verdeutlichen bleibt, halben Wegs zwischen einer metaphorischen und einer begrifflichen Größe. Die Sprache des Alltags geht an der kritischen Stelle zumeist mit eingespielter Selbstgenügsamkeit vorüber. Es würde genügen, ihr bei ihren Beinahe-Berührungen mit dem kritischen Sujet etwas aufmerksamer als gewöhnlich zuzusehen, um dem unbeachteten Etwas auf die Spur zu kommen. Denn indem sie für verhangene Novembertage, für Elefantenhäute und Mäusefelle, für in Pfeffer und Salz melierte Böden öffentlicher Pissoirs, für düstere Wolkenfronten und silbrige Alterskopfbehaarung, für zerfallene Gesichtszüge (soll nicht Goethes Miene, nach Auskunft des Weimarer Fürstenleibarztes Carl Vogel, bei der Angstkrise zwei Tage vor seinem am 22. März 1832 eingetretenen Tod »aschgrau« gewesen sein?[3] ), ferner für steife Packpapiere, für fahle Cashmere-Eleganz, für rechtsfreie Zonen wie für unfrohe Zukunftsaussichten, für eheliche Gewohnheiten, für tote Archivalien, staubbedeckte Regale und hundert andere Bewandtnisse den gleichen unpathetischen Ausdruck wählt – das Wörtchen »grau«, zumeist in adjektivisch geduckter Position, seltener in Zusammensetzung mit Nomina wie in Graubrot, Grauwasser, Grauzone, Greyhound –, weist sie dem unscheinbaren Lexem einen ausgedehnten Anwendungsbereich zu, ohne nennenswerte chromatologische Ansprüche, geschweige denn explizite Aussagen über Atmosphärisches damit zu verbinden. In der extensiven Verwendung des Worts verbirgt sich ein Gedanke, ja eine Mehrzahl von Gedanken, von deren Volumen man sich üblicherweise keine Vorstellung macht.
Unter dem unscheinbaren Farbwort gehen Wahrnehmungen, Wertungen und Anmutungen eine vage Symbiose ein. Das Gleichgültige, das Trostlose, das Ungefähre, das Ungewisse, das Unentschiedene, das Unbestimmte, das in die Länge Gezogene, das Immergleiche, das Eindimensionale, das Tendenzlose, das Irrelevante, das Amorphe, das Nichtssagende, das Bedeckte, das Nebelhafte, das Monotone, das Zweifelhafte, das Mehrdeutige, das leicht Widerwärtige, das in ferner Vorzeit Versunkene, das von Spinnweben Bedeckte, das Aschenfarbige, das Archivarische, das Novembrige, das Februarische – es ist nicht wenig, was unter dem gleichen fahlen Segel über die Gewässer der Alltäglichkeit fährt. Falls man sagen dürfte, das menschliche Dasein verfüge von sich her über eine implizite Meteorologie, so würde der Zuständigkeitsbereich der existentialen Wetterkunde nicht zuletzt durch den Gebrauch des Grau-Worts angezeigt. Wer sich vornimmt, die Wetterberichte der Seele als unmerklich fortlaufendes Sprachspiel ernst zu nehmen, ja es als eigenes Genre des Nachrichtenwesens gelten zu lassen, kommt nicht umhin, das Graue explizit zu machen.
In jedem sehfähigen Dasein ist das Eintauchen in weltliche Farbigkeiten mitenthalten. Ohne ein Minimum an Farbenlehre kann sich das menschliche Leben nicht vor sich selbst erläutern. Die Urdifferenz von Hellem und Dunklem geht mit der Unausweichlichkeit einer Elementarwahrnehmung aller Erfahrung mit Buntem oder farblich Dezidiertem voraus – wir werden dies später mehrfach kommentieren: einmal im Zusammenhang mit Anmerkungen zu Goethes Farbenlehre, die zu den Problemen der Dunkelheit im Verhältnis zum Hellen, der farbigen Schatten und des Grau bedeutende Erkenntnisse bietet; dann anläßlich einer Erörterung des Phänomens Farbenblindheit, bei welchem die angeborene Grausichtigkeit als Basisqualität des menschlichen Aufenthalts in einem Hell-Dunkel-Raum ohne Farben dramatisch hervortritt, und schließlich bei Gelegenheit der Ausführungen zur Revolution des Sehens durch die Schwarzweißphotographie im mittleren 19. Jahrhundert.
Auch ohne Bezüge auf den physiologisch bedingten Daltonismus bzw. die Achromatopsie und die epochale Verfremdung des Sichtbaren in der ersten Hälfte des photographischen Zeitalters kennt sich das lichtempfindliche Dasein selbst seit je als aktuelles oder virtuelles Ausgesetzsein in eine ausgedehnte Unbuntheit – nicht nur an Nebeltagen. Wo Alltagsschwere sich ausbreitet, nimmt die Empfindung überhand, das gewöhnliche Spiel der farblichen Valeurs sei außer Kraft gesetzt. Es gibt Momente, in denen das Grau, als visuelles Datum und als Stimmung, durch seine Nähe zur Monotonie die Oberhand gewinnt. Wer im existentiellen Tief versinkt, spürt, wie aus chromatischen Kontrasten die Spannung entweicht. Die Kolorite der Dinge ringsum rinnen in einer neutralen All-Farbe, einem empfundenen Dunkelgrau, zusammen. Der Zustand ließe sich annäherungsweise durch den Verweis auf übermüdete Augen erläutern, wenn eine Aversion gegen Wahrnehmungen sie überwältigt; man kann ihn vielleicht auch verdeutlichen durch den Vergleich mit dem cafard eines Masochisten nach dem Exzeß, schwarzgrau und elend wie die Stimmung eines Mitteleuropäers nach den Pandemie-Nachrichten einer spätwinterlichen Tagesschau.
Das Grau, das zu denken gibt, ob man es als Begriff oder als Metapher bzw. als Metonymie auffaßt, ist dem Unentschiedenen zugeordnet, es steht für Mittleres, Neutrales, Unbesonderes, für Einbettung in Gewöhnliches jenseits von Lust und Unlust. Ist es nicht Farbe, heißt es Alltäglichkeit. Als Milieu, als Mittelbereich, als environment aus Sitte, Gerede und Aromen, dem man durch Geburt oder Flucht ausgeliefert ist, wird es zur »Welt« im ganzen. Es bildet den Horizont oder das Wo des In-Seins überhaupt, mitsamt seinem Gefolge aus Tendenzen, Ungewißheiten und vagen Gefahren.
Als das Reich der Selbstverständlichkeiten, das der Phänomenologe, als der philosophische Betreuer der Grauwelten, in mutwillig erhöhter Rezeptivität ausschreitet, so voraussetzungslos wie möglich, unalarmiert aufmerksam (ob er nun Edmund Husserl heißt oder Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty oder Hermann Schmitz), reich an Beobachtungen, die nicht überreden, sondern erhellen, in lichterloher Mittelmäßigkeit zur Deutlichkeit entschlossen, schmückt sich das so gewürdigte Alltägliche mit dem demütigen, doch selbstbewußten Titel »Lebenswelt« – einem Wort, das vor allem dank seiner Durchführung in Husserls Spätwerk[4] aufhorchen machte. Es versprach in streitbarer Bescheidenheit, von einem Leben zu handeln, das sich von dem der Biologen toto coelo unterscheidet; es wollte Aufschluß geben über eine in der Alltäglichkeit erschlossene und verborgene Welt, von der die szientistischen Physiker und viele andere Wissenschaftler aufgrund ihrer Objektivitätsillusion sich selber ausgeschlossen haben.
Würde uns die Frage vorgelegt, worin aus kulturdynamischer Sicht das Hauptereignis des 19. und 20. Jahrhunderts bestand, könnte eine der möglichen Antworten lauten: wohl nicht zuletzt in der Umfärbung aller Farbwerte. Von diesem Vorgang hat das Alltagsbewußtsein im Zeitstrom nicht mehr erfahren, als für die Einsetzung einer veränderten Grundstimmung nötig war. Die Veränderung rastete irgendwann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein, vielleicht sogar erst in den sechziger Jahren, sobald mit einem Mal evident schien, daß alle Farben gleich gut sind und wie vergeblich es wäre, immer noch Verhältnisse der Über- und Unterordnung zwischen ihnen geltend machen zu wollen. Die Vereinigten Farben der Gegenwart erweisen sich gegenseitig Respekt und verzichten darauf, die Nachbarfarben dominieren zu wollen. Durch die neue Empfindungs- und Urteilsweise nahm das durchschnittlich unkreative, trendbestimmte Dasein am Epochenvorgang der Enthierarchisierung teil. Es vollzog ihn nach, als hätte es ihn gewollt. Im Fall der Farben war die Aufhebung der Beziehungen zwischen Höherem und Niederem eng an den gleichzeitig sich vollziehenden sinnverwandten Prozeß der Desymbolisierung gebunden.
Das Farbensehen weiß gewöhnlich nicht, daß es eine Geschichte hat. Modernes Design und seine postmodernen Nachspiele geben sich daran zu erkennen, daß Farben und Bedeutungen weit auseinandertreten. Niemand besteht mehr darauf, die Hoffnung müsse grün codiert sein, während die Ferne, die Weite, die Umhüllung vom Unendlichen nach Blau verlange; wer immer noch meint, Rot sei die deklarierte Liebe, dem wird zu einem besseren Geschmack kaum noch zu verhelfen sein. Die »Stoffe« machen sich das ihre vom arbitraire du signe zu eigen, unter dessen Vorzeichen die von Ferdinand de Saussure inspirierte »strukturalistische« Sprachwissenschaft im 20. Jahrhundert ihren Gang durch die akademischen Korridore angetreten hat. Die Abspreizung der chromatischen Signifikanten von der vormals obligaten symbolischen Fracht der Signifikate vollzieht sich, gleichgültig ob sie asketischen oder neu-barocken Motiven gehorcht, viel eher unter dem Einfluß von kulturweit verbreiteten farbenpsychologischen Konditionierungen – um vom sinnfernen Spiel der Modefarben nicht zu reden – als entlang des Leitfadens alteuropäischer liturgischer, allegorischer oder schultypischer Farbbedeutungen.[5]
Wo der Zug zur Enthierarchisierung und der zur Desymbolisierung sich trafen, entstand eine strategische Allianz – vielleicht auch nur eine zufällige Wirkungsgemeinschaft – gegen die Sonder- und Spitzenstellung des Weißen. In der Eminenz der Farbe Weiß resümierte sich eine im mediterranen und okzidentalen Raum jahrtausendmächtige Überlieferung solarmythologischer, lichtmetaphysischer und farbtheologischer Motive mitsamt ihren Spiegelungen in kirchlichen Liturgiefarben und dynastischen Bildsprachen; sie reichen vom obligaten Weiß der Tauben, die dem Heiligen Geist die Flugtauglichkeit attestieren, über den Glanz fürstlicher Krönungsmäntel zu den unbeirrbar weißen Lilien des Hauses Bourbon. Wenn es je von Vorteil war, aus dem Brunnen der Vergangenheit zur Gegenwart heraufgestiegen zu sein, dann ist es das Weiß, das hiervon zu profitieren verstand. Es galt seit je als älter denn die Geschwisterfarben, und allein mit der Schwärze hätte es eine Vorrangfrage zu klären gehabt. In ihm schienen das Leuchten und das Von-weit-her-Kommen eins geworden zu sein. Indem es den Erscheinungswert einer visuellen Kategorie annahm, geriet das Weiß zur stabilisierten Epiphanie. Als Franz von Baader, der Theosoph in dürftiger Zeit, den Blitz zum Vater des Lichts erklärte,[6] wurde das Weiß das Ingrediens eines Gottesbeweises aus der Farbe. Als der All-Farbe kam ihm der Rang einer Überfarbe zu. Durch sie ging das Sein-zum-Auge ins Sein aus reinem Denken über. Wenn Johannes Scotus Eriugena im 9. Jahrhundert dozierte: omnia quae sunt lumina sunt – Alles, was ist, ist lichtartig –, knüpfte er nicht nur an die lichtmetaphysischen Spekulationen der Spätantike an, er bot zugleich ein Portrait Gottes als des wahren Suprematisten. Seiner überhellen Natur gemäß konnte dieser nicht anders, als alle Unterscheidungen, die die Welt erzeugen, innerhalb einer Farbe, der Überfarbe, anzulegen. Gott ist der Künstler, der sich nur Weiß-in-Weiß artikuliert. Er bewegt sich in einem Lichtweiß-Spektrum, das sich zum Nuancensturm ausweitet, umtönt vom unvernehmlichen Brüllen des ein-namigen Seins.
Der oft beschworene revolutionäre Bruch im Denken des 19. Jahrhunderts weist unvermeidlich einen farbphilosophischen Aspekt auf. Als umwälzungsfähig, ja als gezielt rotierbar werden nun nicht nur die Glücks- und Schicksalsräder aufgefaßt: In deren Lauf greift eine aktivierte Avantgarde der Menschheit ein – Aufklärung will fürs erste ein Unternehmen zur »Sabotage des Schicksals«[7] sein: Mit einem Mal werden Farbenkreise gedreht, Wertpyramiden umgekehrt, Hierarchien untergraben. »Die Münze umprägen« ist ein Wahlspruch, der in Epochen frei flottierender Respektlosigkeit wiederkehrt.[8] Solche Umwälzungen, Umfaltungen und Kehren machen, sobald sie an der Zeit sind, vor dem Institut der Gottes- und Königsfarbe nicht halt. Es wäre sinnlos, von modernen Zeiten zu sprechen, würde in ihnen nicht auch das Ancien régime der Farben an sein Ende gebracht. Zum Tableau der seit dem 18. Jahrhundert aufkommenden Unruhen mit langen Folgen gehört der Königsmord im Reich der Farben, durch den das Weiß seiner Eminenz entkleidet wurde.
Bevor die Republik der farblichen Gleichberechtigung proklamiert werden konnte und die United Colors of Everything die Auslagen bestimmten, mußte es zumindest einmal zum offenen Affront gegen die Königin kommen – so wie die Hinrichtung Ludwigs XVI. im Januar 1793 die Singularität in der politischen Geschichte darstellte, die der Tendenz zur Ablösung monozephaler (monarchischer) durch polyzephale Systeme die ereignishafte Spitze aufsetzte. Vom Verlauf dieses Affronts berichten herkömmliche Kunst- und Kulturgeschichtserzählungen nichts; sie berühren das Sujet bestenfalls indirekt – in diesem Kontext ergäbe sich Gelegenheit, das eingangs erwähnte Wort Cézannes, auf das zurückzukommen bleibt, wiederaufscheinen zu lassen; es verrät seinerseits kaum etwas vom Drama des Theozids auf der Bühne der Farblichkeiten.
Der locus classicus für die Umwertung des höchsten Farbwerts findet sich im 42. Kapitel von Herman Melvilles 1851 erschienenem Roman Moby-Dick, or: The Whale, in dem das Motiv des weißen Leviathans seinen Auftritt feiert. In der Gestalt eines sehr alten, vielmals gejagten, in allen Künsten der Selbsterhaltung und des Gegenangriffs erprobten, listigen, anthropophoben Albino-Meerungeheuers verkörpert sich aus der Sicht des Erzählers ein Rest all dessen, was sich aus mittelalterlichen Anschauungen über den »Fürsten dieser Welt« in die neuere Zeit mitsamt ihrer ozeanisch geweiteten Welterfahrung hinübergerettet hat. Sie bringt nicht weniger zum Vorschein als eine neu-gnostische Doktrin von der Umwertung der Werte.
Melvilles Erzähler hat nicht vergessen, wie tief das Weiß von alters her mit erhabenen Vorstellungen verbunden war. Verkörperte sich nicht Zeus in einem weißen Stier? Trugen nicht die katholischen Priester unter dem Meßgewand ein der antiken weißen Tunika nachempfundenes Chorhemd, genannt die Albe, die als Taufhemd die Zugehörigkeit der Offizianten zum corpus Christi symbolisierte? Gingen in den Visionen des Johannes von Patmos die Erlösten nicht weißgekleidet in die Ewigkeit ein, auf kollegialem Fuß mit den weißgeflügelten Boten? Und hieß es nicht von jenem, »der aussah wie ein Mensch«, dem verewigten Sohn mit dem aus dem Mund ragenden Schwert, sein Haupt und sein Haar sei weiß gewesen »wie Wolle, leuchtend weiß wie Schnee« (Apk 1,49)? Dennoch, so versichert der Erzähler, lauere »etwas schemenhaft Unfaßbares im tiefsten Sinn dieser Färbung«.[9] »Dieses Unfaßbare« sei »die Ursache«, »warum die Vorstellung des Weißen, wenn es aus freundlicheren Beziehungen gelöst und mit etwas an sich Entsetzlichem gepaart erscheint, das Entsetzen bis zum höchsten Grade steigert«,[10] mag es auch lange Zeit als »das bedeutsamste Symbol geistiger Dinge« gedient haben.
»Ist es, weil das wesenlose Weiß an die frostig leeren, die unermeßlichen Räume des Weltalls gemahnt und weil uns deshalb der Dolch des Gedankens an Auflösung und Nichts heimtückisch durch die Seele fährt, wenn wir die weißen Abgründe der Milchstraße betrachten? Oder ist es, weil Weiß im Grunde nicht so sehr eine Farbe als die sichtbare Abwesenheit jeder Farbe und gleichzeitig die Summe aller Farben ist; weil daher eine weite Schneelandschaft uns so inhaltlos schweigt und so bedeutungsschwer redet: eine farblose, allfarbige Welt ohne Gott [a colourless, all-colour of atheism], vor der wir zurückbeben?«
Folglich:
»[W]enn wir dies alles erwägen, dann liegt das Weltall gelähmt und aussätzig vor uns«.
Wer ungeschützt auf die mächtige Gegenwart der unerträglichen Allfarbe sich einließe wie ein leichtsinniger Reisender in Lappland, der auf die Sonnenbrille verzichten wollte,
»starrt […] sich blind an dem unendlichen weißen Leichentuch, das rings alles Sichtbare umhüllt«.[11]
In der höhnischen Außerordentlichkeit der Albino-Kreatur, die durch die Ozeane kreuzt, leuchtet, wie mit der Gewalt des Zum-letzten-Mal, das Hierarchiegefühl der alteuropäischen Farbenmetaphysik auf, invertiert und auf die Spitze des Bösen gestellt. Weiß ist nicht mehr die Summe des Schönen; zum Unheimlichen erhöht, ist es des Schrecklichen Anfang, Mitte und Ende. Seinen ersten großen Auftritt hatte es in Edgar Allan Poes Roman Die Erzählung des Arthur Gordon Pym aus Nantucket (1838), als eine schneeweiß verhüllte Riesengestalt vor dem in den antarktischen Abgrund stürzenden Schiff auftauchte. Melvilles spätmetaphysisch appretiertes Pathos nimmt die Sorge Nietzsches um den guten Gebrauch der Umwertung aller Werte vorweg: Auch der Amerikaner zur See redet noch einer Polumkehrung ohne Nachlassen der Höhenspannung das Wort. Er antwortet, freiwillig ungeheilt von der transzendenten Neurose Alteuropas, auf den althergebrachten metaphysischen Zug von oben. Der übersetzt sich in ein Zurückschrecken vor unlebbarer Höhe.
Im weiteren sollte sich zeigen, wie umweglos Umwertungen in Abwertungen münden und wie leicht statt alternativer Hochspannungen Enthemmungen, Entlastungen und Erleichterungen aufkamen, die die Räume unter sich aufteilen. In der nachmetaphysisch »präzisierten Welt«[12] stellen die Verhältnisse sich dar, als sei der Ratschlag aus Walter Serners Handbrevier für Hochstapler – »Banalisiere die Dinge und du wirst Erfolg ernten und Chancen säen«[13] – auf breiter Front rezipiert worden.
Entsymbolisierung und Enthierarchisierung haben der alten Farbenordnung ihre Gehalte entzogen und ihre Gewalt neutralisiert. Das Nebeneinander der Farbtöne erweist sich als eines der Felder, auf denen alles geht. Die flachen Hierarchien des guten Geschmacks erleichtern das Leben und Geltenlassen. Wie Konstellationen machen Saisonfarben geneigt, sie zwingen nicht. Sie verbreiten sich im Modus milder Infektionen, sie vermischen sich leicht und bringen den überdrußgetriebenen Wandel voran. Am liebsten verstünde sich die scheinentspannte Welt als das Reich der freien Spektren, in denen alles an alles grenzt. Eine Deklaration wie die des De-Stijl-Gründers Theo van Doesburg, wonach Weiß »die spirituelle Farbe unserer Zeit« sei, klang schon im Jahr 1929 so monomanisch wie anachronistisch, wenn sie auch nicht ganz so kunstmessianisch versessen war wie Yves Kleins (1928-1962) Vorschlag an die Internationale Atomenergiebehörde, Kernwaffen sollten künftig so gebaut werden, daß sie Atompilze in seinem patentierten Yves-Klein-Blau hervorbrächten.
Die polychrome Idylle trügt; die zur Durchmischung einladende Liberalität der Moderne kann die erwünschte Regenbogengesellschaft nicht erzwingen. Zugleich ist es für Entmischung und reinfarbige Identitäten zu spät. Aus der Summe der Einzelfarben entsteht, wie Experimente zeigen, keine leuchtende Allfarbe, vielmehr ergibt sich ein stumpfes bräunliches Grau. Von Melvilles Weiß ist keine Rede mehr. Dreckfarbigkeit bildet das unumgängliche Resultat der postmodernen Mixophilie. Indem sie dies ausspricht, stellt die aktuelle Farbenlehre ein starkes pro nobis an ihren Anfang. Grau ist der maßgebliche Farbwert der Gegenwart. In tausend Stufen deklinierbar, erschreckt diese Farbe ihre Betrachter nicht mehr wie vormals die weiße Dämonie, doch besitzt sie auch nicht die mobilisierende Kraft, die dem Roten und Schwarzen in den Tagen ihrer hohen Attraktorstärke zukam.
Was bei Pigmentmischungen entsteht, hatte schon Newton unverblümt niedergeschrieben, und Goethe übersetzt hier die Prosa seines Kontrahenten (dem er die Behauptung nicht verzeiht, das weiße Licht sei aus den Spektralfarben »zusammengesetzt«) mit grimmigem Entzücken: Der Mischung entspringt, um Newtons Ausdrücke wiederzugeben, etwas, das »mäusefarben, aschfarben, etwa steinfarben oder wie Mörtel, Staub oder Straßenkot […] und dergleichen« vor Augen liegt.[14] Keine Politik der Pigmente wird Graues aus seiner Lethargie reißen, wenn sie auch neugrüne oder altrote Kokarden aufsteckt. Jenseits von Gefallen und Mißfallen gibt Grau den Zeitgenossen unserer Tage die farblose Allfarbe der entfremdeten Freiheit zu sehen.
1. Das Ge-gräu: Platons Höhlenlicht, Hegels Dämmerung, Heideggers Nebel
»Solange man das Grau nicht gedacht hat, ist man kein Philosoph.« Naturgemäß bedeutet es einen Unterschied, ob man dergleichen bei einer metropolitanen Vernissage äußert oder im Eröffnungsvortrag eines Philosophenkongresses in Cambridge. Im ersten Fall darf man das zustimmende Lächeln der Nicht-Betroffenen in Rechnung stellen. Mit Genugtuung nähmen die amüsierten Galeriebesucher wahr, wie andere Leute hier an Maßstäben gemessen werden, denen diese wohl nicht genügen. Tant pis pour eux. Die Anwesenden verstehen mit einem Mal, das Glas Prosecco in der Hand, warum ihnen die Lehren der meisten sogenannten Philosophen, tot oder am Leben, seit je wenig bedeuten wollten. Beim Anblick der Rücken ihrer Bücher braucht niemand mehr ein schlechtes Gewissen zu haben. Grau ist der sie bedeckende Staub, der ihnen inneren Wert und Aktualität abspricht, und dies, wie man erfährt, zu Recht, da die Verfasser das Grau nicht gedacht haben.
Die Anwesenden räumen ein, daß einige Plein-Air-Denker unter den Philosophen die Ausnahmen bildeten. Nietzsche wußte, worum es ging, als er vor den Gedanken warnte, die nicht beim Gehen im Freien konzipiert wurden. Wenn Merleau-Ponty die »glückselige Welt der Dinge und ihren Gott, die Sonne«,[15] beschwor, war auch er wohl auf einem guten Weg. Ebenso Rilke, als er sich vor dem archaischen Torso Apolls unter den Antiken des Louvre von einer Stimme aus altgrauem Stein angerufen fühlte: »Du mußt dein Leben ändern«; Rilke freilich, wurde er auch von einem Denker wie Heidegger respektvoll zitiert, war weniger Philosoph als ein Sänger unaussprechlicher Schwingungen.
Immerhin, auch leicht dahingesprochene Worte bewirken gelegentlich folgenreiche Dinge. Aus dem herablassenden Lächeln entsteht für diesmal die Kontur einer Einsicht: Die Bewerber zur philosophischen Fakultät hätten, um zu werden, wie ihr Metier von ihnen fordert, sich – um auf Cézanne zu hören – vor dem Mont Sainte-Victoire niederlassen sollen, um dem Vortrag des Bergs über das Flimmern des provenzalischen Lichts, die Nuancen farbigen Graus und das massive Dastehen des felsigen An-sich in hellichter Entzogenheit zu folgen.
Auf einem Philosophenkongreß vorgebracht, dürfte die These, erst der Grau-Gedanke mache den Philosophen, wirken wie die Axt, die das Eis des Konsensus spaltet. Als unerläutertes Behauptungsereignis hingestellt, ist sie, bevor Rechtfertigungen ihr zu Hilfe kommen, von unmittelbarer Absurdität – gehörlähmend und wie von allen vernünftigen Verbindungen abgeschnitten. Die Einigkeit, im Wesentlichen uneinig zu sein, ohne welche solche Synoden nicht zustande kämen, müßte nach dem Ertönen der These binnen weniger Sekunden zerfallen. Einige würden meinen, eine ausgeklügelte Provokation gehört zu haben, und quasi souverän in sich hineinlachen; andere, heftiger irritiert, rollten das Programmheft zur Tagung so nervös zusammen, daß Anhänger von Konrad Lorenz Gelegenheit erhielten, die Theorie der Übersprunghandlungen an einer nicht-alltäglichen Personengruppe zu überprüfen. Beobachter neo-pawlowscher Schule fänden ihre Vermutung bestätigt, bei Angehörigen von Reflexionsberufen seien die bedingten Reflexe besonders robust ausgeprägt, ja bis zur Vorhersagbarkeit eingeschliffen.
Angesichts der Exzessivität des Satzes über das Grau als wesentliche Denkaufgabe für Philosophen sortiert sich das Publikum spontan entlang einer Unterscheidung, die sich wie eine selbstwahrmachende Anwendung von Fichtes Lehrsatz bewährt, wonach, was für eine Philosophie man wähle, davon abhänge, was für ein Mensch man sei. Fichtes Unterscheidung zwischen den Liebhabern der Freiheit und den Deterministen, die sich in allem auf die äußeren Umstände hinausreden, kleidet sich für diesmal in den Gegensatz zwischen Leuten, die eher frontal zu reagieren gewohnt sind, und denen, die sich im lateralen Denken üben. Die Gruppe der Frontalisten setzt sich zusammen aus Hörern, die sich in allen diskutablen Fragen zum sic et non bekennen. Sie sehen in der intentio recta den jederzeit gebotenen Stil redlichen Argumentierens. Im aktuellen Fall äußerte sich dies dadurch, daß sie, minimal höflich, wie britisch geschulte Debattierer zu sein pflegen, zu dem Urteil kommen, sie hätten Nonsense vernommen, zudem solchen, von dem sich beim besten Willen nicht sagen lasse, er sei elegant. Ihre Diskursethik schreibt vor, dem Unsinn keine Chance zu geben. Die vorgebrachte These sei so abwegig, daß auf sie das Prädikat not even wrong anzuwenden sei.
Die Gruppe der Lateralisten umfaßt die historisch und psychologisch geschulten Gelehrten, für die es bezeichnend ist, in gedanklichen wie in praktischen Dingen der intentio obliqua den Vorzug einzuräumen. Ihnen erscheint es weniger wichtig zu untersuchen, ob etwas Gesagtes richtig ist, als vielmehr wie ein Sprecher dazu komme, es zu sagen. Erfahrung bestätigt ihnen, keine Irrlehre sei je vom Himmel gefallen und jedes noch so erratische Satzereignis sei irgendwie interdiskursiv und subsymbolisch vernetzt. Seit Vernetzungen den Begründungen den Rang ablaufen, ist es ratsam, in der Abwegigkeit eine Anderswegigkeit zu vermuten. Dank lateraler Logik kann jedes noch so verirrte Schaf mit der sinnträchtigen Herde vermittelt werden. Kein Irrtum muß ungeheilt und einsam bleiben. Für die der Obliquität Verpflichteten scheint es naheliegend, in der Vita des Referenten nachzuschauen, ob er vielleicht in jüngerer Zeit zum Dadaismus oder über Synästhesien publiziert hat. Verdient der Unsinn auch keine Unterstützung, hat er doch Umfeld und vielleicht Methode.
Der Redner selbst, wie wird er sich aus der Affäre ziehen? »Solange man das Grau noch nicht gedacht hat, ist man kein Philosoph.« Wer eine solche These im Angesicht einer Versammlung von Leuten ausspricht, die auf den Vorwurf, sie hätten das Grau im Denken versäumt, unmöglich gefaßt sein konnten, löst fürs erste seine jähe Vereinsamung aus. Du hast das Nichtwissen, das Nichtkönnen und das Nichtwollen in diversen Fronten des Unbehagens dir gegenüber. Während die eine Fraktion im Saal dir ihre Verachtung offeriert, hat die andere ein Therapieangebot für dich in petto, eine dritte denkt, du solltest das Fach wechseln. Vielleicht fällt dir rechtzeitig jene Figur in Christian Friedrich Grabbes Stück Herzog Theodor von Gothland (1822) ein, die in aussichtsloser Situation den Ausspruch tut: »und nichts als nur die Verzweiflung kann uns retten«.
Angesichts der manifesten Verlegenheit läßt sich die Insistenz auf der Behauptung, es sei das gedachte Grau, das den Philosophen mache, nur aufrechterhalten, indem man eine überbrückende Alternative aufstellt: Entweder hat man sich in den Philosophen, bei denen sich zum Grau nichts findet, getäuscht und sie mit halber Arbeit davonkommen lassen; oder sie müssen sich, weil sie und insofern sie Philosophen waren, zum Grau geäußert haben – wobei man einzuräumen hätte, dies könne bei ihnen zunächst nur indirekt und implizit geschehen sein. Von der Forderung, der Grau-Gedanke müsse in ihren Denkspielen schon mitgewirkt haben, darf man nicht abrücken, wenn auch der ausgesprochene Begriff bei den Betroffenen fehlte. Diese Konzession schließt die Forderung ein, es müsse manchen Problemgebieten und Sachgehalten relevanter Konzepte von heute ein virtuelles Vorleben, ein Verharren im Sinnschatten älterer Wörter zugesprochen werden, wenn auch die Klarbegriffe oft erst später zum Dasein erwachten.
Um eines der eminentesten Exempel aufzugreifen: Es kann ja nicht sein, daß die im modernen Schlüsselthema »Subjektivität« verhandelten Sachverhalte – Sokrates zum Trotz – über weit mehr als zweitausend Jahre gänzlich inexistent gewesen wären, obgleich erweisbar ist, Experten der Ideengeschichte bestätigen es, daß sie erstmals in Fichtes Bemühungen um die Klärung seiner »ursprünglichen Einsicht« nach 1794 unvergeßlich deutlich ausgesprochen wurden; nicht ohne Grund hat der Gründer der Neuen Phänomenologie, Hermann Schmitz (1928-2021), neben Heidegger der größte, wenn auch weithin unbekannt gebliebene Denker des 20. Jahrhunderts auf deutschem Boden, Fichte einen »Schicksalsmann« genannt. Das Zugeständnis einer »Präexistenz« von Problemen in der Latenz wird durch ein schwaches, doch subtil wirkungsvolles logisches und stoffliches Kontinuitäts- und Verträglichkeitsmotiv erzwungen, das sich in der Abfolge notwendiger und zufälliger Ideenäußerungen so gut wie allenthalben geltend macht. Man kann es als den »Grundsatz der zunehmenden Explizitheit« fassen. Wenn er auch selten affirmativ behandelt wird – am prominentesten in Hegels Doktrin von der »Arbeit des Begriffs« und in Ernst Blochs von Schellings Naturideen inspirierten Studien über Kategorien des »Herausbringens«[16] –, müßte ohne die Unterstellung seiner Geltung der größte Teil zeitlich aufeinanderfolgender geistesgeschichtlich relevanter Formulierungskomplexe, vulgo »Theorien«, im Halbdunkel der Archive verdämmern und dem Zufall blinder Sprünge von einem »Paradigma« zum folgenden ausgeliefert bleiben. Das Prinzip Explizitmachung übergreift summa summarum sämtliche Fokusverschiebungen, die das rationale Kerngeschehen der sogenannten »Paradigmenwechsel« bilden.
Um Analoges an einem zweiten Großmotiv »kontinentaler« Philosophie im 20. Jahrhundert zu erläutern: Man kommt nicht umhin anzunehmen, das menschliche Dasein sei von jeher in Stimmungen – Angst, Langeweile, Schwermut, Zuversicht – eingetaucht gewesen, die die Modi seines In-der-Welt-Seins färben; gleichwohl findet sich in den Annalen des Denkens vor Heideggers Interventionen ab 1927 zu ihnen so gut wie nichts Brauchbares.[17] Kein akademischer Kopf zuvor war auf die Behauptung gefaßt: »Wir müssen ontologisch grundsätzlich die primäre Entdeckung der Welt der ›bloßen Stimmung‹ überlassen.«[18] Wenn aber schon die Alten mit typologischer Tendenz vom »lachenden Demokrit« und vom »weinenden Heraklit« sprachen, verrieten sie einen Sinn für Tönungen des Denkens durch »Stimmungen« ante litteram.
Entsprechendes ist von einem dritten Großmotiv des neueren Denkens, der Frage nach dem anderen, zu sagen. Aus der Tatsache, daß vor Fichte und Feuerbach noch nie ein namhafter Denker nach dem Wesen von Du-Subjektivität sich expressis verbis erkundigt hatte und daß erst im 20. Jahrhundert postegologische Diskurse über Ich und Du auftauchten,[19] kann unmöglich gefolgert werden, man habe früher von der Koexistenz mit Andersbeseeltem, Andersbegeistertem, Anderswilligem nichts gewußt. Und daß – um ein viertes Motiv anzudeuten – das Nachdenken über das moralische Verhältnis von Menschen zu ihresgleichen und zu den ihnen anvertrauten sachlichen Aufgaben bis an die Schwelle des 20. Jahrhunderts, so erstaunlich es klingt, ohne das Wort »Verantwortung« auskam, sollte niemanden zu der Auffassung verleiten, in den zweieinhalbtausend Jahren, als das Denken von Ionien nach Jena wanderte, sei verantwortungslos gedacht und empfunden worden. Im Gegenteil sollte man überzeugt sein, das im modernen Terminus Gemeinte muß in früheren Epochen unter anderen begrifflichen Beleuchtungen und praktischen Zugriffswinkeln für vormalige Verhältnisse mehr oder weniger angemessen artikuliert gewesen sein.
Daß diese Rede etwas lang ausfällt, rechtfertigt nicht den Schluß auf die Kürze ihres Sinns. So wahr Platon, Hegel und Heidegger Philosophen gewesen sind – das Beiwort »wirkliche« wäre anmaßend –, so unvermeidlich ist die Annahme, der obigen These gemäß, bei ihnen sei das Grau vorgedacht worden, obschon mit der Einschränkung, es könne vorerst nur im Modus einer Approximation geschehen sein, das heißt in virtuellen Projektionen, deren Sachgehalte anders gefaltet, in anderem Winkel angeschnitten, mit anderer Dichte geknäuelt auftauchten – nüchterner gesagt: heterodiskursiv, in Vorschein-trächtigen Zeichen dem noch nicht gesagten Schon-zu-Sagenden auf der Spur.
Wer Platon für einen Philosophen hält, ja wer, mehr noch, bereit ist, der Schulmeinung folgend in ihm den Gründer der philosophia zu sehen, dem Wort wie der Sache nach, und wer sich nicht dagegen sträubt, die Substanzen und die Akzidentien alteuropäischen Philosophierens als eine Serie von Fußnoten zu Platon zu resümieren, um Whiteheads semihumoristisches Bonmot noch einmal aufzugreifen, ehe es definitiv verbraucht ist, muß auf die kritische Stelle zeigen, an der Platon das Graue ins Denken einführt.
Gibt es eine solche Stelle denn überhaupt? Falls sie sich bestimmen ließe, ist es vorstellbar, man habe sie mehr als zwei Jahrtausende lang überlesen? Warum ist in den Lexika der antiken Philosophie und den Indices zu Platons Wortschatz kein Eintrag zum Ausdruck »grau« zu finden? Wie es bei den bestversteckten Dingen vorkommt,[20] verbirgt sich das Gesuchte an der Oberfläche, wo niemand es vermutet. Es liegt in der exponiertesten Passage des meistgelesenen Werks hellenischer Klassik offen zutage, ohne daß je ein Exeget es der Mühe wert gefunden hätte, sich ihm mit der gebotenen Ausführlichkeit zuzuwenden.
Es genügt, das Höhlengleichnis aus dem 7. Buch der Politeia zu rekapitulieren, um nach wenigen Sätzen auf den frühesten Diskurs über das Grau, genauer: das Dunkelgrau, zu stoßen, das den gewöhnlichen Illusionsbenutzern die Welt bedeutet. Die Bestandteile des Gleichnis-Arrangements sind in Umrissen noch allgemein bekannt. Da sind zunächst die Gefangenen in der Höhle, mit Absicht so gefesselt, daß sie nur nach vorn schauen können; da ist das große Feuer im hinteren Höhlengrund, das analog zur Lampe in einem Filmprojektor funktioniert; dann die teils redenden, teils stummen Träger, die im Rücken des Publikums vielfältige Objekte vor dem Feuer so vorübertragen, daß man sie selbst, die Träger, nicht bemerkt, sondern nur die Dinge, die sie nach oben halten; und schließlich ist da die vorne gelegene Höhlenwand, auf welche die Gefesselten nolens volens unverwandt starren, zum einen, weil sie absichtlich immobilisiert sind, zum anderen, weil sie nichts Besseres kennen als die Schattenspiele vor ihren Blicken. Daß die Wand steingrau gewesen sein könnte, spielt für das Folgende eine untergeordnete, doch nicht ganz belanglose Rolle. Die Farbe Grau kommt nicht durch die vom fernen Feuer mäßig angeleuchtete Wand ins Spiel – sie könnte auch rötlich, bläulich, bräunlich oder silbern getönt sein –, sondern durch die Erscheinungen, die auf ihr dank der Aktivitäten der obskuren Träger ruhelos vorbeiwandern.
Die Erscheinungen an der Wand heißen bei Platon Schatten, skiai. So hatte Homer, Jahrhunderte zuvor, die entkörperten Phantome der Verstorbenen in der Unterwelt genannt, die dem Helden auf seiner Hadesfahrt begegneten. Schatten sind es nun auch, die sich in Platons Urszene philosophischer Erkenntniskritik auf der Höhlenwand bewegen. Es sind die Schatten, die den Unwissenden die Welt bedeuten. Kaum kann man der Vermutung sich entziehen, Platon habe mutwillig die homerische Unterwelt in die athenische Lebenswelt zitiert. Angewidert vom doxischen Wahnleben der Stadt nach einem fast dreißigjährigen Krieg, setzt der Philosoph seine Mitwelt nahezu mit einem Totenreich gleich. Als letzter Aristokrat und erster Denker von Profession möchte er aus diesem bürgerlichen Hades zurückkehren in eine wahrhaft gültige Tageswelt über dem Getümmel, in die noetische Welt, in der die Urbilder und die Ideen den immerwährenden Reichstag des Seins abhalten.
Was Schatten sind, auch ohne Unterweltbezug, war den Hellenen kein Geheimnis. Tagschatten entstehen und werden augenfällig, wenn Körper dem Licht den Weg versperren. Daher die Redewendung: Körper »werfen« Schatten – wobei die Undurchlässigkeit der Körper, ihre Nicht-Transparenz, als deren natürliche Mitgift veranschlagt wird. Besser wäre es zu sagen, sie werfen sich mit ihrer Massivität dem Licht in den Weg. Die Spuren der Lichtfortgangsverhinderung fallen als Schatten auf.
Licht scheint der Inbegriff von Nachgiebigkeit zu sein; vom erstbesten Körper läßt es sich auf seiner geraden Strahlenreise anhalten. Es übereignet der Vorderseite des Körpers die Dosis an Helligkeit, die sie sich zu nehmen fähig ist. Schatten markieren die Umrisse der Dinge, die das Licht stehlen – Platon vermeidet es, der Frage nachzugehen, ob das Licht nicht von sich her auf Gestohlenwerden aus ist, damit es seine sichtbarmachende Kraft am Widerstand beweise.[21]
Wie dem auch sei, die Rückseiten der diebisch opaken Körper geben nur Nicht-Licht weiter, falls man von Weitergabe sprechen darf. Die Felder der Nichtweitergabe werden als Schatten sichtbar. Dies freilich setzt voraus, es sei eine flächig sich ausbreitende Lichtquelle vorhanden, um am Hindernis vorbeizustrahlen, so daß die abgedunkelten Felder zu den beleuchteten Flächen in Kontrast treten. Gäbe es den diffundierenden Schein vom Feuer im Höhlengrund her nicht, der von der Wand vorne aufgefangen wird, wären alle Schatten schwarz; besser, es gäbe sie nicht mangels Aktualität. Auf einer schwarzen Wand wären schwarze Schatten nicht feststellbar, weil sie den Unterschied, der einen Unterschied »macht«, nicht bewirkten. Zu fragen, was Schatten machen, wenn sie nicht geworfen werden, käme der Frage gleich, was Winde tun, wenn sie nicht wehen. Für letztere kannten die Griechen eine Antwort: Unbeschäftigte Winde tafeln in Aiolos' Palast auf seiner Insel im Tyrrhenischen Meer; was ungeworfene Schatten tun, ist nicht überliefert.[22] Jedoch: Ist die Wand, die überschüssiges Licht vom entfernten Feuer abfängt, felsighell getönt, auch silbermatt, gelblichgrau oder rosafarben, heben die Schatten als dunkelgraue, schwarzgraue Silhouetten sich von ihr ab.
Mithin: Sagt Platon Schatten, skiai, sagt er, ohne es expressis verbis zu sagen, schattenfarbig, einfarbig, unfarbig, lichtbedingt lichtarm oder einfachhin: dunkelgrau. Schatten bedeuten kein Grau ohne Eigenschaften. Den Erscheinungen der schattenfarbigen Welt kommt aufgrund ihrer Gestaltnatur ein gewisses Maß an Erkennbarkeit zu – durch sie haben sie am noetischen Universum Anteil. Tragen die Träger hinter dem Publikum eine Amphore vorbei, wird sie den Zuschauern aufgrund ihrer Gestalt als ein Gefäß dieser Art erkennbar: Die Schattenlinie spricht vage von einer Form, auch wenn diese den Verzerrungen durch die Unebenheit der schattenzeigenden Fläche unterliegt und der flackernden Lichtquelle wegen keine stillstehende und scharfkantige Silhouette aufweisen kann.[23] Doch selbst wenn die opaken Körper ihrer stofflichen Natur nach photophob, ja sogar lichtlos, konfus, dunkel und unerkennbar sind, dem Nichtsein zugewandt, so wird ihr konkretes Dasein durch die Photophilie der Gestalt, die im Schattenumriß sich andeutet, der Erkennbarkeit genähert. Schattige Umrisse sind Grenzlinien zwischen Gestalt und Dunkelheit, graue Vorboten der noetischen Welt. Sie bleiben als vage Zeugen der Gegenstandsform mit der Sphäre des Erkennbaren verbunden.
Platons poetische Theorie des Schattens ließe sich unbemüht als ein Beispiel für philosophische Gleichnisrhetorik in den Bereich der Didaktik abschieben. Man könnte sie sogar als Entgegenkommen der Philosophie zum Alltagsverstand mißdeuten, wäre sie nicht ihrer Tendenz nach destruktiv gegen das triviale Erkennen im ganzen gerichtet. Wenn sie das alltägliche Wahrnehmen der bunten Erscheinungswelt mit der Fixierung an Schattenspiele gleichstellt, übt sie sich in einer Ironie, die das Prädikat »verheerend« verdient.
Was die Sklaven der Wahrnehmungshöhle vor sich haben, ist eine ganz von Materie beherrschte Welt. Sofern ein Rest von Farbigkeit an ihr haftet, so als eine dunkelgraue Resthelligkeit, die knapp vor der völligen Lichtlosigkeit, nahe am Untergang in reiner Schwärze haltmacht. Es waren im übrigen bereits im Altertum die Maler, die den Schatten im Hinblick auf Deformationen und Farbigkeiten mehr Gerechtigkeit widerfahren ließen als die Philosophen, denen am Phänomen der »Löcher im Licht« letztlich nur das Formfeste und das Monochrome etwas zu sagen hatten.[24] Die Maler waren die ersten, die einen praktischen Vorbegriff von der Bedeutung der Schatten für das räumliche Sehen entwickelten.
Die philosophische Farbenlehre setzt mit einem radikal ironischen Präludium ein: Wo Schatten zu sehen sind, bewegen Menschen sich in einer Dunkelgrauzone, die zur Finsternis, zu einer Nacht ohne Gegenteil tendiert. Idealistischer Lehre zufolge ist der Materie jede Teilhabe an Licht, Form, Intelligibilität und Sein abgesprochen; noch Kusanus wird die Materie ein confusum chaos nennen, ein außerhalb aller Struktur und Begreiflichkeit angesiedeltes Fast-Nichts.
Wer nach vollzogener idealistischer Aufklärung – vom hellen Höhlenausgang kommend – in das Reich des Materiellen zurückkehrte, in dem die Mehrheiten hausen, hätte ein mäßig gestuftes Monochrom vor Augen, Schattengrau vor Felswandgrau. Er bekäme es zu tun mit einem Volk von Angeketteten, die obstinat überzeugt sind, sie wüßten genug von allem, was der Fall ist. Weil auch Theorie-Adel verpflichtet, müssen die ersten wirklichen Lehrer – die a priori unvolkstümlichen Dozenten kontraintuitiver Einsichten – sich der Wut der Kavernenleute aussetzen, die um besseres Wissen nicht gebeten haben.
Hätte also Platon nicht die Materie, den Stoff, das Woraus der Dinge, das Aristoteles dann hyle nannte, als das Lichtundurchlässige, als nichtseienden Widerstand gegen das wahrhaft Seiende, als Unbestimmtheit, allenfalls als virtuelle Bestimmbarkeit aufgefaßt und hätte er ihre Reflexe an der Wand nicht als Schatten, als dunkelgraue Abfälle der Sichtbarkeit gedacht, wäre er – es erübrigt sich, es zu sagen – kein Philosoph gewesen.
Klänge die Pointe, Platons Lehre habe auf zweieinhalb Jahrtausende alteuropäischen Denkens ihren »Schatten« geworfen, auch etwas billig, ganz ohne Witz wäre sie nicht. Was man die Neuzeit nennt, ist gekennzeichnet durch eine Summe von Bestrebungen, aus Platons Schatten zu treten. Als antiplatonisches Experiment angelegt, ordnete die Moderne die Verhältnisse von Lichtquelle, beleuchteten Flächen und verdunkelten Zonen von Grund auf verändert an, zumeist inspiriert von neu-aristotelischer Erfahrungsfreudigkeit, nach Descartes auch vom illuminierten Autismus eines Konstruierens aus logischer Evidenz und nach den Enzyklopädisten beflügelt vom Ausgriff in die weite Welt der Lexikoneinträge. Weltkinder jüngerer Jahrhunderte wollten sich nicht mehr einreden lassen, sie seien bloße Schattenseher, nachdem eine stets halb esoterisch auftretende Philosophie, unverbesserlich idealistisch, ihnen zu erklären versucht hatte, wovon die Dinge die Schatten seien. Sie begannen, an ihrer ihnen aus Athen attestierten Schattensichtigkeit zu zweifeln, nicht weniger als an ihrer Erbsündigkeit, für welche bedenkliche Zeugnisse aus Jerusalem, Rom und Hippo vorgelegt worden waren.
Ein allgemeiner Abolitionismus drängte darauf, das kognitive Höhlenleben ebenso wie die politische Sklaverei zu beenden. In plakativen Menschenrechtserklärungen wurde den vormaligen Sklaven des Scheins ein unverlierbarer Anspruch auf Höhlenausgangsfreiheit zugesprochen, mehr noch, es wurde ihnen die Pflicht zum Höhlenverlassen angesonnen.
Nachdem die Freiheitsforderung die Ungeduld als Faktor der großen Politik in die Welt gesetzt hatte, wurde die Zeit reif für die Emergenz des Unterschieds zwischen Revolution und Reform. Das überschwängliche und unmögliche Sofort des Ausgangs aus der Unmündigkeit trieb die Einsicht hervor, wonach an der Freiheit einiges ist, was man sich besser für später aufhebt. Vielleicht darf bereits hier von der Frühgeburt des sozialdemokratischen Habitus aus dem Sinn für Zeitpläne die Rede sein. Die guten Gewohnheiten der Emanzipation bilden sich nicht über Nacht. In fernerer Analogie hierzu hatten sich während der stürmischen Jahre der Französischen Revolution manche Deputierte dafür ausgesprochen, das von den Enragierten geforderte allgemeine Du zwischen den citoyens zurückzustellen, bis die Voraussetzungen für Familiarität nicht bloß in den Clubs, sondern in der sich zivilisierenden Welt im ganzen erfüllt seien. Im Beharren auf höflicher Reserve verbarg sich die Ahnung, wie schnell aus Königsduzern die Königsköpfer hervorgehen.
Die weitere Entwicklung beweist, daß und warum es bei einer privativen Theorie des Grau platonischen Stils nicht bleiben konnte. So wie es unmöglich war, das Böse dauerhaft nur als Abwesenheit des Guten zu begreifen, erwies sich mit der Zeit, daß das Grau nicht nur durch den Raub an der Helligkeit verstanden werden konnte. Dem Bösen einen aktiven Sinn, eine Eigenheit mit Tatkraft, ein Ich des Drangs zur Erniedrigung und Auslöschung von Gegnern und Hindernissen zuzuerkennen war das eine; das Grau als Ergebnis gegeneinander arbeitender Erhellungs- und Abblendungstendenzen, als Leistungsbegriff, als Kompromißphänomen zu denken war das andere.
Als Hauptgutachter in dieser Sache darf man keinen anderen als Hegel vor die Schranke rufen, namentlich den Schule machenden Professor der Berliner Jahre. Bei ihm, dem Meister des Denkens aus dem Elan voranschreitender Explizitmachung des Geistes durch sich selbst, kommt das Grau endlich expressis verbis zu seinem Recht. Falls »Recht« Ausdrücklichkeit bedeutet, fällt das kritische Artikulationsereignis in das Jahr 1821, von dem die Kulturgeschichtsschreibung ansonsten nichts wirklich Unvergeßliches zu berichten hat, es sei denn, man wäre dem Kult großer Männer so zugetan, daß man Napoleons Tod am 15. August auf Sankt Helena und die A-tempo-Modellierung der Büste Goethes durch Christian Daniel Rauch zwischen dem 18. und dem 20. August in Jena nicht unerwähnt lassen möchte.
Das Titelblatt zu Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts trägt die Jahreszahl 1821.[25] Das Buch selbst war bereits im Oktober des Vorjahrs in die Buchläden Berlins und in die Hände der Studenten gelangt.[26] Hegel las vor seiner Hörerschaft vom 25. Oktober 1820 an bis weit ins folgende Jahr über die erste Hälfte des Werks (bis zum Paragraphen 181); fortgesetzt wurden die Vorlesungen vom 24. Oktober 1821 an mit der zweiten Hälfte bis zum Schluß des Textbuchs. Was damals von Oktober zu Oktober und länger vorzutragen war, ergab ein reichlich herbstliches Programm. Gehandelt wurde von der »bürgerlichen Gesellschaft«, von ihrem »System der Bedürfnisse«, ihrer Rechtspflege, ihrer Polizei und ihren Korporationen. Abgeschlossen, wenn auch nicht wirklich gekrönt wurde der Entwurf von einer etwas skandalösen, allzu gutbürgerlichen, überaffirmativen Coda, die man wohl oder übel als Predigt über den goldenen Oktober des Staats hinnehmen muß. Den heute durch Behäbigkeit unerträglichen Finalpassagen[27] wurde ein hochgradig erbauliches, intellektuell blasses und für Hegels Verhältnisse unbegreiflich begriffsarmes Nachspiel über die »Weltgeschichte« (§§ 341-360) hinzugefügt, mit dem der Autor mehr als eklatant gegen sein in jüngeren Jahren erlassenes Dekret verstieß, wonach die Philosophie sich hüten müsse, erbaulich sein zu wollen.[28]
Für das philosophische Denken folgender Generationen erwies es sich als Glücksfall, daß der spätere Hegel oft genug gegen die noch nicht rechtskräftig gewordenen Urteile aus der Zeit seines methodischen und stilistischen Hochgefühls verstieß, nicht zuletzt gegen den Bann über das »vorstellende« Denken und den bildlichen Ausdruck, der von alters her in der schulischen Philosophie kein Hausrecht mehr genießt. In den Erbaulichkeiten, die ihm mit zunehmendem Alter häufiger unterliefen, und bei seinen Ausflügen in die sonst verpönte Bildsprache erwies Hegel sich als Großmeister des nicht-diskursiven Ausdrucks, sogar mit plötzlichen Aufschwüngen zu shakespeareschen Höhen.
Auf dem Gipfel von Hegels Verstößen gegen sein Gesetz der Ausführlichkeit und der Enthaltung von bildlicher Anschauung, am Ende der Vorrede zur Philosophie des Rechts – in der die logischen und polemischen Motive der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes in härterer, etwas machtsüchtigerer, wohl auch angesichts der nach dem Kotzebue-Mord 1819 verschärften Zensur mehrdeutigerer Gestalt wiederauftauchen – finden wir jene, aller Einbettung in gute Gründe zum Trotz, jäh aufragenden Formulierungen, die den Ruhm des Autors bei Zeitgenossen und Späteren als eines unbedingt zu hörenden Zeugen des Bewußtseins für das Existieren in geschichtlich bewegten und nachgeschichtlich stagnierenden Zeiten ausmachen:
»Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden, und mit Grau in Grau läßt sie sich nicht verjüngen, nur erkennen; die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug.«[29]
Die Merkwürdigkeit der vielzitierten Worte folgt aus der offensiven Konfiguration der Farbausdrücke mit dem Namen »Philosophie«. Ohne Umschweife wird das Graue als Eigentum des Philosophierens bestimmt. »Ihr Grau« ist es, das sie malt, und sie setzt den Farbton aus freien Stücken, ungenötigt selbstgewiß, außerhalb der Konkurrenz mit der Grisaillenkunst, von der Hegel kaum mehr gewußt haben dürfte, als daß sie vormals existierte, sei es als ein vergangener Stil der kirchlichen und profanen Ornamentik[30] oder als unscheinbarer Zweig des Aquarells. Mit der Figur »Grau in Grau« verdeutlicht sich der Anspruch der Gedankenkunst auf Zuständigkeit für Graues so weit, als sollte ihr Leben, Weben und Sein im grauen Bereich allgemein und das Herausarbeiten von Graustufen im besonderen das Eigentümliche des Philosophierens ausmachen. Philosophie ist demnach nicht nur der Wille zur Ausführlichkeit, die sich ihre Ankunft im letzten Ergebnis niemals leichtmacht, sie ist nicht nur ständiger Prozeß und immerneue Arbeit des Begriffs am Andrang des Unbegriffenen unter Vermeidung von Überstürzungen, sie muß und möchte überdies zugeben, daß sie Schlußsätze von höchstem Resultatwert hervorbringt, ohne ins Sonntägliche abzugleiten. Solche Sätze treten grau getönt in Erscheinung, besser: in präzisiertem Grau, Grau in Grau. Man schreckt anfangs davor zurück, von einem Systemgrau oder Enzyklopädiegrau zu sprechen, wenngleich die hybriden Ausdrücke sich aufdrängen. Gemeint ist ein bekennendes Grau, das keine Gründe sieht, sich zu verbergen. Wenn Hegel der Philosophie attestiert, am Abend ihres Welttags »ihr Grau in Grau« zu malen, ist der Schluß nicht weit, Grau sei der Inbegriff der Resultatfarbe, wie sie nach Durcharbeitung aller nötigen Vorstufen dem denkenden Auge sich »vorstellt«. Was sich der Vorstellung als Ergebnis anbietet, kommt der Bildlichkeit entgegen, es neigt zur Abbreviatur, ja, es gerinnt zu dem Zitat, mit dem das Ganze in nuce und als Summe gegeben ist.
Hegel hat kein beliebiges Grau gedacht, wie eine nebenbei aufgeraffte Kolorierung, die an zufällig bemerkten Dingen auffiele; dem grauen Hut des Ministers Altenstein und dem diskreten Gehrock des Kollegen Savigny hätte er keine systemrelevante Bedeutung abgewinnen wollen. Vielmehr gab er der »bildlichen«, indirekt begrifflichen Vermutung Raum, im Grau das Milieu, um nicht zu sagen das finale Element des Denkens als solchen zu erkennen. Philosophie malt »ihr« Grau-in-Grau nicht äußerlich anstreichend: Es kommt ihr nicht wie ein von Saisonfarbenschöpfern angenommener Trend zu gedeckten Tönen zu, sie produziert es aus sich selbst, und im Produzieren stellt sie es als Medium der Unterscheidung von Grauem in Grauem heraus. Grau ist die Farbe der Vermittlung, die aus den kämpfenden Extremen ein haltbares Ergebnis in die Welt setzt.
Grau ist nach Hegels erhellendem Diktum nicht nur die Leistungsfarbe der Philosophie, es ist auch Anzeige des Zeitindex, den die gereifte Idee an sich trägt. Reife Philosophie ist wesenhaft späte