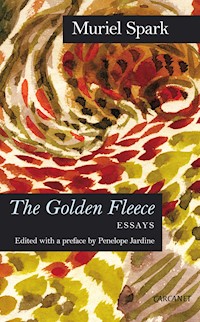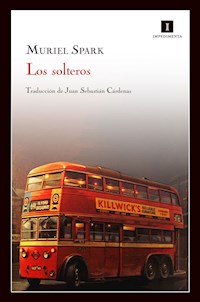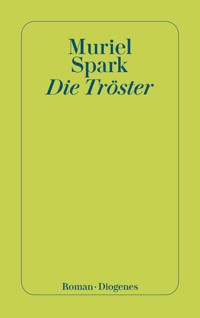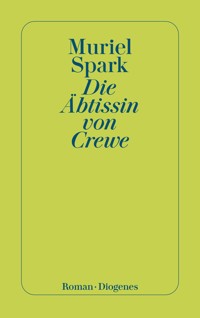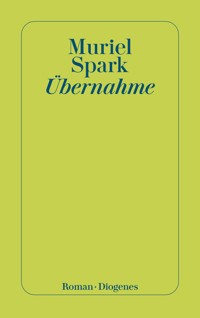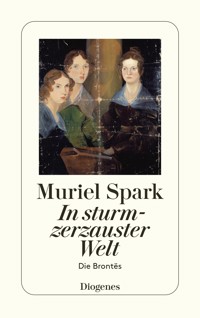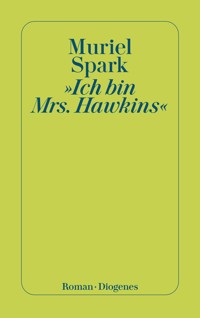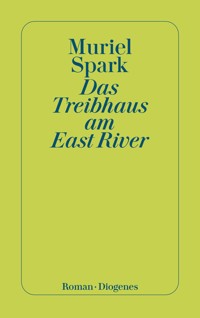7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was sich in den Klassenzimmern eines Internats am Genfersee abspielt, ist äußerst lehrreich. Aber nicht immer lehrplangemäß. ›Der letzte Schliff‹: eine moderne Schulgeschichte, ein amouröser Clinch zweier Jungautoren, eine Mordgeschichte. Ein obsessiver Reigen, in dem nicht nur wichtig ist, wer mit wem schlief, sondern wer wem wie an den Kragen will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Muriel Spark
Der letzte Schliff
Roman
Aus dem Englischen von Hans-Christian Oeser
Diogenes
1
Als erstes«, sagte er, »müssen Sie den Schauplatz festlegen. Sie müssen den Schauplatz vor sich sehen, entweder in der Wirklichkeit oder in der Phantasie. Zum Beispiel hat man von hier aus einen Blick über den See. Aber an einem Tag wie heute hat man keinen Blick über den See, dafür ist es zu neblig. Das andere Ufer sieht man nicht.« Rowland setzte seine Lesebrille ab und musterte die Teilnehmer seines Kurses ›Kreatives Schreiben‹: zwei Jungen und drei Mädchen um die Sechzehn oder Siebzehn, deren Eltern für so etwas ihr Geld ausgaben. »Wenn Sie den Schauplatz festlegen«, sagte er, »müssen Sie also schreiben: ›Das andere Ufer des Sees war nebelverhangen.‹ Oder wenn Sie, an einem Tag wie heute, Ihre Phantasie spielen lassen wollen, können Sie schreiben: ›Das andere Ufer des Sees war eben noch zu sehen.‹ Aber da Sie den Schauplatz erst festlegen, dürfen Sie noch keine Akzente setzen. Beispielsweise ist es noch zu früh, um zu schreiben: ›Wegen des verdammten Nebels konnte man das andere Ufer des Sees nicht sehen.‹ Das kommt erst noch. Sie legen lediglich den Schauplatz fest. Sie wollen noch nicht auf etwas Bestimmtes hinaus.«
Das College Sunrise, eine Art Pensionat für Schüler beiderlei Geschlechts und unterschiedlicher Nationalität, hatte seinen Anfang in Brüssel genommen. Begründet hatte es Rowland Mahler, zusammen mit seiner Frau Nina Parker.
Dank zehn Schülern von sechzehn Jahren aufwärts hatte die Schule, vor allem aufgrund ihres guten Rufes, floriert; dennoch hatte Rowland am Ende des ersten Geschäftsjahres nur mit Mühe und Not eine ausgeglichene Bilanz vorweisen können. Daher verlegte er den Sitz des Instituts nach Wien, erhöhte das Schulgeld und schrieb den Eltern, Nina und er würden ein aufregendes Experiment durchführen: Von nun an sei das College Sunrise eine ›Wanderschule‹, die jedes Jahr an einen anderen Ort ziehen werde.
Im darauffolgenden Jahr waren sie, unter Hinterlassung lobenswert geringer Schulden, von Wien nach Lausanne umgesiedelt. Derzeit bestand das College Sunrise in Ouchy am Genfer See aus neun Schülern. Rowland hatte soeben Unterricht in Kreativem Schreiben erteilt, einem beliebten Fach, das fünf der Schüler gewählt hatten. Inzwischen war Rowland neunundzwanzig, Nina sechsundzwanzig. Rowland machte sich Hoffnungen, eines Tages selbst einen Roman zu veröffentlichen. Um seine, wie er sich ausdrückte, ›schöpferischen Kräfte‹ zu schonen, überließ er fast alle Büroarbeiten Nina, die gut Französisch sprach, sich um die Verwaltungsaufgaben kümmerte und sich mit den Eltern herumschlug, wobei sie eine eindrucksvolle Sorglosigkeit an den Tag legte. Sie neigte dazu, alle genaueren Nachfragen der Eltern im Keim zu ersticken. Seltsamerweise gab diese Haltung den Eltern im allgemeinen das Gefühl, für ihr gutes Geld auch eine entsprechende Leistung zu bekommen. Und noch jedesmal war es ihr gelungen, eine provisorische Genehmigung zum Betreiben der Schule zu erlangen, die mit Ach und Krach so lange verlängert werden konnte, bis sie wieder weiterzogen.
Es war Anfang Juli, aber nicht sommerlich. Der Himmel hing voller dicker Regenwolken. Der See lag schon seit einigen Tagen im Nebel verborgen.
Rowland blickte aus dem breiten Fenster des Klassenzimmers, in dem er unterrichtete, und sah, wie drei der Schüler, die an seinem Kurs teilgenommen hatten, aus dem Haus traten und vom Nebel verschluckt wurden. Es waren Chris Wiley, Lionel Haas und Pansy Leghorn (genannt Leg).
Chris: siebzehn Jahre alt und auf eigenen Wunsch Schüler am College Sunrise. »Auf die Uni kann ich später immer noch gehen.« Und jetzt? »Ich möchte an meinem Roman schreiben. Ich dachte mir, dafür ist das College Sunrise der ideale Ort.« Rowland erinnerte sich an seine erste Unterredung mit dem rothaarigen Chris, dessen Mutter und Onkel. Ein Vater war weit und breit nicht zu sehen. Sie schienen wohlhabend und völlig überzeugt von Chris’ Sicht der Dinge. Rowland nahm ihn auf. Bislang hatte er noch jeden aufgenommen, der sich auf das Institut beworben hatte. Resultat dieser Aufnahmepolitik war die experimentelle und tolerante Atmosphäre, die in der Schule herrschte.
Aber wenden wir uns wieder Chris und seinen beiden Freunden zu, denen Rowland vom Fenster aus nachschaute: Von allen Schülern bereitete Chris ihm die größten Sorgen. Er schrieb an einem Roman, richtig. Auch Rowland schrieb an einem Roman, und er durfte sich nicht anmerken lassen, für wie begabt er Chris hielt. Wie er so aus dem Fenster sah, überkam ihn ein schwacher Anflug jener Eifersucht, die ihn in den kommenden Monaten vollkommen beherrschen und Stunde um frühe Morgenstunde an Heftigkeit zunehmen sollte. Worüber unterhielt sich Chris mit den anderen beiden? Diskutierte er den Unterricht, der hinter ihm lag? Was hätte Rowland nicht darum gegeben, Chris’ Gedanken lesen zu können! Nach außen hin war er Chris ein enger Freund und ihm herzlich zugetan – in gewisser Weise handelte es sich tatsächlich um eine echte Freundschaft. Aber – wo nahm Chris nur seine Begabung her? Er war so selbstbewußt. »Weißt du, Chris«, hatte Rowland gesagt, »ich glaube nicht, daß du auf dem richtigen Weg bist. Vielleicht solltest du den Roman in den Papierkorb werfen und noch einmal von vorn anfangen.«
»Wenn er fertig ist«, hatte Chris erwidert, »könnte ich ihn in den Papierkorb werfen und noch einmal von vorn anfangen. Aber nicht, bevor ich nicht den Roman beendet habe.«
»Und wieso nicht?« hatte Rowland gefragt.
»Ich will sehen, was ich schreibe.«
Rowlands Frau und Kollegin Nina saß an einem großen runden Tisch im Gemeinschaftsraum des College Sunrise. Um den Tisch herum saßen fünf Mädchen: Opal, Mary, Lisa, Joan und Pallas.
»Wo ist Tilly?« fragte Nina.
»Die ist in der Stadt«, antwortete Opal. Tilly hieß allgemein Prinzessin Tilly und war auch als solche im Schulregister eingetragen, doch niemand wußte, Prinzessin von wo oder was. Sie ließ sich nur selten im Unterricht blicken, und Nina ging der Sache nicht weiter nach. Unterrichtsgegenstand war gesellschaftliche Etikette oder, wie Nina es nannte, »comme il faut«.
»Bevor Sie das Institut verlassen, wollen wir Ihnen Schliff beibringen«, setzte Nina den Mädchen auseinander. »Als würde man einem wertvollen Möbelstück den letzten Schliff geben. Emporkömmlinge wie Ihre Eltern (Gott erhalte ihre Bankkonten!) möchten etwas sehen für ihr Geld. Hören Sie zu: In England ißt man Spargel bekanntlich mit den Fingern, doch Inbegriff feiner Manieren im Umgang mit Spargel ist, ihn mit der linken Hand zum Mund zu führen. Kapiert?«
»Meine Eltern sind keine Emporkömmlinge«, entgegnete Pallas. »Mein Vater, Mr. Kapelas, entstammt einer alten Kaufmannsfamilie. Aber meine Mutter ist ungebildet. Allerdings trägt sie teure Kleider.«
»Sitzen Sie denn wenigstens gut?« erkundigte sich die Engländerin Mary Foot, eine angehende junge Dame, blond, mit blauem Kleid und blauen Augen. Ihr ganzer Ehrgeiz war darauf gerichtet, ein Geschäft in einem Dorf aufzumachen und Keramik und hauchdünne Halstücher zu verkaufen. »Alles kommt darauf an, wie etwas sitzt«, erklärte sie. »Man sieht Frauen mit den allerschönsten Kleidern, die aber einfach nicht richtig sitzen.«
»Sie haben ja so recht«, sagte Nina, und Mary liebte ihre Lehrerin dafür nur noch inniger. Kaum jemand ließ Mary wissen, daß sie mit irgend etwas ›ja so recht‹ hatte.
»Weiter«, sagte Nina. »Sollte man Ihnen zum Imbiß ein Kiebitzei anbieten, so wird auch dieses in die Linke genommen. Das habe ich in einem Benimmbuch gelesen; vielleicht war’s auch nur ein Scherz. Jedenfalls kann ich es nachvollziehen: Wenn Sie die Rechte frei haben wollen, um jemandem die Hand zu schütteln, müssen Sie das Kiebitzei in der Linken halten, vorzugsweise in einer gefalteten Papierserviette, denke ich. Vergessen Sie nicht: Für dieses Wissen zahlen Ihre Eltern.«
»Was ist ein Kiebitz?« fragte Pallas.
»Ach, nur so ein Vogel, es gibt eine Menge verschiedener Arten.«
»Ich mag Möwen«, sagte Pallas.
»Bekommen Sie dann Heimweh?« fragte Nina.
»Ja. Bei allem, was mit dem Meer zu tun hat, bekomme ich Sehnsucht nach Griechenland.«
Opal erzählte: »Im kommenden Frühjahr hätten wir eigentlich nach Griechenland fahren wollen, wenn in unserer Familie nicht der Crash passiert wäre.« Der ›Crash‹ war ein Bankrott, der Opals Eltern ins Elend gestürzt hatte – eine Lage, die sie derzeit zu meistern suchten. Womöglich würde Opals Vater ins Gefängnis kommen, so steil war es mit der Familie bergab gegangen. Nina und Rowland hatten sich unverzüglich erboten, Opal am Institut zu behalten, ohne Schulgeld oder Unterhaltskosten zu verlangen – eine Geste, die von der Gesamtheit der Schülerinnen und Schüler sehr begrüßt wurde.
»Gesamtheit …« Als wäre die Schule groß genug gewesen, um von irgendeiner Gesamtheit zu sprechen. Mit den berühmten Internaten und Pensionaten, die Gabbitas, Thring und Wingate in farbigen Hochglanzbroschüren empfahlen, konnte das College Sunrise jedenfalls nicht mithalten. Ja, in einschlägigen pädagogischen Kreisen war das College Sunrise so gut wie nicht bekannt, und wenn, dann bestenfalls als ziemlich zwielichtige Einrichtung. Hinter vorgehaltener Hand wurden vor allem der Mangel an Tennisplätzen, die, sofern vorhanden, schmuddeligen Swimmingpools bekrittelt sowie die Tatsache, daß das Institut von Zeit zu Zeit umzog. Umgekehrt war noch niemandem ein Sittlichkeitsskandal zu Ohren gekommen, und die Schule galt allgemein als progressiv, unkonventionell, kunstsinnig und tolerant. Was die Schüler rauchten oder schnupften, unterschied sich kaum vom Drogenkonsum an anderen Schulen, ob diese ihren Standort nun in Lausanne hatten oder in einer Straße in Wakefield.
Mit insgesamt acht zahlenden Schülern kamen Nina und Rowland knapp über die Runden und machten sogar einen kleinen Gewinn. Sie beschäftigten eine Putzhilfe und eine Köchin, eine Französischlehrerin, die gleichzeitig als Rowlands Sekretärin fungierte, sowie einen gutaussehenden Gärtner, der auch alle anderen anfallenden Aufgaben erledigte. Gemeinsam setzten Nina und Rowland alles daran, Rowland Zeit, Spielraum und Gelegenheit zu geben, seinen Roman zu vollenden, während sie gleichzeitig ihr Leben so angenehm wie möglich dahinbrachten. In Wahrheit liebten sie das Institut.
Der springende Punkt des Unternehmens war jedoch eindeutig Rowlands Roman. Nina glaubte an den Roman und an Rowland als Romancier ebenso wie dieser selbst.
Als Chris mit seinen beiden Begleitern spazierenging, mußte er an den Brief denken, den Rowland seinem Onkel geschrieben hatte. Darin hatte er besonders den Kurs ›Kreatives Schreiben‹ am College Sunrise empfohlen: »Das diesjährige Literaturseminar wird vor allem das Verhältnis zwischen Schreiben und Macht kritisch unter die Lupe nehmen.« Chris war fasziniert von dieser Ankündigung – sie ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Irgendwo hatte er sie doch schon einmal gehört – wo war das gleich gewesen? Als er auf den undurchdringlichen Nebelvorhang über dem See starrte, durchschoß es ihn plötzlich wie ein Lichtstrahl: Mit diesem Satz war für ein Literaturfestival in England geworben worden. Dank seines vorzüglichen Gedächtnisses konnte sich Chris noch genau an den Wortlaut der Broschüre erinnern. Er empfand tiefe Zuneigung zu Rowland, ja fast Fürsorglichkeit. Seine Selbstsicherheit war so ausgeprägt, daß sie nicht weiter auffiel. Er kannte sich. Er spürte seine Begabung. Es war alles nur eine Frage der Zeit und der Übung. Da er selber so ungewöhnlich war, nahm Chris die anderen ebenfalls als ungewöhnlich wahr. Er konnte sich Menschen nicht als Teil einer großen Masse vorstellen, höchstens als Mitglieder der Gesellschaft, die zu organisieren seiner Meinung nach viel einfacher sein mußte, als die Organisatoren immer behaupteten. Sich selbst überlassen, würden die Leute in Harmonie miteinander leben. Also sollte man auch ihn sich selbst überlassen, um – um was zu tun? Na – was immer eben. Es war eine gute Theorie. Vorläufig jedenfalls fand er seinen Tutor Rowland überaus amüsant. Rowland hatte die ersten beiden Kapitel des Romans gelesen, den Chris am Institut zu schreiben beabsichtigte. »Aber das ist ja ganz ausgezeichnet«, hatte Rowland nach der Lektüre des zweiten Kapitels geflüstert, als sei er sprachlos vor Staunen. Chris konnte sich noch an jede Nuance seiner Reaktion erinnern. Rowland hatte das Manuskript durchgelesen. »Bist du sicher«, hatte er dann gefragt, »daß du damit weitermachen willst, oder würdest du lieber …«
»Lieber was?«
Rowland verfolgte den Gedankengang nicht weiter. »Der Dialog«, sagte er, »woher wußtest du, wie man Dialoge …«
»Ach, ich habe halt immer viel gelesen.«
»Oh, verstehe, du liest viel. In einem historischen Roman mußt du … Und was, wie … Hast du vor, ihn zu beenden?«
»Aber ja.«
»Wovon handelt er? Wie wird er sich entwikkeln? Historische Romane – sie müssen sich entwickeln. Wie …?«
»Keine Ahnung, Rowland. Ich kann die Zukunft nicht vorhersagen. Ich weiß nur, daß die Handlung sich schon irgendwie ergeben wird.«
»Und unseren Kurs ›Kreatives Schreiben‹ findest du natürlich hilfreich …«
»Der ist vollkommen irrelevant, aber in anderer Hinsicht ist er ganz nützlich.«
Rowland hatte Angst; er verspürte denselben Stich eifersüchtigen Neids, neidischer Eifersucht wie damals, als er Chris’ Manuskript zum ersten Mal in die Hand genommen und gelesen hatte.
2
Der Roman, an dem Chris schrieb, war schon weiter gediehen, als er Rowland gegenüber zugegeben hatte. Aus einer Art Selbstschutz heraus, verbunden mit dem Wunsch, möglichst viel von dem Schreibseminar zu profitieren, gefiel er sich in vagen Absichtserklärungen. Dabei hatte er die Handlung längst im Kopf.
Gegenstand seines Romans war die Schottenkönigin Maria Stuart, die 1587 wegen angeblicher Teilnahme an einer Verschwörung gegen Elisabeth I. von England enthauptet worden war. Auch des Mordes an ihrem Gatten Lord Darnley zwanzig Jahre zuvor hatte man sie bezichtigt. Fortan fanden sich ebenso viele, die ihre Schuld, wie solche, die ihre Unschuld verfochten. Beide Seiten hatten gute Argumente: die einen behaupteten, Maria und einige ihrer adeligen Gefolgsleute seien an dem Mord beteiligt gewesen, die anderen hielten dagegen, Maria sei unschuldig und das Verbrechen von ihren Gegnern, aufständischen Adeligen, eingefädelt worden.
Chris vertrat eine dritte Position, die im Kern darin bestand, daß er den Verlauf der Ereignisse bis zu jenem Tag zurückverfolgte, an dem eine Gruppe schottischer Edelleute, angeführt von Darnley, in Marias Gemach in Holyrood eindrang, wo sie gerade Karten spielte. Mit ihren Dolchen meuchelten sie David Rizzio, ihren Privatsekretär, Musiker und engen Vertrauten, auf den Darnley außerordentlich eifersüchtig geworden war. Rizzio, begabt, ehrgeizig, war Italiener. Seine Familie stammte aus Turin.
Chris’ Roman zufolge war der Mord an Darnley von Rizzios Familie als Racheakt inszeniert worden. David Rizzio hatte seinen jüngeren Bruder Jacopo, der im Mittelpunkt des Mordkomplotts stand, am Hofe der Königin in Edinburgh eingeführt.
Chris kümmerte es nicht, ob seine Theorie glaubhaft war oder nicht, ihm ging es allein um die gute Story, die sie seiner Ansicht nach hergab. Abgesehen von seiner Originalität, sollte der Roman fesselnd geschrieben sein und eine breite Leserschaft finden.
Rowland, der zu diesem Zeitpunkt von der Handlung noch nichts wußte, hatte die ersten fünfzehn Seiten des Buches eingehend studiert und ein Würgen in der Kehle verspürt. Nein, nein, das kann nicht sein, das ist ja gut, sehr gekonnt. Das kann nicht Chris’ Werk sein – es ist gegen jede Logik, daß dieser Bengel eine solche Szene erfinden kann. Irgend etwas muß danebengehen. Er mußte es mit der Wurzel ausreißen, Einhalt gebieten. Dann dachte er: »O mein Gott! Was denke ich da?«
Auf seinem Weg von Lausanne hinab nach Ouchy kam Chris an einer Reihe Privatvillen vorbei, hinter deren Toren es so still war, daß man denken mochte, es sei niemand anwesend.
Erwartungsvoll näherte er sich dem vierten Haus in der langen Straße. Es stand hinter einer langgestreckten, niedrigen Mauer. Viermal schon war er zu verschiedenen Zeiten an dem Haus vorbeigekommen, und – horch! – sobald er die Mauer passierte, ertönten die Klänge einer Violine, die erst wieder verstummten, wenn er weitergegangen war. Einmal hatte er im oberen Fenster einen flüchtigen Blick auf einen Kopf, eine Schulter erhascht. Er konnte nicht erkennen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte oder wie alt die betreffende Person war. Es war einfach so, daß jemand nach ihm Ausschau hielt, dann auf der Geige ein paar Takte einer unbekannten Melodie spielte und, sobald er das Ende der Mauer erreicht hatte, unvermittelt abbrach.
Es dunkelte. Als er die Eingangshalle des Instituts betrat, hörte er aus Rowlands Fernsehgerät die vertraute Stimme Hazels von Sky News: »Da wir durch den Abend gehen in die Nacht …« Das Wetter in England war warm, vereinzelte Schauer im Südosten und Regen im Norden Schottlands.
Chris versuchte, sich die wenigen Töne der Melodie ins Gedächtnis zurückzurufen, die auf der Violine erklungen war, doch je mehr er sich bemühte, desto weniger wollte sie ihm einfallen. Er beschloß, weiterhin jeden Tag an dem Haus vorbeizugehen, bis er das Rätsel gelöst hätte. Er suchte Rowland auf, um ihm von seinem sonderbaren Erlebnis zu berichten. »Jemand«, sagte er, »der Zeit hat, stundenlang am Fenster zu sitzen und zu warten.«
Rowland hatte den Fernseher leiser gestellt.
»Setz dich«, sagte er.
»Nein, ich muß an meinem Roman weiterarbeiten.«
»Mein Gott, du reibst dich noch ganz auf. Leg doch mal einen Abend eine Pause ein.«
3
Am nächsten Abend gegen neun Uhr gingen Rowland und Chris gemeinsam zu dem geheimnisvollen Haus mit der Geige. Das Tor stand offen, im Vestibül brannte Licht, doch die Fassade lag im Dunkeln. An der Eingangstür war ein glänzend poliertes Messingschild angebracht: »Dr. Israel Brown«.
Auch hinter dem Haus, dem sie sich in der Dunkelheit vorsichtig näherten, fand sich keine Spur eines Bewohners. Doch auf dem Gartenweg, der zur Hinter- und zur Terrassentür führte, gewahrten sie den Schein einer Taschenlampe. Aus dem Dunkel löste sich der Mann, der die Taschenlampe in der Hand hielt, offenbar ein Gärtner oder jemand, der auf das Haus aufpaßte. Er war schon älter und ging gebückt. »Suchen Sie jemanden?« fragte er in waadtländischem Singsang.
»Wir kommen vom College Sunrise«, erklärte Rowland. »Wie ich höre, gibt es in diesem Haus einen Geiger. Ich suche einen Geigenlehrer.«
Der Mann lachte. »Das ist Giovanna, die die Geige spielt«, sagte er. »Sie braucht keinen Job.«
»Wer ist Giovanna?« fragte Chris.
»Giovanna Brown. Ob Sie’s glauben oder nicht, Dr. Browns Tante, auch wenn sie zehn Jahre jünger ist als er. Eine von diesen Geschichten, wie sie in den besten Familien vorkommen.«
»Dann habe ich sie spielen hören«, sagte Chris. »Ich bin zufällig vorbeigekommen. Ein paarmal.«
»Aha.«
»Sind sie weggefahren?« fragte Rowland.
»Ja, sie sind abgereist. Falls Sie eine Nachricht hinterlassen möchten, vormittags kommt eine Putzhilfe.«
»Keine Nachricht«, erwiderte Rowland, »es war nur ein Höflichkeitsbesuch.«
Auf dem Rückweg bemerkte Chris: »Offenbar ist sie ein Krüppel oder hatte einen Unfall, der sie dazu nötigt, den ganzen Tag am Fenster zu sitzen, und so hat sie mir, als ich am Haus vorbeikam, einen Streich gespielt.«
»Was für schwärmerische Ideen du immer hast.«
»Nein, es ist eine logische Vermutung.«
Was es in der Tat war, denn in Wien, wo sie Musik studierte, hatte sich Israel Browns junge Tante in einem Eishockeystadion das Schienbein gebrochen. Sie war zum Haus ihres Neffen in Lausanne geflogen worden, um dort zu genesen. Und tatsächlich hatte sie sich damit vergnügt, immer wenn ihr rothaariges Opfer Chris vorüberkam, an dem Fenster, wo sie täglich mit hochgelegtem Bein saß, ein paar Takte auf ihrer Violine zu spielen.
Doch bislang ahnte weder Chris noch Rowland etwas vom tatsächlichen Verlauf der Dinge. Rowland fragte: »Hast du was genommen?«
»Nein«, antwortete Chris. »Ich rauche und ich schnupfe nicht, wenn ich schreibe. Eigentlich fast nie.«