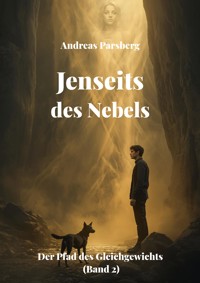4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Spiel der Dämonen
- Sprache: Deutsch
Henri Vogt weiß, dass Zeitreisen keine Flucht sind. Sie sind Prüfungen. Und manche Epochen verlangen mehr als Mut. Sie verlangen Opfer. Gemeinsam mit Chloé wird Henri in eine Zeit zurückgerufen, in der Götter nicht nur angebetet, sondern gefürchtet werden. Oberägypten, nahe dem Tal der Könige, im Jahr 1528 vor Christus. Ein Reich aus Macht, Ritualen und schwarzer Magie, in dem Priester über Leben und Tod entscheiden und der Wille der Götter mit Blut besiegelt wird. Während Henri in den Kerkern und Tempeln des alten Ägypten gefangen wird, gerät Chloé in den Einfluss des Pharaonenhofes. Was als heilender Auftrag beginnt, führt sie mitten hinein in einen uralten Machtkampf zwischen göttlichen Schutzkräften und zerstörerischen Flüchen. Ein falscher Pakt, ein verratener Eid, und das Schicksal eines ganzen Herrscherhauses steht auf dem Spiel. Getrennt voneinander kämpfen Henri und Chloé ums Überleben, verfolgt von Priestern, Dämonen und einer Wahrheit, die älter ist als jede Zeitreise. Erst als sie erkennen, welche Rolle sie selbst im Spiel der Götter einnehmen, begreifen sie, dass diese Reise mehr fordert als ihre Fähigkeiten. Sie fordert ihre Liebe. Und ihre Entscheidung. Denn nicht jeder Pakt wird mit Worten geschlossen. Manche werden mit Seelen besiegelt. Ein atmosphärischer Fantasy-Roman voller ägyptischer Mythologie, dunkler Rituale und einer Zeitreise, die erstmals zwei Schicksale untrennbar verbindet. Mit Der Pakt der Götter erreicht das Spiel der Dämonen eine neue Dimension aus Macht, Opfer und göttlicher Konsequenz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Andreas Parsberg
Der Pakt der Götter
Das Spiel der Dämonen (Band 7)
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Impressum neobooks
1
Die Totengöttin Hel hatte Schedu in den Limbus befohlen, um ihm einen wichtigen Auftrag zu erteilen. Der kleine Dämon war erleichtert gewesen, als er den Befehl ohne Zwischenfälle ausgeführt hatte und nun endlich zurück zum Waverly Hills Sanatorium durfte. Er sehnte sich nach seinen Freunden Ellen und Kate. Ihre Anwesenheit, ihre Stimmen und selbst ihre menschliche Zerbrechlichkeit fehlten ihm mehr, als er es je für möglich gehalten hätte.
Auf dem Weg zurück ins Zwischenreich hatte sich für ihn jedoch etwas zutiefst Ungewöhnliches ereignet. Alexandra, die Tochter der Katzengöttin Bastet, hatte heimlich Kontakt zu ihm aufgenommen. Ihre Stimme war wie ein leises Echo durch die Ebenen geglitten, vorsichtig, bedacht, und sie hatte ihn im Namen von Henri um Hilfe gebeten. Schedu hatte geduldig zugehört. Er mochte Henri. Mehr noch: Er verdankte ihm seine Freiheit, nachdem er über Jahrhunderte hinweg in Vergessenheit und Verbannung gefangen gewesen war. Schedu war kein gewöhnlicher Dämon. Er empfand Dankbarkeit. Er kannte so etwas wie Ehre. Und er wusste, dass er die Freundschaft von Ellen und Kate verlieren würde, wenn er Henri jetzt im Stich ließ.
Also hatte Schedu zugestimmt.
Und genau hier lag sein Problem.
Wie sollte er der Totengöttin Hel entkommen?
Der kleine Dämon umklammerte das schwarze Schwert und hetzte über die weit geschwungene Felsenbrücke. Tief unter ihm brodelte rotglühende Lava, zähflüssig und träge, als hätte selbst das Feuer Mühe, sich zu bewegen. Violette Flammenzungen leckten gierig an den Felswänden empor, nur um im nächsten Augenblick wieder in sich zusammenzufallen. Es blubberte und gurgelte in der Tiefe. Giftgrüne Dämpfe stiegen wie hauchzarte Nebelschleier auf und verwoben sich miteinander.
Doch für all das hatte Schedu keinen Blick übrig. Der koboldartige Dämon war ganz auf sein Ziel fixiert. Der Ausgang aus dem finsteren Reich der Totengöttin lag greifbar nahe. Wurde er auf seiner Flucht gefangen, erwartete ihn die Dämonenfolter. Langsam. Endlos. Mit anschließender Vernichtung.
Hel verzieh niemals.
Niemand verließ ihr Reich freiwillig.
Schedu erreichte das andere Ende der geschwungenen Felsenbrücke. Vor ihm öffneten sich weitere Gänge, schmal und verzweigt, in denen ebenfalls grünliche Dampfschleier hingen. Ohne zu zögern, setzte er zu kraftvollen Sätzen an und jagte weiter.
Da erklang hinter ihm ein kreischender Triumphschrei.
Wie von einem Blitz getroffen, fuhr der kleine Dämon herum und riss sein schwarzes Schwert hoch.
Die Totengöttin Hel war keine zehn Meter von ihm entfernt. Zorn funkelte in ihren Augen, als sie die Arme hob. Mit der Bewegung wirbelte sie schwefelartige Dämpfe auf, die sich wie lebendige Wesen um ihren Körper legten. Dann blickte sie auf Schedu herab und stieß ein wildes, hasserfülltes Gelächter aus.
Mit einer gleitenden, blitzartigen Bewegung zog sie ein goldenes Krummschwert und schwang es über ihrem Kopf. Sie trug einen kunstvoll goldverzierten Helm und ein glänzendes Kettenhemd, das selbst im düsteren Licht unheilvoll schimmerte. Ihr roter Umhang flatterte im heißen Wind. Ihre großen Augen bohrten sich stechend und bösartig in den kleinen Dämon.
Schedu erwartete den Angriff. Er war eiskalt in seinen Handlungen. Angst, wie Menschen sie kannten, war ihm fremd. Als Dämon liefen Gefühlsregungen auf einer anderen Ebene ab, fern von Zittern und Panik.
Hel wollte ihn überrennen, ihn im ersten Angriff kampfunfähig machen. Töten wollte sie ihn nicht. Dafür liebte sie es zu sehr, ihre Opfer leiden zu sehen. Die ewige Dämonenfolter war schlimmer als jeder Tod.
Sie versuchte nicht einmal, ihn mit Worten zur Aufgabe zu bewegen. Mit dem Überqueren der Felsenbrücke hatte Schedu eine Grenze überschritten.
Der kleine Dämon konnte nur reagieren. Sein koboldartiger Körper spannte sich an, Muskeln und Sehnen verhärteten sich. Das schwarze Schwert war leicht erhoben.
Dann war Hel heran.
Die Klinge ihres Krummschwertes sauste durch die Luft, getragen von einer gewaltigen Kraft. Schedu parierte im letzten Augenblick. Die Klingen kratzten kreischend aneinander entlang. Die Wucht des Aufpralls schleuderte ihn zurück. Er taumelte. Seine Hand, sein Arm bis hinauf zur Schulter fühlten sich plötzlich an, als wären sie aus Stein.
Doch er lebte.
Hätte der Hieb ihn voll getroffen, wäre sein Körper in zwei Hälften gespalten worden.
Schedu sprang auf, drehte sich um und rannte auf die labyrinthartigen Gänge zu, die nur wenige Meter entfernt lagen.
Die Totengöttin folgte ihm dichtauf.
„Lauf nur, du Ratte!“, schrie sie höhnisch. „Du wirst mir den Grund deiner Flucht unter der Folter noch sagen. Jeder redet unter meinen Händen!“
Im letzten Augenblick warf sich Schedu wieder herum. Hel griff erneut an. Dichte Schwefeldämpfe umhüllten ihren Körper, während sie das Schwert wie das Zustoßen einer Kobra nach vorne rammte.
Diesmal wich der Dämon aus. Der Schwerthieb ging ins Leere. Kaltblütig riss Schedu die rechte Hand hoch. Die schwarze Klinge flirrte durch die Luft und durchschlug mit einem hässlichen Laut das Kettenhemd der Göttin. Die Wucht schleuderte Hel mehrere Schritte zurück.
Sie rappelte sich auf, stützte sich auf den rechten Ellenbogen und starrte dem fliehenden Dämon nach.
Schedu hatte den Moment genutzt und war in einen seitlichen Gang geflohen. Hatte er die Göttin wirklich verletzt? In ihm wallte Hass auf Hel, die bösartige Wächterin der Totenhalle, die ihn seit Ewigkeiten in ihrem Reich gefangen gehalten hatte.
Angewidert verzog er das Gesicht. Er wusste, wie mächtig sie war. Doch es gab kein Zurück mehr. Er hatte sich entschieden, Henri in Theben zu helfen. Also musste er den eingeschlagenen Weg gehen.
Er machte sich nichts vor. So schnell er auch rannte, noch war er nicht entkommen. Er musste den magischen Dimensionsschacht erreichen, einen kristallinen Aufzug aus schwebenden Steinen. Der einzige Weg aus dem Totenreich. Alexandra hatte ihm versprochen, die richtige Jahreszahl einzustellen.
Schedu biss die Zähne zusammen. Schwarze Schatten huschten über sein Gesicht, ein äußeres Zeichen seiner inneren Erregung. Er rannte weiter durch die engen Gänge. Vor ihm lag ein fernes, unwirkliches, milchiges Licht.
Als er um die nächste Biegung sprang, hüllte ihn violetter Nebel ein. Eisige Kälte verdrängte die glühende Hitze. Klänge hallten wider, hell wie zerberstendes Glas. Der felsige Boden war von breiten Rissen durchzogen, aus denen grüne Dämpfe aufstiegen. Schleimige Flüssigkeiten bildeten schimmernde Pfützen. Die Dämpfe wanden sich wie Schlangen nach oben, griffen nach seinen kurzen Beinen.
Dann tauchte der Dimensionsschacht auf.
Eine rote, wabernde Fläche spannte sich wie ein Spiegel über den gesamten Gang. Schedu beschleunigte seinen Lauf.
Er erreichte das grelle Licht, riss schützend die Hände vors Gesicht und sprang in die erste Kristallkugel. Der runde Stein hüllte ihn in roten Nebel und begann schwebend aufzusteigen. Es brauste und tobte. Ein Höllensturm brach los. Der Lärm war ohrenbetäubend.
Der Kristall raste durch das Nichts, zog einen grellen Kometenschweif hinter sich her. Grauer Nebel brodelte. Schwarze Schatten ballten sich zusammen. Dumpfes Grollen drang aus unvorstellbaren Fernen.
Ein blutroter Schemen jagte durch die Unendlichkeit, schneller als jeder Gedanke.
Schedu hoffte, dass Alexandra die richtigen Einstellungen vorgenommen hatte.
Dann kam der Aufprall.
Wie von einem Blitz gefällt, kippte der Dämon vornüber. Sein Körper zuckte und erzitterte. Der rote Kristall rollte über den heißen Sand der Sahara und blieb am östlichen Nilufer liegen. Mit einem lauten Knall zerbrach er. Schedu purzelte heraus, überschlug sich mehrfach und prallte gegen eine Felswand.
Sein Gesicht war angespannt, die Augen geschlossen. Die Atemzüge waren tief und unregelmäßig. Würgende Geräusche entrangen seiner Kehle. Sein Körper bäumte sich auf, verkrampfte sich. Die Atemzüge verstummten, setzten röchelnd wieder ein.
Dann erbrach sich Schedu.
Er würgte den gesamten Mageninhalt auf den felsigen Boden. Zitternd richtete er sich auf, fluchte und schimpfte innerlich über die Reise. Sein hageres Gesicht verzerrte sich.
Schließlich schüttelte er die letzten Reste der Schwäche ab, stand auf, stolperte vorwärts und fluchte erneut.
Plötzlich herrschte Ruhe. Frieden. Auch in ihm.
Er betrachtete seine Umgebung und wusste, dass er angekommen war.
Vor ihm lagen die Tempelanlagen von Karnak. Die mächtigen Pylone des Tempels des Amun-Re ragten auf. Drei von Mauern umgebene Bezirke bildeten die Anlage: Amun, Month und Apophis. Jeder Bereich unterstand einem Hohepriester.
Der Hohepriester des Amun-Re war Djehuti. Der Hohepriester des Apophis hieß Chandranath. Die Hohepriesterin des Month war Nefertari, die Halbschwester des Pharao Ahmose.
Die drei schlimmsten Feinde Henris waren hier vereint.
Schedu wandte den Kopf, blickte über den sanft fließenden Nil, sah Boote treiben und betrachtete die mächtige Königsstadt Theben mit der gewaltigen Palastanlage auf dem westlichen Nilufer.
Er war im Jahr 1528 v. Chr. gelandet.
Nun musste er nur noch Henri finden.
War sein künftiger Gefährte bereits angekommen?
Plötzlich hörte er Stimmen und Schritte hinter sich. Erschrocken drehte er sich um und erkannte, dass mindestens ein Dutzend Soldaten ihn umringt hatte. Lange Speere und schwere Knüppel blitzten im Licht.
„Verhaftet die Missgeburt!“, schrie ein Mann mit der Stimme eines Anführers. „Solche Kreaturen gehören eingesperrt!“
Schedu wollte davonrennen. Als er den ersten Schritt machte, krachte ein Knüppel auf seinen Kopf.
Augenblicklich verlor er das Bewusstsein!
2
Oberägypthen, Tal der Könige,
45 km von Theben entfernt
1528 v. Chr.
Henri spürte seinen Körper wieder. Er nahm wahr, dass er fühlte, dass er sah, dass er hörte. Diese Rückkehr der Sinne kam abrupt, fast gewaltsam, als würde jemand einen Schalter umlegen.
Sofort versuchte er, sich zu orientieren. Um ihn herum herrschte vollkommene Dunkelheit. Kein Schimmer, kein Glimmen, nicht einmal ein Rest von Licht erreichte seine Augen. Dazu kam eine bedrückende Stille, so dicht und schwer, dass sie fast greifbar wirkte.
Wie in einer riesigen Grabkammer.
Henri brauchte nur wenige Augenblicke, um zu begreifen, dass dieser Gedanke erschreckend präzise war. Er lag auf einem harten, kalten Untergrund, der sich eindeutig als Stein oder Fels anfühlte. Als er die Hände ausstreckte, tastete er links und rechts, dann vorsichtig nach oben. Überall stieß er auf glatte, massive Steinflächen. Er befand sich in einem länglichen, viereckigen Kasten.
In einem Sarkophag!
Die Erkenntnis traf ihn wie ein Schlag. Vieles hatte er in Betracht gezogen, aber nicht, dass Alexandra ihn ausgerechnet in einem Grab hatte ankommen lassen. In einem verschlossenen Steinsarg, tief unter der Erde.
Die entscheidende Frage war nun, wo sich dieser Sarkophag befand.
Noch auf dem Rücken liegend, stemmte Henri beide Hände gegen den Deckel. Einen kurzen Moment verharrte er reglos. Dann drückte er entschlossen gegen die Steinplatte.
Es war Schwerstarbeit. Der Deckel wog nach seiner Einschätzung deutlich mehr als einen Zentner. Millimeter um Millimeter bewegte sich der Stein nach oben. Seine Muskeln brannten, die Sehnen spannten sich schmerzhaft an. Fast eine volle Minute verging, bis er eine schmale, spaltbreite Öffnung geschaffen hatte.
Und dennoch sah er kein Licht. Außerhalb des Sarkophags herrschte dieselbe vollständige Dunkelheit wie in seinem Inneren. Auch die Stille war unverändert, vollkommen und bedrückend. Kein Atemzug, kein Rascheln, kein fernes Geräusch drang an sein Ohr. Er konnte also mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass sich kein menschliches Wesen in unmittelbarer Nähe befand.
Henri bündelte sämtliche Kräfte, die ihm noch zur Verfügung standen, und stemmte sich mit aller Macht gegen den Deckel. Schweiß trat ihm auf die Stirn, seine Arme zitterten vor Anstrengung. Schließlich kippte der Schwerpunkt. Der Rest war vergleichsweise leicht. Der massive Deckel rutschte zur Seite.
Schwer atmend blieb Henri noch einige Sekunden im Sarkophag liegen, um seine verbrauchten Kräfte zu sammeln. Als sich sein Atem wieder halbwegs beruhigt hatte, richtete er sich vorsichtig in eine sitzende Position auf.
Nach wie vor war er von absoluter Dunkelheit und vollkommener Lautlosigkeit umgeben. Er musste sich in einem geschlossenen Raum befinden, irgendwo innerhalb eines Gebäudes oder tief unter der Erde. Nur so ließ sich diese vollkommene Stille erklären, die in ihrer Totalität fast unerträglich war.
„Hallo?“, rief er halblaut.
Keine Antwort. Kein Echo. Seine eigene Stimme klang dumpf und verschluckt. Das bestätigte seine Vermutung, dass er sich in einem allseits umschlossenen Raum befand. Eng, niedrig, massiv.
Langsam richtete Henri sich weiter auf. Wie erwartet stieß er mit den vorgestreckten Händen rasch gegen die Decke des Raumes. Immerhin hatte er genug Platz, um ein Bein über den Rand des Sarkophags zu schwingen. Mit den Zehenspitzen tastete er vorsichtig nach unten, doch er erreichte keinen Boden. Sein Fuß pendelte frei in der Luft.
Sich mit beiden Händen am Rand festhaltend, ließ er sich hinabgleiten. Ganz geräuschlos war die Kletteraktion nicht verlaufen, doch offenbar hatte sie niemanden aufgeschreckt. Die Stille blieb unverändert.
Henri streckte die Hände vor sich aus und begann, den engen Raum Schritt für Schritt zu erkunden. Nach wenigen Schritten stieß er gegen ein hüfthohes Hindernis. Es fühlte sich an wie ein Tisch, auch wenn er sich dessen in der Dunkelheit nicht völlig sicher sein konnte. Als er mit den Händen über die Oberfläche strich, ertastete er verschiedene Gegenstände. Töpfe, Gefäße, etwas Weiches, das sich wie frische Blumen anfühlte, dazu mehrere Utensilien, deren Zweck sich ihm nicht sofort erschloss. Schließlich stieß er auf etwas Unverkennbares: einen Laib Brot und beerenartige Früchte.
In diesem Moment begriff er die Bedeutung dieser Dinge und erschrak zutiefst. Es handelte sich um Totengaben, wie sie im alten Ägypten den Verstorbenen mit ins Grab gelegt wurden.
Das bedeutete, dass er sich tatsächlich in einer Grabkammer befand. Henri war belesen genug, um zu wissen, dass altägyptische Grabanlagen äußerst solide von der Außenwelt abgeschottet waren.
War er lebendig in einer solchen Grabkammer eingemauert?
Was hatte Alexandra hier nur falsch gemacht? Der Gedanke ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Lebendig eingemauert zu sein, war sein größter Alptraum.
Ohne fremde Hilfe würde es ihm kaum möglich sein, dieses steinerne Gefängnis jemals wieder zu verlassen. Fast hektisch setzte Henri sich erneut in Bewegung, tastete die Mauern ab, suchte nach Ritzen, nach verborgenen Mechanismen, nach irgendeinem Hinweis auf einen Ausgang.
Doch er fand nichts.
Die Mauern waren ringsum undurchdringlich. Wuchtige Steinquader, viel zu schwer, um von einem einzelnen Mann auch nur ansatzweise bewegt zu werden, waren präzise auf- und nebeneinander geschichtet. Immerhin gab es schmale Fugen zwischen den Steinen, durch die frische Luft in die Kammer drang. Eine Tür oder irgendeinen Öffnungsmechanismus konnte Henri jedoch nicht entdecken.
Er rief laut um Hilfe. Mehrmals. Seine Stimme hallte nicht einmal wider. Niemand schien in Hörweite zu sein.
Mit großer Mühe kämpfte er die aufsteigende Panik nieder. Schließlich zwang er sich zur Ruhe, setzte sich auf den kalten Steinboden und lehnte sich mit dem Rücken an den Sarkophag.
So schwer es ihm auch fiel, Henri machte sich langsam mit dem Gedanken vertraut, dass er in dieser Grabkammer elendig umkommen würde!
3
Oberägypthen, Nil,
2 km vor Theben
1528 v. Chr.
Chloé von Bartenberg kam zu sich wie nach einem Schlaf, der scheinbar eine Ewigkeit gedauert hatte, und als sie die Augen aufschlug, brauchte sie einen Atemzug zu viel, um zu begreifen, dass sie nicht mehr in der vertrauten Welt war, sondern unter einem dunklen Nachthimmel lag, der sich wie ein schweres Tuch über sie spannte. Die schmale Mondsichel war halb hinter tiefhängenden Wolken verborgen, und die vereinzelten Sterne blinkten in der unendlichen Ferne des Weltraums, als würden sie etwas wissen, das ihr noch fehlte.
Merkwürdige Geräusche drangen an ihre Ohren, ein leises Schwappen von Wasser, das Quaken eines Frosches, das heisere Krächzen eines Vogels, und dazwischen strich ein lauer Wind über ihren Körper, als würde er sie prüfen oder trösten wollen, während der Geruch einer frischen, unverbrauchten Natur auf sie eindrang, feucht, grün und fremd, so als sei die Luft hier noch nicht von Menschen atemwarm gemacht worden.
Als sie sich aufrichtete, hatte das unvorhergesehene Folgen, denn alles um sie herum fing an zu schwanken, und sie musste mit einer plötzlichen, unbeholfenen Anspannung um ihr Gleichgewicht kämpfen, bis sie endlich erkannte, wo sie sich befand, nämlich in einem kleinen, seltsam geformten Boot, das auf einer ruhigen Wasserfläche trieb. Das Schaukeln wurde langsamer, als würde das Boot sich wieder beruhigen, und sitzend hatte Chloé Gelegenheit, sich mit ihrer Umgebung vertraut zu machen, obwohl ihr Herz dabei schneller schlug, als es sollte.
Die Wasserfläche war eindeutig ein Fluss, das erkannte sie an der Strömung, die das Boot unaufhaltsam vorwärtsbewegte, und er musste sehr breit sein, denn sie konnte weder links noch rechts ein Ufer wahrnehmen, während nirgendwo ein Licht brannte und sich keine Konturen einer natürlichen oder künstlichen Landschaft aus dem Dunkel der Nacht schoben. Sie hatte keine Ahnung, wo sie sich befand, und diese Ahnungslosigkeit fühlte sich nicht nach Abenteuer an, sondern nach einem Abgrund, der sich unter ihr auftat.
Immer noch verwundert dachte sie an die vergangene Nacht zurück, und allein dieser Rückblick ließ ihr die Haut prickeln, weil der Besuch einer schwarzen Katze sie völlig aus dem Konzept gebracht hatte, nicht nur wegen der Erscheinung, sondern weil das Tier gesprochen und sich mit einer unheimlichen Selbstverständlichkeit als Alexandra vorgestellt hatte. Die Katzenfrau sprach sehr lange mit ihr, und je länger sie redete, desto schwerer wurde es, das Gehörte als Spinnerei abzutun, denn sie hatte ausführlich von der Seelenfamilie der Ahmosiden berichtet, Alexandra erzählte ihr von Satamun, Amanda, Kate und Engrina, und außerdem von drei gefährlichen Hohepriestern, die ihre Zukunft und das Leben von Henri bedrohten.