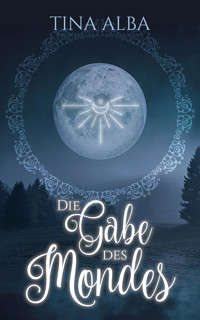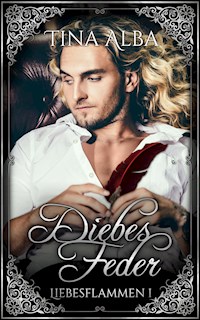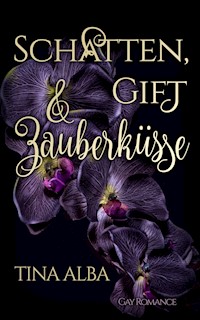4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
1939: Als Selkie-Magier Siever auf den jungen Soldaten Iven trifft, verliebt er sich Hals über Kopf. Er riskiert alles - und verliert. Heute: Nach einem schweren Schicksalsschlag flüchtet der in sich gekehrte und trauernde Joris mit seiner Großmutter nach Juist. Hier findet er nicht nur Ruhe, sondern auch Keno, den Selkie-Jungen mit dem unwiderstehlich frechen Blick. Doch Joris ahnt nicht, dass es in seiner Familie schon einmal eine Verbindung zwischen einem Menschen und einem Selkie gab. Und welch schreckliches Geheimnis der Magier hütet, der seinen Liebsten als Schüler auserwählt hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Der Ruf der SelkiesSpuren durch die Zeit
Tina Alba
Für Regina, ohne die ich mit Siever die Hölle komplett gefeudelt hätte.
Impressum
Tina Alba c/o WirFinden.Es Naß und Hellie GbR Kirchgasse 19 65817 Eppstein
www.tina-alba.de
E-Book-Satz: www.tanja-rast.de/e-book-satz
Cover: Sylvia Ludwig
Grafiken:
Dünenstrand (1757525909): mapman/shutterstock.com
Model (2113636496): Kiselev Andrey Valerevich/shutterstock.com
Robben (1733458016): Alfmaler/shutterstock.com
Schiff (2011315232): SSKH-Pictures/shutterstock.com
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Menschen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
1.Heimaturlaub - Wilhelmshaven, Anfang Dezember 1939
Iven
Der Seehund war wieder da.
Im Dämmerlicht tauchte sein glänzender Kopf aus den Fluten auf, schien auf der graublauen Nordsee zu tanzen. Iven fühlte trotz der Entfernung den Blick aus den dunklen, großen Augen des Tieres, als würde der Seehund ihn beobachten.
Und das nicht zum ersten Mal. Die Begegnung vor einigen Wochen mochte Zufall gewesen sein, Iven erinnerte sich daran, als sei sie erst gestern gewesen. Er hatte Streit gehabt. Am Telefon, das Ivens Wirtin gehörte, die ihm ein kleines Zimmer vermietet hatte, damit er, wenn er an Land war, nicht auf einem der Wohnschiffe hausen musste. Im Einsatz auf See war es schon immer beengt genug, geteilte Kabinen, alles voller Männer, alles voller Anspannung. Wenn er auf dem Stützpunkt war, wollte Iven keinen Stahl um sich haben, nicht ständig über die bestiefelten Füße anderer Marinesoldaten stolpern.
Mit Dini hatte er gestritten, der Frau, die er heiraten würde, falls er es schaffte, unbeschadet aus diesem Weltkriegswahnsinn wieder nach Hause zu kommen. Kurz vor seinem ersten Auslaufen mit einem Schiff der deutschen Kriegsmarine. Es war so banal gewesen. Sie hatten sich wegen des Termins für die Hochzeit in den Haaren gelegen, den Dini unbedingt hatte festlegen wollen – und dann waren ihm die folgenschweren Worte einfach so herausgerutscht: Liebling, lass uns damit warten. Warten, bis der Krieg vorbei ist. Er kann ja nicht ewig dauern, vielleicht ist er bald schon vorbei. Ich möchte doch nur Sicherheit für dich. Auch dass du dir meiner vollkommen sicher bist. Wer weiß denn, ob ich nach meinem nächsten Einsatz überhaupt nach Hause komme? Und falls – wer weiß denn, ob ich dann noch gesund bin? In einem Stück? Ob du mich dann überhaupt noch willst? Du musst versorgt sein. Was, wenn ich in einem Zustand aus dem Krieg zurückkehre, in dem ich das nicht mehr kann?
Iven ballte die Hände zu Fäusten und fluchte stumm. Er hatte gesagt, was er gedacht hatte, und damit seiner Verlobten das Herz zerfetzt. Ihr die Hoffnung geraubt und ihren Traum von einer heilen Welt, von einem sich rasch wieder einstellenden Frieden und Familie, dem Häuschen mit Garten und den Kindern, die dort auf der Wiese Fußball spielten, in Scherben geschlagen.
Sie hatten einander seitdem nicht wiedergesehen und auch nicht miteinander gesprochen. Iven hatte geschrieben, Briefe und Postkarten, zwei jede Woche, mindestens. Er hatte nach Worten gesucht, um sie um Vergebung zu bitten, doch sie stellte sich stur. Er hatte sie gerade deswegen so gern, weil sie wusste, was sie wollte. Besser noch, weil sie wusste, was sie nicht wollte, und das war: ihre Hoffnung verlieren.
Iven konnte es ihr nicht verdenken. In Marienhafe war es noch weitgehend ruhig. Doch die Bedrohung wurde von Tag zu Tag greifbarer. Im September waren die ersten Bomben auf Wilhelmshaven gefallen. Natürlich, wegen der U-Boote und der Kriegsschiffe. Viel war nicht zerstört worden, Iven dankte dem Himmel dafür – doch der Krieg war heftiger, grausamer geworden. Und bald, da war Iven sicher, würde auch Emden ins Blickfeld der Alliierten rücken. Emden war wichtig mit seinen Bahnhöfen, von denen aus Menschen flüchteten und Güter ihre Reise begannen oder vollendeten. Mit seinem Hafen.
Ein kleines Dorf irgendwo im Nirgendwo auf dem Weg nach Norddeich? Eher nicht. In Marienhafe hofften die Menschen, dass es bald vorbei sein würde, obschon auch dort Propagandagebrüll aus Volksempfängern schallte und kriegsverherrlichende Parolen die Schlagzeilen der Tageszeitungen beherrschten.
Iven glaubte nicht, dass es so bald enden würde. Dini klammerte sich an die Hoffnung auf schnellen Frieden. Sie hatten darüber diskutiert, immer wieder, seit dieser verdammte Krieg begonnen hatte.
Iven nahm seine Mütze ab, rieb sich die kurz geschorenen Haare und richtete den Blick wieder auf das Meer. Obwohl es kalt war und grau, das Meer war schön. Immer. In den Abendstunden wirkte es so friedlich. So ruhig. Und dort, wo er stand, hatte er den Stützpunkt und die Schiffe im Rücken, sah nichts als weite graue Nordsee, hatte Sand unter den Stiefeln und konnte in der leicht diesigen Luft die Umrisse der Insel Mellum erkennen. In diesem Augenblick hätte er alles dafür gegeben, wenn er durch die Nebelschleier hätte schwimmen können, um dahinter nicht auf Mellum zu landen, sondern Avalon zu betreten. Hinaus aus dieser entsetzlichen Zeit, in der Krieg die ganze Welt bedrohte, nur weil ein kleiner schnauzbärtiger Mensch voller Machtgier nicht genug bekommen konnte.
Nun blickte er sich doch zum Stützpunkt um, und er schauderte. Was mochte sich in den Räumen befinden, die einfache Marinesoldaten wie er nicht zu betreten hatten? Die Keller, die Forschungseinrichtungen, die Labore, die es überall gab, wo es auch Militär gab? Nun, vielleicht nicht hier im kleinen, ländlichen Ostfriesland. Oder gerade hier?
Iven riss den Blick von den Gebäuden, dem Stacheldraht und den bedrohlich wirkenden Schatten der Kriegsschiffe los und zwang sich, das Meer anzusehen und zu atmen. Die kalte Luft hielt ihn fest im Hier und Jetzt. Sie roch nach Schnee. Vielleicht würde es weiße Weihnachten geben, vielleicht würde er Weihnachten zu Dini fahren und sie in den Arm nehmen, küssen und den ganzen dummen Streit vergessen. Er würde ihre Finger küssen, ganz besonders den, an dem sie den Verlobungsring trug, und dann würde er ihr versprechen, dass er sie heiratete. Sobald der Krieg vorbei war.
Der Seehund war noch immer da. Er zog seine Bahnen, tauchte ab, tauchte wieder auf und blickte Iven aus seinen dunklen Kohleaugen an, als würde er ihn ganz genau beobachten. Und ihm auf den Grund seiner Seele blicken, auf dem noch etwas ruhte, das ihn umtrieb, schon so viele Monate lang. Seit er Soldat war und das erste Mal die Enge einer Kasernenstube gekostet und den Schlafraum mit anderen Kerlen geteilt hatte, war es heftiger geworden – dieses Wissen, dass er nicht nur Frauen wie seine Behrentdine, seine hübsche, liebe, engelsblonde Dini, attraktiv und begehrenswert fand, sondern auch Männer.
Auch darum hatte er sich nach einer Bleibe außerhalb der Wohnschiffe umgesehen, sobald er nicht dazu verpflichtet war, auf irgendeinem Schiff zu sein. Er hatte fortgewollt von all den Männern, und vor allem von denen, die ihn nachts aus verwirrenden Träumen voller verbotener Fantasien aufwachen ließen, schweißgebadet und zitternd vor Erregung.
Er hatte nie mit Dini darüber gesprochen.
Und so, wie die Stimmung zwischen ihnen gerade kochte, würde er wohl auch sehr lange nicht mit ihr darüber reden.
Ich Feigling.
Weihnachten. Zu Weihnachten würde er Dini die Wahrheit zum Geschenk machen und sein Herz vor ihr ausbreiten. Sich verwundbar machen, viel verwundbarer noch, als er es auf dem Zerstörer war, auf dem er diente. Falls er nicht doch wieder in letzter Sekunde den Schwanz einzog.
Iven bückte sich, fuhr mit einer Hand durch den kalten Sand, erwischte einen Stein mit einer unangenehm spitzen Kante, fluchte und schleuderte ihn auf das Meer hinaus. »Scheiße. Ich mache alles kaputt.« Er hatte es versucht, immer wieder. Schreibend. Aber die richtigen Worte, die Dinis zerbrochene Träume hätten kitten können, hatte er bisher nicht gefunden.
Und dann träumte er auch noch jede Nacht von Piet. Seit er ihn im Sommer beim Schwimmen gesehen hatte, splitterfasernackt, draußen in der Nacht. Im Mondlicht, wie albern und romantisch. Nein, kein bisschen romantisch, ich habe ihn bespannt, und ich schäme mich dafür. Er schämte sich noch viel mehr für das, was seine Hand in seinem Schoß angestellt hatte, während er zugesehen hatte, wie Piet sich im Mondlicht am Strand abgetrocknet hatte. »Scheiße«, wiederholte Iven. Er blickte aufs Meer hinaus. Die Sonne ging unter, Wasser und Horizont schimmerten blutrot. Der Seehund war fort. Vielleicht hatte Iven ihn mit seinem Steinwurf verscheucht. Jetzt tat es ihm leid, seiner Wut auf den Streit mit Dini und auf seine eigene Feigheit auf diese Weise Luft gemacht zu haben. Er vergrub das Gesicht in den Händen und versuchte, Klarheit in seine Gedanken zu bringen.
Er fand nur wilde Wollknäuel aus Wünschen, Träumen und zerbrochener Hoffnung. Dieser verdammte Krieg. Dieser verdammte Hitler. Er wünschte sich, er könnte die Zeit zurückdrehen. Und dann? Ich alleine kann ja wohl auch nicht verhindern, dass dieser Misthund an die Macht kommt.
Neben ihm knallte ein Stein auf den Boden, so nah, dass das harte Geschoss ihn beinahe am Knie getroffen hätte. »Hey!« Iven wirbelte herum und suchte die Umgebung ab. Der Stein war direkt aus der Richtung des Wassers gekommen. Mit zusammengekniffenen Augen blickte Iven den schmalen Sandstreifen entlang, doch er sah niemanden.
Oder doch? Bewegte sich da nicht ein Schatten?
Iven tastete nach dem Stein. Er war nass. Was zum …? Er stutzte. Der Stein hatte eine scharfe Kante, die ihm unangenehm in die Hand pikte.
»Nicht schön, nicht wahr? So etwas beinahe an den Kopf zu bekommen, ist ausgesprochen unangenehm.«
Eine Männerstimme, tief und weich. Sie jagte Iven einen Schauer über den Rücken. Er wandte sich um.
Hinter ihm stand eine hochgewachsene Gestalt in lässiger Kleidung, etwas wie einen Mantel über dem Arm, ein leicht schiefes Lächeln auf dem blassen Gesicht, das, Iven fand kein anderes Wort dafür, aristokratisch wirkte.
Seine Gedanken rasten. Wer war der Kerl? Einer der adeligen Schnösel, die hin und wieder mit den Kommandanten zusammenhingen, oder vielleicht ein neuer Befehlshaber, der noch in Zivil herumrannte? Er stand auf und stellte fest, dass der seltsame Fremde einen Kopf größer war als er. Mindestens.
»Ich entschuldige mich, falls ich Sie mit meinem Steinwurf belästigt oder verletzt haben sollte. Ihn zu werfen war …«
»Ungehörig? Unvorsichtig? Unhöflich? Alles zusammen?«
Schwang da ein Lachen in der Stimme mit? Iven musterte ihn, suchte an der hellen Stirn unter rabenschwarzem Haar nach einer Wunde.
Da war nichts. Und der Mann war ganz sicher auch nicht vom Militär, dazu war sein Haar viel zu lang. Im Nacken zusammengefasst reichte es ihm beinahe bis zum Hintern. Der Mantel, den er über dem Arm trug, war kein Soldatenmantel. Es war ein Pelz, erkannte Iven bei einem näheren Blick, schimmernd glatt, grau und von dunklen Flecken durchsetzt.
Iven weitete die Augen. »Ist das etwa ein Robbenpelz?«
Jetzt lächelte der Fremde wirklich. Seine schlanken Finger strichen über das Fell. »Sie mögen Robben …« Mit den Blicken tastete er Ivens Uniform nach Rangabzeichen ab. »Gefreiter zur See?«
Iven schielte zum Meer. Der Seehund war noch immer nicht wieder aufgetaucht. Er zuckte mit den Schultern. »Vielleicht mag ich es einfach nur nicht, wenn ein Tier nur wegen seines Fells getötet wird, damit ein Mensch sich einen Mantel daraus machen kann.«
Der Mann zog eine Braue hoch, was seinem Gesicht einen Hauch Arroganz verlieh. Noch immer spielte das Lächeln um die sinnlichen Lippen. »Nun, ich kann Ihnen versichern, dass für dieses Fell kein Seehund gestorben ist.« Das Lachen tanzte in seiner samtigen Stimme. Noch einmal strich er beinahe zärtlich über den Pelz, und Iven spürte einen Schauer über seinen Rücken rinnen. Der Mann hatte schöne Hände. Lange, schlanke Finger, die sanft und zugleich kräftig wirkten.
Iven schluckte eine bissige Bemerkung herunter. »Nun, wenn ich Ihnen mit dem Steinwurf nicht zu nahe getreten bin, dann werde ich mich jetzt verabschieden. Gute Nacht.«
»Wie bedauerlich. Ich wollte Sie gerade fragen, ob ich Sie zu einem Glas Teepunsch oder Glühwein einladen kann. Oder einem Tee, wenn es etwas Harmloses sein soll. Dieses Wetter, finde ich, verlangt nach einem heißen Getränk. Zudem ist etwas Warmes immer gut für eine niedergeschlagene Seele.« Er musterte Iven so intensiv, dass dieser unwillkürlich zurückwich.
»Warum sollten Sie das tun? Ich kenne Sie doch gar nicht.«
Wieder dieses Lächeln, das die dunklen Augen des Fremden funkeln ließ. Als hätte sein Blick den mitternächtlichen Sternenhimmel eines friedlichen Sommerabends eingefangen. Der Mann streckte eine Hand aus. »Siever«, sagte er. »Und Sie sind Gefreiter zur See … Iven Wessels. Sehen Sie? Keine Fremden mehr. Wir haben unsere Namen ausgetauscht.«
»Nun, eigentlich haben Sie meinen von meiner Uniform abgelesen.« Zögernd streckte Iven die Hand aus und schlug ein. Siever hatte seine Neugier geweckt, und der Gedanke an einen heißen Glühwein oder Teepunsch mit so viel Kandis, dass die Süße an den Zähnen klebte, hatte durchaus etwas Angenehmes. Wie meint er das mit der niedergeschlagenen Seele? Steht mir auf der Stirn geschrieben, dass ich mit meiner Verlobten Streit habe?
Mit festem Griff schloss sich Sievers Hand um Ivens. »Also. Wo können wir hingehen?«
»Ich habe ein Zimmer in einer Pension in der Nähe des Stützpunktes. Nicht weit von hier. Die Frau, die das Haus führt, vermietet an Soldaten.«
»Nun, vielleicht hat sie auch ein Zimmer für einen harmlosen Zivilisten auf der Durchreise?«
Harmlos? Iven spürte leises Kribbeln in der Magengrube. Siever hatte wieder sanft gesprochen, das Lächeln zupfte noch immer an seinen Mundwinkeln, und doch spürte Iven, dass dieser Mann mehr war, als er vorgab zu sein. Ein harmloser reisender Zivilist? Wer in diesen Zeiten reiste, gerade an Orte wie Wilhelmshaven, die durchaus kriegsentscheidend waren, der war vermutlich weder harmlos noch Zivilist. Iven verengte die Augen. War der Kerl vielleicht ein britischer Spion, der versuchte, einen einfachen Soldaten dazu zu bringen, Details über den Stützpunkt auszuplaudern? Wollte er ihn betrunken machen und nach kommenden Einsätzen aushorchen?
»So viel Misstrauen habe ich nicht verdient.« Siever legte eine Hand auf Ivens Schulter. »Ich gebe Ihnen mein Wort, Gefreiter, dass ich weder ein Spion noch ein hochrangiger Offizier in Verkleidung bin.«
»Was … sind Sie dann?« Iven krächzte, seine Stimme wollte ihm nicht gehorchen. Sein Magen hatte sich in einen kribbelnden Ameisenhaufen verwandelt. Und woher weiß er, dass ich ihm nicht traue? Habe ich auch das in leuchtenden Buchstaben auf der Stirn stehen? Siever musste gemerkt haben, wie sehr er sich angespannt hatte, denn die Hand verschwand von seiner Schulter.
»Ich wünschte, du hättest keine Angst vor mir.« Siever flüsterte beinahe.
Iven spürte warmen Atem sein Ohr streifen und erschauerte. Mit klammen Fingern zog er seinen Mantel enger um sich. »Ich habe keine Angst. Ich bin nur vorsichtig. Das ist meine Pflicht.«
»Sehr löblich.«
»Was willst du?« Auch Iven warf Förmlichkeiten über Bord. »Wer zum Klabautermann bist du?«
»Du kennst mich.« Siever legte den Kopf schief. »Nein, das ist vielleicht übertrieben, aber wir haben einander schon oft gesehen. Ich habe dich beobachtet. Und du mich. Und heute habe ich mich entschlossen, dich anzusprechen.«
»Beobachtet?« Ivens Kehle wurde eng. Was weiß er über mich?
Siever strich über seinen Robbenfellmantel. »Lass uns irgendwo hingehen, wo es wärmer ist.« Er hob den Kopf und atmete tief die feuchtkalte Luft ein. »Es wird bald regnen.«
»Ernas Pension. Du hast gesagt, du willst ein Zimmer.«
Siever hob eine Braue. »Ich darf also im selben Haus übernachten wie du, falls diese Erna noch ein Zimmer frei hat? Doch nicht so misstrauisch, Gefreiter?«
Iven gelang ein Lächeln. »Vielleicht will ich nur wissen, wo sich der Mann herumtreibt, der mich zu kennen behauptet, obwohl ich ihn noch nie gesehen habe.«
»Und der sich von mir zu einem Teepunsch einladen lässt?«
»Vielleicht.« Da war etwas in Sievers Augen, das Iven berührte. Kenne ich ihn wirklich nicht? Habe ich ihn nicht doch schon einmal irgendwo gesehen? Er musste sich zusammenreißen, um nicht den Kopf zu schütteln. Ein reicher Schnösel mit einem Robbenfellmantel. Nie im Leben.
Ernas Pension lag in einer schmalen Seitengasse in der Nähe des Stützpunktes. Ein Geheimtipp unter den Marinesoldaten und hin und wieder Treffpunkt für gemütliche Abende. Heute war die Gaststube leer, die Rezeption nicht besetzt. Erna stand hinter dem Tresen und polierte Biergläser. Die Luft im Schankraum roch verraucht, im offenen Kamin prasselte ein Feuer.
»Gemütlich«, stellte Siever fest, während er die Tür hinter sich schloss.
Erna strahlte, als Iven nähertrat. »Na, mien Jung! Was kann ich für dich tun? Hast’n Freund mitgebracht? Richtig so, genieß die Zeit, bis du wieder raus musst. Man weiß ja nie, was da draußen passiert.« Dass die mütterliche ältere Dame, die Erna war, nicht über die Theke griff und Ivens Wange kniff, verdanke dieser vielleicht nur seiner Uniform. Über Iven hinweg musterte sie Siever, der sich einen Platz in einer Ecke ausgesucht hatte. Dort waren Sessel anstelle der einfachen Stühle aufgestellt, der niedrige Couchtisch ließ alles beinahe wie ein Wohnzimmer wirken. »Siever würde gern ein paar Nächte bleiben, hast du noch ein Zimmer?«
»Sicher, mien Jung. Die Sieben ist heute frei geworden. Wollt ihr was essen? Trinken?«
Iven blickte sich zu Siever um und erntete ein Nicken. »Was gibt es denn?«
»Kartoffelsuppe mit Speck. Bier dazu?«
»Erst mal ein Teepunsch, wir haben lange draußen gestanden.«
»Kommt sofort. Macht es euch gemütlich.« Erna machte sich auf den Weg in die Küche. Auf halber Strecke hielt sie inne, musterte Siever noch einmal eingehend und murmelte: »Wat’n schicker Mann.«
Siever lächelte. »Sehr süß, deine Wirtin.«
Iven zog seinen Mantel aus, hängte ihn an den Garderobenständer und ließ sich in den Sessel Siever gegenüber fallen. »Sie ist eine ganz Liebe, bitte behandel sie dementsprechend.«
Wieder wanderte Sievers Braue aufwärts. »Was denkst du denn? Natürlich. Immerhin hat sie mich einen schicken Mann genannt.«
Und damit hat sie vollkommen recht. Iven musste sich zusammenreißen, um seine Zufallsbekanntschaft nicht ständig anzusehen. Himmel, ja, der Mann war schön. Wie konnte ein Mann solches Haar haben? Lang und glatt, im Nacken zusammengebunden, einige Strähnen hatten sich aus dem strengen Pferdeschwanz gelöst und gaben dem schmalen Gesicht mit den klaren, glatten Zügen ein wenig Weichheit. Iven erkannte keinen Bartschatten auf Sievers Wangen, und doch wirkte er kein bisschen wie ein Milchbubi. Und seine Hände … Iven schluckte. Energisch schob er den Gedanken beiseite, wie es wohl wäre, von diesen Händen berührt zu werden. Verdammt, was ist mit mir los?
Siever blickte ihn an, als wollte er erneut auf den Grund seiner Seele schauen. Dann zwinkerte er ihm zu und zeigte wieder dieses fast schelmische Lächeln.
Wäre Erna nicht im selben Augenblick mit einem Tablett beladen angerückt, Iven hätte nicht gewusst, was er sagen sollte.
»Guten Appetit, Jungs.« Sie stellte Schalen mit dampfender Suppe auf den Tisch, einen Korb mit Brot und zwei Gläser, in denen golden der Teepunsch schimmerte. Kandiszucker füllte die Gefäße zu einem guten Drittel. Der scharfe Duft des geele Köm stieg Iven in die Nase, und er schnupperte wohlig. Erna legte Siever noch einen Schlüssel mit einem hölzernen Anhänger hin, auf den die Zahl sieben aufgemalt war. »Die Treppe rauf und dann am Ende des Flurs. Ich mache zu für heute, lasst einfach alles stehen, wenn ihr zu Bett geht. Und wenn ihr noch was wollt, bedient euch selbst und schreibt es auf den Block. Nacht!«
»Danke, Erna. Nacht!«
Iven wartete, bis die Wirtin verschwunden war, dann hob er sein Glas. »Prost.«
Siever nickte. »Prost.« Über den Rand seines Glases hinweg blickte er Iven an.
Diese Augen. Dieses Lächeln. Ivens Magen kribbelte immer noch. Wer bist du? Ihm fiel auf, dass Siever den Seehundmantel nicht an den Garderobenständer gehängt hatte. Er lag auf der Sessellehne, und Siever bedachte ihn mit wachsamen Blicken. Und dann erkannte Iven noch etwas. Er ließ den Löffel Suppe, den er gerade zum Mund führen wollte, wieder sinken. »Das ist ja gar kein Mantel!«
»Das habe ich auch nie behauptet«, gab Siever zwischen zwei Löffeln Suppe zurück. »Du siehst, was du sehen willst, Iven, und darum kannst du mich nicht erkennen.« Er fuhr fort, die Suppe zu löffeln, und Iven leerte seine Schale ebenfalls, obwohl plötzlich alles nach Stroh schmeckte und auch der süß-scharfe Punsch aus schwarzem Tee und Kümmelschnaps ihn kaum noch erreichte. Sie schwiegen, nur das leise Knistern des hinunterbrennenden Kaminfeuers erfüllte den Raum. Ivens Blicke klebten an dem Robbenfell. Denn das war es, ein Pelz, kein Kleidungsstück. Woher mochte Siever es haben?
Schließlich schob Siever seine Schale beiseite. »Wo wollen wir uns weiter unterhalten? Hier? Oder in deinem Zimmer?«
»Vielleicht sollten wir jeder in unser eigenes …«
»Aber dann wirst du nicht erfahren, wer ich bin. Und woher wir uns kennen. Aber ich weiß, dass es das ist, was du willst. Dein Herz sehnt sich nach der Wahrheit.« Er deutete zum Fenster, an dem inzwischen dicke Regentropfen hinunterrannen. »Ich sagte doch, es würde regnen.« Er streckte seine Hand aus, beinahe berührten seine Fingerkuppen Ivens. Und dann berührten sie ihn wirklich.
Es durchfuhr ihn wie ein Stromstoß. Iven zuckte zurück. »Was …?« Er starrte Siever an, dessen dunkle Augen im schummrigen Licht der Gaststube groß wirkten und tief wie das Meer. Ein anderes Gesicht schob sich vor Sievers Züge. Rund und silbergrau, mit großen schwarzen Knopfaugen, langen Schnurrhaaren und einer Nase, die sich gegen das Wasser verschließen konnte. Warum fiel ihm jetzt der Seehund wieder ein?
»Ihr Menschen wisst nicht mehr viel«, raunte Siever. »Aber gerade kann ich es euch nicht verdenken. Immerhin führt ihr Krieg, und das ist anstrengend. Der Gedanke an Freund und Feind füllt eure Köpfe und eure Herzen. Ihr folgt Flaggen, ihr tragt eure Farben auf eurer Kleidung, und ihr zieht gegeneinander in den Kampf.« Seine Stimme war leise geworden. »Ihr seht nur noch den Tod. Ich bin Leben, Iven. Du bist immer wieder an den Ort gekommen, an dem du mich beobachten konntest, also kam ich immer wieder zurück. Weil ich spüre, dass du dich ebenso nach Leben sehnst wie die Frau, an die du denkst, und die dir gerade grollt. Ich sehe, dass du an andere Dinge als Waffen und Kämpfe denkst. Du denkst an Dinge, die das Leben feiern, und du traust dich nicht, deinem Herzen zu folgen, weil deine Wünsche … was? Verboten sind? Unkonventionell?« Er legte seine Hand auf Ivens.
Sievers Hand auf seiner fühlte sich beinahe heiß an, weil Ivens eigene so klamm und kalt waren. Die Wärme des Punsches war aus ihm geschwunden, immer mehr, je länger Siever gesprochen hatte. »Du …«, er schluckte. Er konnte es nicht aussprechen. Das war doch zu verrückt. War Siever vielleicht einer von denen, die Soldaten auf ihre mentale Gesundheit hin untersuchten? Hatte irgendjemand aus seiner Einheit darüber geplaudert, dass Iven Streit mit seinem Mädchen hatte? Hatte derselbe Jemand vielleicht einmal einen der verstohlenen Blicke bemerkt, die Iven anderen Männern zugeworfen hatte, wenn er sich unbeobachtet gefühlt hatte?
»Was würdest du sagen, wenn du nicht so voller Angst und Misstrauen wärst, Iven? Was würdest du sagen, wenn du an Märchen glauben würdest?« Sievers Stimme war wie Honig, seine Berührung wie Samt, der sich an seine Haut schmiegte.
Iven schloss die Augen – und er sah Bilder. Der Seehund war wieder da. Er schwamm an der Küste entlang, nah am Strand, immer wieder tauchte sein grauer Kopf aus den Wellen auf. Grau mit dunklen Tupfen, so wie das Fell, das neben Siever auf dem Sessel lag.
»Willst du es anfassen? Mach nur.«
»Was?«
Siever deutete mit der freien Hand auf das Fell, ohne Anstalten zu machen, Ivens Finger loszulassen. »Tu es.«
Ivens Hand zitterte, als er sie nach dem Pelz ausstreckte. Er hatte mit einem Mal das Gefühl, eine Grenze zu überschreiten. Das Fell fühlte sich seidig und glatt an, die einzelnen Haare fest, und doch war es weich und warm, als würde es leben. Und dann war da Sievers Hand, strich mit Ivens gemeinsam über das Fell, führte seine Bewegungen. »Du weißt, wer ich bin«, raunte er. Seine Stimme klang atemlos.
»Unmöglich«, keuchte Iven. Das kann nicht sein, das ist vollkommen unmöglich! Das gibt es nicht! Das kann es nicht geben!
»Ach, ihr Menschen«, murmelte Siever. Er hielt Ivens Hand, führte dessen Finger an seine Lippen und küsste sie, einen nach dem anderen.
Iven schnappte nach Luft. Die Küsse waren kühl und sanft wie eine Meeresbrise. Blitze schossen durch seinen Körper. Die Gewissheit war da, aber er konnte sie nicht aussprechen.
»Nur weil ihr euch etwas nicht erklären könnt, wagt ihr nicht, daran zu glauben. Märchen haben alle einen wahren Kern, Gefreiter Iven.«
Iven zitterte. Die Küsse auf seine Fingerkuppen hatten in seinem Körper ein Feuer entfacht, und er wusste nicht, wie er es löschen sollte. Er hatte begehrt, immer wieder, und nicht den Mut gehabt, diesem Gefühl nachzugeben, und nun saß er hier mit diesem Mann, der seine Seele las wie ein Buch und kurz davor war, ihn zu einer Dummheit zu verleiten.
»Nichts ist weniger dumm, als dem Ruf des Lebens zu folgen«, raunte Sievers Stimme. »Leidenschaft ist Leben. Ich jedenfalls könnte nicht leben ohne sie.«
»Du bist der Seehund!« stieß Iven hervor. Er sah Siever an, sein Atem ging in schnellen, harschen Zügen. »Es ist unmöglich, aber du … du bist der Seehund!« Er hatte es ausgesprochen. Iven spürte die Macht der Worte – er hatte sie gesagt, und nun wurden sie wahr. »Du bist der Seehund. Sag mir, wie kann das sein?«
Siever lächelte. »Erst einmal freue ich mich für dich, dass du die Wahrheit erkannt hast!« Noch immer hielt er Ivens Hand. »Es kann sein, weil ich so wirklich bin wie du.«
Iven schüttelte den Kopf. »Und ich dachte, die Legenden kämen aus Schottland.« Damit bin ich wohl der Anwärter auf einen Orden für die dämlichste Feststellung dieses Jahrhunderts.
»Legenden? Hatten wir nicht eben schon festgestellt, dass ich wirklich bin?«
»Selkies.« Iven grub seine Finger in Sievers Seehundfell. Er wollte es greifen, be-greifen, dass er sich diesen Abend nicht nur einbildete. Lag er vielleicht doch gerade in seiner Koje auf seinem Schiff oder in seinem Bett in Ernas Pension und schlief? War das alles nur ein Traum, der zerplatzen würde wie eine Seifenblase, sobald zum Schichtwechsel geweckt wurde?
»Es gibt Seehunde hier in Ostfriesland. Die Nordsee hier ist dieselbe, die auch Schottland umspült. Dass sie dort näher am Ozean ist, ist unwichtig. Es ist dasselbe Meer. Dasselbe Wasser. Es gibt Selkies dort – und es gibt Selkies hier. Es gibt Feen, Iven. Es gibt die Anderswelt, und jeder Mensch könnte sie betreten, wenn er sich nur erinnern würde und nicht vergessen hätte zu träumen. Du hast es nicht vergessen. In dir ist noch Hoffnung. Du gehörst zu denen, denen ihre Großeltern am Kaminfeuer Geschichten erzählt haben. Als du am Meer gestanden hast, heute Abend, und hinübergeschaut hast nach Mellum, da hast du dir gewünscht, Mellum wäre Avalon, und dass du das hier … den Krieg, die Angst … hinter dir lassen könntest.« Siever blickte Iven in die Augen. »Willst du das? Willst du das alles hinter dir lassen? Wenigstens für eine Nacht?«
Sievers Stimme wickelte Iven ein wie eine weiche, warme Decke. »Warum kennst du meine Gedanken?« Er bekam die Worte kaum heraus, so eng war seine Kehle.
»Ich kenne sie, weil ich dich kenne. Seit ich dich zum ersten Mal am Strand sah, in der Nacht nach den ersten Bomben, da wusste ich, dass ich dich treffen muss. Weil ich fühle, dass uns etwas verbindet. Wir Feenwesen spüren so etwas. Du warst erschüttert in dieser Nacht. Du hattest Angst. Du hast an Menschen gedacht, die du liebst, und bis heute bist du um sie in Sorge. Und das zu Recht. Der Krieg wird nicht schnell enden, so sehr es sich auch so viele Menschen wünschen. Der Krieg wird diese Welt noch lange begleiten. Aber ich kann dir Vergessen schenken, für eine Nacht, für viele, für alle, wenn du es willst. Willst du vergessen, Iven?«
»Ja.« Ja, ich will vergessen, ich will keine Angst mehr haben, ich will mich nicht länger verstecken. Ich will endlich … ganz sein. »Zeig es mir.«
Siever lächelte. Warm, ein wenig anzüglich, ein wenig verführerisch. Er erhob sich geschmeidig, zog das Fell unter Ivens Hand hervor.
Ein eigenartiges Gefühl von Verlust durchzuckte Iven, als er das glatte Robbenfell nicht mehr unter seinen Fingern spürte, diesen Pelz, der sich so warm angefühlt hatte, so, als wäre wirklich ein ganzes Tier da, das lebte, atmete. Mit weichen Knien stand er auf, schwankte und griff reflexartig nach Sievers Hand.
Siever hielt ihn. Stützte ihn. »Dein Zimmer oder meins?«
Meins, deins, egal, irgendeines! Iven atmete tief durch. »Sie hat dir die sieben gegeben. Meins ist die vier. Was meinst du?«
Jetzt grinste Siever. Unverschämt. Wundervoll. »Deins.«
Iven stolperte die Treppe mehr hinauf, als dass er sie ging. Vor der Zimmertür ließ er beinahe den Schlüssel fallen, weil seine Hände auf einmal klamm und kalt waren und ihm nicht mehr gehorchen wollten. Sein Herzschlag dröhnte ihm in den Ohren, und er fühlte sich seltsam leicht, obwohl er wusste, dass er im Begriff war, etwas Verbotenes zu tun. Mit zusammengebissenen Zähnen schloss er die Tür auf, schob sich ins Zimmer, wartete, bis Siever ihm gefolgt war, dann drückte er die Tür zu und verriegelte sie von innen. Sicher war sicher. Er lehnte sich an die Tür, seine Knie wollten schon wieder unter ihm nachgeben. »Zeig es mir, Siever«, stieß er hervor. Was auch immer es sein würde.
Siever legte das Robbenfell über das Fußende des Bettes, dann trat er so nah an ihn heran, dass Iven seine Wärme spüren konnte. Er legte Iven die Hände auf die Schultern. »Ich kenne deine Wünsche«, raunte er. Seine Hände wanderten in Ivens Nacken, er zog ihn näher. Und küsste ihn.
Ivens Beine gaben nach. Er klammerte sich an Sievers Schultern. Der Kuss brannte auf seinen Lippen, er schmeckte nach Salz, Wind und Meer. Nach Verbotenem und Geheimnissen, die er tief in seinem Herzen würde verschließen müssen, sobald diese Nacht vorbei war.
Sie wird nie vorbei sein. Sievers Samtstimme, in seinem Kopf, um ihn herum, überall. Sie vibrierte in Ivens Seele.
Iven spürte, dass Siever begann, seine Uniform zu lösen. Geschickt knöpfte er Jacke und Hemd auf, und dann waren seine Hände auf Ivens Haut, auf seiner Brust, Fingerspitzen streiften seine Brustwarzen. Iven warf den Kopf in den Nacken, unterbrach den Kuss. Er keuchte. Das Atmen fiel ihm schwer. Die Luft wog Zentner.
Siever strich über sein Gesicht, legte eine Hand auf sein Herz. »Alles?«, raunte er. »Willst du alles?«
Iven nickte stumm. Er ertrank in Sievers Augen. Die Welt um ihn herum verschwamm in einem Rausch aus Bildern, Gefühlen, Düften. Siever berührte ihn, erkundete ihn, streifte ihm alle störenden Kleidungsstücke ab und trug ihn zum Bett. Er legte ihn in die kühlen Decken, beugte sich über ihn und streichelte seine Haut, jeden Zentimeter davon, überall. Bis Iven sich stöhnend wand, zitterte, bettelte, flehte, keuchte. In seinem Schoß loderten Flammen.
Irgendwann waren sie beide nackt, und Iven wurde forscher, erkundete seinerseits Sievers Körper, der ihm erschien wie ein Kunstwerk aus einer anderen Welt. Weiche, glatte Haut, hell wie Alabaster, das rabenschwarze Haar, die großen, dunklen Augen, in denen sich Lust und Verlangen spiegelten.
Sie umschlangen einander, kosteten ihre Lust, wurden eins wie zwei Wasserströme, die ineinanderflossen. Trennten sich wieder, nur um sich erneut miteinander zu vereinen, bis sie erschöpft dalagen, Iven in Sievers Armen, Sievers Körper wie ein schützender Wall zwischen ihm und der verschlossenen Tür.
Iven fühlte sich ganz.
Zum ersten Mal in seinem Leben.
2.Flammen und Meer – Marienhafe und Juist, im Sommer 1991
Joris
Flammen knisterten, Rauch biss ihm in den Augen, er konnte nicht atmen. Die Hitze des Feuers war um ihn herum, versengte seine Kleidung, seine Haut, sein Haar. Joris schrie. Sirenen schrillten. Mischten sich mit anderen Lauten, Gebrüll, Klirren; die Zimmertür flog auf, Feuerwehrleute in voller Montur. Jemand packte Joris, zog ihn in seine Arme. Verschwommen erkannte Joris das Gesicht der Feuerwehrfrau hinter dem Visier ihres Schutzhelms. Und dann nichts mehr. Nur noch das Gefühl beinahe unerträglicher Leere.
Schweißgebadet und keuchend fuhr Joris aus dem Schlaf, die Finger in die Decke gekrallt. Im ersten Augenblick wusste er nicht, wo er war. Angespannt lauschte er, schnupperte – kein Rauch. Kein Knistern. Keine Hitze, die auf der Haut und in den Augen brannte. Er tastete neben sein Kopfkissen, fand den Plüschseehund und drückte ihn fest an seine Brust. Er bohrte die Nase in das Stofftier und roch den Duft nach Lavendel. Mit geschlossenen Augen konzentrierte er sich auf das weiche Fell der kleinen Robbe, den Lavendel und auf seinen Atem. Atmen. Tief. Bei jedem Atemzug zählte er, bis vier beim Einatmen, bis acht beim Ausatmen. Immer länger aus als ein, das Zählen beruhigte ihn, ebenso der Lavendel.
»Scheiße«. Er hatte geglaubt, die Träume hätten endlich aufgehört. Doch immer, wenn er glaubte, darüber hinweg zu sein, kamen sie mit Macht zurück, brachen in seinen Schlaf wie ein heftiges Gewitter. Dann war mit einem Mal alles wieder da. Sein Elternhaus, das Feuer, Hitze, Rauch, Schreie. Feuerwehrsirenen, die Feuerwehrfrau, die ihn aus seinem Zimmer gezerrt hatte, in dem er wie ein panisches Kaninchen verharrt hatte. Die Schmerzen in der Brust, die bangen Fragen, die Zeit im Krankenhaus. Schließlich die Gewissheit: Seine Mutter hatte es nicht geschafft.
Joris wusste nicht, was schlimmer war: die Träume mit ihren schrillen Farben und den grellen Geräuschen oder die Erinnerung an diesen Moment, in dem die freundliche Oberärztin im Krankenhaus an sein Bett gekommen und erst einmal wortlos seine Hand genommen hatte. Ein Blick in die Augen der Frau, und Joris hatte es gewusst. Sie hatte gar nichts sagen müssen. Er hatte nicht einmal weinen können. Stumm hatte er sich abgewandt, sich unter der sterilweiß bezogenen Bettdecke verkrochen und die Arme um seine Brust geschlungen. Er musste sie festhalten, sich selbst festhalten. Seinen eigenen Körper zusammenhalten, damit der Schmerz und die Leere ihm nicht das Herz sprengten.
»Scheiße«, flüsterte Joris noch einmal und blinzelte die Tränen weg. Er hatte lange gebraucht, bis er darüber hatte reden können. Noch länger, bis er zum ersten Mal geweint hatte.
»Keno«, wisperte er und drückte die Robbe noch fester an seine Brust. Seine Oma kümmerte sich um ihn, seit das Feuer ihm die Mutter geraubt hatte. Sein Vater war schon Jahre zuvor an Krebs gestorben, er erinnerte sich kaum an ihn, er war damals erst vier gewesen.
Als das Feuer kam, war er zwölf Jahre alt gewesen. Jetzt war er fünfzehn, saß auf seinem Bett und heulte und hielt ein Plüschtier im Arm wie ein kleines Kind – und es war ihm scheißegal. Die Tränen waren gut, das hatten ihm so viele gesagt. Erst die Oberärztin mit den sanften dunklen Augen und den liebevollen Händen. Dann Oma Dini, dann die Therapeutin, die mehrere Wochen gebraucht hatte, bis er es endlich geschafft hatte, über das Feuer zu sprechen. Über die Angst, die ihn überfiel, wenn er nur eine Kerze sah, Rauch roch. Er hatte ein Jahr gebraucht, bis er eine Kerze hatte anzünden können. In diesem Jahr war er das erste Mal mit seiner Oma beim Osterfeuer gewesen, das er aus sicherer Entfernung hatte beobachten können.
Das erste Mal nach dem Brand geweint hatte er jedoch erst auf Juist. Dini hatte ihn aus der Schule genommen und ihn auf die Insel gebracht. Bis dahin hatte er nicht einmal gewusst, dass seine Oma ein Ferienhaus auf Juist besaß, hinten im Loog, außerhalb des Dorfes. Nur ein paar Schritte über die Dünen, und er war am Strand.
Damals, vor drei Jahren, hatte er Keno das erste Mal getroffen.
Joris sog noch einmal den Lavendelduft der Plüschrobbe in seine Nase, dann legte er sie liebevoll auf sein Kopfkissen. Oma Dini hatte sie ihm geschenkt und das Duftsäckchen hineingenäht, nachdem sie festgestellt hatte, dass Joris Seehunde mochte.
Joris lächelte, putzte sich die Nase und rieb sich die Augen. Er mochte ganz besonders einen Seehund, und der war sein großes Geheimnis. Er ließ sich zurück aufs Bett fallen und schloss die Augen. Seine Gedanken wanderten. Nicht zurück zum Feuer. Sondern zu diesem ersten Urlaub auf Juist. Zurück zu dem Abend, an dem er Keno kennengelernt hatte. Und sich verliebte.
Er war wieder zwölf, und er saß alleine am Strand und beobachtete den Sonnenuntergang. In den Wellen erkannte er einen runden, glänzenden Kopf, der immer wieder auftauchte, dann erblickte Joris für einen Moment die Schwanzflosse des Seehundes, der da in den Wogen spielte. Am Tag davor hatte er das Tier schon einmal gesehen – er war schwimmen gegangen, und der Seehund war mit ihm geschwommen, so zutraulich, als gäbe es nichts Besseres für eine Robbe, als mit einem verschlossenen Touristenjungen am Strand hin und her zu schwimmen.