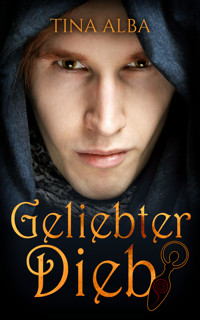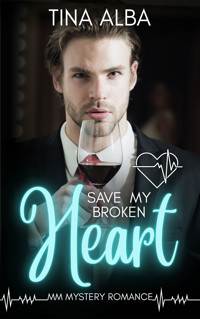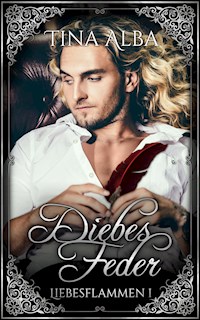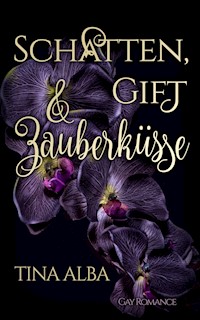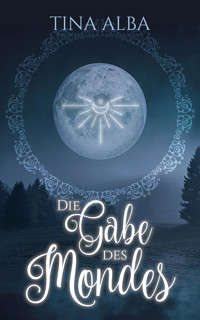
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Elf Caerian trägt das Zeichen des Mondgottes, dessen Gabe ihn zu einem der wenigen wahren Heiler macht. Alleine durch eine Berührung kann er jede Krankheit lindern und der Sage nach sogar den Tod besiegen. Immer wieder plagen ihn aufwühlende Träume, in denen er durch die Straßen einer grauen, nebelverhangenen Stadt irrt. Etwas zieht ihn dorthin – nur was? Caerian macht sich auf die Suche nach dem düsteren Ort. Er ist sicher, dass dort eine Aufgabe auf ihn wartet. Die Bewohner der Hafenstadt Thovara führen ein Leben in ständiger Angst. Seit einiger Zeit ist der Stadtfürst vollkommen unberechenbar geworden. Es sind schon so viele anlasslos zur Strafarbeit in die Edelsteinminen verschleppt zu worden. Als Caerian mit einem Handelsschiff in Thovara einläuft, ist er sicher: Dies ist der Ort, den er gesucht hat. Doch warum hat sein Gott ihn in diese Stadt geführt, in der alles und jeder zu leiden scheint? Erst, als er auf die alte Daona trifft, kommt Licht ins Dunkel – und Caerian gerät in einen Sumpf aus Intrigen, Mordanschlägen und finsterer Magie, aus dem er nicht nur Daona und sich selbst retten muss, sondern auch den Mann, der vom ersten Augenblick an sein Herz gestohlen hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die
Gabe
des
Mondes
Tina Alba
Inhaltswarnungen
Kann Spuren von Erdnüssen enthalten!
Es gibt Inhalte, die Betroffene triggern können, das heißt, dass womöglich alte Traumata wieder an die Oberfläche geholt werden. Deswegen habe ich für diese Personen eine Liste mit möglichen Inhaltswarnungen für alle meine Romane zusammengestellt:
www.tina-alba.de/inhaltswarnungen
1. Mondberührt
Caerian
Nebel.
Seit wir Sellian verlassen hatten, umgab er die Sonnengans wie ein grauer Schleier. Der Wind, der das Schiff vom Hafen auf die Meerenge hinausgetrieben hatte, hatte uns am dritten Tag auf See im Stich gelassen.
Ich stand am Bug, stützte mich mit klammen Händen auf die Reling und spähte in die graue Suppe vor uns, in der ich nichts als geisterhafte Schatten erkennen konnte. Ein wenig hinter mir maß ein Matrose mit Lot und Faden die Wassertiefe und rief immer wieder dem Steuermann Zahlen zu.
Ich wollte nicht wissen, wie tief das Wasser unter uns war. Mich interessierte nur, wann wir endlich Thovara erreichen würden. Ich trommelte mit den Fingerspitzen auf feuchtes Holz und unterdrückte den irrwitzigen Wunsch, ins Meer zu springen und auf die andere Seite der Meerenge zu schwimmen.
Ich war nicht der Einzige an Deck. Die Sonnengans hatte bereits Passagiere an Bord gehabt, als sie in Sellian eingetroffen war, und nicht alle hatten sie dort verlassen. Niemanden schien es im Bauch des Schiffes zu halten, wo es nach Getreide, Gemüse und Tieren roch und viel zu warm und stickig war, während die Sonnengans wie eine Schnecke durch die Flaute schlich und wir Thovara gefühlt keinen Zoll näherkamen. Ich hatte davon gehört, dass bei zu langem Ausbleiben des Windes die Beiboote ausgesetzt wurden, um das Schiff zu ziehen – doch Kapitän Franah stand ruhig wie eine Statue neben mir im Bug, blickte auf das Wasser und nickte immer wieder bei den Rufen des Matrosen, der mit Lot und Faden über der Reling hing.
Ich trat von einem Bein aufs andere und trommelte erneut mit den Fingerkuppen auf das feuchte Holz. Sind wir bald da?
»Habt Ihr es wirklich so eilig, nach Thovara zu kommen, Elf?« Franah hatte sich zu mir umgewandt und blickte mich an, eine Augenbraue gehoben. Ihr gewelltes Haar ringelte sich in winzigen Löckchen um ihr dunkles Gesicht. Sie schob eine vorwitzige Strähne unter ihr Stirnband.
Ich nickte. Wie sollte ich ihr erklären, was mich trieb? Ich wusste es doch selbst kaum, und wenn ich im Geist in Worte fasste, was mich in die Graue Stadt zog, dann klang es selbst in meinen eigenen Ohren verwirrend.
»Noch könnt Ihr es Euch überlegen. Das Leben in Thovara ist gerade allem Anschein nach alles andere als angenehm, seit der junge Fürst den Verstand verloren hat.« Franah tippte sich vielsagend an die Stirn.
Ich horchte auf. »Warum? Was ist mit dem Fürsten? Und warum denkt Ihr, dass er …?« Ich ahmte ihre Geste nach.
Franah schnaubte. »Der Kerl hat nicht mehr alle Planken an Deck, wenn Ihr mich fragt. Sitzt wie die Made im Käse wohlbehütet und abgeschottet auf seiner Burg und lässt es sich gut gehen, während die Menschen in seiner Stadt wohl bald anfangen werden, zusammen mit den Ratten im Unrat nach Essbarem zu wühlen.« Sie deutete auf die Deckplanken. »Das, was da drin ist, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das Land um die Graue Stadt herum ist von einer üblen Missernte heimgesucht worden, schon wieder. Schlechtes Wetter, Schädlinge, Ihr wisst schon.«
Ich nickte, davon hatte ich gehört, und ich wusste, dass ein Teil des Getreides im Bauch der Sonnengans aus meiner Heimat stammte. Was mochte dieser Fürst für ein Mensch sein, wenn er sicher und satt auf seiner Burg hockte, während seine Stadt hungerte? Sollte nicht ein guter Regent zuerst darauf bedacht sein, dass es seinem Volk gut ging? Ich war sicher, wäre Sellian an Thovaras Stelle, dann würde unsere Königin höchstpersönlich die Dörfer besuchen, nach dem Rechten sehen und ihre Kornkammern öffnen.
»Ich sage ja nichts dagegen, dass neuerdings wieder Edelsteine aus Thovara verschifft werden«, fuhr Franah fort. »Die Smaragde und Saphire aus den Minen in den Wäldern sind die Reinsten, die es auf dem Markt gibt. Und genau darum gehe ich davon aus, dass der Vater des Blutfürsten nicht ohne Grund diese Minen schließen ließ. Er wäre doch sehr dumm, wenn er auf solchen Reichtum verzichten würde. Dennoch hat er es getan.«
Blutfürst. Bei diesem Namen rieselte mir ein Schauer über den Rücken. Ich erwiderte Franahs Blick und hob eine Braue.
»Ja, so nennen sie ihn. Unter der Hand, natürlich, aber ich habe diesen Namen schon mehrfach in den vergangenen zwei, drei Monden gehört, wann immer ich mit meiner Gans dort war, um Ladung zu löschen. Es heißt, an den Edelsteinen klebe das Blut der Minenarbeiter. Die armen Hunde sollen nichts anderes sein als bessere Sklaven.«
Ich schauderte.
»Manch einer im Hafen munkelte«, sprach Franah weiter, »dass der Blutfürst gar nicht der rechtmäßige Sohn des alten Fürsten ist.« Sie warf einen bedeutungsvollen Blick auf meine Ohren. »Ich denke, Ihr wisst, warum, Elf.«
»Ihr meint die Weissagung?« Natürlich wusste ich davon, dass ein Ahnherr des Fürsten von Thovara einst eine Elfenprinzessin zur Frau genommen hatte. Eine Priesterin des Lhir, so wie ich einer war. Solange der Mond seine Runde macht und solange ein Nachfahre unserer Verbindung den Thron hält, sollen Thovara und Sellian blühen. Niemand wusste, ob die Prinzessin diese Worte vor dem Traualtar wirklich gesprochen hatte, aber sie hielten sich hartnäckig – auch in meiner Heimat. Sellian blühte. Immerhin konnten wir Thovara mit Getreide beliefern. Ich hob die Schultern. »Das ist eine Legende.«
»Und wie so viele hat sie vielleicht einen wahren Kern.« Franah ließ den Blick wieder auf das nebelverhangene Meer schweifen.
Irgendwo vor uns, hinter diesen Schleiern, lag Thovara, die Graue. Wollte ich wirklich in diese Stadt? Nein. Aber ich musste, wenn ich nicht bis an mein Lebensende von diesen verdammten Albträumen verfolgt werden wollte. In der vergangenen Nacht hatte ich wieder kaum geschlafen, und langsam zehrte die fehlende Ruhe an meinen Kräften. Ich erschrak bei jedem Mäusefiepen halb zu Tode, fühlte mich abgeschlagen und musste mich zusammenreißen, um auf die neugierigen Blicke meiner Mitreisenden nicht gereizt oder ungehalten zu reagieren. Sicher, ich war etwas Besonderes, ein Küstenelf aus Sellian, der seine Heimat verließ. Und das auch noch allein. Ich fühlte mich wie ein exotisches Tier in einer Sammlung, das von allen angestarrt wurde. Leute flüsterten hinter meinem Rücken, fragten sich vielleicht, wie gut ich mit meinen spitz zulaufenden Ohren hörte und ob es wirklich stimmte, dass wir Elfen bei Nacht so gut sehen konnten wie Katzen.
Hin und wieder hatte ich mich nicht zusammennehmen können und den Flüsterern einen scharfen Blick zugeworfen. Die wussten dann immerhin, wie gut ich hören konnte.
Ein junges Mädchen, das in Begleitung eines älteren Mannes, vielleicht ihres Großvaters oder eines Onkels reiste, hatte mich, als ich an Bord ging, mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen angestarrt, bis ihr Verwandter ihr mit einem sanften Tippen ans Kinn den Mund geschlossen und sie hastig weggeführt hatte. Hatte er befürchtet, ich könnte dem Mädchen gefährlich werden? Beinahe hätte ich bei dem Gedanken laut gelacht, denn keine Frau würde je von mir etwas zu befürchten haben. Ich seufzte und blickte wieder aufs Meer hinaus. »Passiert das hier öfter?«
»Was?« Franah drehte sich um und lehnte sich mit dem Rücken an die Reling.
»Kein Wind. Dieser Nebel.«
»Durchaus.«
»Und wie lange dauert es, bis wieder Wind aufkommt?«
Franah hob die Schultern. »Meistens zwei, drei Tage.«
Zwei oder drei Tage? Ich umklammerte die Reling fester und hielt mit Mühe einen deftigen Fluch zurück, den sicher niemand an Bord einem Elfen und schon gar keinem Mondpriester zugetraut hätte.
»Glaubt mir, wenn Ihr erst in Thovara seid, werdet Ihr Euch in die Flaute zurückwünschen. Oder an Euren herrlichen weißen Strand und die Dünen. Sellian ist wunderschön.«
Wem sagte sie das? Ich war drei Tage an Bord, drei Tage von meiner Heimat entfernt, und spürte schon jetzt nagendes Heimweh.
»Da kommt Ismal mit dem Tee. Trinkt einen Becher, Elf, macht es Euch auf den Bänken im Bug gemütlich und genießt die Zeit auf dem Wasser. Hört den Wellen zu. Das solltet Ihr vielleicht auch nachts tun, dann würdet Ihr sicher auch einmal wieder schla…«
Ein lautes Scheppern, dann ein Aufschrei unterbrachen Franah. Ismal, der Gehilfe des Schiffskochs, hatte mit seinem Tablett voller Becher mit heißem Tee mit Honig die Kajüte verlassen, um die Getränke wie jeden Vormittag an alle an Deck zu verteilen. Ich sah ihn auf uns zukommen, dann strauchelte er plötzlich und stürzte. Mit einem lauten Scheppern ging mit ihm das Tablett zu Boden, er landete halb auf dem Haufen zerbrochener Becher und in einer Pfütze aus heißem Tee – und hielt mit seinem spitzen Schrei seine Hand.
»Ismal!« Franah rannte los. »Was hast du angestellt, ungeschickter Bengel?«
Ich ahnte, dass sie es nicht böse meinte und den Jungen nur so anblaffte, weil sie sich sorgte. Eilig folgte ich ihr. Hatte der Kleine sich verletzt?
»Verdammt!« Franah hatte Ismal erreicht, ihn vorsichtig aufgerichtet, und im Näherkommen erkannte ich, was die Kapitänin zu dem Fluch veranlasst hatte. Der Junge umklammerte seinen linken Arm, drückte ihn an sich, und darunter färbte sein heller Kittel sich tiefrot. Er musste auf eine Tonscherbe gefallen sein, und so heftig, wie das Blut strömte, musste er sich das Handgelenk zerschnitten haben. Ich zögerte nicht, obwohl sich bereits eine kleine Versammlung um Franah und den Jungen formiert hatte. Sollten sie doch die Gerüchte um die magische Begabung, die in den Augen aller Menschen jeder Elf und jede Elfe besaßen, weiter verbreiten.
Ich kniete neben den beiden und legte eine Hand auf Ismals unverletzten Arm. »Ismal«, sagte ich leise. »Sei ganz ruhig, ich helfe dir. Zeig mal her. Gib mir deine Hand.«
Der Junge zitterte, sein dunkles Gesicht zeigte einen ungesunden Grauton, und auf seiner Stirn standen Schweißperlen. »Mir ist schlecht«, wimmerte er.
»Ich weiß. Es wird gleich besser.« Mit beiden Händen berührte ich den Arm des Jungen, schloss die Augen und rief, was in mir brannte. Wie durch Watte vernahm ich das Aufkeuchen der Leute um uns herum. Ich ließ mich nicht beirren. Mein Feuer strömte, das Blut hörte auf zu fließen, Schmerz und Furcht wichen sanfter Wärme.
»Bei allen Göttern«, wisperte eine Stimme, dann eine andere: »Er ist ein Berührter!«
Ich blinzelte, schüttelte den Kopf, um die Benommenheit loszuwerden, die mich jedes Mal nach einer Heilung übermannte, und blickte in Ismals geweitete Augen. »Besser?«
Er nickte und konnte offensichtlich nicht aufhören, mich anzustarren. Langsam schob er den blutgetränkten Ärmel zurück und betrachtete seinen Arm. Glatte, dunkle Haut, nicht einmal eine Narbe. »Danke«, murmelte Ismal.
Ich nickte. »Pass das nächste Mal besser auf! Und beschwere dich bei dem, der dieses Tau hier so unordentlich herumliegen lassen hat.«
Franah zog die Brauen zusammen. »Das werde ich tun«, sagte sie. »Ismal, geh dich waschen, versuch, diesen Kittel wieder sauber zu bekommen, und dann ruh dich den Rest des Tages aus. Jefra soll sich um neuen Tee kümmern, sag ihm das von mir.«
»Ja, Kapitän.« Der Junge kam schwankend auf die Füße.
Das Mädchen, das mich bei meiner Ankunft auf der Sonnengans so angesehen hatte, trat vor und ergriff seine Hand. »Komm, ich helfe dir.« Sie stützte Ismal, aber ihr Blick klebte an mir, noch während sie den Jungen zurück zur Kajüte führte.
Ich rappelte mich auf. Franah reichte mir die Hand, ich griff dankbar zu.
»Geht zurück zu den Bänken oder unter Deck, Leute.« Sie scheuchte die Schaulustigen fort, dann sah sie mich durchdringend an. »Wollt Ihr es Euch nicht noch einmal überlegen, Berührter? Solltet Ihr Euch entscheiden, nicht nach Thovara zu gehen, dann biete ich Euch auf meinem Schiff einen Platz und gut bezahlte Arbeit an. Ihr seid ein wahrer Heiler! Besser als jeder Schiffsarzt! Für die Zeit, die wir noch unterwegs sind, bekommt Ihr die Kabine meines ersten Offiziers. Ich werde gleich mit ihm sprechen. Überlegt es Euch, Heiler. Thovara ist kein Pflaster für Euch.« Sie drückte meine Hand. »Braucht Ihr noch etwas?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nur ein wenig Ruhe.«
»Die sollt Ihr bekommen. Jetzt gleich. Kommt.«
Wenig später saß ich auf einer schmalen, aber sauberen Koje in der winzigen Kabine des ersten Offiziers und war das erste Mal seit drei Tagen wieder allein. Erst jetzt merkte ich, wie sehr ich Stille und Abgeschiedenheit vermisst hatte. Im Schlafsaal für die Passagiere unter Deck gab es zwar Vorhänge zwischen den einzelnen Hängematten, doch wirklich allein hatte ich mich dort nicht gefühlt. Immer hatte ich irgendjemanden husten, atmen, schnarchen oder im Schlaf reden gehört. Jetzt konnte ich eine Holztür hinter mir schließen und sogar einen Riegel vorschieben. Ich legte die Hände um den Tonbecher, den Jefra mir gebracht hatte, und atmete den Duft des Kräutertees ein. Er war mit Honig gesüßt und schmeckte wunderbar frisch, doch gerade war es seine Wärme, die ich am meisten brauchte. Meine Heilergabe war wie ein ungezähmtes Pferd, das sich gegen jeden Versuch auflehnte, es zu zügeln. Ich hatte gelernt, sicher, hatte all das Wissen, das mein Tempel über die Gabe besaß, aufgesogen wie ein Schwamm, und dennoch war ich weit fern davon, ein ausgebildeter Heiler zu sein.
Ich trank meinen Tee, dachte an Franahs Angebot, das ich ganz sicher ausschlagen würde, und sehnte mich nach traumlosem Schlaf. Und nach der Ankunft in Thovara.
Ich wanderte ziellos durch graue, nebelverhangene Straßen, vorbei an Menschen mit grauen Gesichtern und grauer Kleidung. Alles war grau an diesem Ort, vielleicht sogar ich selbst. In düsteren Straßen wohnte Angst. Ich spürte sie mit jedem Schritt, den ich tiefer vordrang in das Straßengewirr. Sanftes blaues Licht leuchtete um mich herum. Es hüllte mich ein wie ein Schutzmantel.
»Zurück!«, raunten mir körperlose Stimmen zu. »Geh hin, wo du hergekommen bist!«
Ich schauderte, wirbelte herum und sah – niemanden. Vor mir weitete sich das Netz enger Gassen zu einem Platz mit einem Brunnen. Eine Gruppe Menschen zog darüber hinweg, Hände und Füße in Ketten aus schimmernden grünen Steinen, verfolgt von einem Drachen aus Eis. Ich wollte mich hinter den Brunnen kauern, doch zu spät – der Drache hatte mich gesehen, der Blick seiner Augen, die hellblau waren wie Saphire, durchbohrte mich. Ich konnte nur reglos stehen und starren, wie festgebannt umklammerte ich mit beiden Händen den Brunnenrand. Mein Blick fiel über den sich windenden Drachen hinweg auf die düster über der Stadt thronende Burg, auf deren Zinnen ein Banner wehte. Zum ersten Mal, seit ich von der grauen Stadt träumte, erkannte ich Farben. Ein Schiff mit rotem Segel auf tiefblauem Grund. Das Bild des Banners brannte sich in meine Gedanken. Es war wichtig. Ich war sicher.
Der Drache fauchte, riss mich aus meiner Erstarrung. Er umrundete die gebundenen Menschen, dann breitete er ledrige Schwingen aus und schraubte sich in den Himmel. Fast riss mich der Wind, den seine Flügel verursachten, von den Füßen.
Der Drache fuhr hoch, riss das Maul auf, spie eine grellweiße Flamme – das Banner löste sich in winzige Ascheflocken auf.
Eine Glocke erklang, und der Drache, die grauen Straßen und die Menschen in Ketten aus Smaragden zerbarsten in Tausende schillernder Funken.
Keuchend fuhr ich hoch, um mich herum nichts als Dunkel, und von fern drang der gläserne Ton einer Glocke an meine Ohren. Ich zerrte die Wolldecke von meinen Beinen, schlang die Arme um die Knie und senkte den Kopf.
Atmen. Du musst atmen, Caerian!
Die Stimme meines Lehrers in meinen Gedanken holte mich in die Wirklichkeit zurück. Ich war auf der Sonnengans in der winzigen Kabine des ersten Offiziers auf dem Weg nach Thovara, und das gläserne Klingen, das ich gehört hatte, war die Schiffsglocke, mit der draußen an Deck die Nachtwache die Stunden zählte.
Ich hatte geträumt. Schon wieder. Von Thovara, der Grauen Stadt im Nebel auf der gegenüberliegenden Seite der Meerenge, die meine Heimat von der der Menschen trennte.
Ich rieb mir die brennenden Augen, schwang die Beine aus dem Bett, tappte zur Waschschüssel und schüttete mir eine Handvoll kaltes Wasser ins Gesicht. Bleierne Müdigkeit steckte mir in den Knochen, dennoch wusste ich, dass ich nicht mehr würde schlafen können. Ich schlüpfte in Kleidung und Stiefel, öffnete den Riegel an der Tür und trat in den engen Gang. So leise wie möglich erklomm ich die knarrende Stiege zur Luke und kletterte an Deck. Ich brauchte frische Luft.
Eine leichte Brise begrüßte mich, als ich hinaustrat. Über der sacht dahingleitenden Sonnengans hatte sich der Nebel gelichtet, die Wolkendecke war aufgerissen, und der volle Mond leuchtete silberhell auf das Meer. Die Nachtwache stand mit dem Steuermann am Ruder. Ich trat an die Reling und betrachtete die schimmernde Silberspur des Mondlichtes auf dem Wasser. Vollmond, wie in der Nacht vor einem Jahr, als der Strahl silbernen Feuers meine Stirn getroffen und mein Leben für immer verändert hatte. Lhir hatte mich berührt, der Gott des Mondes, dem ich als Priester diente, und die Gabe der wahren Heilung in mir geweckt.
Einige Monde später, irgendwann in der Mitte meiner Ausbildung, hatten die Träume begonnen, die mich seither nicht mehr losgelassen hatten. Ich hatte versucht, sie zu verheimlichen, aber sie waren immer zudringlicher und intensiver geworden. Irgendwann hatte ich es nicht mehr ausgehalten und mit Hohepriester Alvaron darüber gesprochen, zitternd und bebend.
Atme. Du musst atmen, Caerian.
Ich glaubte, Alvarons Hand auf meiner Schulter zu spüren, seinen warmen Blick, während er mir zuhörte. Seine warme Stimme, als er mir sagte, was ich schon so lange befürchtete: dass diese Träume mich führen wollten. Dass Lhir mir mit der Heilergabe auch einen Auftrag gegeben hatte.
Immer wieder hatten wir über das gesprochen, was ich im Traum gesehen hatte, so lange, bis Alvaron die Stadt in Nebel und Grau zu erkennen geglaubt hatte.
Und da war ich nun, an Bord eines Handelsschiffes aus dem Süden, das Getreide und andere Lebensmittel in die von Missernten gebeutelte Stadt bringen sollte.
Was würde ich dort finden? Einen Drachen, wie in meinem Traum? Schaudernd zog ich meinen Mantel enger um mich. Der Wind frischte immer mehr auf. Rufe erklangen, Schritte um mich herum. Das Schiff erwachte zum Leben, Menschen kletterten in die Takelage, flatternd blähten sich die großen Segel.
Die Sonnengans flog wieder.
Und die Menschen an Bord bedachten mich für den Rest der Reise mit noch neugierigeren Blicken. Ihr Flüstern, wenn ich an ihnen vorbeischritt, wurde zu meinem ständigen Begleiter.
2. Die graue Stadt
Caerian
Der Nebel kehrte am Abend zurück, aber nicht die Flaute. Die Sonnengans glitt über das Wasser, tanzte über die Wellen, Seemeile um Seemeile, und schließlich, am Morgen des sechsten Tages, vernahm ich vom Ausguck her das Hornsignal, das Land in der Nähe ankündigte. Ich blinzelte in den Nebel und erkannte die Küste als gezackte Linie vor uns, ein Spiel aus Licht und Schatten. Nach einer Weile schälten sich Lichter aus dem hellen Grau – zwei Reihen auf dem Wasser dümpelnder Kugeln, die geisterhaft grün leuchteten.
»Willkommen in Thovara.« Franah war neben mich getreten. »Habt Ihr es Euch überlegt, Berührter? Werdet Ihr an Land gehen – oder mit uns weiterfliegen in den Süden?«
»Ich werde in Thovara von Bord gehen.«
Franah schüttelte den Kopf. »Eure Entscheidung. Ich hoffe für Euch, dass Ihr wieder Schlaf findet, wenn ihr gefunden habt, was Ihr dort sucht.«
Verflucht. Anscheinend sah ich so müde aus, wie ich mich fühlte. Die Träume hatten mich weiterhin verfolgt. Ich hatte jede Nacht stundenlang in der kleinen Kabine wach gelegen, versucht, die verwirrenden Bilder zu ordnen und irgendeinen Sinn darin zu finden. Den Drachen hatte ich nie wieder gesehen, dafür war mir das Banner mit dem Schiff darauf immer wieder erschienen. Manchmal wehte es stolz auf den Zinnen der Burg, die über der Stadt thronte, dann wieder hatte ich es in Flammen aufgehen und in Ascheflöckchen zu Boden rieseln sehen. Ich blinzelte erneut. »Kapitän, was sind das für Lichter?«
Franah grinste. »Das Einzige, das in Thovara noch gut funktioniert, sind anscheinend die Thaumaturgen. Sie stellen diese schwimmenden Lichter her und schaffen sie auf die Meerenge hinaus. Sie markieren den Weg zur Hafeneinfahrt. Das Wasser hier ist voller Untiefen und Korallenriffe. Bevor die Stadtfürsten auf die Idee gekommen sind, die Einfahrt zu markieren, sind hier einige Schiffe gesunken, weil die Riffe ihnen die Bäuche aufgeschnitten haben. Und da es hier oft genug nebelig ist, haben Markierungen aus Birkenstämmen und Reisig einfach nicht ausgereicht.«
Ich nickte, fasziniert von den Leuchtkugeln, die die Fahrrinne zu beiden Seiten in regelmäßigen Abständen flankierten. Einige glühten nur noch schwach, und ich erkannte sogar drei erloschene Blasen, doch das Licht reichte aus, uns in das von Kaimauern aus glänzendem schwarzen Stein eingerahmte Hafenbecken zu führen. Geräusche drangen an meine Ohren – das Plätschern des Wassers, als die Sonnengans in den Hafen glitt, Rufe von der Kaimauer, ein Schrei. Ein Laut, als fiele etwas aus größerer Höhe ins Wasser, gebellte Befehle. Langsam schob sich das Schiff einem freien Liegeplatz entgegen, der Steuermann manövrierte es geschickt an die Kaimauer. Matrosen warfen wartenden Hafenarbeitern Taue zu, und dann lag die Sonnengans fest im Hafen. Weitere Matrosen fuhren das Fallreep aus und begannen ohne Umschweife, die Getreidesäcke an Land zu schleppen. Offensichtlich wurde sie bereits erwartet, denn sie wurden umgehend an Land von einer Gruppe Hafenarbeiter in Empfang genommen.
Franah sah mich an. »Also dann, Berührter, viel Glück. Und wenn Ihr doch noch Eure Meinung ändert … im übernächsten Mond komme ich wieder.«
Ich nickte, streifte mir die Kapuze meines Mantels über und rückte meine Umhängetasche zurecht, die Schreibzeug und Kleidung zum Wechseln enthielt. Ich reichte Franah einen Beutel mit Bernsteinen, den verabredeten Preis für die Passage. »Danke, dass ich mitfahren konnte. Viel Glück weiterhin auf Eurer Reise, Kapitän.«
»Viel Glück auch Euch. Passt auf Euch auf.«
Ich nickte und betrat die Rampe, die zum Kai hinabführte, wobei ich achtgab, möglichst niemandem in den Weg zu treten und möglichst schnell aus dem Bereich fortzukommen, in dem Matrosen und Hafenarbeiter sich beim Entladen beinahe gegenseitig auf die Füße traten. Die Sonnengans war nicht das einzige Handelsschiff im Hafen. Einige Liegeplätze weiter erkannte ich einen kleinen eliarischen Drachen. Hinter mir ging noch ein weiterer Mann von Bord, so, wie er gekleidet war, ein Eliarer aus dem Norden, und hielt auf das Drachenschiff zu. Er wechselte anscheinend einige Worte mit einem Hafenarbeiter bei dem Schiff, dann ging er an Bord. Er würde nach Hause fahren, vermutete ich. Ich hatte gerade einen Fuß auf thovarischen Boden gesetzt und sehnte mich schon nach Sellian zurück.
»Was willst du hier, Fremder?«, blaffte mich eine Stimme barsch von der Seite an. Ein Mann in speckiger Teerjacke baute sich vor mir auf. »Waren nehmen wir gern, aber nicht noch mehr Mäuler, die diese Stadt stopfen muss!«
Ich musste mich zusammenreißen, um mich nicht zu ducken. »Ich bin nur auf der Durchreise«, gab ich zurück. »Ich will jemanden treffen, und dann umgehend weiterziehen. Auf dem Landweg.«
Der Mann starrte mich an, und mir wurde klar, dass es sicher besser gewesen wäre, hätte ich die Kapuze meines Mantels aufgesetzt. »Hab ja keine Ahnung, wen einer wie du hier treffen will, aber solange du dich an die Gesetze hältst, spricht nichts dagegen.« Er grinste schief und zeigte ein paar abgebrochene Zähne. »Aber hüte dich – die Gesetze ändern sich hier so schnell, wie der Wind sich dreht, also gib gut auf deine spitzen Ohren und deine feinen Roben acht.«
Damit drehte er sich um und ließ mich einfach stehen, und doch hatte ich das Gefühl, seine durchdringenden Blicke seien an mir kleben geblieben. Er hatte meine Ohren angestarrt. Und meine Stirn. Ich griff nach der Kapuze und zog sie mir tief ins Gesicht. Wer genau hinsah, konnte durchaus das Zeichen Lhirs auf meiner Haut schimmern sehen, das mich als einen Berührten auswies. Hatte er es erkannt? Hatte er deswegen so einer wie du gesagt? Oder weil ich ein Elf war? Ich würde es ganz sicher herausfinden. Doch zuerst brauchte ich eine Bleibe.
»Steh hier nicht rum, wo anständige Leute arbeiten müssen!«
Ich machte einen Satz zur Seite und konnte dem verschwitzen, müde aussehenden Mann, der mich angeblafft hatte, während er rumpelnd ein großes Fass an mir vorbeigerollt hatte, gerade noch ausweichen. Ihm folgten weitere Arbeiter, die Fässer zu dem eliarischen Drachen rollten, wo weitere Leute sie an Deck hievten. So, wie die Fässer rochen, vermutete ich irgendein scharfes, alkoholisches Getränk, obwohl aus einigen beim Rollen auch seltsam rumpelnde Laute erklangen. Ich hob die Schultern, sah zu, dass ich aus dem Weg kam, und folgte erst einmal dem, was ich für die Hauptstraße hielt. Zumindest war die gepflasterte Straße breit genug für zwei Fuhrwerke nebeneinander und führte mit sanftem Anstieg weg vom Hafen.
Ich blickte voraus, und dann sah ich sie, als eine leichte Brise für einen Augenblick die Nebelschwaden über der Stadt auseinandertrieb. Über der Stadt thronte tatsächlich eine trutzige Burg, dieselbe, die ich in meinem Traum gesehen hatte. Das Banner, das auf einem der sechseckigen Burgfriede flatterte, erkannte ich sofort: ein Schiff mit roten Segeln auf dunkelblauem Grund.
Ich zuckte zusammen, als der Windhauch mich sacht streifte und an meiner Kapuze zupfte, und fuhr herum – aber da war nichts. Die Straße hinter mir war leer, nur aus dem Hafenbereich drangen noch immer Stimmen zu mir.
Mit einem leisen Schaudern blickte ich zur Burg auf. Dass ich in meinen Träumen immer wieder Thovara gesehen hatte, konnte laut Alvaron nur bedeuten, dass ich hier jemanden finden würde, der meine Gabe brauchte. Heilung, wie sie nur ein wahrer Heiler geben konnte, für etwas, gegen das Ärzte und Kräuterheilerinnen machtlos waren. Sollte es wirklich so einfach sein? Nachdem ich im Traum dieses Banner gesehen hatte – würde ich den, der meine Heilkräfte brauchte, dort finden? Sollte ich einfach zur Burg hinaufsteigen und um eine Audienz bitten?
Mir fiel wieder ein, was Franah über den Fürsten gesagt hatte. Er hat nicht mehr alle Planken an Deck, wenn Ihr mich fragt. Ein Fürst, der sein Volk ausbluten ließ, der Menschen zu harter Arbeit in Edelsteinminen zwang und auf Seide gebettet in seinem Thronsaal vor vollen Tellern saß, während die Menschen in seiner Stadt viel zu wenig hatten.
Blutfürst hatte Franah ihn genannt. Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch blickte ich zu der Burg auf und fühlte einen Schauer über meinen Rücken rinnen. Irgendjemand da oben brauchte meine Hilfe. Es führte kein Weg daran vorbei, ich musste in die Burg gelangen. Irgendwie. Und den Menschen finden, dessen Schicksal mich in diese Stadt geführt hatte. Lhir, betete ich stumm. Zeig mir den Weg.
Ich ging weiter, langsam, vorsichtig, immer darauf bedacht, den Menschen auszuweichen, die mir begegneten. In einfache Kleidung in gedeckten Farben gehüllt, den Blick gesenkt und wie in Eile huschten die Bewohner Thovaras an mir vorbei. Manche bedachten mich mit einem misstrauischen Blick, doch die meisten hasteten einfach weiter und taten, als würden sie mich nicht bemerken. Als das Rasseln von Ketten und das Geräusch schwerer, schlurfender Schritte an meine Ohren drang, verschwanden die Menschen von den Straßen, als gehorchten sie einer stummen Warnung. Sie verbargen sich in Durchgängen zu Hinterhöfen, kauerten sich in dunkle Ecken oder betraten eilig einen Laden oder eine Schenke. Davon gab es einige an der Hauptstraße – triste graue Löcher, aus deren Fensterhöhlen schummriges Licht drang. Ich drückte mich an eine Mauer und wartete.
Eine Prozession tauchte aus einer Nebenstraße auf und zog Richtung Hafen. Menschen in abgerissenen Kleidern, das Haar strähnig, die Gesichter schmutzig und müde. Sie wankten an mir vorbei in einem schwankenden Gleichschritt, zu dem sie die mit einer Kette verbundenen Fußfesseln zwangen. Voraus gingen zwei Männer in Wappenröcken, die das Schiff auf blauem Grund zeigten, zwei weitere flankierten den Zug und einer, der eine kurze Peitsche in der Hand hielt, bildete den Abschluss. Die meisten der Gefangenen hatten die Lippen zusammengepresst und schleppten sich voran, ohne einen Laut von sich zu geben. Der Geruch nach Krankheit, Blut und ungewaschenen Leibern stieg mir in die Nase, und ich erschauerte und hielt die Luft an.
Ich wollte die Augen schließen, weglaufen, aber ich konnte es nicht. Wie angenagelt stand ich da und starrte diese armen Menschen an. Fußschellen und Handgelenkfesseln hatten die Haut darunter wund gerieben. Die Menschen, alte, junge, Männer und Frauen, manche noch halbe Kinder, waren ausgemergelt und hungerdürr unter ihren zerrissenen Kleidern. Ich vernahm leises Ächzen, die Kette klirrte und schleifte über die Straße, jemand wimmerte. Ein alter Mann stolperte und brachte den ganzen Zug ins Stocken.
»Heda, weiter! Auf die Füße!« Die Peitsche zischte. Das Klatschen des Riemens auf nackter Haut verursachte mir Übelkeit. Ich schluckte hart. Meine Hände begannen zu glühen.
Ohne darüber nachzudenken, dass meine Einmischung vielleicht keine gute Idee war, sprang ich vor, fasste den Gestürzten am Arm und half ihm, sich aufzurappeln, während blaues Leuchten aus meinen Händen in seine Haut sickerte. Saurer, metallischer Gestank stieg mir in die Nase. Ich biss die Zähne zusammen. Und keuchte auf, als mich ein harter Schlag in den Rücken traf.
»Weg von ihm! Was erlaubst du dir, Fremder?«
Ich fühlte mich gepackt und von dem Alten weggezogen, der mich aus aufgerissenen Augen ungläubig anstarrte.
Der Wachmann, der mich gegriffen hatte, drängte mich an die Mauer und funkelte mich wutschnaubend an. »Niemand vergreift sich an des Fürsten Gefangenen«, zischte er mir zu. »Wenn dir dein Leben lieb ist, dann verschwinde von hier und misch dich nie wieder in Dinge ein, die dich nichts angehen.« Er musterte mich, dann griff er nach meiner Kapuze und zerrte sie zurück. Seine Augen weiteten sich. »Was haben wir hier? Einen Elf von jenseits der Meerenge, wie? Sei vorsichtig, Freundchen. Deinesgleichen ist nicht mehr gern gesehen hier, also sieh zu, dass du nicht noch einmal unangenehm auffällst, und zieh deiner Wege!«
»Lass gut sein, Brado, der macht sich ja gleich vor Angst in die Hose!«, rief einer der anderen Wachleute und deutete auf den Zug Gefangener. »Wir werden erwartet. Du weißt, was wir uns anhören dürfen, wenn wir uns wieder verspäten. Ich glaube nicht, dass er uns noch mal Ärger machen wird. Nicht wahr, Fremder?« Die letzten Worte richtete er an mich.
Ich schüttelte den Kopf. »Nein. Sicher nicht. Ihr … könnt mich loslassen. Wirklich. Ich bin schon weg.«
Brado schnaubte, schüttelte den Kopf und spuckte mir vor die Füße. Ein letztes Mal stieß er mich so unsanft gegen die Mauer, dass ich keuchte, dann ließ er mich los. »Sollten wir ein Problem bekommen, weil du uns aufgehalten hast, werde ich dich finden. Also reise am besten schnell weiter, wenn du nicht auch einer von denen da werden willst.« Er deutete auf den Zug von Jammergestalten.
Ich biss mir auf die Unterlippe und schwieg.
Der Mann ließ mich los und kehrte auf seinen Posten zurück. »Also los, weiter!«
Der Gefangenentrupp setzte sich wieder in Bewegung. Der alte Mann, dem ich aufgeholfen hatte, sah mich nicht an. Doch ich bemerkte, dass seine Schritte leichter und kräftiger waren als zuvor. Noch immer glühten meine Hände, ich spürte es, obwohl sie unter den langen Ärmeln meiner Robe verborgen waren – sicherlich mein Glück, dass die Wachen es nicht bemerkt hatten. Der Alte hielt den Blick starr auf den Nacken des Mädchens vor ihm gerichtet, während die Gruppe an mir vorbeizog. Aber ich bemerkte das leise Zucken seiner Finger, als er das Zeichen Lhirs formte – eine aus Daumen und Zeigefinger gebildete Mondsichel.
Er hatte mich erkannt.
Wie gefangen in einem düsteren Traum blickte ich der davonschleichenden Truppe nach, während die Gabe sich in mir aufbäumte und alles in mir danach schrie, diesen Menschen zu helfen. Sie zu befreien, ihre Wunden zu heilen, die körperlichen, aber vor allem die seelischen. In den Augen des alten Mannes hatte ich den Kerker gesehen, den Hunger, die Schläge. Die Ungerechtigkeit. Was war nur los hier? Wohin wurden diese Menschen gebracht? Waren es Verurteilte, die sterben würden? Oder zu Arbeitsdiensten gezwungen, bis sie vor Erschöpfung zusammenbrachen? Was hatten sie getan, um so behandelt zu werden?
Mir wurde schwindlig. Hitze strömte durch meine Adern, als hätte mein Blut sich in flüssiges Feuer verwandelt. Ich lehnte mich an die Mauer, schloss die Augen und zwang mich, ruhig zu atmen. Nach meiner ersten Heilung, im Tempel, war ich zusammengebrochen. Keine gute Idee, das hier zu tun, an einem Ort, an dem ich offensichtlich nicht willkommen war.
»Das war mutig, Fremder. Und leider, ich kann es nicht anders sagen, ziemlich dumm.« Ich fühlte eine Hand an meinem Arm, dann eine Berührung in meinem Nacken. Die Kapuze fiel zurück über meinen Kopf. »Kommt. Schnell. Ihr müsst hier weg, bevor jemand Alarm schlägt.«
»Was …?«
»Gleich. Kommt erst einmal mit.«
Die Stimme klang so resolut, wie der Griff der Hände sich anfühlte, die mich vorwärts führten und schoben. Ich blinzelte unter meiner Kapuze. »Wer seid Ihr? Warum helft Ihr mir?« Ich stolperte und spürte eine Hand unter meinem Arm, die mich stütze. Die Hand einer Frau, schmal und doch kräftig, braun gebrannt und von Runzeln überzogen.
»Gleich«, wiederholte meine Begleiterin, führte mich in eine Seitengasse und dann in noch eine und noch eine, bis ich vollkommen die Orientierung verloren hatte. Würde sie mich jetzt verlassen, würde ich eine Ewigkeit brauchen, um die Hauptstraße wiederzufinden.
Ich stolperte hinter der Frau her, bis sie schließlich innehielt, eine knarrende Tür öffnete und mich ins Innere eines nach Kräutern duftenden Häuschens zog. »Ihr hattet unverschämtes Glück«, hörte ich sie murmeln, wobei sie die Tür sorgfältig verriegelte und dann eine Öllampe anzündete.
Ich streifte die Kapuze ab. »Verratet Ihr mir jetzt, warum Ihr mich entführt habt?«
Vor mir baute sich eine kleine, ältere Frau in einem schlichten grünen Kleid auf, die mir gerade bis ans Kinn reichte. Sie blickte zu mir auf, funkelnde blaue Augen schossen Blitze. »Ich habe dich nicht entführt, Junge«, sagte sie barsch. »Ich habe dir vermutlich das Leben gerettet.«
3. Die alte Kinderfrau
Caerian
»Jetzt setz dich erst einmal hin, mein Junge. Ich koche uns einen Tee, und dann reden wir. Du erzählst mir, woher du kommst, wie es dazu kam, dass dich der Mond berührte, und dann werde ich dir erklären, warum das, was du getan hast, so eine unendlich dumme Idee war. Und warum ich so glücklich darüber bin, dass du gekommen bist! Jetzt wird alles gut! Jetzt wird endlich alles wieder gut! Durch dich, Mondberührter.«
Die Alte schenkte mir ein strahlendes Lächeln, das nun statt wilder Blitze ein schelmisches Funkeln in ihren Augen tanzen ließ. Sie drückte meine Schultern, dann ließ sie mich los und deutete auf einen rohgezimmerten Tisch und zwei niedrige Bänke davor.
Ich war vollkommen überrumpelt, sowohl von der burschikosen Freundlichkeit der alten Dame, als auch durch ihre Hilfe – und ihre Worte. »Ich verstehe das alles nicht, was … wie könnt Ihr wissen, dass ich …« Ich streifte meine Kapuze ab und rieb mir die Stirn. Ziehender Schmerz breitete sich dort aus, wie immer nach einer Heilung. Vor allem einer, die ich nicht vollständig hatte abschließen können. Alvaron hatte mich immer wieder gewarnt, eine Verbindung nie zu abrupt zu beenden, denn sie ging tief. In dem Augenblick, in dem ich dem alten Mann aufgeholfen und seinen verletzten Fuß bemerkt hatte, hatte ich gar nicht anders handeln können, als meine Heilkraft zu nutzen. Ich hatte seinen Schmerz gesehen, seinen Hunger, so viel Leid und Angst. Noch immer spürte ich den Widerhall dieser Gefühle in mir, als hätte ich einen Teil von ihnen mit in mein eigenes Leben gezogen.
Alvaron hatte davon gesprochen, dass so etwas geschehen konnte und dass ich es nach Möglichkeit nicht so weit kommen lassen sollte. Wunderbar. Es war immerhin nicht meine Entscheidung, die Heilung abzubrechen, bevor sie wirklich begonnen hatte. Immerhin hatte ich gerade wohl die Auswirkungen der Regentschaft des Blutfürsten gesehen. Menschen, die in Ketten zur Zwangsarbeit verschleppt wurden. Wenn sie es waren, deretwegen Lhir mich nach Thovara geschickt hatte – wo sollte ich dann beginnen? Und wie überhaupt an sie herankommen? Ich rieb mir noch einmal über die Stirn und sah der Alten zu, die in ihrer Feuerstelle herumstocherte.
»Gleich. Die Geschichte, die ich zu erzählen habe, ist lang, und lange Geschichten brauchen Tee. Hast du vielleicht auch Hunger?«
»Nein … danke …« Ich ließ den Rucksack von den Schultern gleiten, stellte ihn und meine Tasche neben eine der Bänke, legte meinen Umhang darauf und setzte mich. Meine Gedanken rasten wie Waldhörnchen. Ich hatte unzählige Fragen. Was ging in dieser Stadt vor?
Die Frau, die sich für ihr Alter erstaunlich behände bewegte, wuselte zur Feuerstelle, fachte die Flammen an und hängte einen Kessel mit Wasser darüber. Während sie mit den Teekräutern hantierte, sah ich mich in dem winzigen Häuschen um. Neben diesem Raum schien es noch einen weiteren und einen Dachboden zu geben, zu dem eine Leiter führte. Die Einrichtung war karg, aber sauber und ordentlich.
Von der Bank mir gegenüber erhob sich eine kleine Katze, bunt wie Herbstlaub, streckte sich und sprang zu Boden. Ich hielt ihr meine Hand hin, spürte die behutsam schnuppernde, feuchte Nase und kitzelnde Schnurrhaare. Vorsichtig strich ich über den kleinen dreieckigen Kopf und die spitzen Ohren. Ihr Fell war seidig. Sie schnurrte. Ich spürte, wie die Anspannung aus meinen Schultern sickerte, während ich dieses kleine, weiche, warme Leben streichelte, das sich zufrieden an meine Hand drückte. Die Anwesenheit der Katze tat mir auf eigenartige Weise gut. Katzen hatten so ein feines Gespür für Leute und ihre Absichten. Es sprach für die alte Frau, dass eine Katze bei ihr lebte.
Meine Gastgeberin kam zurück, stellte einen dampfenden Becher vor mir ab und setzte sich mit ihrem eigenen in den Händen auf den Platz, von dem eben die Katze aufgestanden war. Sie lächelte noch immer, doch nun schimmerte auch ein Hauch eines anderen Gefühls tief in ihren Augen. Angst? Oder zumindest Sorge? Sie sah mich an. »Bitte entschuldige, dass ich dich so überfallen habe. Aber es ist wirklich besser, sich nicht mit den fürstlichen Wachen anzulegen, das hätte dich in Schwierigkeiten bringen können in Zeiten wie diesen. Ich bin Daona Albarion. Daona reicht. Und bitte hör mit den Förmlichkeiten auf, dann fühle ich mich immer noch älter, als ich ohnehin schon bin.« Sie nahm einen Schluck Tee.
Ich nickte, immer noch ein wenig überrumpelt von ihrer ruppig-freundlichen Art und wie sie mich so einfach zu ihrem Haus geschleppt hatte. »Mein Name ist Caerian. Ich bin erst heute hier angekommen. Ich komme aus …«
»Sellian, nicht wahr? Dem Land der Kiefernwälder und Sandstrände. Dem Land der Elfen.«
»Ja.« Ich kostete den Tee, er schmeckte würzig und zugleich süß, als hätte Daona Honig hineingemischt. Ich musterte sie genauer, während sie anscheinend dasselbe mit mir tat. Eine Narbe fiel mir auf, über ihrer linken Braue, als sei die Haut dort einmal aufgeplatzt gewesen. Aus ihrem dicken grauen Zopf hatten sich einige Strähnen gelöst und umgaben im Widerschein des Feuers ihr Gesicht wie ein Strahlenkranz.
»Und Liarn hat dich berührt. Ich kann es sehen. Sein Zeichen. Ich habe sein Licht an deinen Händen bemerkt, als du diesem armen Tropf auf der Straße aufhelfen wolltest. Du bist ein Heiler.«
»Liarn? So nennt ihr den Mond hier?«
Sie nickte.
Ich berührte meine Stirn, dort, wo über meiner Nase das Zeichen der Gottheit schimmerte, wenn das Licht im richtigen Winkel auf mein Gesicht fiel. Auf wundersame Weise vertrieb Daonas Tee den aufkommenden Kopfschmerz.
»Es war vor einem Jahr ungefähr«, sagte ich. »Warum ist es gefährlich, jemandem zu helfen, der ganz offensichtlich leidet? War es, weil der Mann ein Gefangener war?«
Daonas Gesicht verdüsterte sich. »Ja. Auch. Es sind lange keine Elfen mehr hier gewesen. Warum bist du hergekommen?«
Ich legte den Kopf schief. »Hattest nicht du mir eine Geschichte versprochen?«
»Wenn es an der Zeit ist. Verzeih, aber bevor ich meine Geschichte mit dir teile, muss ich mehr über dich erfahren.«
Ich verengte die Augen. Gut, Daona hatte mich vor einem Übergriff der Wache bewahrt, dennoch schlich sich Misstrauen in meine Gedanken. Wenn ich ihr, einer Wildfremden, alles von mir erzählte, würde sie dann vielleicht doch zu dem Blutfürsten laufen und … ja, was? Mich an ihn verraten?
»Caerian. Ich muss sicher zu sein, dass ich dich in meiner Geschichte zu einem der Helden machen kann.« Sie lächelte, aber es war ein trauriges Lächeln.
»Bitte – was?« Ich, ein Held in einer Geschichte? Was für eine Geschichte sollte das sein? Wie ich die Arbeitssklaven befreite? Ich rutschte auf meiner Bank herum. Was sollte ich tun?
Daona legte eine Hand auf meinen Arm. »Entschuldige, mein Lieber. Dass du hier bist, ein Mondberührter und wahrer Heiler, könnte vieles verändern. Aber ich muss wissen, was dich hierhergeführt hat. Bitte. Du kannst mir vertrauen. Ich schwöre, ich werde dich nicht an jemanden verraten, der besser nicht wissen sollte, dass jemand wie du hier ist. Ich möchte, dass diese Stadt wieder erblüht. Dass all das Schlimme, das hier gerade passiert, aufhört.«
Ich holte tief Atem. »Du sprichst … von dem Fürsten.«
Das Lächeln verschwand. »Du hast also davon gehört.«
»Auf dem Schiff. Ja. Dass er den Verstand verloren haben soll. Dass er es sich gut gehen lässt da oben in der Burg, und seine Stadt geht langsam vor die Hunde. Es gab Gerüchte um Minen.«
Daona seufzte. »Das erzählt man sich jetzt also sogar schon auf dem Meer. Caerian, bitte sag mir, was dich hergeführt hat. Und dann werde ich dir meine Version der Geschichte vom Blutfürsten erzählen.«
Ich straffte die Schultern und sah Daona in die Augen. »Ich glaube, dass ich hier eine Aufgabe erfüllen muss.« Ich nahm noch einen Schluck Tee.
Sie hob eine Braue und wickelte sich die Spitze ihres Zopfes um einen Finger. »Was für eine Aufgabe?«
Ich hob die Schultern. »Das weiß ich nicht. Ich muss sie noch finden. Aber alle Zeichen deuteten darauf hin, dass sie mich hier in Thovara erwarten würde. Es gibt hier jemanden, der die Hilfe eines Heilers braucht, das habe ich in meinen Träumen gesehen.« Ich konnte nicht verhindern, dass mir ein Schauer über den Rücken rieselte, als ich an jenen Traum dachte, in dem der weiße Drache über dem Banner des Fürsten gekreist und es versengt hatte. Lhir würde mich doch nicht hergeschickt haben, damit ich eine Revolte gegen einen wahnsinnigen Herrscher anzettelte? Ich war ein Heiler, kein Söldner! Ich nahm den warmen Becher in beide Hände, weil mir plötzlich kalt wurde.
Daona schien für einen Augenblick zu erstarren, dann ließ ihr wunderbares Lächeln erneut ihre Züge strahlen. »Endlich«, flüsterte sie. »Endlich!« Sie berührte meine Hände. »Caerian, du ahnst nicht, wie sehr ich mich freue, dich gefunden zu haben. Es ist also wirklich wahr – dass Mondberührte dahin ausgesandt werden, wo ihre Kräfte am meisten gebraucht werden.«
»Ich habe noch nicht herausgefunden, warum Lhir mich gerade nach Thovara geschickt hat. Allerdings … bei all den Gerüchten über den Fürsten und beim Anblick des Gefangenenzuges kann ich mir vorstellen …«
Daona schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte sie leise. »Das kannst du nicht, Caerian. Du glaubst diesen Gerüchten?«
Ich hob die Schultern. »Das ist, was ich gehört habe. Das Schiff, mit dem ich gekommen bin, führt Getreide für Thovara mit sich. Die Kapitänin berichtete mir von den Missernten. Und von dem wahnsinnigen Fürsten.«
»Er ist nicht wahnsinnig!« Daonas Stimme klang wie ein Peitschenschlag.
Ich zuckte zusammen und starrte sie an.
Daona war so blass geworden, wie ich selbst gerade auszusehen glaubte. »Bitte, Caerian, verzeih. Aber … du kennst nur die eine Seite. Es gibt noch eine andere.«
Ich holte tief Atem. »Und das ist … deine?«
»Es ist Adriens. Fürst Adriens. Ich habe im Palast gelebt. Ich war ihm nahe. Sehr nahe sogar. Ich kenne ihn so gut wie mich selbst, und ich bin sehr sicher, dass er nicht wahnsinnig ist. Du bist ein wahrer Heiler durch die Berührung des Mondes, Caerian. Wenn du ihn vor dir sehen würdest, dann würdest du verstehen.« Daonas Stimme klang gepresst. Ihre Lippen zitterten. Sie blinzelte heftig und konnte nicht verhindern, dass ihr Tränen über die Wangen zu rinnen begannen. »Bitte, Caerian, hör mir zu. Liarn hat dich zu mir geschickt, da bin ich sicher. Er hat dich geschickt, damit du ihm hilfst. Meinem Fürsten. Es ist nicht er, der all diese Gesetzte erlassen hat – dass die Bettler und Obdachlosen wieder aus den Tempeln vertrieben werden. Dass sie gefangen genommen und in die Minen geschleppt werden, wenn sie beim Betteln erwischt werden. Mein Fürst hat das alles nicht getan. Die Minen, die Sklaven … das war alles nicht … er.« Daona schluckte hart. »Obwohl es sein Siegel ist, das diese Dokumente zu Gesetzen macht.«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich verstehe nicht. Was geschieht hier in dieser Stadt? Ich habe die Gefangenen immerhin gesehen. Wenn Fürst Adrien nicht dafür verantwortlich ist, wer ist es dann?« Ich hatte mich vorgebeugt und blickte in Daonas unendlich traurige Augen. Leises Kribbeln lief meine Wirbelsäule entlang, knisternd wie Katzenfell unter der streichelnden Hand. Ich spürte, dass das, was diese alte Frau mir sagen würde, wichtig war. »Diese Gefangenen … sie sahen nicht aus, als seien sie gut behandelt worden. Das hat mich erschreckt. Und die Seeleute auf dem Schiff, das mich hier abgesetzt hat, sagten, dass viele Händler inzwischen einen Bogen um Thovara machen. Die Leute auf den Straßen huschen umher wie Schatten, und überall spüre ich Angst.«
Daona drückte meine Hände und seufzte. »Fangen wir am Anfang an. Was weißt du über Thovara, Caerian?«
»Nicht viel. Ich bin vor dieser Reise noch nie weit aus Sellian fort gewesen. Alles, was ich über Thovara weiß, habe ich von Reisenden und meinem Lehrmeister erfahren, oder aus Büchern.« Ich lächelte verlegen. Auf einmal kam ich mir vor wie ein Einsiedler aus dem tiefsten Wald, der noch nie eine Stadt gesehen hatte. »Es gibt viele Bodenschätze hier. Kupfer, Smaragd und Saphir. In den Bergen wird eine besondere Traube angebaut, aus der sie hier einen fruchtigen Rotwein keltern, und das Meer soll reich an Fischen sein. An den Klippen leben Muscheln, in denen häufig Perlen wachsen. Und natürlich kenne ich die Weissagung über die Fürstenfamilie.«
Daona verzog das Gesicht und nickte. »Die Prophezeiung sagt, dass Thovara und Sellian so lange in Glück und Reichtum leben werden, wie ein Mitglied des Hauses Kiavara den Thron hält – seit der Verbindung der beiden Fürstenhäuser vor mehreren Generationen.«
Ich nickte. »Ich habe es immer für eine Kindergeschichte gehalten, wenn es auch die Verbindung wirklich gegeben hat. Unsere Chroniken im Tempel berichten darüber – wie sicherlich auch die von Thovara.«
Daona fuhr fort: »Seit dieser uralten Geschichte liegt die Herrschaft in den Händen der Kiavara, und das ist bisher auch gut gegangen. Und … wahrscheinlich ist genau diese Weissagung der Grund, warum der Fürst, der jetzt auf dem Thron sitzt … oder besser, dies der Form halber noch tut … noch am Leben ist.«
Daonas Stimme war immer leiser geworden. Das Leuchten war aus ihren Augen verschwunden, ich sah die Schatten in ihrem Blick jetzt ganz deutlich. Mir wurde schwindlig. Ich war wieder in meinem Traum, sah noch einmal den weißen Drachen das Banner auf den Burgzinnen zu Asche verbrennen. Was hatte Daona eben gesagt? Diese Weissagung ist der Grund, warum der gerade regierende Fürst noch … lebt? War es doch er, zu dem Lhir mich führen wollte? »Was ist mit dem Fürsten?«
Daona rieb sich die Augen, erhob sich und schenkte Tee nach. Dann setzte sie sich wieder mir gegenüber und umfasste ihren Becher mit beiden Händen. Sie holte tief Atem. »Caerian, was ich dir jetzt sage, ist etwas, das außerhalb des innersten Kreises des Fürsten niemand weiß. Der Rat bemüht sich, nichts davon nach außen dringen zu lassen, obwohl inzwischen die halbe Stadt ahnt, dass da oben auf der Burg etwas nicht stimmt. Ich habe deine Heilkraft gesehen, und darum will ich dir vertrauen. Liarn hat dich geschickt.« Sie atmete noch einmal tief durch. »Fürst Adrien ist krank. Sehr krank sogar. Nicht wahnsinnig. Es heißt, er leide an derselben Krankheit, die vor ein paar Jahren auch seinen Vater zu Fall gebracht hat. Wegen dieser Weissagung haben immer wieder Familienmitglieder untereinander geheiratet, so steht es in den Chroniken der Stadt – um die Blutlinie Kiavara rein zu halten und damit den Worten der Elfenprinzessin zu entsprechen. Mir ist ganz anders geworden, als ich davon gelesen habe. Jedenfalls, Fürst Adriens Vater starb an dieser Krankheit nach langem, schweren Leiden – er sagte all die Jahre, er wolle so lange durchhalten, bis sein Sohn den Thron erben könne, wirklich erben, weißt du, ohne dass in seinem Namen Regenten das Amt übernehmen, weil das Kind noch zu jung war.« Sie seufzte. »Adrien war achtzehn, als sein Vater starb, und als regierungsfähig gelten die fürstlichen Nachkommen erst mit einundzwanzig. Also übernahmen die Berater die Regierungsgeschäfte, angeführt von Rat Veldin, der schon Adriens Vater treu gedient hat. Natürlich bezog er Adrien in alle Entscheidungen ein - er war schließlich kein Kind mehr, sondern ein junger Mann, und sein Vater hat ihn gut auf die vor ihm liegenden Aufgaben vorbereitet. Alles hätte sich zum Guten wenden können, hätte nicht plötzlich auch Adrien Zeichen der Krankheit seines Vaters gezeigt. Er war dreiundzwanzig, gerade einmal zwei Jahre lang regierender Fürst, als es begann. Zuerst glaubten alle, es seien die Nachwirkungen eines besonders heftigen Lungenfiebers gewesen, die ihn so geschwächt hatten. Es war ein grässlicher Winter damals. Der halbe Hofstaat lag hustend und keuchend im Bett, auch in der Stadt waren viele krank. Doch während sich alle anderen spätestens mit dem Kommen der ersten warmen Tage wieder vollständig erholt hatten, blieb Adrien geschwächt und wurde den Husten nicht los. Im Gegenteil – es wurde immer schlimmer. Manchmal hustete er sogar Blut, und er hatte so gut wie ständig Fieber. Meist nur leicht, er schüttelte es mit einem Lächeln ab und stürzte sich in seine Arbeit. Um sich abzulenken, sagte er. Bis er eines Tages in einer Ratssitzung nach einem fürchterlichen Hustenanfall zusammenbrach. Er bekam hohes Fieber. Sein Herz wurde immer schwächer. Er sprach von Schmerzen in der Brust. Davon, dass er nicht atmen könne. Er … war so furchtbar erschöpft, und nichts und niemand konnte ihm wirklich helfen.« Daona stockte und wischte mit einer harschen Bewegung eine Träne weg.
Ich hatte mich noch weiter vorgebeugt, während sie gesprochen hatte, und jedes Wort von ihren Lippen getrunken. Meine Aufgabe hatte einen Namen bekommen. Adrien. Ich ertappte mich dabei, wie ich diesen Namen in meinen Gedanken wiederholte, und meine Fantasie versuchte, ein Bild dieses Mannes zu zeichnen. Wie mochte er aussehen? Ich sah Daona an. »Du hast gesagt, du seist ihm nahe gewesen. Du hast also auf der Burg gelebt?«
Sie lachte rau. »Gelebt? Ach Caerian. Ich war eine von denen, die Adrien am nächsten standen. Ich war die Hebamme seiner Mutter und später seine Kinderfrau. Ich habe ihn aufwachsen sehen. Habe seine ersten Jahre als Fürst begleitet und bin beinahe vor Stolz geplatzt, als er im Haupttempel offiziell gekrönt wurde.« Sie schluckte hart.
»Aber … warum bist du dann nicht in der Burg?« Ich spürte doch, wie sehr ihr die Erinnerungen nahegingen. Sie hatte geweint, als sie von Adriens Krankheit gesprochen hatte. Warum war sie nicht bei ihm geblieben? Was war geschehen? Daona sprach mit so viel Liebe von diesem Fürsten, dass mein Misstrauen zu bröckeln begann. Sie hatte ja recht – ich kannte nur eine Seite. Gerüchte, die ich auf einem Handelsschiff aufgeschnappt hatte. Andererseits bekam ich auch das Bild der angeketteten, zerlumpten Gefangenen nicht mehr aus dem Kopf.
Daona nahm einen Schluck Tee. »Er hat mich weggeschickt«, sagte sie leise. »Weil er Angst um mich hatte.«
»Warum?«
Daonas Beherrschung zerfiel immer mehr. Die alte Frau schniefte und zog ein Tuch aus den Tiefen ihrer Rocktasche, mit dem sie sich das Gesicht abwischte und die Nase putzte. »Bei Liarn, ich habe ihn geliebt, und ich liebe ihn immer noch, als sei er mein eigenes Kind. Aber in der Burg änderte sich alles, als diese eliarische Magierin an den Hof kam und Veldin sie schon nach kurzer Zeit in den Rat berief. Du weißt von den Bodenschätzen in dieser Gegend. Es gab in den vergangenen Jahren so viele Grubenunglücke, dass Adriens Vater beschloss, die meisten Bergwerke zu schließen. Der Abbau wurde zu gefährlich. Ich erinnere mich, dass Veldin mit Adrien darüber gesprochen hat, weil die Steine und das Kupfer unsere wichtigsten Handelswaren sind. Und dann tauchte eines Tages diese Frau wie aus dem Nichts auf und bot ihre Dienste an – als Heilkundige und als Erd-Elementalistin. Adrien hatte die Minen geschlossen halten wollen, weil er wie sein Vater die Arbeiter nicht gefährden wollte. Stattdessen hatte er darauf gedrängt, den Ausbau der Weinberge voranzutreiben, und sich um die Pferdezucht bemüht.«
Von thovarischen Kaltblütern hatte ich genauso gelesen wie von den Steinen und dem Wein aus den Bergen – stämmige Tiere sollten das sein, mit großen Hufen voller langer Haare, breiten Rücken und sanftem Wesen. »Was ist dann passiert?« Ich war gefangen von dieser Geschichte, und zugleich abgestoßen von dem Geruch nach Intrigen und Machtspielen, der an ihr hing.
»Da die Magierin Samra beteuerte, die Minen sicher machen zu können mit ihrem Erdzauber, ließ Adrien sich darauf ein, und Samra blieb in der Burg. Sie unterstützte die Alchimisten und Ärzte, wenn sie nicht in den Minen war. Und zuerst sah es auch so aus, als würden ihre Heiltränke helfen. Veldin war vollkommen fasziniert von ihr.« Daona verzog den Mund, als hätte sie auf eine saure Frucht gebissen. »Er war dauernd in ihrer Nähe. Sie verbrachten die Abende zusammen in dem Labor, das er Samra zur Verfügung gestellt hatte. Ich bemerkte, dass er ihr Blumen schenkte und mit ihr durch die Gärten spazierte und sie Seliree nannte, das bedeutet in der Sprache Eliars Geliebte. Er hatte sich anscheinend Hals über Kopf in diese Frau verliebt. Und ich bin mir sicher, dass er dabei irgendwo einen Großteil seines Verstandes verloren hat. Ich traute Samra nicht, und ich misstraue ihr immer noch.«
Mir schwirrte der Kopf bei all den neuen Namen. »Warum? Was hat sie getan?« In mir wuchs ein Gefühl von Dringlichkeit. Mit jedem Wort, das Daona sprach, spürte ich mehr und mehr, dass es Fürst Adrien sein musste, zu dem Lhir mich führen wollte. Er war der Schlüssel. Er brauchte einen Heiler – und seine Stadt ebenso.
»Veldin begleitete sie bei ihren Besichtigungen in den Bergwerken. Und nur wenige Wochen später begannen die Arbeiten in der Saphirmine Blauer Himmel wieder. Kurz darauf wurde auch Kupferhort wieder geöffnet, und als letzte die Smaragdmine Durons Wald. Kurz vor dem Tod des alten Fürsten waren dort zwanzig Arbeiter zu Tode gekommen. Ein Stollen war eingebrochen. Niemand von denen, die dort gearbeitet hatten, kamen heraus.«
Ich schluckte. Ich würde niemals freiwillig in so einen Stollen gehen, und der Gedanke daran, dort unten gefangen zu sein, vielleicht verletzt, hilflos, bescherte mir ein unangenehmes Ziehen im Magen. »Was passierte dann?«
Daona suchte nach Worten. »Was ich jetzt sage, das ist … nur ein Verdacht. Nichts davon ist bewiesen. Wie ich schon sagte, schienen Samras Heilversuche zunächst wirklich Linderung zu bringen. Doch irgendwann …« Sie schüttelte den Kopf, fuhr sich mit der Hand über die Augen. »Ich besuchte meinen Adrien jeden Tag. Manchmal ging es ihm besser, manchmal schlechter, an wenigen Tagen so gut, dass er den Ratssitzungen beiwohnen konnte oder zumindest an seinem Schreibtisch sitzend in der Lage war, Veldins Bericht anzuhören und all die Unterlagen durchzusehen, die ihm vorgelegt wurden. Aber diese guten Tage wurden immer seltener. Irgendwann traf ich Adrien nur noch in seinem Schlafgemach an, weil er zu schwach war aufzustehen. Er bekam wieder häufiger Fieber. Sein Husten wurde schlimmer, und wenn der ihn nicht quälte, dann war es sein schwaches Herz.« Sie presste einen Moment lang die Lippen zusammen. »Ich … ich begann, Nachforschungen anzustellen. Von dem Fenster meiner Kammer aus konnte ich den Burggarten überblicken, also auch die Kräuterbeete. Und was Veldin und Samra da ab und an sammelten, machte mich stutzig. Ich sprach mit Adrien, ich sprach mit den Ärzten am Hof, den Bediensteten. Und in mir wuchs der Verdacht, dass …« Sie stockte. Sah mich an. »Caerian, ich kenne dich erst seit einem Augenblick. Aber du bist ein Berührter. Du bist ein Heiler. Und darum glaube ich fest daran, dass ich dir vertrauen kann.«
Ich war selten um Worte verlegen, aber jetzt wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Ich fühlte mich geehrt, zugleich fragte ich mich, ob ich mich Daonas Vertrauen würdig erweisen konnte, und ob ich ihr ebenso vertraute wie sie anscheinend mir. »Was für ein Verdacht?«
»Dass Adriens Krankheit keinen natürlichen Ursprung hat.«
Ich nickte. »Aber du sagtest, dass auch sein Vater krank war. Könnte es nicht … dasselbe sein?«
»Nein.«
Die Antwort kam so heftig, dass ich zusammenzuckte.
»Entschuldige. Aber nein, ich bin mir sehr sicher, dass Adriens Krankheit nichts mit der seines Vaters zu tun hat. Mein Verdacht ist ein anderer. Ich glaube, dass all die Tränke, die Veldin ihm inzwischen mit Samras Hilfe zubereitet, ihm nicht mehr helfen. Im Gegenteil. Ich glaube, sie machen alles nur schlimmer, auch wenn es im ersten Moment immer danach aussieht, als würden sie wirken. Ich habe es selbst gesehen. Dass er das Zeug getrunken hat und danach plötzlich aufstehen konnte, nur, um dann spätestens zwei Tage später wieder mit brennendem Fieber und nach Atem ringend im Bett zu liegen.« Daona fuhr sich durch die Haare und ruinierte ihren Zopf. »Aber ich konnte nichts beweisen. Je mehr ich nach Hinweisen suchte, umso häufiger passierten mir plötzlich … Dinge.«
»Was für Dinge?« Ich war inzwischen so angespannt, dass ich beinahe flüsterte.
»Als ich auf der Treppe auf einem Ölfleck ausrutschte, dachte ich mir noch nichts dabei. Da war wohl jemand vom Personal unachtsam und hat etwas verschüttet. Aber sie häuften sich, diese kleinen Zwischenfälle.« Gedankenverloren rieb Daona die Narbe an ihrer Stirn. »Diese Verletzung konnte ich vor Adrien nicht verbergen. Er begann, Fragen zu stellen. Und eines Tages war seine Angst um mich so groß geworden, dass er mich geradezu anflehte, die Burg zu verlassen. Also … ging ich schließlich, und ich hasse mich noch immer dafür, dass ich ihn allein gelassen habe. Ich flüchtete wie eine Diebin bei Nacht und Nebel. Es gibt außer Adrien nur noch zwei Menschen in der Burg, die wissen, dass ich noch lebe und wo ich bin. Eine von ihnen hat mir geholfen, diese Unterkunft zu bekommen. Ich verstecke mich hier wie eine Füchsin in ihrem Bau, wenn die Jäger kommen, und suche heimlich nach einer Möglichkeit, meinem Fürsten zu helfen. Und dann streife ich eines Tages durch die Stadt und finde dich … einen Liarn-Berührten. Einen wahren Heiler. Und ich danke dem Mond auf Knien dafür!«
4. Flüsternde Stimmen
Adrien
Mir ist kalt. Mir ist so unendlich kalt!
Ich konnte nicht verhindern, dass meine Zähne klapperten. Ich fror, doch zugleich hatte ich das Gefühl, als würde in meiner Brust eine sengende Flamme lodern. Wie in den Geschichten über diese eliarische Insel der Dämonen, die mir mein Vater erzählt hatte. Dort sollte es Feuer speiende Berge geben, aus denen flüssiges, glühendes Gestein strömte, um auf dem Schnee und Eis des Landes zu erkalten und dabei Wolken aus Dampf aufsteigen zu lassen. In meiner Brust tobte ein solcher Feuerberg, und meine Haut war das Eis, auf dem die Lava erstarrte.
Halb schlafend dämmerte ich dahin. Immer wieder vernahm ich Geräusche – leise Schritte, das Knarren einer Tür, raunende Stimmen. Etwas knisterte, klirrte leise, ein Gewand raschelte, als jemand sich bewegte. Ich konnte nicht erkennen, wer da sprach, dazu waren die Stimmen zu leise. Sie kamen und gingen, wie die rollenden Wellen auf den Felsen unter meinem Zimmer.