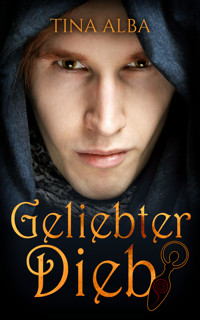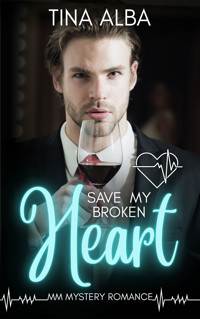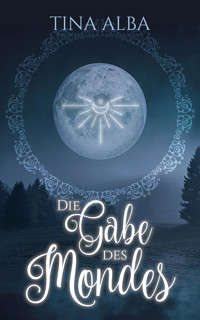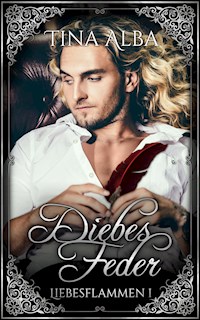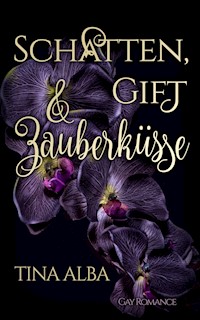4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Zwei Helden, vom Schicksal zusammengeführt! Zwei Herzen, eine Bestimmung! Das Autorenkollektiv "Die Uferlosen" präsentiert: "Seelengefährten". In jedem Buch wird das Thema neu interpretiert, aber eins haben alle Bände gemeinsam: Sie gehen direkt ins Herz. So alt wie die Welt: der Krieg zwischen Licht und Finsternis. Den lichten Shirjana und den dunklen Vinashu ist es gelungen, aus dem ewigen Kreis des Kampfes auszubrechen und ein Gleichgewicht zu finden: Jeder Shirjana findet in einem Vinashu seinen Seelengefährten. Der feinfühlige Shirjana Ayas schlägt sich mit Selbstzweifeln herum: Obwohl er bereits ein Mann ist, hat er seinen dunklen Gefährten bisher nicht gefunden. Noch dazu plagen ihn Albträume, die ihn immer wieder an denselben Ort führen: mitten hinein in eine blutige Schlacht. Als beim jährlichen Treffen der Völker die Abordnung des Sand-Clans ausbleibt, befürchten die Ältesten eine Verbindung zu Ayas’ Träumen. Zusammen mit einer Kundschaftergruppe schicken sie ihn aus, um nach den Vermissten zu suchen. Als Ayas dabei endlich seinem dunklen Seelenbruder begegnet, findet er so viel mehr. Denn auch Khasrir hat Träume, die den sonst so stolzen, selbstsicheren Grenzwächter bis ins Mark erschüttern, führen sie ihn doch auf dasselbe Schlachtfeld, das auch Ayas im Schlaf immer wieder betritt. Gemeinsam machen sich die Seelengefährten auf, um ihren Träumen auf den Grund zu gehen – und stoßen auf ein uraltes, entsetzliches Geheimnis …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Für meinen Vater, der mich die Liebe zu Büchern gelehrt hat. Ohne ihn hätte ich nie angefangen zu schreiben.
Kriegerblut
Tina Alba
Roman
Impressum:
Tina Alba c/o WirFinden.Es Naß und Hellie GbR Kirchgasse 19 65817 Eppstein
www.tina-alba.de/wordpress
Cover: Sylvia Ludwig, www.cover-fuer-dich.de und Regina Mars
Grafiken:
Elvish warrior and protector of the forest: Stepan Kapl/shutterstock.com
Portrait of young African man: G-Stock Studio/shutterstock.com
Dragon wings - Illustration : Tribalium/shutterstock.com
Wing icons vector set: vecktor/shutterstock.com
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Menschen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
1.
Der fünfte Clan
Ayas fühlte Kälte in seinen Kragen kriechen, als hätte der Nebel spinnendünne, knochenlose Finger, die sich unter seine Kleidung schoben. Tastend, klamm, eine ekelhaft schleimige Berührung. Zitternd rieb Ayas sich die Hände und blickte sich gehetzt um. Hatten da nicht Äste geknackt? Flüsterte da nicht ein Raunen durch die abgestorbenen Äste der Bäume, deren schwarze Blätter wie verbrannt wirkten und sich doch standhaft weigerten, auf den Boden zu fallen?
Unter Ayas’ Füßen federte der feuchte Waldgrund, gab bei jedem Schritt schmatzend seine in durchnässten Stiefeln steckenden Füße frei, als wollte er sie festhalten. Ayas’ Atem bildete in der Kälte dünne Wolken vor seinem Mund. Er atmete schon lange nicht mehr durch die Nase, um dem allgegenwärtigen Brodem von Tod und Verwesung zu entgehen, der ihn umgab wie ein Mantel.
Ayas wollte nicht weitergehen. Und doch setzte er wie von fremder Macht gelenkt einen Fuß vor den anderen, näherte sich unausweichlich diesem Ort, den er nicht betreten wollte, nie wieder. Mit scharfen Krallen bohrte sich die Angst in sein Herz. Sie riss an ihm, als wollte sie Stücke aus seiner Seele zerren, um sie dann leise kichernd zu verschlingen.
Aus der Ferne drangen Waffenklirren, donnernder Hufschlag und Gebrüll an Ayas’ Ohren. Er hielt inne, stemmte die Füße in den Boden. Nicht dorthin. Nicht schon wieder.
Der Ort zog ihn an wie Himmelsstein einen eisernen Nagel. Ayas ging weiter, Schritt für Schritt, immer weiter auf die Quelle des Lärms zu. Bald würde er sie sehen, die Krieger, die Hellen und die Dunklen, würde ihre Schreie hören, ihr Fluchen und Klagen. Würde durch ihr Blut waten.
Etwas Kleines, Glitzerndes schoss auf Ayas zu, viel zu schnell, als dass er noch hätte ausweichen können. Er schrie, als das Ding sich in seine Brust bohrte und eine eiskalte Spur durch sein Herz schlug.
Ayas riss die Augen auf, schnappte nach Luft und versuchte, die Umklammerung seiner Decken loszuwerden, in die er sich vollkommen eingewickelt hatte. Von der Schlafstatt neben seiner drang unwilliges Gebrummel an seine Ohren, als Levna sich auf die andere Seite wälzte und das Gesicht an Ebons Schulter drückte.
Ayas atmete zitternd durch und richtete sich auf. Durch die Fenster der kleinen Hütte drang sanftes Schimmern des ersten Tageslichtes und malte Muster auf Möbel und auf Schlaflagern zusammengerollte Gestalten. Sie alle hatten eine lange Nacht hinter sich. Ayas hätte gern noch ein wenig geschlafen, aber … Er vergrub das Gesicht in den Händen und unterdrückte ein Stöhnen. Schon wieder dieser Traum. Immer wieder, als würde dieser grauenhafte Ort ihn verfolgen. Blutgeruch füllte seine Nase, in seinen Ohren hallten die Schreie wider, als hätten sie sich an ihm festgekrallt. Ayas wusste, dass er nicht wieder einschlafen würde. Und falls doch, dann nur, um den Träumen wieder zu begegnen, und er wollte alles, nur nicht das. Er rieb sich das schweißnasse Gesicht, strich sich eine lange weißblonde Strähne aus dem Gesicht, die sich aus seinem locker geflochtenen Zopf gelöst hatte, und wickelte sich vollends aus den Decken. Leise stand er auf, fischte ein leichtes Übergewand aus dem Kleiderhaufen neben seinem Bett und schlich aus der Hütte. Erst, als er die Tür hinter sich geschlossen hatte, atmete er auf.
Stille umgab ihn. Leiser Wind streichelte seine nackte Haut und strich durch sein Gefieder, als er die Schwingen entfaltete, auch sie schweißfeucht und wie vollgesogen mit dem Geruch von Angst und Albträumen. Einige Atemzüge lang stand Ayas nur da, ließ seine Federn vom Wind trocknen und lauschte dessen Wispern und dem Gluckern des Bachs, der sich am Platz der Zusammenkunft entlang schlängelte.
Nach einer Weile warf er das Gewand über und knotete den Gürtel locker um seine Hüften. Ein langer Schlitz am Rückenteil ließ Platz für die Flügel, die Ayas ausschüttelte und wieder faltete, bevor er sich vor dem Haus auf der Bank niederließ. Leise schaudernd schlang er die Arme um den schmalen Körper. Trotz der warmen Sommerluft fror er. Wie immer, wenn er diesen Traum gehabt hatte. Wie jeden Morgen. Ayas blinzelte, kniff die Augen zu, schluckte gegen die Enge in seiner Kehle. Er sehnte sich nach Armen, die ihn hielten. Nach einer Stimme, die ihm sanft zuraunte, dass alles gut werden und die Träume irgendwann wieder verschwinden würden. Aber er war allein. Noch immer allein. Ayas ballte die Hände zu Fäusten, grub die Fingernägel in die Handflächen. Brennender Neid wogte in ihm auf, als er sich zur Hütte umwandte, in deren Schutz die anderen Abgesandten des Nordwald-Clans noch tief und fest schliefen, aneinander gekuschelt, in den Armen des Gefährten, in der wärmenden Nähe des Seelengefährten oder der Seelengefährtin, des dunklen Vinashu, der ihm so sehr fehlte. Erst mit seinem Vinashu an der Seite würde Ayas sich ganz fühlen, das wusste er spätestens seit dem Moment, in dem er gesehen hatte, wie Levna gestrahlt hatte, als Ebon sie das erste Mal angesehen hatte. Er und Levna waren die einzigen Ungebundenen in der achtköpfigen Gruppe gewesen, und noch am selben Tag, als sie den Platz der Zusammenkunft erreicht hatten, war sie über Ebon vom Sonnen-Clan gestolpert und hatte ihren Seelengefährten gefunden. Ihre dunkle Seite, die sie erst vollkommen ganz machte. Natürlich hatte Ayas sich für seine Clanschwester gefreut, ebenso wie für seine ehemalige Clanschwester Sarvi, die vor einem Jahr ihren Shirjana-Seelengefährten Mirr vom Sternen-Clan auf der Versammlung gefunden hatte und jetzt stolz ihren gerundeten Leib vor sich her trug und jedem, ganz gleich, ob er es wissen wollte oder nicht, davon erzählte, wie sehr sie und Mirr sich auf das Kind freuten und schon Wetten abschlossen, ob es Shirjana -oder Vinashu-Erbe in sich tragen würde. Aber es erfüllte ihn ebenso mit Bitterkeit. Seit mehreren Jahren schon schickten die Ältesten seines Clans ihn zu den Zusammenkünften der fünf Zweivölker-Clans, in der Hoffnung, er würde endlich seinen Seelengefährten finden – so sehr er sich auch danach sehnte, überhaupt seinen Vinashu zu finden, so wünschte er sich doch heimlich, dass ein anderer Mann sein Gefährte sein würde. Doch Jahr um Jahr kehrte Ayas allein nach Hause zurück, sobald die Rituale vollzogen, die Geschichten erzählt und die Bündnisse erneuert worden waren. Ayas musste sich zusammenreißen, um nicht mit der geballten Faust auf die Tischplatte zu schlagen, so sehr nagte die Enttäuschung an ihm.
Er atmete tief durch und ließ den Blick über den Versammlungsplatz in der Mitte des kleinen Hüttendorfes schweifen, das nur einmal im Jahr, in der Zeit um den ersten Vollmond im Sommer, bewohnt und voller Leben war. Dann, wenn die fünf Zweivölker-Clans sich trafen, um sich zu erinnern, Geschichten zu erzählen und den alten Bund zwischen Vinashu und Shirjana zu erneuern und neue Seelenbänder zu segnen.
Ayas’ Blick wanderte wie magisch angezogen zu der Statue auf dem Versammlungsplatz, geschnitzt aus Mallrenbaumholz, das hart und beständig wie Fels war und ebenso steingrau schimmerte. In jedem Jahr bekam die Statue einen frischen Anstrich, weiß und schwarz, Zeichen für Licht und Dunkel. Ayas betrachtete die Abbilder der ersten Seelengefährten, die sich vor so vielen Jahrhunderten gefunden hatten, damals, als der Krieg zwischen Licht und Dunkel beinahe die ganze Welt in Schutt und Asche gelegt hätte: Miral, die schwarzhäutige, drachenflügelige Vinashu, lebendige Finsternis, und Treon, der lichte, strahlende Shirjana mit den weißen Schwanenschwingen. Tag und Nacht in einer ewigen Umarmung, eins. Das Zeichen für den Bund, den Vinashu und Shirjana geschlossen hatten, als ihre Ältesten die Sinnlosigkeit eines Krieges erkannt hatten, in dem es keinen Sieger geben durfte. Über eintausend Jahre war dieses Standbild schon alt, und ebenso lange kamen Shirjana und Vinashu an diesen Ort der Versammlungen, um die Einheit der zwei Völker zu feiern und sich daran zu erinnern, wie sie für sich den ewig währenden Krieg beendet hatten. Ayas kannte die Geschichten alle, Wort für Wort, er liebte es, sie zu hören, und sehnte sich danach, sie einst genauso erzählen zu können wie die Ältesten der fünf Clans. Doch noch mehr sehnte er sich danach, endlich den Vinashu zu finden, der für ihn bestimmt war, der seine dunkle Seite sein sollte und sein Leben endlich ins Gleichgewicht bringen würde. Mit dem er eins sein konnte, so wie die Zwei Völker seit Jahrhunderten eins waren.
Ayas seufzte, stand auf und wanderte langsam zu dem Standbild hinüber. Vor zwei Nächten hatten sie dort gemeinsam gefeiert, Abordnungen aus vier Clans, die bereits am Ort der Zusammenkunft angekommen waren. Sie hatten Levna und Ebon gratuliert, die Ältesten hatten ihren Bund unter dem Standbild der ersten Seelengefährten gesegnet, Geschichten erzählt und alle gemeinsam Speise und Trank geteilt. Ayas hatte viele Freunde unter den Shirjana und Vinashu der anderen Clans, er hatte sich auf das Wiedersehen gefreut und bei jedem fremden Vinashu auf dieses Etwas gehofft, das ihm sagen würde, dieser oder jene sei endlich die ersehnte zweite Hälfte seiner Selbst. Und war jedes Mal wieder enttäuscht worden. Langsam wandelte sich die Niedergeschlagenheit in Ayas in Wut. »Warum lässt du mich immer noch warten, Miral, Älteste, Erste Seelengefährtin unter den Vinashu? Warum schickst du allen Shirjana meines Clans ihre Seelengefährten, nur mir nicht?« Er schnaubte. Ich werde auch dieses Mal wieder keinen finden … denn auch wenn der Sand-Clan noch kommt, von ihnen kann es keiner sein. Es war wie ein ungeschriebenes Gesetz, das alle Shirjana und Vinashu kannten – der Sand-Clan stellte die Wächter, und die Wächter mischten sich nicht mit den anderen Clans, sie fanden immer ihre Seelengefährten unter Ihresgleichen und blieben unter sich, dort am Rand des Clanlandes, wo die Steppe in rote Wüste überging. Seit aus zwei Völkern aus Licht und Dunkel das eine Zweivölker-Volk geworden war, seit sich die ersten Seelengefährten noch im Großen Krieg verbunden hatten, um auf ihre Weise dem ewigen Kreislauf des Streits zwischen Tag und Nacht zu entrinnen, hatten die Wächter immer nur Seelengefährten unter den Wächtern gefunden, oft schon im Kindesalter. Ayas wusste, dass er unter Sand-Clan-Vinashu gar nicht zu suchen brauchte – es gab dort niemanden, der für ihn bestimmt war.
Sein Blick klebte geradezu an der Statue. Miral und Treon waren nicht nur die ersten Seelengefährten gewesen – sie waren auch die ersten Wächter, denen es oblag, die Grenzlande zwischen den alten Schlachtfeldern des Großen Krieges und dem Land der Shirjana und Vinashu zu schützen, nachdem der Krieg nach Jahren des Schlachtens und Mordens ein Ende gefunden hatte. So berichteten es die alten Legenden. Inzwischen glaubte keiner mehr, dass von den ehemaligen Schlachtfeldern noch Gefahr drohte – sie waren Ödland, auf dem kaum noch etwas Lebendes gedieh, wo vielleicht kleine hässliche Echsen zwischen feuergeschwärztem Gestein umherhuschten und durch die dort noch herrschende wilde Magie immer hässlicher wurden. Dennoch war es dabei geblieben: Der Clan der Roten Wüste, die zwischen Clanland und ehemaligen Schlachtfeldern lag, bewachte die unsichtbare Grenze noch immer, hütete sie und sorgte dafür, dass niemand dieses durch vergossenes Blut und wilden Zauber verfluchte Land betrat. Der Sand-Clan war und blieb etwas Besonderes.
Ayas seufzte. Ich bin wohl auch etwas Besonderes, immerhin bin ich der einzige Shirjana, der keine Heilergabe besitzt. Ist es das? Bleibe ich deswegen allein? Was stimmt mit mir nicht? Warum erkennt mich niemand? Warum bin ich immer noch allein und ungebunden? Soll ich denn allein sterben? Ohne Seelengefährten? Der Gedanke tat so weh, dass Ayas zusammenzuckte und eine Hand auf die Brust presste. Als würde sein Herz einen Schlag aussetzen, sich zusammenkrampfen und dann erst stolpernd wieder zu schlagen beginnen.
Er schnappte nach Luft und sank auf eine der Bänke unter Mirals hölzernen Schwingen. Noch immer schimmerte Glut in der Feuerstelle, um die sie an den Abenden zuvor singend getanzt hatten. Hier und da lagen weiße Federn, die sich im wilden Reigen aus Shirjana-Flügeln gelöst hatten. Ayas starrte auf seine Finger und atmete zittrig ein. Lichtweiße Haut, die sich nach der Berührung dunkelgeschuppter Vinashu-Hände sehnte, so sehr, dass sie brannte. Ein Schauer rieselte über Ayas’ Rücken. Er zog sein dünnes Gewand enger um sich und angelte nach einer Decke, die jemand nach der Feier draußen liegen gelassen hatte. Die weiche Waldschafwolle wärmte, aber sie war nichts gegen die Berührung eines lebenden Wesens. Eines Gefährten. Eines Seelengefährten.
Es ist, als würdest du dich selbst in den Augen des anderen sehen wie in einem Spiegel, hatte Levna geschwärmt, und du hast die vollkommene Gewissheit, dass dieser andere dich versteht, so wie du dich sonst nur selbst verstehen kannst. Du siehst ihn an und weißt, dass er ist, was dir dein Leben lang gefehlt hat. Du kannst es spüren, dieses Band, als würde es sich unsichtbar von Herz zu Herz ziehen. Du bist eins mit ihm und weißt, dass du nie wieder allein sein wirst, bis der Tod kommt. Und auch dann wirst du nicht allein sein, denn du weißt, dass du diesen Weg mit ihm zusammen gehen wirst, mit deinem Gefährten. Zwei wie eins. Wir atmen wie eins, unsere Herzen schlagen wie eins.
»Ich will das auch. Miral, ich bitte dich, schick mir meinen Seelengefährten. Bitte lass mich nicht allein sterben. Ich habe davor noch mehr Angst als vor diesen verdammten Träumen!«
»Ayas!«
Die Stimme ließ Ayas zusammenzucken und aufspringen. Er atmete erleichtert auf, als er Merinn erkannte, eine der Ältesten seines Clans.
Sie lächelte, sanft und ruhig wie immer. Ihre Bewegungen waren wie fließendes Wasser, als sie sich neben Ayas unter der Statue niederließ und die Hände der noch warmen Feuerstelle entgegenstreckte. »Mein Lieber.« Forschend blickte sie ihn an, musste sehen, wie übernächtigt er sich fühlte. »Wieder diese Träume?«
»Jede Nacht. Es ist nicht besser geworden, Älteste, eher schlimmer. Ich bin aufgestanden, weil ich die anderen nicht stören wollte. Levna war kurz davor, ihr ganzes Bett nach mir zu werfen – mit Ebon darin.« Er wich Merinns Blick aus und starrte in die Feuerstelle und auf die um sie herum liegenden Steine, in die Generationen vor ihm jemand Darstellungen aus dem Krieg gemeißelt hatte. Wenn das Feuer brannte, wirkten sie, als würden die Geflügelten, die Einhorn-Reiter und Schwertkämpfer sich bewegen. Kämpfen. Ayas schauderte. Er konnte die Bilder nicht bewundern wie seine Gefährten und Freunde, denn immer, wenn er hier am Feuer saß, sah er die Krieger einen grotesken Reigen tanzen und glaubte, ihre Schreie zu hören.
Merinn legte behutsam eine Hand auf seine. »Ich kann auch nicht mehr schlafen«, sagte sie leise. Ihre Federschwingen raschelten, als sie eine bequemere Position suchte.
Sie klang so besorgt, dass Ayas aufsah. Merinns ewig junges Gesicht mit den uralten Augen wirkte blasser als sonst, beinahe durchscheinend hinter dem Vorhang silbriger Locken.
»Was hält dich wach, Älteste?«
»Der Sand-Clan. Seine Abgesandten hätten schon längst hier sein müssen. Wir hätten alle gemeinsam ankommen sollen, wie immer. Dass die Wächter noch nicht da sind, macht uns Sorgen. Wir haben Wind- und Flussbotschaften gesendet, seit wir das Gefühl haben, sie seien überfällig, aber nicht eine davon wurde beantwortet. Und ich weiß, wie stark ihre Magie ist.« Sie hob den Kopf und sah Ayas an. »Wir befürchten, dass etwas geschehen ist. Etwas so Schwerwiegendes, dass sie uns noch nicht einmal eine Nachricht senden konnten. Und wenn die Wächter verstummen, dann kann das nur eines bedeuten.« Sie schwieg vielsagend.
Ayas fühlte sich wie ein Kind unter Merinns waldgrünem Blick. »Glaubst du wirklich«, fragte er leise, »dass es mit dem Land jenseits der Wüste zu tun hat? Dass etwas von den Schlachtfeldern kommt?«
In Merinns Blick lag so viel Ernst. Die milden Furchen in ihrem Gesicht, das sonst so alterslos wirkte, schienen sich über Nacht vertieft zu haben und sprachen deutlich von Merinns Sorge.
»Du willst sagen, dass nach so langer Zeit doch noch etwas von dort uns bedrohen will? Nach über tausend Jahren?« Ayas fühlte seine Hände kalt werden. Natürlich konnte ein Ort, an dem mächtige Völker des Lichts und der Dunkelheit in blutigen Schlachten voller Beschwörungen und verzauberter Waffen gefochten hatten, immer noch seine wilde Magie in die Welt atmen. All der Stahl, geführt von Wesen, die alle ihren eigenen, tiefen und uralten Zauber in sich trugen, lag noch immer dort begraben. Ebenso wie die Gefallenen. Natürlich konnte all dasdie Lebenden immer noch bedrohen. Ayas schluckte. Krieg, Kampf, Blutvergießen, mächtiges, uraltes Hexenwerk. Das, wovon er jede verdammte Nacht träumte. Seit Wochen schon. Er sah auf. »Glaubst du, meine Träume haben damit zu tun?« Er wollte die Antwort nicht hören, weil er ahnte, was Merinn sagen würde, und doch wartete er begierig darauf, dass sie wieder sprach.
»Ich habe den Ältesten der anderen Clans von deinen Träumen berichtet«, begann sie nach einer Weile. »Deine Träume und das Schweigen des Sand-Clans machen auch ihnen große Angst. Etwas muss in Bewegung geraten sein. Wir sind uns sicher, dass es mit dem Land jenseits der Wüste zu tun hat. Dass dort etwas erwacht ist, was selbst unsere Wächter nicht haben kommen sehen. Und darum haben wir beschlossen, Kundschafter zu schicken, die nach den Boten des fünften Clans suchen sollen. Und weil du der bist, der träumt, möchte ich, dass du sie begleitest.«
»Aber …« Ayas hielt inne. Es gehörte sich nicht, einer Ältesten zu widersprechen. Doch jetzt zu gehen, bedeutete, nicht weiter nach einem Seelengefährten unter den anderen Abgesandten suchen zu können. Noch hatte er nicht mit allen ihm noch fremden Vinashu gesprochen, noch gab es Hoffnung, noch … er biss sich auf die Zunge und nickte, auch wenn er nicht sicher war, wie er mit seinen Träumen den Kundschaftern helfen sollte. Sie führten ihn in keine bestimmte Richtung. Immer zeigten sie ihm dieselben Bilder, aber er konnte nicht sagen, wo sich all das Schreckliche abspielte, was er in seinen Nachtbildern sah. »Natürlich, Älteste. Wenn ich helfen kann, werde ich natürlich mit den Kundschaftern gehen. Auch wenn ich nicht genau weiß, wie.«
»Ach, Ayas. Ich weiß doch, dass du lieber hierbleiben willst. Ich hoffe doch auch in jedem Jahr, dass du die andere Hälfte deiner Seele endlich findest.« Sie streckte die Hand aus und strich ihm über das Haar, dann drückte sie sanft seine Schulter. »Aber deine Gabe kann helfen. Ich weiß, wie genau du fühlen kannst, was andere empfinden, wenn du es willst. Du kannst Leben spüren. Gefühle. Falls der Sand-Clan in Gefahr ist, falls sie vielleicht überfallen oder gefangen und verschleppt wurden, dann kannst du sie finden, auch wenn sie verborgen werden oder sich selbst versteckt halten. Und mit deinen Träumen, Ayas, bist du ein Seher.« Ernst blickte Merinn ihn an und strich dann leicht über seinen zerzausten Zopf. »Lange hat es keine Seher mehr gegeben. Auch wenn du noch nicht weißt, was genau deine Träume dir zeigen wollen, denke ich, dass du diese Gabe besitzt.«
»Ich? Ein Seher?« Ayas starrte Merinn an. »Ich habe mich in den letzten Wochen nur als einen durch Albträume verwirrten Narren gesehen, der schon ein Mann ist und immer noch auf seinen Seelengefährten wartet.« Er senkte den Blick und verknotete seine Hände. »Glaubst du, dass ich noch jemanden finde, Merinn?«
»Aber natürlich!« Jetzt lächelte sie.
»Aber ich warte schon so lange. Langsam glaube ich, dass etwas an mir … nicht richtig ist. So wie die Heilergabe. Ich bin ein Shirjana. Und ich kann nicht heilen? Was haben die Götter sich dabei nur gedacht?« Für einen Augenblick spürte Ayas den Drang in sich, aufzuspringen und wegzurennen, zu laufen, bis er sich all seine Wut, seine Enttäuschung und sein Selbstmitleid von der Seele gerannt hatte.
»Du bist nicht der Erste ohne die Heilergabe, junger Freund«, gab Merinn ruhig zurück. »Zugegeben, Shirjana ohne diese Fähigkeiten sind selten. Aber alle Shirjana, die ohne die Gabe geboren wurden, waren auf ihre Weise etwas Besonderes. Du kannst Leben und Gefühle spüren, und deine Träume werden dich eines Tages leiten – vielleicht schon bald. Möglicherweise sind sie der Schlüssel zu dem, was uns ziemlich sicher bedroht. Du bist wichtig, Ayas.«
Ayas musste sich zusammenreißen, um nicht zu schnauben. »Wichtig … und zugleich fühle ich mich so unendlich falsch. So … unvollkommen.« Er zuckte zusammen, als er seinen eigenen Tonfall hörte, schluckte und senkte den Kopf. »Verzeih mir, Älteste, ich wollte nicht … ich will nicht kleinreden, was ich kann, auch wenn … die Heiler können ebenso Gefühle spüren. Das ist doch nichts Einzigartiges.«
Sie nahm seine Hände. »Doch, Ayas, denn es ist deine Gabe. Und wenn ich dich ansehe, dann sehe ich jemanden, der eine große Zukunft vor sich hat, auch wenn die Bilder noch im Nebel liegen. Du hast die Träume eines Sehers, und wenn Licht und Dunkel es wollen, dann wirst du ein Seher sein, wenn du es sein musst. Ich bin mir ganz sicher, dass deine Träume die Kundschafter führen werden. Und ebenso gewiss wirst du deinen Gefährten finden. Noch nie ist es geschehen, dass ein Shirjana ohne Vinashu geblieben ist oder ein Vinashu ohne Shirjana. Irgendwo ist ein Vinashu, der genauso einsam ist wie du und auf sein Licht wartet.« Sie beugte sich vor, ließ seine Hände los und strich leicht über seine Stirn.
Ayas zuckte zurück. Er wollte nicht, dass sie ihm das Haar aus dem Gesicht streichelte, wo es die seltsame Narbe verbarg, die er seit seiner Geburt auf der Stirn trug – ein silbrig schimmerndes Mal in Form eines verzerrten Sterns. Ein Mal von vielen. Eine Laune der Götter hatte seine Mutter die seltsamen Zeichen auf seiner Haut genannt und gelacht. Ayas mochte die Narben nicht, vor allem nicht die in seinem Gesicht. Die striemenförmigen Male auf seinen Armen und Beinen und ein weiteres spinnennetzartiges Zeichen auf seiner Brust genau über dem Herzen konnte er wenigstens unter Kleidung verbergen. Das auf der Stirn trug er vor sich her wie ein Banner. Noch etwas, das zu seiner Andersartigkeit beitrug. Ayas wollte nicht anders sein. Er wollte sein wie alle anderen. Und er wollte nicht mehr allein sein.
»Ich habe keine Vorstellung davon, wie du dich fühlen musst«, sprach Merinn sanft weiter. »Vielleicht ein wenig, wenn ich darüber nachdenke, was wäre, falls mir Lani genommen würde. Ohne sie …« Merinn schüttelte den Kopf.
Ayas schloss die Augen, atmete tief durch, um sich zu beruhigen. Merinn ohne ihre Vinashu-Gefährtin Lani? Undenkbar. Die beiden Frauen waren bereits mehrere Jahrzehnte Seelengefährtinnen gewesen, als er, Ayas, geboren worden war – Merinn vom Nordwald-Clan und Lani, die vom Mond-Clan stammte und ihrer Gefährtin gefolgt war. »Ich gehe mit den Kundschaftern«, sagte er fest. »Dann bin ich wenigstens nicht ganz umsonst hergekommen. Wenn du sicher bist, dass ich helfen kann, dann gehe ich.«
Merinn küsste ihn sacht auf die Stirn.
Wieder zuckte Ayas zusammen. Ihre Lippen berührten die Narbe, und fast fühlte sich der zarte Kuss an wie Glut auf der Haut, die sich prickelnd in seine Adern fraß.
»Danke, mein Lieber. Ich glaube, es ist wichtig, dass du mitgehst. Du musst suchen. Nicht nur den Sand-Clan. Du musst die Quelle deiner Träume finden, um die Bilder deuten zu können. Vielleicht findest du Spuren, wenn du noch weiter reist, als du es bisher getan hast. Du warst noch nie im Sanddorf, nicht wahr?«
»Nein. Ich habe den Sonnen- und den Mond-Clan besucht, aber ich war noch nie in der Wüste. Ich hatte immer Angst davor. Ich meine … ein Land ohne Grün, ohne Gras und Bäume? Wie können die Sandleute dort leben? Und außerdem …« Er schluckte. »Ich bin nie zu ihnen gegangen, weil ich immer sicher war, dass ich dort auf keinen Fall meinen Gefährten finde. Die Wächter haben, seit ich denken kann, noch nie Seelengefährten in anderen Clans gefunden.«
Merinn lächelte mit einem Hauch von Traurigkeit. »Das ist wahr. Aber es ist wunderschön in der Wüste. Der Sand ist rot wie Jaspisstein, er ist überall – aber dort, wo Wasser fließt und Leben sich ausbreiten kann, da ragen Bäume aus dem Boden, die aussehen wie geschuppte Stämme mit einem Haupt aus Farnwedeln. Hab keine Angst, mein Kundschafter. Sei neugierig. Hör nie auf zu suchen, Ayas. Eines Tages wirst du finden, was dein Herz sich so sehr wünscht. Es ist noch nie einer von uns allein geblieben. Nicht seit Miral und Treon. Nie. Vertraue darauf. Die Ersten Seelengefährten und die Götter zwischen Licht und Dunkel haben dich nicht verlassen, und sie werden das auch nie tun. Glaube, Ayas. Glaube an die Hoffnung. Daran, dass auch Unmögliches passieren kann. Und an dich.«
Ayas erwiderte Merinns Blick und konnte gar nicht anders, als zu nicken. »Ich versuche …«
Merinn hob die Hand. Sie lächelte nachsichtig. »Nein. Noch einmal.«
Ayas straffte die Schultern. »Ich glaube«, sagte er. »Und ich vertraue. Wann brechen die Kundschafter auf?«
»Sobald der Rat mit allen gesprochen hat. Spätestens heute Mittag, damit ihr noch einige Wegstunden im Licht zurücklegen könnt.«
»Gut. Ich werde bereit sein.«
»Danke. Auch wenn wir es in den vergangenen Tagen nicht gezeigt haben, wir haben wirklich große Sorge. Warum antworten die Wächter nicht auf unsere Wind- und Wasserbotschaften? Was hält sie auf? Und … wie lange dauert es, bis das, was sie bedroht, auch uns erreicht?«
»Das werden wir herausfinden, Älteste Merinn.«
»Und ich hoffe, ihr kommt mit guten Nachrichten zurück.«
Ayas spürte, dass Merinn nicht an gute Nachrichten glaubte. Etwas beunruhigte die Älteste zutiefst, und das waren nicht allein die Verspätung des Sand-Clans oder Ayas’ Träume. Es war die Stille. Alle Vinashu und Shirjana verfügten über magische Gaben. Tiersprecher baten Vögel, Nachrichten zu überbringen. Elementarmagier konnten Wind und Wasser dazu nutzen, Rufe auszusenden. Wind, Wasser und Vögel gab es hier genug – was hinderte den Sand-Clan, der die fähigsten Magier unter allen Shirjana und Vinashu in seinen Reihen hatte, daran, diese Möglichkeiten zu nutzen? Warum schwiegen sie? Wenn sie in Gefahr waren, warum erreichte die Versammelten auf der Zusammenkunft oder die Daheimgebliebenen in den Clandörfern dann kein Hilfeschrei?
»Ich habe Angst«, flüsterte Merinn, als Ayas sich erhob.
»Ich weiß«, gab Ayas zurück. Er spürte in seinem eigenen Körper, dass ihr Herz sich zusammenkrampfte und sich dieses ekelhafte, sinkende Gefühl in ihrer Magengrube ausbreitete. Die klamme, kalte Hand, die sich auf ihre Seele legte, sie zärtlich streichelte und dabei Klauenspuren aus purem Grauen hinterließ. Ihre Furcht wurde wirklich in Ayas. Er rang um Beherrschung, um nicht in die Knie zu sinken, als ihm klar wurde, dass er sich nach jeder von Albträumen durchzogenen Nacht genauso fühlte wie Merinn jetzt. Etwas geschah. Etwas Unglaubliches, Unaussprechliches, das er nicht fassen konnte, wofür er keinen Namen kannte. »Wir werden sie finden. Oder das, was ihnen gefährlich wurde. Und wenn etwas den Sand-Clan angegriffen hat, dann finden wir auch einen Weg, es zurückzuschlagen.«
Merinn nickte. Ihre moosgrünen Augen blickten unendlich traurig.
2.
Auf der Suche
Die Mittagssonne stand hoch am Himmel, als Ayas bereit für seinen Auftrag auf den Versammlungsplatz trat, das lange Haar zu einem festen Zopf geflochten, zwei Dolche im Gürtel. Die anderen erwählten Kundschafter warteten bereits im Kreis der Ratsmitglieder und Abgesandten der anderen Clans. Ayas kannte die anderen Waldläufer flüchtig – Rin, eine Shirjana vom Sonnen-Clan, und ihr Vinashu-Seelengefährte Bamon, Junas mit den seltsam rot gesprenkelten Federn vom Sternen-Clan. Nurna, eine Vinashu mit dem typischen Schmuck der Mond-Clan-Leute, trat auf den Platz, mit ihr noch ein Mond-Vinashu, den Ayas bisher erst einmal gesehen hatte und dessen Namen er nicht kannte. Leises Kribbeln machte sich in seiner Magengrube breit, als er in den Kreis der Ältesten trat, und das lag nicht daran, dass der Auftrag ihn nervös machte. Vielleicht würde Nurna seine Gefährtin werden, oder dieser fremde Vinashu ihn als seinen Seelengefährten erkennen. Beide trugen keine Bundringe, wie sie bei den Mond-Clan-Leuten üblich waren, oder anderen Schmuck, der sie als bereits gebunden auswies.
Ayas konnte nicht aufhören, die beiden zu beobachten, während Merinn zu den Kundschaftern sprach. Er hörte nur mit halbem Ohr zu, immerhin hatte Merinn all ihre Gedanken schon mit ihm geteilt. Und um zu verstehen, dass die anderen Räte sich ebenfalls sorgten, dafür brauchte Ayas keine lange Rede. Er fühlte die unterschwellige Furcht, die nagende, unausgesprochene Angst, die in den Herzen der Ältesten nistete, mit jeder Faser seines Körpers. Fast glaube er, sie riechen zu können.
Ayas rückte seine Umhängetasche zurecht. Sie störte nur wenig, wenn er fliegen würde, und den kurzen, geschwungenen Bogen würde er auch aus der Luft nutzen können. Mit den Unterschenkeln als Hebel spannte er die Sehne und fasste den lederumwickelten Holzgriff fester. Voll innerer Unruhe spreizte er die Federn und bohrte die Stiefelspitzen in den Boden. Er wollte aufbrechen. Fort von der Zusammenkunft, wo er die Blicke der anderen auf sich fühlte wie klebrige Berührungen. Diese Blicke, hinter denen unausgesprochene Worte hingen. Fragen, warum er denn immer noch allein war. Stumme Mutmaßungen und ängstliches Wispern über die Boten des Sand-Clans und das plötzliche Handeln des Rates. Er zwang sich, sich auf Merinns Worte zu konzentrieren, und hörte gerade noch die letzten Phrasen ihres Reisesegens.
»Geht mit den Göttern zwischen Licht und Dunkel, Kundschafter. Passt auf euch auf, und bringt uns Kunde vom Sand-Clan. Folgt den Pfaden, die sie gegangen wären. Findet sie, und dann kehrt, so schnell ihr könnt, zurück und berichtet.« Merinn drückte jedem der Kundschafter die Hände und reichte kleine Phiolen aus gebranntem Ton herum, fest mit Korken und Wachs versiegelt. Ayas kannte die Fläschchen, sie enthielten einen Kräutersud, aufgeladen mit heilender Magie, der Wunden schneller heilen ließ und die Wirkung der meisten Tier- und Pflanzengifte abmilderte.
»Danke«, murmelte Ayas, als er sein Fläschchen entgegen nahm. »Wir werden sie finden.«
»Ich weiß. Viel Glück, Waldläufer, Himmelsläufer.«
Ein letztes Mal küsste Merinn ihn auf die Stirn. Und wieder jagte die Berührung ihrer Lippen einen Feuerstrom durch die silbrige Narbe, der in jeder weiteren auf seinem Körper widerzuhallen schien.
Junas manövrierte sich an die Spitze der kleinen Truppe, als sie das Lager verließen und den Wald über die Sandstraße betraten.
Ayas wusste, dass dieser Pfad sich tief nach Südosten in den Wald schlängelte und ein Wanderer zu Fuß nach zwei Wochen Marsch den Ort erreichen würde, von dem aus das immer wieder von lichten Waldstücken durchzogene Buschland langsam in eine weite Steppe und schließlich rote Wüste überging. An ihrem Rand lebte der Sand-Clan. Ayas kannte Geschichten, dass die Sonne dort so unbarmherzig brannte, dass es hieß, sie würde einem die Schwingen versengen. Kein Vinashu und kein Shirjana aus den Wäldern hatten jemals die Wüste überflogen oder zu Fuß durchquert. Bisher hatte niemand von ihnen das Verlangen gehabt, einen näheren Blick auf die Schlachtfelder zu werfen, deren Grenze die Wächter in der Wüste so aufmerksam beobachteten. Doch jetzt mussten sie vielleicht genau das tun. Ayas wurde bei dem Gedanken daran, eine wasserlose, brennende Ebene aus Sand zu überfliegen, übel. »Haben wir einen Plan?«, fragte er Junas.
»Ich will erst einmal dem Sandpfad folgen, einige aus der Luft und einige zu Fuß. Wenn wir nicht bald auf Spuren der Sand-Clan-Gruppe stoßen, sollten wir uns weiter aufteilen und das Land gehend durchstreifen oder aus der Luft nach Hinweisen suchen. Vielleicht wurden unsere Schwestern und Brüder unterwegs überfallen.«
»Oder sie sind gar nicht erst losgezogen«, warf der Vinashu ein, den Ayas nicht kannte. »Ich bin Larn«, stellte er sich vor und weitete kurz die schwarzblauen Drachenschwingen, »Windmagier und Waldläufer.«
»Ayas. Ebenfalls Waldläufer und …«
»Und was?« Larn hob eine Braue. »Heiler, wie alle Federschwingen?« Er lachte, samtweich und dunkel, seine fast schwarzen Augen funkelten. Das Sonnenlicht ließ die winzigen Schuppen seiner Haut seidenmatt schimmern.
Ayas musste sich zusammenreißen, um nicht die muskulöse schwarze Brust anzustarren, die sich unter einer halb offenen Lederweste zeigte.
»Stimmungsleser«, antwortete Junas, während Ayas noch nach einer Antwort suchte. »Eine nützliche Gabe. Ayas wird Feinde aufspüren oder Wesen in Angst, die sich verbergen. Also los, haltet Augen und Ohren offen, schwärmt aus, aber kommt immer wieder zusammen. Wir suchen bis zum Abend in der Nähe des Pfades und rasten, wenn die Nacht kommt. Larn, Nurna, Ayas, ihr fliegt. Die anderen bleiben mit mir am Boden. Wir treffen uns wieder, wenn die Sonne die Spitzen der höchsten Bäume berührt, und dann tauschen wir und suchen bis zum Einbruch der Nacht weiter. Wenn wir bis dahin nichts gefunden haben, morgen dasselbe noch einmal, bis wir sie aufgespürt haben.«
Nicken und Murmeln antworteten ihm, dann entfernten Nurna und Larn sich ein wenig von der Gruppe. Ayas zog die Brauen zusammen. Hatte Junas ihm tatsächlich zugeblinzelt? Er lächelte, nickte dankbar, dass Junas ihm Zeit gab, mit den beiden Ungebundenen allein zu sein. Vielleicht war ja wirklich einer der beiden für ihn bestimmt.
»Worauf wartest du, Federschwinge?« Larn hatte sich bereits mit einem vernehmlichen Flappen seiner mächtigen Drachenflügel in den Himmel geschraubt, dicht gefolgt von Nurna.
Ayas sah auf, als die beiden schwarzen Schatten über ihn hinwegglitten. Sonnenlicht schimmerte durch die dunklen Schwingen, zeigte den zarten Knochenbau und die feinen Adern in den Flughäuten. Wo an Ayas alles hell leuchtete, waren die beiden Vinashu lebende Dunkelheit mit blauschwarzer Haut und fast schwarzen Augen, drachenflügelig. Wesen der Nacht, die lieber im Dunklen als bei Tageslicht flogen, doch nun taten sie, was notwendig war. Ayas beeilte sich, ihnen zu folgen, breitete ebenfalls die Flügel aus, rannte einige Schritte, bis er den Wind unter seinen Schwingen fühlte. Er lachte leise, packte die Luft mit den Flügeln und ließ sich tragen. Unter ihm verwandelte sich die Landschaft in einen Flickenteppich aus graubraunen Pfaden, wogendem Grasland und immer wieder waldigen Flecken. Der Versammlungsplatz schrumpfte zu einem kreisrunden Fleck zusammen, in dessen Mitte die Statuen Mirals und Treons aufragten, schwarz und weiß, in immerwährender Umarmung. Ayas flog einen Bogen über der Lichtung, dann folgte er Nurna und Larn, die bereits in südöstliche Richtung abgebogen waren. Irgendwo unter ihnen wanderten die anderen drei Kundschafter auf dem Sandpfad in dieselbe Richtung.
Ayas verengte die Augen zu schmalen Schlitzen und spähte zum Horizont. Wie lange würden sie fliegen, bis sie das rote Land erreichten? So weit Ayas blicken konnte, schimmerte unter ihm alles grün, blau und silbern. Die ganze weite Ebene war von Flüssen, Bächen und Seen durchzogen, voller Leben. Dort unten weideten Waldlandhirsche und Wildkühe, Steppenpferde zogen in Herden umher. Ayas konnte ihre wandernden Schatten ausmachen, wie sie gemächlich über das Buschland zogen. Alles wirkte so friedlich.
Larn glitt an seine Seite. »Siehst du etwas?«
»Nichts Ungewöhnliches. Und ich fühle auch nichts, was mich beunruhigen würde.« Nichts. Ganz genau das. Ayas warf einen verstohlenen Seitenblick auf Larn, seinen kräftigen Köper unter den eng anliegenden dünnen Lederkleidern. Larn gefiel ihm, er schien freundlich trotz seiner spöttischen Bemerkungen, und er war schön – aber Ayas fühlte nicht mehr. Und sollte da nicht mehr sein, wenn er seinem Seelengefährten begegnete? Levna hatte gleich gewusst, dass sie zu Ebon gehörte und Ebon zu ihr. Vom ersten Blick an: kein Zweifel. Kein Fragen. Nichts als die feste Gewissheit, nie wieder ohne diesen Vinashu sein zu wollen.
Als würde Larn Ayas’ Gedanken spüren, warf er ihm einen Blick zu, in dem Ayas nichts als Bedauern las.
»Tut mir leid, Federschwinge.« Damit drehte er ab, glitt in einem weiten Bogen tiefer, bis die Baumkronen fast seine ledernen Schwingen berührten.
Ayas würgte die Enttäuschung hinunter und zwang sich, seine Arbeit zu machen. Suchen. Er musste suchen. Irgendwo da unten mussten die Boten des Sand-Clans doch sein.
Sie fanden keine Spuren. Weder aus der Luft, noch auf den gewundenen Reisepfaden konnten Ayas und die anderen auch nur den Hauch einer Fährte entdecken. Das einzig Brauchbare, was Bamon fand, war ein gemütlicher Lagerplatz an einer Flussschlinge, die sich zu einem kleinen See weitete, umgeben von hohen Bäumen und Büschen, die vor Wind und Kälte schützten. Ein umgestürzter Baumriese gab eine bequeme Sitzbank ab, und es lag genug totes Holz für ein Lagerfeuer herum. Nurna hatte unterwegs zwei Steppenhasen gefangen, die nach kurzer Zeit abgezogen und mit Kräutern eingerieben über einem prasselnden Feuer rösteten.
Ayas stocherte in der Glut herum. Die Flammen fingen seine Blicke ein, immer wieder. Er beobachtete ihr Tanzen, das Flackern. Fast, als würde das Feuer Bilder malen. Ihr Tanz glich der drängenden Unruhe in Ayas – er wusste, dass sie die Rast brauchten, dennoch wäre er am liebsten weitergeflogen. Etwas zog ihn weiter. Nach Südosten. Zur Wüste. Zu den Schlachtfeldern. Dorthin, woher seine Träume kamen.
Zischend tropfte Hasenblut in die brennenden Scheite. Der Geruch angesengten Fleisches füllte Ayas’ Nase, und er musste würgen.
»Alles in Ordnung?« Junas legte ihm eine Hand auf die Schulter.
»Ja …« Ayas schüttelte sich und rückte ein wenig vom Feuer weg. »Ich weiß nicht, mir schlägt der Bratengeruch auf den Magen. Er erinnert mich an …« Ayas hielt inne. »Es ist nichts. Ich habe nur einfach keinen Hunger.«
»Sicher?« Junas verengte die Augen und musterte ihn kritisch. »Merinn sagte etwas von dunklen Träumen. Von Träumen, die uns vielleicht verraten, was da in der Wüste geschieht. Oder geschehen ist.«
Ayas seufzte stumm. »Merinn glaubt, dass die Träume ein Hinweis sind … ja. Ich sehe immer wieder dasselbe – ein Schlachtfeld, einen blutigen Kampf, Kreaturen, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Ich fühle das Wirken mächtiger Zauber, sehe Waffen, von denen Blut und Feuer triefen. Die Luft ist wie aufgeladen von Blitzen. Mal ist es Nacht, mal ist es Tag, wenn ich träume, aber immer sind es auch Tag und Nacht, die gegeneinander kämpfen. Ich sehe unser Volk, aber es ist noch nicht vereint. Ich sehe andere Völker des Lichts und der Dunkelheit, wie sie gegeneinander streiten, immer wieder, in einem Kampf, in dem es keine Sieger geben kann.« Keine Sieger geben durfte …
»Merinn sagt, deine Träume sind vielleicht Visionen, die uns führen. Hast du ihr denn nicht zugehört, als sie uns verabschiedete?«
Ertappt schüttelte Ayas den Kopf. »Ich war mit meinen Gedanken woanders.« Bei meinen Träumen. Er hob die Schultern. »Ich weiß, was Merinn glaubt, aber ich hoffe immer noch, dass es eine ganz einfache Erklärung dafür gibt, warum die Wächter nicht zur Versammlung gekommen sind.« Ayas wölbte seine Flügel ein wenig nach vorn und versuchte, in den eigenen Federn Wärme zu finden. Seine Worte klangen selbst für ihn unglaubwürdig.
Junas schien nicht überzeugt. »Ich wünsche dir eine Nacht ohne diese Träume«, sagte er leise, »versuch, wenigstens etwas Brot und Käse zu essen, sonst fehlt dir morgen für die Suche die Kraft.«
Ayas nickte, kramte in seiner Tasche und zog Wegebrot und Käse hervor. Lustlos knabberte er daran, während die anderen sich über die gegrillten Hasen hermachten. Allein der Geruch noch fast blutigen Fleisches ließ seinen Magen Kapriolen schlagen. Was ist nur los mit mir? Mit dem sicheren Wissen, dass er ohnehin nicht würde schlafen können, ließ Ayas sich für die erste Nachtwache einteilen und blieb am Feuer sitzen, während die anderen sich in ihre leichten Wolldecken wickelten und die Augen schlossen.
Ayas lauschte in die Dunkelheit, hörte dem Knistern und Knacken des Feuers zu und fand immer neue Bilder in den tanzenden Flammen. Ihr Anblick fesselte ihn. Golden, bläulich und dann wieder fast blutrot huschten sie über die Scheite, verzehrten sie, die Glut tief im Inneren wirkte beinahe lebendig. Funken stoben, wenn eine Harzblase krachend zerbarst. Kleine Sterne über dem Steppenboden, während sich über dem Lager der Nachthimmel wölbte, Mantel der Nachtgöttin mit seinen Millionen von funkelnden Diamanten darin. Ayas legte den Kopf in den Nacken und versuchte, die vertrauten Sternbilder zu finden. Die Nachtherrin mit ihren schwarzen Schwingen, den weiß gefiederten Herrn der Sonne und des Tageslichts. Keiner konnte ohne den anderen sein. Nacht wandelte sich in Tag und wurde wieder zur Nacht. Zwei und doch eins – so wie Shirjana und Vinashu. So wie Seelengefährten aus Licht und Dunkel.
Der Gedanke brachte den Schmerz zurück. Ayas unterdrückte ein Stöhnen, riss den Blick von den Sternen los und versuchte, auch Bamon und Rin nicht zu sehen, die in inniger Umarmung am Feuer schliefen. Fast hüllten Bamons dunkle Drachenschwingen seine zarte, sonnengoldene Gefährtin mit den bronzenen Federschwingen ein. Ayas biss sich auf die Lippen, als er sich fragte, wie warm es wohl in der Flügelumarmung eines Vinashu sein mochte. Energisch erhob er sich und umrundete in einem weiten Kreis das Lager, spähte in die Steppe hinaus und suchte nach Hinweisen auf ein weiteres Nachtlager. Feuer schien schließlich weit durch die Nacht.
Ayas wandte den Blick nach Südwesten – und verengte die Augen zu schmalen Schlitzen, blinzelte einige Male, um sicherzugehen, dass seine Augen ihn nicht betrogen und er nicht nur den Widerschein des eigenen Lagerfeuers erblickte. Eisige Kälte umfing ihn, als ihm klar wurde, dass das dumpfe rote Glühen in der Ferne tatsächlich blieb. Als würde am falschen Ort und zu einer falschen Zeit eine eigenartige feurige Sonne aufsteigen, die dort nicht hingehörte. Wabernde Nebelschleier schienen sich wie träge tanzende Geister unter dem roten Schein zu bewegen. Ayas zitterte, aber er konnte den Blick nicht abwenden. Auch nicht, als der rote Schein höher stieg: Ein pulsierender, flammender Ball, dessen unheimliches Licht die Steppe übergoss und sie aussehen ließ, als sei sie mit Blut getränkt.
Der Lichtschein pulsierte, schwoll an, züngelnde Flammen griffen wie Finger nach den Nebelschleiern, zerrissen sie, formten neue Nebelgestalten. Sich windende Schatten umgaben den blutroten Schimmer wie Tentakel, von denen Dunkelheit troff und den Boden dampfen ließ, wo immer ihre zähen Tropfen sie berührten. Immer mehr schwarzes Wabern breitete sich aus, wuchs – und zerbarst lautlos. Schwarzrot triefende Fetzen flogen, schienen gegen den Himmel zu klatschen und dort hängen zu bleiben.
Ayas fühlte einen Tropfen auf seiner Hand aufschlagen, dann trafen weitere sein Gesicht. Er fuhr sich mit den Fingern über die Stirn, spürte etwas Klebriges. Übelkeit wallte ätzend in ihm auf, als er erkannte, dass seine Finger rot glänzten.
Der glühende Schein hatte grauem Licht Raum gegeben, und der Himmel regnete Blut.
Ayas schrie, wirbelte herum, er musste zurück zum Lager, die anderen warnen – aber was war geschehen? Das Feuer hatte sich in einen Haufen müde glimmender Asche verwandelt und seine Gefährten … Ayas presste die Hände auf die Lippen und kämpfte gegen den Würgereiz.
Sie waren tot. Zerschlagen, zerfetzt. Ayas sah Blut auf weißen und metallisch schimmernden Federn, blickte in aufgerissene gebrochene Augen, die einmal die Farbe von Wald und Moos oder dem Nachthimmel gehabt hatten. Als sein Blick auf Bamon fiel, der noch im Sterben versucht haben musste, Rin zu schützen, wirbelte Ayas herum und rannte, breitete die Schwingen aus, konnte kaum warten, bis der Wind unter seine Federn griff. Er stolperte, fiel beinahe, raffte sich auf und rannte weiter. Da, endlich, eine Böe fing sich unter seinen Schwingen und trug ihn empor. In den Nebel hinein, der seine fiebrig heiße Haut kühlte und sich wie Tau auf seine Federn legte.