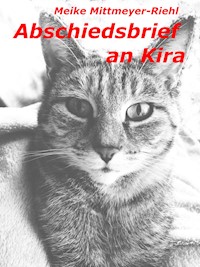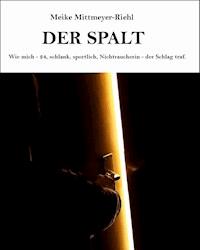
Der Spalt: Wie mich – 24, schlank, sportlich, Nichtraucherin – der Schlag traf. E-Book
Meike Mittmeyer-Riehl
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im Alter von nur 24 Jahren erleidet Meike Mittmeyer-Riehl aus völliger Gesundheit heraus einen Schlaganfall. Eine Aufspaltung der Halsschlagader - eine sogenannte spontane Dissektion - hat den Infarkt ausgelöst: äußerst selten, wenig erforscht, aber eine der häufigsten Ursachen für Schlaganfälle bei jungen Patienten ohne typische Risikofaktoren. Weil keiner ihrer Ärzte ihr die drängende Frage nach dem "Warum" beantworten kann, begibt sich die Journalistin mit der Hilfe von Forschern selbst auf die Spur einer rätselhaften Krankheit. Es wird vermutet, dass die spontane Dissektion mit einer Art Bindegewebsschwäche zusammenhängt - was bedeutet, dass die Ader jederzeit wieder reißen und weitere Schlaganfälle verursachen könnte. Ihre verbissene Suche liefert statt Klarheit immer mehr Fragezeichen, denn bislang kennt die Medizin die Hintergründe der seltenen Erkrankung kaum. Die Ungewissheit und der verzweifelte Versuch, eine Erklärung zu finden, stürzen die junge Frau in eine psychische Erkrankung. Erst die zwingt sie zur echten Auseinandersetzung mit allem, was passiert ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meike Mittmeyer-Riehl
Der Spalt
Wie mich – 24, schlank, sportlich, Nichtraucherin – der Schlag traf.
Über das Buch
Eben ist sie noch topfit über den Tennisplatz gerannt. Ein paar Stunden später liegt sie verkabelt auf der Stroke Unit, umgeben von Todkranken und Sterbenden. Als Meike Mittmeyer 2012 die Diagnose „Schlaganfall“ erhält, bricht für sie eine Welt zusammen. Mit nur 24 Jahren, als gesunde, sportliche, schlanke Frau und überzeugte Nichtraucherin? Unmöglich! Eine Aufspaltung einer der Halsschlagadern – eine sogenannte spontane Dissektion – hat den Infarkt ausgelöst: äußerst selten, wenig erforscht, aber eine der häufigsten Ursachen für Schlaganfälle bei jungen Patienten ohne typische Risikofaktoren. Weil keiner ihrer Ärzte ihr die drängende Frage nach dem „Warum“ beantworten kann, begibt sich die Journalistin mit der Hilfe von Forschern selbst auf die Spur einer rätselhaften Krankheit. Und auf den langen Weg zu einem Leben nach – und vor allem mit – einer schlimmen Diagnose, der so einige Rückschläge für sie bereithält.
Über die Autorin
Meike Mittmeyer-Riehl, geboren am 11.04.1987 im südhessischen Dieburg, studierte nach dem Abitur Online-Journalismus an der Hochschule Darmstadt und sammelte redaktionelle Erfahrungen bei Print- und Onlinemedien in Deutschland und den USA. Nach ihrem Volontariat bei einer regionalen Tageszeitung arbeitete sie dort als Lokalredakteurin, später als Online-Redakteurin bei einer Fachzeitung. Ihr Lebenstraum ist – nach einer Weltreise – ein Flug ins All.
Wie?
In diesem kurzen, eiligen, von einem ungeduldigen Dröhnen begleiteten Leben
eine Treppe hinunterlaufen? Das ist unmöglich. Die dir zugemessene Zeit ist so kurz, dass du,
wenn du eine Sekunde verlierst, schon dein ganzes Leben verloren hast, denn es ist nicht länger; es ist immer nur so lang, wie die Zeit, die du verlierst.
Franz Kafka – „Fürsprecher“1
Für Dennis und Kai:
die beiden wichtigsten Männer in meinem Leben.
Inhalt
-Vorwort-
Kapitel 1: Aus. Vorbei.
Kapitel 2: Die Diagnose
Kapitel 3: Glück? Was ist denn Glück?
Kapitel 4: Das Pochen im Ohr
Kapitel 5: Tschüss, Klinik
Kapitel 6: Hallo, Reha
Kapitel 7: Die Wut, mein bester Freund
Kapitel 8: Eine Krankheit voller Sackgassen
Kapitel 9: Déjà-vu im Wilden Westen
Kapitel 10: Die Wahrheit schlägt zu
Kapitel 11: Immer mehr Fragezeichen
Kapitel 12: Der Rückschlag
Kapitel 13: Ich, der Angsthase?
Kapitel 14: Aus dem Gleichgewicht
Kapitel 15: Eingeständnis einer „Niederlage“
Kapitel 16: Papierflieger und Tränen
Kapitel 17: Alarmstufe gelb
Kapitel 18: Verpasste Chancen
Kapitel 19: Der Spiegel ist für mich gestorben
Kapitel 20: Volle Kraft voraus
Richtiges Handeln bei Schlaganfall-Verdacht
Spontane Dissektion - das Wichtigste in Kürze
Danksagungen
Quellenangaben
-Vorwort-
Gaby Köster hat ein Buch über ihren Schlaganfall geschrieben. Bap-Frontmann Wolfgang Niedecken hat ein Buch über seinen Schlaganfall geschrieben. Tausend Schlaganfall-Bücher, und jetzt schon wieder eines? Und dann auch noch von einem Niemand geschrieben? Warum sollte ich das denn lesen? Vielleicht waren das eure ersten Gedanken, als ihr den Rückentext dieses Buches gelesen habt. Und um eine Antwort gleich vorweg zu nehmen: Ich habe dieses Buch vor allem für mich selbst geschrieben – weil es Teil meines Verarbeitungsprozesses ist, der bis heute, vier Jahre danach, andauert, und wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile andauern wird. Das war mein wichtigstes Anliegen für diesen Bericht.
Bevor ihr dieses Buch jetzt aber gleich wieder aus der Hand legt, möchte ich wenigstens versuchen, zu erklären, warum es sich trotzdem lohnen könnte, weiterzulesen. Ein kleiner Unterschied zu vielen anderen Büchern zu diesem Thema ergibt sich allein schon aus der Tatsache, dass ich in einem sehr jungen Alter von nur 24 Jahren einen Schlaganfall erlitt. Und dass die Ursache dafür – eine sogenannte spontane Dissektion der Halsschlagader – eine insgesamt zwar sehr seltene, aber immerhin die zweithäufigste Schlaganfall-Ursache bei jüngeren Patienten unter 50 Jahre darstellt. Das weiß so gut wie niemand. Auch ich nicht, bis ich selbst betroffen war. Selbst vielen Ärzten ist diese spezielle Schlaganfall-Ursache nicht geläufig – das kann ich zumindest aus meiner Erfahrung heraus sagen.
Einen Schlaganfall bekommt man doch erst, wenn man alt ist, raucht und Übergewicht hat – so lautet die weit verbreitete Meinung. Nun, leider ist es nicht so. Die spontane Dissektion ist bis heute eine rätselhafte Erkrankung. Sie trifft meist Menschen, die keine typischen Risikofaktoren für einen Schlaganfall aufweisen: kein Übergewicht, keinen Bluthochdruck, keine hohen Blutfettwerte, kein Rauchen.
Es gibt Hinweise darauf, dass die Krankheit mit einer bestimmten Art von Bindegewebsschwäche einhergeht. Ein kleiner „Webfehler“ im System, wie es einer der wenigen ausgemachten Dissektions-Experten Deutschlands, Dr. Tobias Brandt aus Heidelberg, in unserem Gespräch so schön formuliert hat. Eindeutige Antworten gibt es aber immer (noch) nicht. Und genauso mangelt es an verständlichen, deutschsprachigen Informationen zu dieser seltenen Schlaganfall-Ursache.
Also habe ich mich selbst auf die Suche nach Antworten begeben. Ich habe versucht, mich zum Experten meiner eigenen Erkrankung zu machen (so gut es geht, zumindest): Im Wälzen von Studien und Fachliteratur und im Gespräch mit Experten, die in diesem Bereich forschen. Als gelernte Journalistin ist das ja sogar irgendwie meine Aufgabe. Ich wollte also nicht das tausendunderste x-beliebige Schlaganfall-Buch schreiben: Ich wollte das erste Buch als Betroffene einer spontanen Dissektion schreiben, das nicht nur meine persönliche Geschichte erzählt, sondern auch verständlich über das Krankheitsbild informiert. Mein zweites Anliegen war es also, zu informieren.
Bitte erwartet jetzt aber keine rein wissenschaftliche Abhandlung. Auch konnte ich nicht auf all die vielen anderen Ursachen für Schlaganfälle, die junge Menschen und sogar Kinder treffen können, eingehen. Das war auch nicht mein Anspruch. Alle Fakten, die ich im Zuge meiner Recherchen sammeln konnte, habe ich am Ende des Buches noch mal in einem Überblick zusammengefasst. Wenn ich meine Geschichte schon aufschreibe, dachte ich, kann ich sie auch genauso gut veröffentlichen – und ein kleines bisschen dazu beitragen, aufzuklären.
Eigentlich lautet ja einer unserer journalistischen Grundsätze: sei nicht zu nah dran, mach dich nicht mit einer Sache gemein! Das konnte ich in diesem Fall nicht einhalten. Ich machte mich selbst zum Subjekt meiner Recherchen. Bei meinen Gesprächen mit Ärzten und Forschern ging es plötzlich nicht mehr nur um irgendeine Krankheit, um das Leben von irgendjemandem, sondern um meine Krankheit, um mein Leben. Das kann einen emotional ziemlich umhauen.
Leider ist es mir nicht gelungen, meine Erkrankung als Teil meines Lebens zu akzeptieren. Denn das ist die wirkliche Herausforderung nach einem solchen Schicksalsschlag: das Leben mit der Diagnose. Mit einem Schlag (bei mir im wahrsten Sinne des Wortes) ist alles anders. Die Phasen des Abstreitens, der Wut, der Verzweiflung, der Hoffnung, die man in den Tagen, Wochen, Monaten und Jahren nach einem solchen Ereignis erlebt, habe ja nicht nur ich erlebt. Sie erlebt jeder, der durch eine schwere Erkrankung oder ein anderes einschneidendes Lebensereignis völlig aus der Bahn geworfen wird.
Auch wenn zunächst alles danach aussah: Ich schaffte es nicht, mich mit meinem Schicksal und der Ungewissheit, die diese rätselhafte Erkrankung mit sich bringt, abzufinden. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre wies mich mein Körper ganz deutlich in die Schranken – diesmal aufgrund einer psychischen Erkrankung und so deutlich, dass ich seine Signale nicht noch einmal ignorieren konnte. Ich musste langsam, oft auch schmerzhaft, lernen, dass es einen Unterschied zwischen verdrängen und verarbeiten gibt. Und dass man immer auch zurückschauen muss, um vorwärts zu kommen.
Erst dieser harte Rückschlag zwang mich zur echten Auseinandersetzung mit allem, was passiert war. Und zur Auseinandersetzung mit meinem Leben an sich, mit dem, was mir wichtig ist, was ich brauche und was ich wirklich will. Das bringt mich zu meinem dritten Anliegen, das eigentlich eher eine diffuse Hoffnung ist: Ich wollte, dass sich in meinen Erlebnissen auch andere Menschen wiederfinden, die schwere Zeiten durchmachen mussten. Ich wollte auf ganz ehrliche Art und Weise schildern, wie es ist, wenn einem der eigene Körper in einem Alter, da eigentlich alle Türen offenstehen sollten, plötzlich all diese Türen mit voller Wucht vor der Nase zuknallt. Darum habe ich ganz bewusst auch die Emotionen und Gedanken nicht ausgelassen, für die man sich im Nachhinein schämt oder die man zutiefst bereut.
Möglicherweise bringe ich so den einen oder anderen dazu, sich über sich selbst, sein Leben, seine echten Ziele und Träume Gedanken zu machen. Und zwar idealerweise nicht erst, wenn ihn eine schwere Erkrankung dazu zwingt.
Vielleicht habt ihr jetzt doch noch Lust bekommen, ein kleines bisschen weiter zu lesen. Wenn ja, freue ich mich über euer Feedback zum Buch, wenn nein, freue ich mich ebenso über eure Begründung: [email protected]. Natürlich bin ich auch für neue, spannende Forschungsansätze, Erfahrungsberichte anderer Betroffener und viel mehr dankbar.
Meike Mittmeyer-Riehl im April 2016
Kapitel 1: Aus. Vorbei.
„Carpe diem
A battle cry
Aren’t we all too young to die?”
Green Day – “Carpe Diem“2
Das sollte er also gewesen sein, der letzte Tag meines Lebens. Ich dachte diesen Gedanken ganz ruhig, beinahe gleichgültig, so wie man sich hinsetzt, um eine Einkaufsliste zu schreiben. Ich wusste nicht, was mir diese Gewissheit gab. Ich hatte keine starken Schmerzen, im Gegenteil: Ich fühlte mich überraschend leicht, fast schwerelos. So, als würde ich ein paar Zentimeter über mir selbst schweben. So, wie man sich im Traum manchmal fühlt, wenn man sich selbst beim Handeln zusieht. Meine Stimme klang, als würde jemand anders sprechen, ich hörte mich wie aus einem Lautsprecher, wie aus dem Radio.
Dabei war dieser 17. März 2012, der erste, schöne, sonnige Frühlingstag des Jahres, kein Tag zum Sterben. Tage zum Sterben, das sind doch diese grauen, verregneten, trüben Tage im November.
Ein wenig beunruhigte mich nur die Tatsache, dass ich zu Hause keinerlei Vorkehrungen für eine längere, schon gar nicht für eine endgültige, Abwesenheit getroffen hatte. Auf der Terrasse trockneten auf dem Wäscheständer Handtücher und Socken in der Frühlingssonne. Mein Zimmerbrunnen plätscherte noch, abends schaltete ich ihn eigentlich immer aus, damit der Motor nicht heiß lief. Im Kühlschrank stand noch eine angebrochene Milch, im Obstkorb lagen Äpfel und Bananen. Es waren absurde Überlegungen wie diese, die mich umtrieben, als ich merkte, dass meine Beine mich nun doch nicht mehr tragen würden. Ich versuchte noch, mich gegen den Drang, umzufallen, zu wehren, aber vergeblich. „Dennis? Mir geht es nicht gut“, sagte ich, und schon war er da, um mich aufzufangen. Ich fiel ihm direkt aus der Dusche entgegen.
Ich blieb bei vollem Bewusstsein, war ganz wach, ganz klar; von Panik oder Todesangst keine Spur. Dennoch wusste ich, dass es nicht mehr lange dauern konnte. Jetzt war es soweit, jetzt starb ich. Wenigstens tut es nicht weh, dachte ich noch, als ich Dennis ein „Hilf mir“ entgegenhauchte. „Ich rufe den Notarzt“, sagte er und ging raus; und ich lag da, immer noch bei vollstem Bewusstsein.
Wenn euch nachts schon mal so richtig ein Arm eingeschlafen ist, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie sich zu diesem Zeitpunkt meine gesamte linke Körperhälfte angefühlt hat. Oder eben nicht angefühlt hat. Sie war taub, weg, so als hätte man mich gerade mit einem riesigen Filetiermesser in der Mitte durchgeschnitten. Ich richtete meinen Oberkörper auf, oder besser gesagt, machte Anstalten, mich aufzurichten, so wie man das mit einem halben Körper eben kann. Ich nahm mein linkes taubes Bein in die Hände und zwängte es in meine Jogginghose, die auf dem Boden lag. Man hat ja gar keine Vorstellung davon, wie schwer so ein Bein ist, wenn man es nicht bewegen kann. Ich starrte auf meinen linken Fuß und forderte ihn dazu auf, sich endlich zu rühren, aber das war unmöglich. Das Bein könnte auch irgendeinem Passanten auf der Straße gehören. Als ich die Hose anhatte, schaffte ich es, ich weiß nicht mehr wie, auch in mein T-Shirt. Es war ein nagelneues, quietschgelbes Tennis-Shirt, das im weiteren Verlauf meiner Geschichte noch eine Rolle spielen wird. Das war mir damals aber natürlich noch nicht klar. Mein einziger Gedanke dabei war: Der Rettungswagen muss jeden Moment da sein, und ich will schließlich nicht nackt daliegen, wenn sie kommen, um meinen Tod festzustellen.
Doch dann, ganz plötzlich, spürte ich in dem fremden Bein, das da taub in meinen Hosen steckte, ein Kribbeln. So, wie ein eingeschlafener Arm kribbelt, wenn man die Finger nur lange genug bewegt hat. Mein Bein kribbelte, mein Arm, meine linke Wange. Ich steckte wieder fest in meinem Körper drin, das traumartige Gefühl war verschwunden. Sofort sprang ich auf und blieb fest auf beiden Beinen stehen, hörte mein Herz laut und schnell pochen. Die Gewissheit, sterben zu müssen, war so schnell weg, wie sie gekommen war. Ich lebte.
Als Dennis wieder hereinkam, stand ich steif wie ein Baum im Bad. „Setz dich hin, um Himmelswillen“, fuhr er mich an. Ich setzte mich auf den geschlossenen Klodeckel, er fühlte mir den Puls. Ich weiß nicht mehr, was wir in diesem Moment sprachen, oder ob wir es überhaupt taten. Ich hatte auch kein Zeitgefühl. Ich weiß nur noch, dass wenig später die Rettungsassistenten da waren. Dennis schilderte ihnen dankenswerter Weise die Symptome, ich weiß nur noch, dass ich kopfschüttelnd sagte: „Ich weiß, das deutet alles auf einen Schlaganfall hin. Aber das kann doch nicht sein?!“
Aus Laien-Sicht betrachtet konnte das eigentlich wirklich nicht sein. Ein Schlaganfall, ein in der Regel durch ein Blutgerinnsel ausgelöster Infarkt im Gehirn, trifft doch vor allem Ältere. Dachte ich damals; und das denken die meisten Menschen wahrscheinlich immer noch. Rauchen, schlechte Ernährung, Diabetes, hoher Blutdruck, Bewegungsmangel, all das begünstigt einen Schlaganfall. Alles Risikofaktoren, die auf mich zu null Prozent zutrafen. Ich war sogar das genaue Gegenteil: 24 Jahre jung, sehr schlank und sportlich, dazu eine überzeugte, ich würde fast sagen militante, Nichtraucherin.
Auch die Rettungsassistenten schienen einen Moment darüber nachzudenken, als sie mich da sitzen sahen. Der eine von ihnen, ein kräftiger Kerl mit einem runden, freundlichen Gesicht, sagte aber dann: „Das passt mir hier alles nicht. Wir fahren ins Krankenhaus.“ Widerwillig stieg ich mit ihnen die Treppe runter und ins Auto ein, ich brauchte keine Hilfe. Die Lähmung war komplett verschwunden, so als wäre sie nie dagewesen. „Wo fahrt ihr sie hin?“, fragte Dennis. „Nach Darmstadt“, sagte der kräftige Rettungsassistent, „Stroke Unit.“ (Eine Stroke Unit ist eine Spezialstation für Schlaganfallpatienten)
*
In dem Moment, da die Tür des Rettungswagens zuschlug, war mein bisheriges Leben vorbei. Das wusste ich zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Manchmal will ich es heute noch nicht glauben. Nach diesem ersten schönen Frühlingstag im März 2012 sollte nichts mehr so sein, wie es war.
Davon ahnte ich nichts, als ich dort auf der Krankenliege im Rettungswagen lag, entgegen der Fahrtrichtung. Die Sirene hörte ich kaum, auch vom Blaulicht sah ich nichts. Es war ja noch hell. Ich fror, zitterte am ganzen Leib. Schließlich war ich noch völlig nass in meine spärlichen Klamotten gestiegen. Ich fuhr diese Strecke in die Stadt jeden Tag zur Arbeit, aber so schnell hatte ich sie noch nie bewältigt. Der kräftige Sanitäter saß neben mir und schaute mich aufmerksam an, ohne zu lächeln. Er schien jeden Moment bereit, schnell einzugreifen, sollte ich irgendeine eigenartige Reaktion zeigen. Aber was für eine Reaktion sollte ich schon zeigen? Es ging mir wieder gut und mir fehlte nichts. Irgendwie schöpfte ich Zuversicht aus seinem runden, freundlichen Gesicht.
Ich war mir sicher, dass all das nur ein schrecklicher Irrtum sein konnte; dass ich nur einen kleinen Kreislaufkollaps hatte, nichts Schlimmes. Vielleicht einen eingeklemmten Nerv, darum die Lähmung. Von so etwas hatte ich schon mal irgendwo gelesen. Ich war mir sicher, dass ich am Abend wieder nach Hause könnte, dass ich meine Wäsche hereinholen und den Zimmerbrunnen ausschalten könnte, wie geplant. Ja, so würde es ganz bestimmt kommen.
Nach einem schweren Schicksalsschlag wie dem Verlust eines geliebten Menschen oder auch einer schweren Erkrankung durchlebt man in der Regel verschiedene Phasen. Viele der heute üblichen Modelle der Krisen- oder Trauerbewältigung gehen, in abgewandelter Form, zurück auf die US-amerikanische Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004). Ihre ursprünglichen „fünf Phasen des Sterbens“ beschreiben die wesentlichen fünf Stadien, die ein Mensch durchläuft, wenn er weiß, dass er bald sterben muss. Ihre Erkenntnisse beruhen auf Interviews mit über 200 todkranken, sterbenden Patienten3. Nach Kübler-Ross setzen sich diese fünf Phasen wie folgt zusammen:
Das Nicht-wahrhaben-Wollen:
Man streitet ab, will die Diagnose nicht wahrhaben, redet sich ein, dass alles nur ein großer Irrtum sein kann.
Zorn:
Man wird wütend und neidisch auf alle, denen es vermeintlich besser geht und die weiterleben dürfen.
Das Verhandeln:
Man versucht, mit sich selbst oder einer höheren Macht, vielleicht Gott, einen Pakt zu schließen: Wenn ich dies oder jenes mache, wird doch bestimmt wieder alles gut!
Die Depression:
Wut und Zorn weichen jetzt dem Gefühl, dass alles aussichtlos ist.
Die Akzeptanz:
Der Kampf ist vorbei, man akzeptiert die Situation und beginnt, auf das Gute zurückzublicken, das einem im Leben wiederfahren ist.
So oder zumindest so ähnlich lassen sich auch die Stadien beschreiben, die Menschen nach einem Schicksalsschlag durchleben. All das ist nicht in Stein gemeißelt und kann sich bei jedem etwas anders darstellen, manche Phasen gehen ineinander über, andere bleiben ganz aus, oder die Reihenfolge ist eine andere.
Auch für meine persönliche Aufarbeitung finde ich die Einteilung in Phasen im Nachhinein sehr wichtig, um mir selbst mein Verhalten und meine Gefühle von damals besser erklären zu können und um zu ergründen, weshalb mich dieser Einschlag derartig aus der Bahn geworfen hat, dass ich bis heute nicht damit zurechtkomme. Auch ich halte mich in meinem rein subjektiven Bericht nicht starr an die klassischen fünf Phasen, sondern habe meine eigenen definiert – und das natürlich auch erst jetzt, mit vier Jahren Abstand.
Nach so einem Schicksalsschlag ist das alte Leben vorbei, unweigerlich, daran lässt sich nicht rütteln; das neue Leben aber ist noch lange, lange nicht in Sicht. Die Phasen, die ich im Folgenden beschreibe, stehen für eine Art Mittelding, ein „Leben zwischen den Leben“, könnte man sagen. Wie eine Brücke zwischen zwei Ufern. Diese Brücke führt über tosende Flüsse, schwindelerregende Schluchten, durch unendliche Wüsten und durch wütende Gewitterstürme. Aber das werdet ihr im Laufe meines Berichts noch sehen.
Als ich im Rettungswagen lag und mir einredete, dass schon alles gut sein würde, wusste ich natürlich noch nicht, dass ich gerade in „meiner“ Phase eins angekommen war. Sie war die kürzeste von allen, sie dauerte nur wenige Stunden. Ich nenne sie: das Abstreiten.
Kapitel 2: Die Diagnose
„Manchmal sieht unser Schicksal aus wie ein Fruchtbaum im Winter. Wer sollte bei dem traurigen Ansehn desselben wohl denken, dass diese starren Äste, diese zackigen Zweige im nächsten Frühjahr wieder grünen, blühen, sodann Früchte tragen könnten?“
J.W. von Goethe – „Wilhelm Meisters Lehrjahre“4
Es musste alles ein großer Irrtum sein. An diesem Gedanken klammerte ich mich weiter verkrampft fest, während ich im Krankenhaus von Untersuchung zu Untersuchung geschoben wurde. Computertomographie, Magnetresonanztomographie, Doppler-Untersuchung (eine spezielle Ultraschall-Untersuchung der Halsgefäße): Ich ließ alles relativ uninteressiert über mich ergehen, weil ich noch immer die große Zuversicht in mir trug, dass ich kerngesund war.
Der nette Krankenpfleger, der mich von Untersuchung zu Untersuchung brachte, sagte irgendwann zu mir: „Sie sind so ruhig und gelassen, das sind wirklich die wenigsten in Ihrer Lage. Bewundernswert.“ Ich stutzte. Das ist deshalb ein so komischer Satz, weil ich von Natur aus eigentlich alles andere als ruhig und gelassen bin, leider. Ich bin notorisch überpünktlich und neige zu innerer Unruhe, ich laufe, lese, schreibe, spreche und denke sehr schnell, und mir reißt schnell der Geduldsfaden, wenn jemand mit diesem Tempo nicht mithalten kann. Darum gab mir der Satz des Krankenpflegers schon ziemlich zu denken. Warum nur war ich so ruhig? Plötzlich machte ich mir doch ganz schön Sorgen.
Als die Untersuchungen abgeschlossen waren und das Warten auf die Ergebnisse begann, lächelte der nette Krankenpfleger besonders breit und sagte: „Da draußen werden Sie schon sehnlichst erwartet.“ „Meine Familie?“, fragte ich glücklich. Und im Flur warteten tatsächlich meine Eltern und Dennis. Sie lächelten alle drei, niemand weinte. „Wie geht’s?“, fragte meine Mutter fröhlich. Es fühlte sich einen Moment lang so an, als hätte ich mir beim Tennis einfach nur den Fuß verstaucht. „Gut“, gab ich ebenso fröhlich zurück. Dann wurde ich wieder weggeschoben und musste einsam auf die Ergebnisse warten. Immerhin gab man mir ein Glas Wasser zu trinken.
Nach einer halben Stunde, oder einer, oder auch zwei, ich hatte das Zeitgefühl verloren, jedenfalls war es draußen mittlerweile schon dunkel, kam eine junge Ärztin. Ich schnappte von ihren Erklärungen nur Satzfetzen auf – „Durchblutungsstörung im Hirn“ – „spricht für einen Schlaganfall“ – „Riss in der Halsschlagader“. Ich starrte sie an, ich glaube, ich schlug mir sogar die Hand vor den Mund. Und trotzdem fühlte ich eigentlich nichts. Keine Angst, keine Panik. Ich war genauso ruhig wie vorher, ließ diese fürchterliche Diagnose über mich schwappen wie eine Welle in der Brandung. Das war der Beginn von Phase zwei. Ich nenne sie: die Schockstarre.
Ich weiß heute nicht mehr genau, wie es dann weiterging. Ich glaube, ich wurde direkt in mein Zimmer geschoben, meine Eltern und Dennis kamen noch kurz mit rein, brachten mir Schlafanzug und Zahnbürste. Dann mussten sie gehen, es war ja schon nach zehn. Ich durfte nur einmal kurz aufstehen, um aufs Klo zu gehen, Zähneputzen musste ich im Bett.
Als ich eine Weile im Dunkeln in dem Zimmer gelegen hatte, durfte ich vom Stationstelefon des netten Krankenpflegers aus meinen Bruder anrufen. Meine Eltern hatten mich auch gebeten, das zu tun, da sie ihm nur in aller Kürze berichtet hatten, was passiert war. Er sollte hören, dass es mir gut ging. Rückblickend war dieser Moment einer der furchtbarsten überhaupt in meinem Leben. Und es gab von jetzt an so einige furchtbare Momente.
Ich wählte die Nummer meines Bruders und hörte noch, wie er abhob und seinen Namen sagte. Aber dann konnte er zehn Minuten gar nichts mehr sagen, weil er nur weinte. „Es geht mir gut“, rief ich beschwichtigend in den Hörer, „es ist alles gut!“ Ich redete und redete, vergoss nicht eine einzige Träne. Plötzlich fühlte ich mich wie der Arzt, der seinem verzweifelten Patienten Trost und Zuversicht spenden muss. Dabei war ich es, die verkabelt im Krankenbett lag.
Dazu muss man wissen, dass mein Bruder, fünfeinhalb Jahre älter als ich, immer schon ein großer Bruder war, wie er im Buche steht. Fünfeinhalb Jahre, das ist im frühen Kindesalter ein enormer Altersunterschied. Aber der hat im Alltag nie zu Problemen geführt, im Gegenteil.
Ich kann mir keine schönere Kindheit vorstellen als die, die ich hatte. Unser Elternhaus steht direkt an einem kleinen Fluss, von der Terrasse aus hat man einen herrlichen Blick über weite Felder bis hinten zum Wald. Als Kinder haben mein Bruder und ich viel Zeit am Fluss verbracht, haben Stöcke gesammelt, Staudämme gebaut und manchmal sogar Birnen-große, noch lebende Flussmuscheln aus dem Wasser geholt (und dann aus Mitleid natürlich wieder zurückgelegt).
In sehr kalten Wintern, wenn der Fluss komplett zugefroren war, schlitterten wir über die hubbelige Eisfläche und bestaunten die kuriosen Eisformationen, die sich an dem kleinen Wasserfall schräg gegenüber von unserem Zuhause am Ufer gebildet hatten. Ich kann mir nicht vorstellen, wie eine Kindheit in einer großen Stadt aussieht, und ehrlich gesagt habe ich sogar ein bisschen Mitleid mit Stadtkindern. Die wunderschönen Erlebnisse in der Natur möchte ich jedenfalls nicht missen.
Mein Bruder hat mich schon immer beschützt, hat sich wie eine große, nicht unüberwindbare Mauer vor mich gestellt, wenn ich von anderen Kindern gehänselt wurde. Oft hört man, dass ältere Geschwister unheimlich eifersüchtig auf den Neuankömmling sind, der plötzlich all die Aufmerksamkeit und Liebe der Eltern einfordert. Zwischen uns gab es diese Probleme nie, wie mir meine Mutter immer wieder erzählt hat.
Mein Bruder übernahm sehr früh für mich Verantwortung, passte auf mich auf, wenn unsere Mutter mal kurz aus dem Haus ging, beschützte mich vor Mitschülern, wenn ich draußen beim Spielen geärgert wurde, und war auch sonst immer für mich da. Jedenfalls dauert diese besondere Beziehung zwischen uns bis heute an, und auch wenn wir uns nicht mehr jeden Tag sehen, weiß ich, dass er sich ohne Zögern auch heute noch wie eine unüberwindbare Mauer vor mich stellen würde, wenn Unheil droht. Ich kenne naturgemäß kein Leben ohne meinen Bruder, und obwohl er die ersten fünfeinhalb Jahre seines Lebens ohne mich verbracht hat, bin ich mir ziemlich sicher, dass auch er sich ein Leben ohne mich nicht mehr vorstellen kann.
Und ich weiß, dass ihn der Gedanke, mich an jenem ersten schönen Frühlingstag um ein Haar verloren zu haben, beinahe umgebracht haben muss. Ich redete also weiter auf ihn ein, versicherte ihm, dass es mir gut gehe, dass ja nichts passiert sei und dass ich ganz bestimmt wieder gesund würde. Meine Aufmunterungsversuche fruchteten zumindest ansatzweise.
Nach unserem Telefonat lag ich in dem dunklen Zimmer und starrte gegen die weiße, geschlossene Tür, über der eine Uhr hing. Ich hatte Hunger, aber man gab mir nichts mehr zu Essen. Es gab nichts, das mich von meinem Hunger ablenkte, selbst die ganzen Messgeräte, an die ich angeschlossen war, standen außer Sichtweite am Kopfteil meines Bettes.
Also dachte ich noch einmal über das Gespräch mit meinem Bruder nach und begriff plötzlich: Es geht hier nicht nur um mich. Welches Leid, welche Sorgen ich mit dieser blöden Aktion über meine ganze Familie gebracht haben musste, konnte und wollte ich mir in diesem Moment gar nicht vorstellen. Die bloße Ahnung davon kroch mir aber wie ein eisiges Schaudern den Rücken hinunter. Und ich hasste mich dafür, ihnen das angetan zu haben.
Beim Versuch, schnell an etwas anders zu denken, an irgendetwas anderes, versuchte ich, die andere Patientin in meinem Zimmer zu sehen, die hinter mir lag. Ich konnte mich aber wegen der ganzen Kabel und Zugänge an meinem Körper kaum bewegen. Ich hörte nur ihr ungewöhnlich schnelles, röchelndes Atmen, das mich irgendwie beunruhigte. Auf Zurufe reagierte sie nicht. Erst später erfuhr ich, dass die alte Frau im Koma lag. Mir war zu jener Zeit eben noch nicht richtig bewusst, dass ich auf der Stroke Unit lag. Einer Station also, die für viele, die dort landen, die letzte in ihrem Leben ist.
Kapitel 3: Glück? Was ist denn Glück?
„Here am I floating round my tin can
Far above the moon
Planet earth is blue
And there's nothing I can do”
David Bowie – „Space Oddity“5
Die Nacht war sehr unruhig. Jede Stunde kam jemand in mein Zimmer, um zu schauen, ob ich noch lebte. Man leuchtete mir in die Augen, maß Blutdruck. Dabei hätte irgendeines der Geräte, an die ich angeschlossen war, sicherlich angefangen zu piepsen, sobald mein Herz stehenbleibt. Aber wahrscheinlich ist das üblich auf der Schlaganfall-Station. Sicher ist sicher.
Die unruhige, schlaflose Nacht bot mir also immerhin ein paar Gelegenheiten zum Nachdenken. Ich muss immer noch unter Schock gestanden haben, denn ich fühlte eigentlich gar nichts. Ganz sachlich, ich würde sagen, fast wissenschaftlich – ja, eigentlich so, wie ich auch an die Recherchen meiner Diplomarbeit zwei Jahre zuvor herangegangen war – analysierte ich die Geschehnisse des vergangenen Tages. Versuchte, mir einen Reim auf die schreckliche, aber für mich in diesem Moment völlig ungreifbare Diagnose zu machen.
Ich rekapitulierte den Tag: Weil es der erste schöne Frühlingstag gewesen war, hatten Dennis und ich beschlossen, Tennis zu spielen. Ich war erst am Abend zuvor von einer Schulung für Volontäre (ich war seinerzeit Volontärin, also auszubildende Redakteurin bei unserer regionalen Tageszeitung) in Bonn zurückgekommen. Es war Dennis‘ Geburtstag, darum waren wir abends bei unserem Lieblingsitaliener essen gegangen und unser beider Lieblings-Fußballmannschat, Eintracht Frankfurt, hatte auch noch gewonnen. Es war ein perfekter Start ins Wochenende. An dem Samstag waren wir dann auf den Tennisplatz gefahren, mit den Rädern, wie immer. Ich spielte seit rund zwei Jahren, Dennis schon länger. Ich war nicht berauschend gut, hatte aber schon eine Begabung, denn ich lernte schnell. Wir hatten ganz normal angefangen zu spielen.
Und irgendwann, bemerkte ich nun bei meinen nächtlichen Analysen, hatte ich ein Stechen im Hals gespürt. Ich weiß noch ganz genau, dass mich das eine Sekunde lang irritierte. Dazu kamen leichte Schmerzen im Hinterkopf. „Vielleicht brüte ich eine Erkältung aus“, dachte ich mir. Als dann auch noch etwas Benommenheit dazukam, war die Sache für mich klar. „Mir ist nicht so gut“, sagte ich zu Dennis, „lass uns aufhören.“ Vielleicht hatte ich mir bei der Schulung in Bonn etwas eingefangen. Oder es war der Wetterumschwung. Wir fuhren mit den Rädern zurück zu Dennis‘ Eltern.