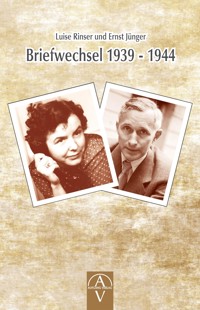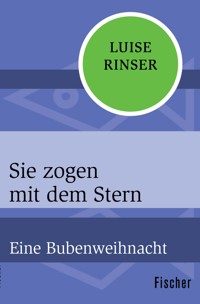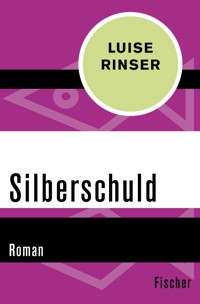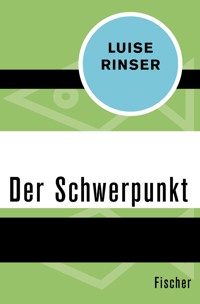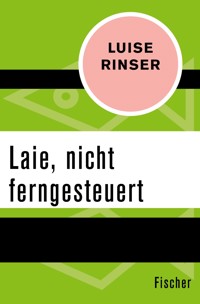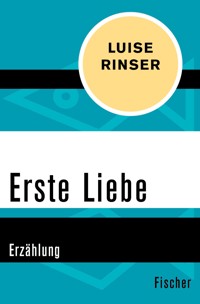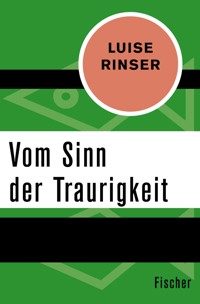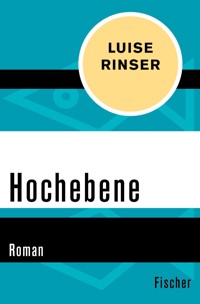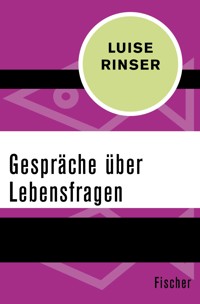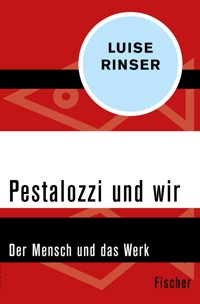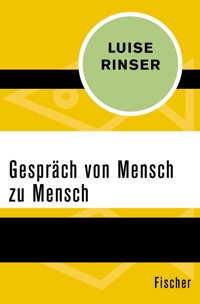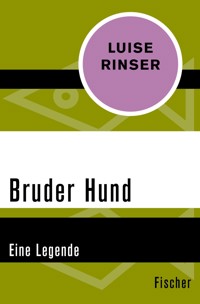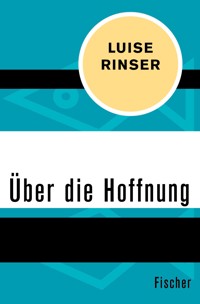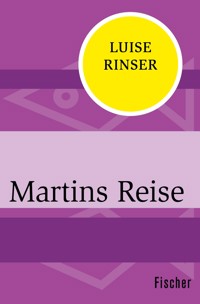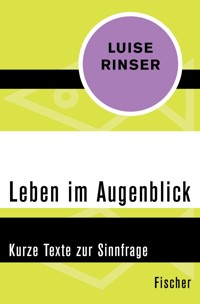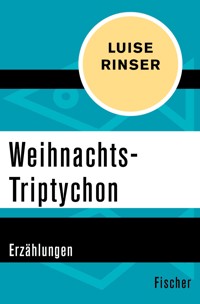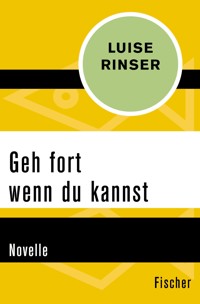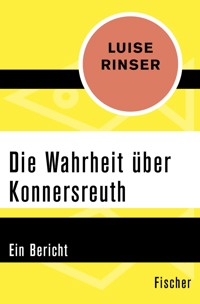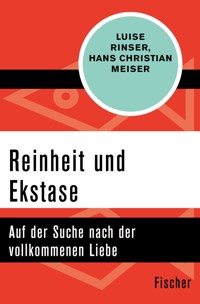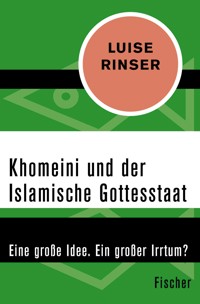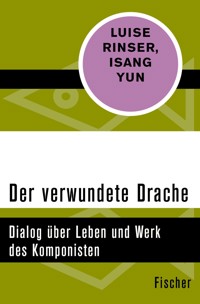
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Wenn in Ostasien eine schwangere Frau von einem Drachen träumt, so bedeutet das, dass ihr Kind ein besonderes Schicksal haben wird.« Und ist der Drache gar verwundet, wie es die Mutter des koreanischen Komponisten Isang Yun in ihrem Traum sah, so steht dem Kind ein schweres, aber bedeutendes Schicksal bevor. Luise Rinser führt hier nicht nur ein Interview mit Isang Yun: Sie gewährt uns vielmehr Einblick in das persönliche Gespräch zweier vertrauter Freunde. Isang Yun schildert prägende Episoden aus seinem bewegten Leben zwischen Ost und West, Musik und Politik und lässt sein Werk vor diesem Hintergrund umso lebendiger werden. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Luise Rinser | Isang Yun
Der verwundete Drache
Dialog über Leben und Werk des Komponisten
Über dieses Buch
»Wenn in Ostasien eine schwangere Frau von einem Drachen träumt, so bedeutet das, dass ihr Kind ein besonderes Schicksal haben wird.« Und ist der Drache gar verwundet, wie es die Mutter des koreanischen Komponisten Isang Yun in ihrem Traum sah, so steht dem Kind ein schweres, aber bedeutendes Schicksal bevor. Luise Rinser führt hier nicht nur ein Interview mit Isang Yun: Sie gewährt uns vielmehr Einblick in das persönliche Gespräch zweier vertrauter Freunde. Isang Yun schildert prägende Episoden aus seinem bewegten Leben zwischen Ost und West, Musik und Politik und lässt sein Werk vor diesem Hintergrund umso lebendiger werden.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Luise Rinser, 1911 in Pitzling in Oberbayern geboren, war eine der meistgelesenen und bedeutendsten deutschen Autorinnen nicht nur der Nachkriegszeit. Ihr erstes Buch, ›Die gläsernen Ringe‹, erschien 1941 bei S. Fischer. 1946 folgte ›Gefängnistagebuch‹, 1948 die Erzählung ›Jan Lobel aus Warschau‹. Danach die beiden Nina-Romane ›Mitte des Lebens‹ und ›Abenteuer der Tugend‹. Waches und aktives Interesse an menschlichen Schicksalen wie an politischen Ereignissen prägen vor allem ihre Tagebuchaufzeichnungen. 1981 erschien der erste Band der Autobiographie, ›Den Wolf umarmen‹. Spätere Romane: ›Der schwarze Esel‹ (1974), ›Mirjam‹ (1983), ›Silberschuld‹ (1987) und ›Abaelards Liebe‹ (1991). Der zweite Band der Autobiographie, ›Saturn auf der Sonne‹, erschien 1994. Luise Rinser erhielt zahlreiche Preise. Sie ist 2002 in München gestorben.
Impressum
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Erschienen bei FISCHER Digital
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Copyright © by Christoph Rinser
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Montasser Medienagentur, München
Covergestaltung: buxdesign, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-561347-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Gottes ist der Orient!
Vorwort
I Kindheit in Korea
II Jugend in Korea und Japan
III Umwege zu Beruf und Selbstfindung
IV Studium und erste Erfolge
Träume: Zwei Einakter
V Entführung
Bericht
VI Befreiung und Neubeginn
›Sim Tjong‹
Werkverzeichnis
Diskographie
Namenregister
Bildnachweis
Gottes ist der Orient!
Gottes ist der Okzident!
Nord- und südliches Gelände
Ruht im Frieden seiner Hände.
Goethe, ›West-östlicher Divan‹.
Vorwort
Man sagt mir, es sei nötig, diesem Buch ein Vorwort zu geben, in dem ich sein Entstehen erkläre; denn diese Entstehungsgeschichte sei selbst schon ein Kapitel des Buches. Nun gut. Ich will antworten auf die Frage, die gewiß gestellt werden wird: Wie kommt eine deutsche Schriftstellerin dazu, die Biographie eines koreanischen Komponisten zu schreiben, und kann sie das überhaupt, ohne Koreanerin und Musikerin oder Musikwissenschaftlerin zu sein? Und warum wählt sie so ein fernab liegendes Sujet?
Es war nicht ich, die es wählte, es wählte mich. Isang Yun und ich sind Freunde. Wir lernten uns als Mitglieder der Berliner Akademie der Künste kennen. Unsere Freundschaft ruht auf vier Pfeilern, vier Gemeinsamkeiten: der Philosophie des Tao, der modernen Musik, der Erfahrung politischer Verfolgung und Gefangenschaft unter einer Diktatur und der Arbeit für die Wiederherstellung der Demokratie in Südkorea. Eines Tages schlug mir Isang Yun vor, die Geschichte seiner Entführung durch den Koreanischen Geheimdienst (KCIA) aus der Bundesrepublik nach Südkorea aufzuschreiben. Es sollte ein rein politisches Buch werden. Jedoch: Isang Yuns politisches Leben ist seit seiner Jugend so eng mit seinem künstlerischen verbunden, daß man nicht vom einen reden kann, ohne das andre zu berichten.
Ich fand zunächst, die eindrucksvollste Form des Berichts sei die Autobiographie. Aber: abgesehen vom Problem der sprachlichen Gestaltung, die für ihn trotz seiner erstaunlichen Beherrschung des Deutschen zu mühsam wäre, kann er, so sagt er, nur dann von sich sprechen, wenn er einen Zuhörer leibhaftig vor sich habe, und könne er von vielem nur berichten, wenn dieser Zuhörer ähnliche Erfahrungen habe und zudem auch fähig sei, die Pausen in der Musik als Musik zu erkennen. Dieser Zuhörer also war ich. Wir nahmen unser Gespräch, das mehrere Wochen dauerte, auf Band. Zusätzliches, beiläufig sonst Erwähntes stenographierte ich mit. Ich stellte Fragen, Isang Yun antwortete. So bot sich uns für das Buch die literarische Form des Dialogs ganz selbstverständlich an.
Um fragen zu können, muß man wissen. Was wußte ich, um richtige Fragen stellen zu können? Soweit es um fernöstliche Philosophie und Religion, um aktuelle Fernost-Politik und koreanische Kultur geht, besitze ich ein gerade ausreichendes Wissen. Da ich zudem in Südkorea war, habe ich den Geist der Landschaft in mich aufgenommen. Der Umgang mit Koreanern in Deutschland, vor allem mit Isang Yun, erschloß mir nach und nach die koreanische Art, zu denken und zu fühlen.
Aber: Isang Yun ist Komponist, und zwar ein moderner. Wer über einen Musiker schreibt, muß etwas von seiner Musik und von Musik überhaupt verstehen. Was kann die Autorin anführen zur Legitimierung ihres Unterfangens, als Nichtmusikerin über Musik zu reden?
Ich sehe mich zu einer Apologie gedrängt, obgleich die Approbation des Buches durch Isang Yun selbst eine solche Apologie eigentlich überflüssig macht. »Du hast verstanden«, sagte er. Ich will aber noch einiges anfügen: Musik und Musiker gehören zu meinem Schicksal. Mein Vater war im Nebenberuf Organist. Ich hatte jahrelang Geigenunterricht. Während meiner Schul- und Studienzeit gab ich mein gesamtes Taschengeld aus für Oper und Konzerte. Meine beiden Ehemänner waren Musiker: mein erster Mann, Horst Günther Schnell, Schüler von Paul Hindemith, Opernkapellmeister in Braunschweig und Rostock, 1943 als Antifaschist gefallen in einer Strafkompanie, war mir ein guter Lehrer für Musiktheoretisches, bei ihm lernte ich Partiturlesen. Mein zweiter Ehemann war Carl Orff. Teilnehmend am Entstehen einiger seiner bedeutenden Arbeiten, vor allem am ›Oedipus‹, bei Proben und Schallplattenaufnahmen, bei Besprechungen mit Dirigenten, Regisseuren, Bühnenbildnern, Sängern, lernte ich viel über Operndramaturgie.
In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in München die ›Musica Viva‹-Konzerte von Karl Amadeus Hartmann. Ich versäumte wenige und lernte nach und nach alles Neue und Neueste kennen, von Bartók und Strawinsky bis zur Wiener Schule und zur Elektronenmusik. So wuchs ich mühelos in die moderne Musik hinein. Das Hören der atonalen Musik Isang Yuns bot keine Schwierigkeit für mich, und auch der den westlichen Ohren unvertraute fernöstliche Klang war mir eher vertraut als fremd. So ging ich denn, was das Musikalische anbetrifft, wie eine Schlafwandlerin an mein Unternehmen, über diese Musik zu schreiben. Die Schwierigkeiten, die sich bei der Arbeit ergaben, waren andrer Art. Isang Yun, der sich das Buch gewünscht hatte, scheute plötzlich davor zurück, über sich zu sprechen. »Ich bin doch nicht wichtig«, sagte er, und er meint, was er sagt. Diese Haltung »Bescheidenheit« zu nennen, ist falsch. Isang Yun weiß schon, wer er ist und was er kann (auch was er nicht kann). Aber er weiß, als wisse er nicht. Das ist taoistisch. Sein Lebensgefühl ist anders als das westliche. Er pocht nicht wie wir auf das Ich-Sein, auf die Individualität, auf die unverwechselbare Persönlichkeit und ihre Dauer, er pocht nicht einmal auf die Dauer seiner Musik. Sich selbst darstellen, das bedeutet ihm ein Heraustreten aus der großen Harmonie. Nichtreden ist besser als Reden.
Koreaner sind zwar sehr kommunikativ, wahren aber größte Distanz im Privaten. »Ich kann doch nicht meine nackte Haut öffentlich zeigen«, sagt Isang Yun. Diese Schamhaftigkeit gehört zum ostasiatischen Stilbewußtsein, das ästhetischer wie ethischer wie religiöser Natur ist. Für uns im Westen, die wir an die Mode des süchtigen Sich-nackt-Präsentierens in der Kunst und in der Nicht-Kunst der gängigen Memoiren gewöhnt sind, ist diese Keuschheit, die nichts zu tun hat mit Puritanismus und Verdrängung, etwas Sonderbares. Ich finde sie schön. Bei Koreanern kommt dazu die Scheu, über sich sprechend, ihre starken Gefühle zu zeigen. Es bedeutet, »sein Gesicht verlieren«.
Sosehr also der europäisch gewordene Isang Yun diese Biographie wünschte, so stark sträubte sich der Ostasiate in ihm dagegen. In den Wochen unsrer Zusammenarbeit war es meine tägliche Morgenmühe, ihn sanft, aber bestimmt zum Weiterreden zu bringen, wenn er auf seine schwermütig-gelassene Art störrisch wurde. Wer je mit Ostasiaten zu tun hatte, der weiß, wie schwierig es ist, gegen sie anzukommen, wenn sie sich mit ihrer uralten Weisheit und Passivität gegen die westlich-intellektuell drängende Aktivität still und mächtig sperren.
Das einzige Argument, mit dem ich Isang Yun jeweils zum Weiterreden locken konnte, war ein politisch-humanes: es sei ja doch nicht unsre vordringliche Absicht, über den Komponisten Isang Yun zu schreiben, sondern über einen Künstler, der in einer Diktatur seiner Freiheit beraubt wurde und der mit diesem Schicksal einer von vielen ist, ein Modellfall, ein Zeuge, ein Mahner.
Eine andre Schwierigkeit ergab sich aus dem Umstand, daß wir im politischen Teil Personen des öffentlichen Lebens in Korea und in der Bundesrepublik belasten mußten. Isang Yun wollte aber nicht, daß Menschen aus der Regierung seines Gastlandes kritisiert würden, und er wollte nicht, daß der Eindruck entstünde, er identifiziere die aktuelle Regierung Südkoreas und den KCIA (dem freilich viele Südkoreaner angehören) mit dem südkoreanischen Volk, das er liebt und dem er sich ganz und gar zugehörig fühlt. Diese Rücksichten gerieten oft in Konflikt mit seiner Ehrlichkeit und Genauigkeit und meiner Verpflichtung zu sauberer Berichterstattung nach vorhandenen Dokumenten. Bisweilen halfen wir uns, indem wir Belastendes und belastete Namen wegließen.
Ich bedauere es auch, daß Isang Yun aus dem fertigen Manuskript einiges gestrichen haben wollte, was ihm als zu privat erschien. So fehlt einiges menschlich Ergreifende, seine tapfere Frau und seine Kinder betreffend. Ich sollte auch alle Stellen streichen, die von seinen Erfolgen berichten. Das war nun schlechterdings unmöglich.
Es gab übrigens auch Schwierigkeiten, die aus mir selbst kamen: obgleich ich, auch nach Isang Yuns Urteil, der fernöstlichen Welt nahe bin, so ist sie doch nicht ganz die meine. Gerade weil ich sie kenne, weiß ich, daß ich sie nicht genau genug kenne. Das zu wissen, brachte mich während der Arbeit in eine tiefe Mutlosigkeit. Je mehr ich zu erklären versuchte, desto deutlicher wurde mir, daß ich das viel Wichtigere, Größere, das Eigentliche nicht sagen konnte, weil es nicht sagbar ist. »Der Sinn, den man ersinnen kann, das ist nicht der Sinn«, sagte Lao Tse über den Taoismus, den ahnungsweise zu verstehen unerläßlich ist für den, der sich mit Isang Yun beschäftigt. Natürlich machte mir auch das Formale dieser Arbeit Schwierigkeit: auf lange Strecken hin war ich zur Arbeit eines Reporters gezwungen, besonders im politischen Teil. Dabei fühlte ich mich wie ein Jagdhund, der nicht von der Leine gelassen wird, um das Wild Sprache zu erjagen. Aber schließlich: es ging um das Phänomen Isang Yun. So unterwarf ich mich mehr oder minder willig den Zwängen, die sich aus der Sache ergaben. Die Sache selbst aber ist ganz und gar auch die meine: es geht um Kunst und um das Menschliche.
I Kindheit in Korea
I.Y.
Wenn in Ostasien eine schwangere Frau von einem Drachen träumt, so bedeutet das, daß ihr Kind ein besonderes Schicksal haben wird. Meine Mutter träumte vor meiner Geburt von einem Drachen, aber es war kein vollkommen glücklicher Traum. Als ich sieben oder acht Jahre alt war, erzählte sie mir: sie habe einen großen Drachen gesehen, er schwebte in der Luft über dem Jiri-Berg, der meinem Geburtsort San Chung Gun gegenüber liegt. Dieser Berg hatte für uns etwas Mystisches, er war uns heilig. Über diesem Berg also lag der Drache zwischen den Wolken, er flog, aber er stieg nicht hoch zum Himmel, er konnte nicht, er war verwundet. Meine Mutter erschrak über den Traum, denn er sagte ein schweres, aber bedeutendes Schicksal für mich voraus.
L.R.
Wie deutest du selbst den Traum?
I.Y.
Du kennst mein Cellokonzert. Erinnere dich an den Oktavensprung gegen den Schluß zu. Dieser Sprung bedeutet das Bedürfnis und Verlangen nach Freiheit, Reinheit, nach dem Absoluten. Im Orchester glissiert die Oboe vom Gis zum A, und dieses A wird von den Trompeten, die für mich in dieser hohen Lage immer etwas Göttlich-Ermahnendes haben, übernommen. Es sind zwei Trompeten. Sie blasen abwechselnd dieses A. Das Cello will es erreichen, aber es gelingt ihm nicht. Es kommt mit seinem Glissando einen Viertelton höher als Gis, aber höher nicht. Es gibt auf. Das unendlich und unfaßbar Hohe, das Absolute, das A der Trompeten, das bleibt bis zum Schluß.
L.R.
Bis zu diesem überhöhten Gis zu kommen, ist schon sehr viel, meine ich. Freilich: für den, der aufs A zielt, bleibt es ein Lebensschmerz, es nicht zu erreichen. Aber weiß man selber genau, wie hoch man kommt? Und ist nicht die Spannung aufs absolute Trompeten-A hin das, was dich schöpferisch macht?
I.Y.
Ich habe dir schon oft gesagt, daß ich nicht weiß, ob ich wirklich zum Musiker, zum Komponisten, geboren bin. Vielleicht hätte ich etwas ganz anderes tun sollen.
L.R.
In die Politik gehen?
I.Y.
Ich weiß nicht.
L.R.
Überzeugt dich dein Erfolg nicht davon, daß es dein Schicksal ist, Komponist zu sein?
I.Y.
Erfolg, was ist Erfolg? Ein Schatten, der vorüberzieht. Weißt du, ob auch nur ein einziges meiner Stücke mich überlebt? Aber was würde das ausmachen? Ich arbeite so viel und so gut ich kann, und eines Tages möchte ich aufhören und wieder zurückkehren in meine koreanische Heimat und dort am Meer sitzen, ganz still, und fischen und Musik hören im Geist, ohne sie aufzuschreiben, und mich selber finden in der großen Stille. Und dort will ich auch begraben sein, in der Wärme meiner Heimaterde.
L.R.
Erzähl von deiner Heimat und ihrer Wärme! Du bist in der Nähe von Tong Yong geboren, in einem Dorf, in der Nähe der Südküste. Du bist also Südkoreaner von Geburt. Heute hat es eine große politische Bedeutung, ob jemand in Süd- oder in Nordkorea geboren ist. Hatte es damals, am 17. September 1917, auch schon einen politischen Aspekt?
I.Y.
Damals war doch Korea noch ungeteilt.
L.R.
Aber es gab den Süden Koreas und den Norden. Gab es, wie in Deutschland etwa, ethnische Unterschiede, Unterschiede der Mentalität?
I.Y.
Ja, das wohl. Die Nordkoreaner stammen zum Teil aus der Mandschurei. Ein temperamentvolles, kriegerisches, hartes Volk, zäh und unternehmend und organisatorisch begabt. Wir im Süden sind weicher, emotionaler, auch bequemer, wir lieben das Schöne, und wir sind besonders begabt für Dichtung und Musik. Man sagt bei uns: Schöne Frauen aus dem Norden, schöne Männer aus dem Süden. Auf jeden Fall sind wir Individualisten und Ästheten.
L.R.
Deine Heimat ist schön. Ich kenne die Gegend um Pusan: Hügel mit Kiefernwäldern, Buchten mit reinem blauem Meer und Fischerbarken, die felsigen Ufer, die vielen Inselchen, die milde Luft, ich verstehe dein Heimweh.
I.Y.
Ich kam mit drei Jahren nach Tong Yong. Das war schon damals eine Stadt, sie liegt auf einer Halbinsel, einer Landzunge, und sie ist berühmt wegen der Fischerei. Das gehört zu meinen Erinnerungen: die Fischerboote auf dem Meer, nachts unter dem klaren Sternhimmel, die Gesänge der Fischer von Boot zu Boot, und am Morgen in den engen Straßen der Stadt der Fischmarkt, tausend und tausend silberne Fische, ein Gewimmel in den Körben, und manchmal sprang ein Fisch wie ein Silberblitz hoch und aus dem Korb auf die Straße, und wenn in der Frühe gerade ausgeladen wurde, lagen die Fische zuerst einfach auf der Erde, und man mußte geradezu durch Fischfluten waten. Es gab bei uns eine besondere Art von Kabeljau, der fabelhaft schmeckt. Das Meer ist unendlich fischreich dort. Jedenfalls war es so in meiner Kindheit.
L.R.
Es ist wohl noch so. Dein Vater war kein Fischer. Er war – wir würden heute sagen: ein Privatgelehrter, nicht wahr?
I.Y.
So kann man sagen. Die Familie Yun, genau gesagt, unser Zweig der Familie, kommt aus China. Yun ist ein chinesischer Name. Die Yuns sind vor etwa siebenunddreißig Generationen in Korea eingewandert.
L.R.
Ist das Familienlegende, oder beruht es auf geschichtlich nachweisbaren Daten?
I.Y.
Fast jede chinesische und koreanische Familie hat ihr Ahnenbuch. Für einen Ostasiaten ist es sehr wichtig zu wissen, welcher Familie er angehört und woher er stammt. In jeder zweiten oder dritten Generation muß der jeweilige Familienvater das Stammbuch seiner Linie ergänzen, es wird in einem eigenen Schrein aufbewahrt und nur bei großen Familienfesten vorgezeigt. Wir Yuns kamen wahrscheinlich als Gesandte mit einer kulturellen Funktion nach Korea. Damals stand Korea unter dem politischen und kulturellen Einfluß Chinas. Es war keine Kolonie wie in unserm Jahrhundert unter den Japanern, es war selbständig, hatte aber enge Beziehungen zu China. Es gab damals das, was man heute den akademischen Austausch-Dienst nennt. So vielleicht kamen die ersten Yuns nach Korea. Yun ist ein chinesisches Wort und bedeutet Haupt, Führer, Anführer.
L.R.
Auch dein Vorname ist chinesisch.
I.Y.
Eigentlich heiße ich I Sang. Sang heißt Maulbeerbaum. Da Yun der Führer heißt, bedeutet mein Name, der eigentlich umgekehrt sein müßte, nämlich Yun I Sang: der Führer auf dem oder unterm oder beim Maulbeerbaum.
L.R.
Und was will das sagen?
I.Y.
Mein Vater war ein guter Kenner der chinesischen Geschichte und Literatur. So kannte er auch die Geschichte von I Yun. Das war ein bedeutender Philosoph und Politiker der Yin-Zeit, also vor rund dreitausend Jahren. Damals war ein Teil Chinas von Kriegen und Naturkatastrophen heimgesucht und verarmt. Der König, oder besser: der oberste Minister, wußte nicht, wie es weitergehen würde. Da hörte er sagen, daß irgendwo auf dem Dorf verborgen ein Weiser wohne, ein Philosoph mit politischem Interesse, aber nicht aktiv, er lebe ganz einfach, er schlafe unter einem Maulbeerbaum, da könne man ihn finden. Zu diesem I Yun schickte der Minister einen Boten, der ihn zu Hofe bringen sollte. I Yun aber ging nicht mit. Da schickte der König einen zweiten Boten, aber I Yun verließ nicht seinen Maulbeerbaum. Da ging der Minister selbst zu ihm, redete mit ihm und überzeugte ihn von seiner Aufgabe, das Land zu retten, und da ging er mit. Er wurde hoher Beamter, und da hatte er einen großen Einfall: er muß wohl beobachtet haben, daß auf seinem Baum Raupen wohnten, die sich in Kokons einspannen, und daß das Material, mit dem sie sich einspannen, aus Fäden bestand, die man verwenden konnte. So ließ er im ganzen Land Maulbeerbäume pflanzen.
L.R.
Damit begann die Seidenraupenzucht.
Das alte Schulgebäude in Tong Yong
I.Y.
Vielleicht. Ich bin dessen nicht sicher. Mein Vater liebte diese Gestalt sehr, und darum hat er mich nach ihr genannt.
L.R.
Die Geschichte ist voller Bedeutung, bist du dir dessen bewußt? I Yun ist gegen seinen eigentlichen Wunsch Politiker geworden. Das Schicksal wiederholt sich: auch du bist gegen deinen Wunsch schon früh in die Politik verwickelt worden.
I.Y.
In meiner Familie gab es immer hohe Beamte, Architekten, Marineoffiziere. Du hast das riesige Gebäude in Tong Yong gesehen, in dem ich zur Schule ging. Es wurde vor etwa vierhundert Jahren erbaut. Einer der Architekten war ein Yun, mein Ur-Ur-Urgroßvater. Mein Vater zeigte mir in dem Gebäude eine Tafel, auf der die Namen der beim Bau Beteiligten stehen. Darunter sind viele Yuns. Es gibt eine Geschichte von einem Yun aus dem vorigen Jahrhundert, von meinem Urgroßvater also. Er war Marineoffizier. Damals landete nach Jahrhunderten, in denen Korea hermetisch abgeschlossen war gegen das Ausland, das erste europäische Schiff an unsrer Küste. Es war ein modernes Schiff, so eines hatten und kannten wir nicht.
L.R.
Dabei hattet ihr schon im 16. und 17. Jahrhundert höchst erstaunlich raffinierte Erfindungen gemacht: eine Art Handgranaten, Feuerklöße genannt, und eine Art Kanonen, aus denen ihr die, wie ihr sie nanntet, fliegenden Donnergeschosse schicktet, und eine Art Panzer, Feuerwagen genannt, und die Schildkrötenboote, gepanzerte Unterseeboote. Alles zu eurer Verteidigung, nicht zum Angriff, ihr habt ja keine Angriffskriege gemacht seit vielen Jahrhunderten, ihr seid nur viele Male überfallen worden. Aber dann seid ihr in eurer so avantgardistischen Technik einfach stehengeblieben, und der Westen hat euch überholt.
I.Y.
Als damals das europäische Schiff landete, es war 1866, konnte das für uns nichts Gutes bedeuten. Darum befahl der König, das Schiff zu versenken. Tong Yong war Marinestützpunkt. Dort wählte man zwei hohe Offiziere aus, einer davon war mein Urgroßvater, und die beiden nahmen ein paar Dutzend Marinesoldaten mit, und sie tauchten unter das Schiff und bohrten es von unten an. Eine tapfere Tat.
L.R.
Und dein Großvater? Was tat der?
I.Y.
Gar nichts Besonderes. Er besaß Land, nicht sehr viel, aber genug, um sich davon gut zu ernähren. Er hatte einen Bruder, der kinderlos war, und er selbst hatte eine Tochter und nur einen einzigen Sohn, den die beiden Familien schrecklich verwöhnten, das war mein Vater. Er wollte zuerst Medizin studieren, das war bei uns damals Naturheilkunde; aber dann gab er das auf und tat nichts mehr als lesen. Er las chinesische Literatur, und er dichtete selbst. Nebenbei hatte er ein bißchen Land, das heißt, zuerst war es mehr, aber er mußte Stück um Stück verkaufen. Er hatte auch einen kleinen Fischereibetrieb, aber er kümmerte sich nicht darum, und als dann einmal der Kabeljau nicht kam, hatte er große Verluste, und er mußte wieder Land verkaufen. Da wußte er nicht mehr, wie er seine Familie ernähren sollte. Bei uns in Korea ist es so, daß ein Yangban kein Kaufmann sein sollte, das war ein niedriger Beruf.
L.R.
Was ist ein Yangban?
I.Y.
Ein Gelehrter aus einer Familie mit Gelehrtentradition. Ein Yangban bleibt ein vornehmer Herr auch dann noch, wenn er ganz verarmt ist. Ganz verarmt war mein Vater nicht, doch mußte er etwas arbeiten, und es war einem Yangban erlaubt, ein Handwerk auszuüben. Mein Vater hatte dann eine kleine Möbelschreinerei, mit sieben oder acht Leuten. Sie machten kleine verzierte Tische. Ich war viel in der Werkstatt. Der Vater aber lag lieber in seinem Zimmer und las und schrieb Gedichte. Er war sogar ein angesehener Dichter. Damals konnten alle Gelehrten dichten. Sie schrieben im Stil der Tang-Dichtung, also wie Li Tai Po. Sie schrieben natürlich in chinesischer Schrift. Mein Vater war Mittelpunkt eines Dichterkreises. Wohin er kam – er war Mittelpunkt. Es gab damals oft Dichtertreffen, dabei wurden die Gedichte vorgelesen und kritisiert, und es wurde Wein getrunken, und dann kamen auch Kisaengs, das waren, du weißt, nicht einfach Prostituierte, sondern Mädchen, die singen konnten und ein Instrument spielen und auch selber dichten. Natürlich waren sie auch für den Eros da.
L.R.
Sind Gedichte deines Vaters erhalten?
I.Y.
Nein, darauf hat er keinen Wert gelegt. Es war auch nicht üblich, daß Gelehrte ihre Gedichte veröffentlichten, sie hatten in dieser Hinsicht keinen Ehrgeiz. Es genügte ihnen, sich wechselseitig die Gedichte vorzulesen. Ich habe oft im Zimmer meines Vaters solche Gedichtblätter liegen sehen, und es kümmerte meinen Vater nicht, wenn meine Mutter solche Blätter nahm, um mit ihnen Feuer zu machen. Übrigens dichtete mein Vater nicht nur, er machte auch kalligraphische Holzschnitte. Seine Bilder hingen damals in vielen Tempeln.
L.R.
Du warst der älteste Sohn, nicht wahr?
I.Y.
Der älteste Sohn aus meines Vaters zweiter Ehe. Aus der ersten stammen zwei Töchter, aus der zweiten drei Mädchen, ich und mein jüngerer Bruder. Ihn hat mein Vater sehr geliebt.
L.R.
Dich nicht?
I.Y.
Nein, mich nicht. Meine Mutter sagte einmal, es komme daher, daß wir uns zu ähnlich seien. Ich habe aber doch schöne Erinnerungen an meinen Vater. Er nahm mich oft nachts mit aufs Meer zum Fischen. Wir saßen dann schweigend im Boot und horchten auf das Springen der Fische und auf den Gesang der anderen Fischer, die sich von Boot zu Boot zusangen, schwermütige Lieder, den sogenannten »Südgesang«, das Wasser trug die Töne weit, das Meer war wie ein Resonanzboden, und der Himmel war voller Sterne. Aber ich hatte auch ohne meinen Vater meine Erlebnisse am Meer. Es war mir verboten, nachts allein zum Fischen zu gehen. Ich ging doch. Heimlich. Fünf Kilometer weit mußte ich laufen, bis ich zum richtigen Platz kam: zu einem Felsenriff, das etwa fünfzehn Meter steil zum Meer abfiel. Ich war nicht sportlich, aber ich kletterte mutig die gefährlichen Klippen hinunter, in einer Hand die Bambusangel, auf dem Rücken den Fischkorb. Es ging mir nicht darum, Fische zu fangen, es ging mir ums Dasitzen, allein unter dem Sternenhimmel, von dem im Sommer unzählige Sternschnuppen fielen. Diese menschenleere Nachtwelt hatte eine magische Anziehung für mich. Auf dem Weg zum Riff und beim Klettern hatte ich schreckliche Angst, aber dann, wenn ich dort saß, war ich angstlos und vollkommen glücklich. Das Meer hatte noch andere Freuden für mich, zum Beispiel den Krabbenfang. Bei Ebbe liefen wir Kinder an den Strand. An bestimmten Zeichen im Sand erkannten wir, wo ein Krabbenloch war. Wir wischten den Sand weg und steckten ein kleines Stück Bohnenpastete ins Loch. Ich weiß nicht, wozu: ob die Krabben das gerne fraßen oder ob es sie im Gegenteil reizte und aus dem Loch trieb. Jedenfalls kam dann bald eine Krabbe heraus. War es eine männliche, ließen wir sie ins Loch zurückkriechen. Der weiblichen, die man daran erkennt, daß ihr hinteres Ende viel weicher ist, banden wir eine Schnur um dieses Ende, ehe wir sie ins Loch kriechen ließen. Nach kurzer Zeit zogen wir sie an der Schnur wieder heraus, und wir konnten sicher sein, daß ihr eine zweite sofort nachfolgte. Warum das so ist, das weiß ich nicht. Aber auf solche Weise haben wir immer statt einer Krabbe deren zwei gefangen.
L.R.
Hast du an deinen Vater noch andere Erinnerungen außer jener an den nächtlichen Fischfang?
I.Y.
Ja, ich erinnere mich daran, wie er Zeremonien leitete, etwa zum Jahrestag eines verstorbenen Verwandten, eines unsrer Ahnen. An solchen Tagen stand er früh auf und badete und konzentrierte sich dabei, während in der Küche von den Frauen die rituellen Speisen bereitet wurden. Am Abend saßen wir alle schön gekleidet bei Kerzenlicht am Tisch und aßen. Wir, das waren natürlich nur die männlichen Mitglieder der Familie.
L.R.
»Natürlich«, sagst du. Du meinst, »natürlich« im Sinne eurer Tradition, nach der Frauen an Zeremonien nicht teilnehmen und auch sonst nicht mit zu Tische sitzen. So ist es heute noch.
I.Y.
Wir sind ein Volk der langen, der uralten Traditionen. Zu unsrer Tradition gehört, daß man bei einer solchen Feier den Ahnenschrein öffnet und daß alle Mitglieder der Familie vor ihm die vorgeschriebenen Verbeugungen machen. Es werden dabei auch alte heilige Texte vorgelesen, Huldigungen an die Toten. Mein Vater las sie sehr schön vor. Wenn der Verstorbene erst ein oder zwei oder drei Jahre tot ist, dann gehen alle an sein Grab. Später feiert man nur zu Hause. Dazu kommen viele Verwandte. Es gibt da einen alten Glauben: man serviert das Essen in Bronzeschüsseln, und wenn alle Gäste bei der Zeremonie ganz konzentriert sind, hört man einen ganz leisen Klang von den Bronzeschüsseln: es sind die Toten, die als erste essen. Ich habe mir immer viel Mühe gegeben, so konzentriert zu sein, daß ich den Klang hören könnte, und ich glaubte auch, ihn zu hören. An solchen Tagen und in dieser feierlichen und geheimnisvollen Atmosphäre war mein Vater der großartige Mittelpunkt. In solchen Stunden mochte ich ihn gern.
L.R.
Da entsprach er deinem Bild von einer echten Vater-Figur. Und wie ist es mit der Mutter-Figur?
I.Y.
Meine Mutter, ach, die hatte es nicht gut. Sie war die zweite Frau meines Vaters. Aber sie war nicht ebenbürtig, sie war keine Yangban-Frau, sie kam aus einer einfachen Bauernfamilie. Die Yangbans sind sehr klassenbewußt. Meine Mutter wurde nicht gut aufgenommen in dieser stolzen Familie, und sie litt. Alles war ihr fremd: die Familie, die Stadt, die Sitten, und sie war immer traurig, und eines Tages hielt sie es nicht mehr aus, und sie ging fort mit mir. Das erzählte sie mir viel viel später. Ich war eineinhalb Jahre alt, ich bekam noch Muttermilch, als sie fortging mit mir, ohne Geld, ganz heimlich. Manchmal wurde sie von Bauernwagen mitgenommen, dann aber lief sie wieder zu Fuß, sie wollte heim zu ihren Eltern. Unterwegs kam sie an einen Fluß, da war die Brücke weggerissen von einer Überschwemmung, die Reisfelder standen tief unter Wasser. Da watete meine Mutter mit mir auf dem Rücken durch die Flut. Aber in der Mitte riß der Fluß sie mit, und mich löste er von ihrem Rücken. Sie schrie um Hilfe, und ein Bauer rettete sie und mich.
L.R.
Ich habe gehört in Korea, daß eine Frau, die ihrem Mann wegläuft, von ihrer eigenen Familie nicht aufgenommen wird.
I.Y.
Ja, das ist meistens so gewesen. Aber irgendwohin mußte meine Mutter ja schließlich. Sie ist dann doch zu ihrer Familie gegangen. Eines Tages kam mein Vater und bat sie zurückzukehren, und sie ging mit ihm.
L.R.
Du hast gesagt, zu deinen schönsten Erinnerungen gehörten die an die nächtlich singenden Fischer. Hast du andere Klang-Erinnerungen?
I.Y.
Ja. Sie hängen zusammen mit den Reisfeldern, die an unser Haus am Stadtrand grenzten. Wenn die Felder im Frühling unter Wasser standen, gab es dort unzählige Frösche. Die Nächte waren voll von ihrem Geschrei. Für mich war es kein Geschrei, es waren vielstimmige Chöre, fast kunstvoll komponiert: eine Stimme begann, eine andere fiel ein, eine dritte, und plötzlich setzte der Chor ein mit hohen und mittleren und tiefen Stimmen, und ebenso plötzlich verstummten alle, eine Pause folgte, und dann begann wieder eine Solostimme, eine andere setzte ein, und wieder der Chor, und so ging es die Nacht hindurch. Tagsüber sangen auf den Reisfeldern die Frauen. Sie sangen alte Volkslieder. Auch meine Mutter sang mit, sie hatte eine schöne Stimme.
L.R.
Und dein Vater, der Dichter, konnte er ein Instrument spielen?
I.Y.
Nein, er hat nicht einmal gesungen. Aber ich selbst habe gesungen. Ich hatte eine schöne, klare und kräftige Singstimme. Meine Mutter sagte, das komme daher, daß ich als Kind so viel geweint habe. Ich war bekannt als Wein-Kind. Ich war nicht krank, nur sehr sensibel.
L.R.
Nun, es gibt einige Erklärungen für dein vieles Weinen, meinst du nicht? Bist du nicht beinahe ertrunken im Fluß, losgerissen vom Rücken deiner Mutter? Meinst du, das sei kein Schock gewesen für dich? Meinst du, davon bleibt kein Trauma im Unbewußten? Deine Angst stammt nicht aus der Gefängniszeit, die ist viel älter, die ist ungefähr so alt wie du! Und meinst du, die Traurigkeit deiner Mutter, ihr Leiden unter der Yangban-Familie, habe dich nicht beeindruckt? Und dein Gefühl, vom Vater nicht geliebt zu sein? Und vielleicht warst du überhaupt nicht gern auf dieser Erde. Ein verwundeter Drache hat es schwer.
I.Y.
Du hast recht: der Drache lebt nicht sehr gern oder jedenfalls nicht leicht.
L.R.
Hattest du eigentlich musikalische Anregungen außerhalb des Hauses? Was war mit den Wandertruppen, die Opern aufführten?
I.Y.
Ja, das war etwas Faszinierendes. Diese Wandertheater stammen aus der alten höfischen Tradition. Bis zum Ende des koreanischen Kaiserreichs zu Anfang dieses Jahrhunderts waren die Sänger und Musiker angesehene Leute bei Hofe. Aber dann wurden sie entlassen und mußten sehen, wie sie ihr Brot verdienten. So schlossen sie sich zu Truppen zusammen und zogen von Ort zu Ort. Es war immer ein großes Ereignis, wenn sie in einen Ort kamen. Sie bauten ein Zelt auf und eine Bühne, ganz primitiv. Die Aufführungen waren abends und nachts. Es brannten Öllichter und Fackeln. Das Publikum stand oder saß stundenlang geduldig und begeistert da. Die Truppen führten meist Ausschnitte aus alten Opern auf, so wie ›Sim Tjong‹, das ist der Stoff meiner Münchner Oper zu den Olympischen Spielen 1972. Weil unsere Stadt groß war, kamen zu uns berühmte Truppen. Aber sie waren alle arm. Man bezahlte keine festen Preise, man gab ihnen Geld, soviel oder sowenig man eben geben wollte. Wenn sie Pech hatten und es kam gerade Regenzeit, konnten sie nicht spielen und mußten in irgendeinem billigen schlechten Quartier bleiben. Sie mußten oft ihre Frauen als Pfand dalassen, um Geld für Essen und Zimmer zu bekommen. Aber so arm sie waren, sie spielten fabelhaft. Einmal, als sie in Tong Yong gewesen waren, lief ich als kleines Kind ihnen einfach nach bis in den nächsten Ort, und da saß ich wieder vor der Bühne und hörte zu. Meine Eltern waren sehr in Sorge, und schließlich fanden sie mich weit weg von zu Hause bei den Sängern.
L.R.
Hatten diese Truppen ein Orchester?
I.Y.
Richtiges Orchester habe ich erst anderswo gehört, nämlich bei einem reichen Verwandten meiner Mutter. Der war aus der Mandschurei gekommen und hatte Geld gemacht und gab oft Feste, zu denen auch meine Mutter kam, mit mir. Es kamen dazu auch immer Kisaengs, zehn oder mehr, die sangen solistisch und auch im Chor, und sie spielten auf den traditionellen alten Instrumenten, der mongolischen Geige, Ho Gung genannt, und auf dem Zupfinstrument Go mung go. Diese Musik war für mich faszinierend. Ihren Klang kann ich nicht vergessen. Aber das Schönste dort waren die Nächte. Wenn alles still war und alle schliefen, wachte ich auf und hörte einen Gesang, eine Männerstimme sang irgendwo weit weg in den Bergen, ich hörte deutlich das Lied, und ich hörte es jede Nacht und jedesmal, wenn ich bei meinem Onkel war. Wer da sang, weiß ich nicht, und niemand konnte es mir sagen, denn niemand außer mir hat je diese Stimme gehört. Es war eine überirdisch schöne Stimme.
L.R.
Vielleicht war sie in dir selbst.
Der Vater, Ki Hyun Yun
I.Y.
Vielleicht. Übrigens, das habe ich fast vergessen, hatten wir in Tong Yong ein Freilichttheater, das berühmt war für die O Kwang Dae-Aufführungen. Das ist ein Musiktheater. Der Inhalt der Stücke ist fast immer ein Klassenkonflikt, nämlich zwischen den Yangban und den unteren Schichten, den Bauern, Fischern, Dienern, Kaufleuten, auch Polizisten. Die Schauspieler waren alle Laien. Sie hatten ihre normalen Berufe im Alltag. Man hat manchmal behauptet, es seien Berufsschauspieler. Das stimmt nicht. Der Eindruck konnte dadurch entstehen, daß sich das Spielen in den Familien vererbte und natürlich immer mehr vervollkommnet wurde. Jetzt ist diese Art von Theater gestorben.
L.R.
Nein, aber nein! Ich sah doch selbst in Korea solche Spiele im Freien, auf einem Universitäts-Campus in Seoul und in der Nähe der Nordgrenze, dahin fuhren wir eigens, denn dort gibt es eine berühmte Gruppe, die Maskenspiele aufführt, ebenfalls mit sozialkritischem Inhalt. Das Kulturministerium gibt sogar viel Geld aus zur Erhaltung dieser Spieltradition, und die Universität Seoul hat einen eigenen Lehrstuhl für Folkloristik. Die Studenten freilich benützen diese Zusammenkünfte nicht ganz im Sinne der Regierung. Trotz Anwesenheit des Geheimdienstes klatschen sie sehr bei allen Stellen, die man als Kritik an der Regierung Park verstehen kann.
I.Y.
Übrigens waren solche Spiele während der Zeit der Besetzung durch die Japaner streng verboten wie alle Fortführung koreanischer Tradition. Man wollte uns mit Gewalt japanisieren. Davon später. Ich muß jetzt noch von einem andern sehr sehr starken musikalischen Eindruck erzählen. Du hast das Stück ›Namo‹ gehört. Ich schrieb es 1971. Das Erlebnis, das ich darin musikalisch verarbeite, liegt in meiner Kindheit. Die Schamanen – es waren meist Frauen – waren berufsmäßige Kultpersonen, eine Verbindung von Priester und Arzt und Zauberer. Man rief sie in die Familien, wenn jemand schwer krank war, denn sie konnten Krankheiten heilen und den Tod vertreiben. Man rief sie auch zu schon Gestorbenen. Ich erinnere mich daran, daß man sie rief, wenn das Meer ertrunkene Seeleute oder Fischer anschwemmte. Das waren unglückliche Seelen, denen mußten die Schamanen zur Erlösung verhelfen. Für mich war der traurige Anlaß unwichtig. Mich faszinierte die Form. Wenn die Schamanin kam, brachte sie jüngere Gehilfen mit, darunter konnten auch Männer sein. Aber die Hauptrolle hatte immer eine Frau. Die Schamaninnen waren wunderbar reich gekleidet und geschminkt, sie trugen Schmuck und manchmal Masken. Sie bauten im Garten eine kleine Bühne auf mit einer Beleuchtung wie im Theater und mit aufgehängten Stoffen als Kulissen. So eine Aufführung kostete viel Geld, aber man gab das gern aus, besonders wenn die Schamanin beliebt war. Es kamen immer viele Zuschauer. So eine Darbietung dauerte drei Tage und drei Nächte. Manchmal am Vormittag war Pause, da schlief die Schamanin, aber dann ging’s wieder weiter. Die Schamanin sang stundenlang, immer fort. Es gab irgendeine einfache Spielhandlung, aber wichtig waren nur die Gesänge, epische Gesänge, Beschwörungen, Gebete. Die Spiele wurden improvisiert nach einem allgemein bekannten Grundgerüst. Als Kind hörte ich Stunde um Stunde diese Gesänge. Das war schön, als Bild und Klang. Die Schamanin steigerte ihren Gesang von Stunde zu Stunde, bis sie in Ekstase war und in Trance. In meinem Stück ›Namo‹ habe ich diesen frühen Eindruck in moderne Musiksprache umgesetzt. Man kann aber auch in meinen andern Stücken, in jedem, deutliche Spuren meiner auditiven Kindheitseindrücke finden. – Ach, weißt du, ich hatte wirklich eine schöne, reiche Kindheit, trotz einiger Leiden. Eben fällt mir etwas anderes ein: das Drachensteigen. Das war im Winter, im Januar. Bei uns ist es da nicht kalt, wir haben Seeklima an der Südküste, wenn Seoul minus zehn oder minus zwanzig Grad hat, dann blühen bei uns die Kamelien. Also, im Januar war das Drachenfest. Das Drachensteigen war nicht wie hier in Deutschland ein Spiel für Kinder, sondern für Männer, fast ein Sport, ein Wettkampf. Jeder dieser Drachen war ein Kunstwerk, übermannsgroß, so schwer, daß einer allein ihn nicht tragen kann. Und die, die Drachen steigen lassen, die müssen Meister sein. Du mußt dir vorstellen: die Drachenmeister waren auf den Hügeln postiert, die an unsrer Küste liegen; auf jedem Hügel stand eine Gruppe. Der Meerwind trug die Drachen hoch und weit. Die Drachenschnüre waren oft tausend und mehr Meter lang, und so flogen die Drachen kilometerweit. Es geht dabei nicht darum, den eigenen Drachen möglichst hoch steigen zu lassen, sondern darum, mit der eigenen Schnur die des andern durchzuschneiden, in der Luft natürlich. Dafür hat man die Schnur sorgfältig präpariert: man hat sie mit Glaspulver eingerieben und trocknen lassen, dann ist sie hart und scharf wie ein Messer. Jeder Drachenmeister hat da sein eigenes raffiniertes Rezept. Man läßt also den Drachen im Wind steigen und versucht, die andere Drachenschnur durchzuschneiden, indem man die eigene scharf gegen sie führt. Aber es ist die Regel: man darf sie nur von oben her durchschneiden. Es gab dabei auch Dreier- und Viererkämpfe. So ein Wettkampf konnte zehn Tage dauern, so lange, bis nur mehr ein einziger Drachen in der Luft war. Es gab auch Mannschaften, eine Drachen-Liga, wie es hier Fußball-Ligen gibt. Das Zuschauen war so aufregend wie heute das Zuschauen bei einem Fußball-Wettkampf, nur ging es viel stiller zu. Es gab andere Feste, zum Beispiel das Azaleenfest. Südkorea ist im Frühling ein einziger blühender Azaleengarten. Die Kinder ziehen mit Körben aus und pflücken die Blüten. Die Frauen machen aus Reismehl und Eiern und Wasser einen Teig, in den streuen sie die Blüten und backen kleine Eierkuchen. An einem bestimmten Tag im März, zur Azaleenblüte, gehen die Menschen zu den Gräbern ihrer Ahnen, um sie zu pflegen. An diesem Tage sind alle Straßen gesäumt von kleinen Büdchen, in denen Azaleen-Pfannkuchen gebacken werden.
L.R.
Gab und gibt es nicht zu Buddhas Geburtstag das Fest der zehntausend Laternen?
I.Y.