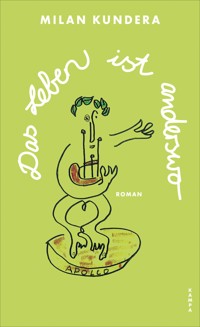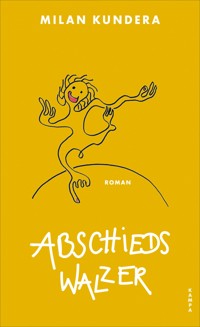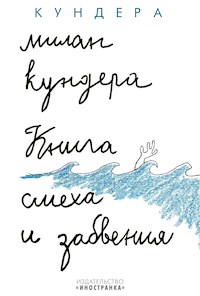18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Milan Kundera plaudert über Literatur, als säße man mit ihm im Café. Mit der ihm eigenen Ironie verknüpft er Anekdoten, Analysen, Erinnerungen und Bilder zu seiner ganz persönlichen Geschichte des Romans. So offenbart sich ein seltener Blick auf Kunderas eigene Poetik, der seine weltberühmten Romane in neuem Licht erstrahlen lässt. Ein eindringliches Plädoyer für die Gattung des Romans, die die Macht hat, den Vorhang zu zerreißen, der unseren Blick auf die Welt und uns selbst verschleiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Milan Kundera
Der Vorhang
Aus dem Französischen von Uli Aumüller
Kampa
Erster TeilBewusstsein der Kontinuität
Bewusstsein der Kontinuität
Über meinen Vater, der Musiker war, wurde folgende Anekdote erzählt. Er ist irgendwo mit Freunden, wo aus einem Radio oder von einem Plattenspieler die Akkorde einer Symphonie erklingen. Die Freunde, alle Musiker oder Musikliebhaber, erkennen sofort Beethovens Neunte. Sie fragen meinen Vater: »Was ist das für ein Stück?« Und er, nach langem Überlegen: »Das hört sich an wie Beethoven.« Alle müssen ein Lachen unterdrücken: Mein Vater hat die Neunte Symphonie nicht erkannt! »Bist du sicher?« – »Ja«, sagt mein Vater, »der späte Beethoven.« – »Woher weißt du, dass es der späte ist?« Worauf mein Vater sie auf eine bestimmte Harmonienfolge aufmerksam macht, die der jüngere Beethoven nie hätte benutzen können.
Die Anekdote ist sicher nur eine maliziöse Erfindung, doch veranschaulicht sie gut, was das Bewusstsein für historische Kontinuität ist: eines der Zeichen, an denen wir einen Menschen als Angehörigen der Zivilisation erkennen, die die unsere ist (oder war). Alles nahm in unseren Augen die Gestalt einer Geschichte an, erschien wie eine mehr oder weniger logische Folge von Ereignissen, Einstellungen, Werken. In meiner frühen Jugend kannte ich ganz selbstverständlich, mühelos die genaue Chronologie der Werke meiner Lieblingsautoren. Unvorstellbar der Gedanke, Apollinaire habe Alcools nach Calligrammes geschrieben, denn wäre es so gewesen, wäre er ein anderer Dichter, hätte sein Werk einen anderen Sinn! Ich liebe jedes Gemälde von Picasso um seiner selbst willen, aber auch Picassos Gesamtwerk als einen langen Weg, dessen aufeinanderfolgende Perioden ich auswendig kenne. Die berühmten metaphysischen Fragen: Woher kommen wir? Wohin gehen wir? haben in der Kunst einen konkreten, klaren Sinn und bleiben keineswegs unbeantwortet.
Geschichte und Wert
Stellen wir uns einen zeitgenössischen Komponisten vor, der eine Sonate geschrieben hat, die in ihrer Form, ihren Harmonien, ihren Melodien den Sonaten Beethovens gleicht. Stellen wir uns sogar vor, diese Sonate wäre so meisterhaft komponiert, dass sie, wäre sie wirklich von Beethoven, zu seinen Meisterwerken gezählt hätte. Trotzdem, von einem Zeitgenossen komponiert, würde sie lächerlich wirken, wie großartig sie auch sein mag. Bestenfalls würde man ihrem Verfasser als einem Virtuosen der Nachahmung applaudieren.
Wie? Man empfindet bei einer Sonate von Beethoven ein ästhetisches Vergnügen, und verspürt keines bei einer im gleichen Stil und mit gleichem Reiz, wenn sie von einem unserer Zeitgenossen stammt? Ist das nicht der Gipfel der Heuchelei? Das Empfinden von Schönheit ist, statt spontan, statt von unserer Sensibilität eingegeben, demnach von unserer Vernunft bedingt, von der Kenntnis eines Datums?
Da kann man nichts machen: Unsere Wahrnehmung von Kunst ist so eng mit unserem historischen Bewusstsein verknüpft, dass dieser Anachronismus (ein von heute stammendes Beethovenwerk) spontan (nämlich ohne jede Heuchelei) als lächerlich, falsch, unpassend, ja ungeheuerlich empfunden würde. Unser Bewusstsein der Kontinuität ist so stark, dass es bei der Wahrnehmung jedes Kunstwerks eine Rolle spielt.
Jan Mukarovsky, der Begründer der strukturalistischen Ästhetik, schrieb 1932 in Prag: »Einzig die Annahme des objektiven ästhetischen Wertes verleiht der historischen Entwicklung der Kunst einen Sinn.« Anders gesagt: Wenn der ästhetische Wert nicht existiert, ist die Geschichte der Kunst nur ein unermessliches Depot mit Werken, deren chronologische Reihenfolge keinerlei Sinn hat. Und umgekehrt: Nur im Kontext der historischen Entwicklung einer Kunst ist der ästhetische Wert einer Kunst wahrnehmbar.
Aber von welchem objektiven ästhetischen Wert kann man sprechen, wenn jede Nation, jede historische Periode, jede gesellschaftliche Gruppe ihren eigenen Geschmack hat? Soziologisch gesehen hat die Geschichte einer Kunst keinen Sinn an sich, sie ist Teil der Geschichte einer Gesellschaft, ebenso wie die Geschichte ihrer Kleidung, ihrer Bestattungs- und Hochzeitsriten, ihrer Sportarten oder Feste. So ungefähr wird der Roman in dem Artikel behandelt, der ihm in der Encyclopédie von Diderot und d’Alembert (1751–1772) gewidmet ist. Der Verfasser dieses Textes, der Chevalier de Jaucourt, spricht dem Roman eine große Verbreitung zu (»er wird von fast allen gelesen«), einen moralischen Einfluss (mal nützlich, mal schädlich), aber keinen ihm eigenen spezifischen Wert; übrigens erwähnt er fast keinen der Romanciers, die wir heute bewundern: weder Rabelais noch Cervantes, Quevedo, Grimmelshausen, Defoe, Swift, Smollett, Lesage, noch den Abbé Prévost; der Roman stellt für den Chevalier de Jaucourt weder eine autonome Kunst noch eine autonome Geschichte dar.
Rabelais und Cervantes. Dass der Enzyklopädist sie nicht genannt hat, ist keineswegs skandalös; Rabelais kümmerte es wenig, ob er Romancier war oder nicht, und Cervantes meinte einen sarkastischen Epilog zur phantastischen Literatur der vorangegangenen Epoche zu schreiben; weder der eine noch der andere hielt sich für einen »Begründer«. Erst nachträglich, allmählich, wurde ihnen durch die Ausübung der Kunst des Romans diese Stellung zugeschrieben. Und nicht, weil sie die ersten gewesen wären, die Romane schrieben (vor Cervantes hat es viele andere Romanciers gegeben), sondern weil ihre Werke besser als die anderen die Raison d’être dieser neuen epischen Kunst verständlich machten; weil sie für ihre Nachfolger die ersten großen romanesken Werte darstellten; und erst ab dem Augenblick, da man begann, in einem Roman einen Wert, einen spezifischen, einen ästhetischen Wert zu sehen, konnten die Romane in ihrer Abfolge als Geschichte erscheinen.
Theorie des Romans
Fielding war als einer der ersten Romanciers imstande,eine Poetik des Romans zu denken; jeder der achtzehn Teile von Tom Jones wird von einem Kapitel eröffnet, das einer Art Theorie des Romans gewidmet ist (eine leichte, amüsante Theorie; denn so theoretisiert ein Romancier: indem er seine eigene Sprache sorgsam bewahrt und den Jargon der Gelehrten meidet wie die Pest).
Fielding hat seinen Roman 1749 geschrieben, das heißt zwei Jahrhunderte nach Gargantua und Pantagruel, eineinhalb Jahrhunderte nach Don Quijote, und auch wenn er sich auf Rabelais und Cervantes beruft, ist der Roman für ihn doch immer noch eine neue Kunst, sodass er sich selbst als »Begründer einer neuen literarischen Provinz« bezeichnet. Diese »neue Provinz« ist derart neu, dass sie noch keinen Namen hat! Genauer gesagt hat sie im Englischen zwei Namen, novel und romance, aber Fielding verbietet sich, diese zu benutzen, denn, kaum entdeckt, ist die »neue Provinz« schon von »einem Schwarm dummer und grässlicher Romane überschwemmt (a swarm of foolish novels and monstruous romances)«. Um mit denen, die er verachtet, nicht in einen Topf geworfen zu werden, »vermeidet« er »sorgfältig den Ausdruck Roman« und bezeichnet die neue Kunst mit einer ziemlich ausgeklügelten, aber bemerkenswert zutreffenden Formulierung: eine »prosai-komi-epische Schrift (prosai-comi-epic writing)«.
Fielding versucht diese Kunst zu definieren, das heißt ihre Raison d’être zu bestimmen, den Bereich der Wirklichkeit zu umreißen, den sie erhellen, erforschen, erfassen soll: »Die Nahrung, die wir hier … unserem Leser … anbieten … ist nichts anderes als die menschliche Natur.« Diese Aussage ist nur scheinbar banal; man sah damals im Roman amüsante, erbauliche, unterhaltsame Geschichten, nicht mehr; niemand hätte ihm ein so allgemeines, das heißt so anspruchsvolles, so ernstes Ziel wie die Untersuchung der »menschlichen Natur« zugestanden; niemand hätte den Roman in den Rang einer Reflexion über den Menschen als solchen erhoben.
In Tom Jones hält Fielding plötzlich mitten im Erzählen inne und erklärt, dass eine der Figuren ihn verblüfft; ihr Verhalten erscheint ihm als »die unerklärlichste aller Absurditäten, die jenem seltsamen und außergewöhnlichen Geschöpf je in den Sinn gekommen ist: dem Menschen«; tatsächlich ist das Staunen angesichts dessen, was an »jenem seltsamen Geschöpf, dem Menschen, unerklärlich« ist, für Fielding der erste Anstoß, einen Roman zu schreiben, der Grund, ihn zu erfinden. Die »Erfindung« (im Englischen invention) ist für Fielding das Schlüsselwort; er beruft sich auf dessen lateinischen Ursprung, inventio, was Entdeckung bedeutet (discovery, finding out); beim Erfinden seines Romans entdeckt der Romancier einen bis dahin unbekannten, verborgenen Aspekt der »menschlichen Natur«; eine romaneske Erfindung ist also ein Akt der Erkenntnis, von Fielding definiert als »ein schnelles und scharfsinniges Eindringen in das wahre innere Wesen aller Gegenstände unserer Betrachtung (a quick and sagacious penetration into the true essence of all the objects of our contemplation)«. (Ein bemerkenswerter Satz; das Adjektiv »schnell« – quick – macht klar, dass es sich um den Akt einer spezifischen Erkenntnis handelt, bei der die Intuition eine grundlegende Rolle spielt.)
Und die Form dieser »prosai-komi-epischen Schrift«? »Als Begründer einer neuen literarischen Provinz habe ich jede Freiheit, die Gesetze dieser Rechtsprechung zu erlassen«, verkündet Fielding und verwahrt sich im Voraus gegen alle Normen, die ihm jene »Literaturfunktionäre« diktieren möchten, die die Kritiker für ihn sind; der Roman ist für ihn, und das halte ich für entscheidend, durch seine Raison d’être definiert; durch den Bereich von Wirklichkeit, den er »entdecken« soll; seine Form hingegen unterliegt einer Freiheit, die niemand begrenzen kann und deren Entwicklung eine immerwährende Überraschung sein wird.
Armer Alonso Quijano
Der arme Alonso Quijano wollte sich zur legendären Gestalt eines fahrenden Ritters aufschwingen. Für die gesamte Literaturgeschichte hat Cervantes genau das Gegenteil erreicht, er hat eine legendäre Gestalt absteigen lassen: in die Welt der Prosa. Prosa: Dieses Wort bezeichnet keineswegs nur eine nicht in Versform gebrachte Sprache; es bezeichnet auch das Konkrete, Alltägliche, Körperhafte des Lebens. Die Aussage, der Roman sei die Kunst der Prosa, ist also keine Binsenweisheit; das Wort definiert den tiefen Sinn dieser Kunst. Homer kommt nicht auf den Gedanken, sich zu fragen, ob Achill oder Ajax nach ihren zahlreichen Nahkämpfen noch all ihre Zähne hatten. Don Quijote und Sancho dagegen machen sich andauernd Sorgen um die Zähne, die schmerzenden Zähne, die fehlenden Zähne. »Wisse, Sancho, dass ein Diamant nicht so kostbar ist wie ein Zahn.«
Die Prosa ist jedoch nicht nur die peinliche oder vulgäre Seite des Lebens, sie ist auch eine bis dahin vernachlässigte Schönheit: die Schönheit der bescheidenen Gefühle, zum Beispiel der von Vertraulichkeit geprägten Freundschaft, die Sancho für Don Quijote hegt. Der tadelt ihn wegen seiner geschwätzigen Ungezwungenheit und weist darauf hin, dass in keinem Ritterbuch ein Knappe in diesem Ton mit seinem Herrn zu sprechen wagt. Natürlich nicht: Sanchos Freundschaft ist eine von den cervantesischen Entdeckungen der neuen prosaischen Schönheit: »… ein kleines Kind könnte ihm weismachen, es sei mitten am Tag dunkel: und um dieser Einfältigkeit willen liebe ich ihn wie mein eigenes Leben, und all seine Überspanntheiten können mich nicht dazu bringen, ihn zu verlassen«, sagt Sancho.
Don Quijotes Tod ist umso ergreifender, als er prosaisch ist, das heißt ohne jedes Pathos. Er hat bereits sein Testament diktiert, dann liegt er drei Tage im Sterben, umgeben von Menschen, die ihn lieben: Doch »das hält die Nichte nicht vom Essen, die Gouvernante nicht vom Trinken und Sancho nicht davon ab, gut gelaunt zu sein. Denn die Tatsache, etwas zu erben, tilgt oder vermindert den Kummer des Menschen um den Toten.«
Don Quijote erklärt Sancho, dass Homer und Vergil die Personen nicht so beschrieben, »wie sie waren, sondern so, wie sie sein sollten, damit sie kommenden Generationen als Vorbilder der Tugend dienen konnten«. Nun ist Don Quijote selbst aber alles andere als ein Vorbild. Romanfiguren wollen nicht für ihre Tugenden bewundert werden. Sie wollen verstanden werden, und das ist etwas vollkommen anderes. Die Helden im Epos siegen, oder wenn sie besiegt werden, bewahren sie bis zum letzten Atemzug ihre Größe. Don Quijote wird besiegt. Und zwar ohne jede Größe. Denn alles ist von vornherein klar: Das menschliche Leben als solches ist eine Niederlage. Das Einzige, was uns angesichts dieser unausweichlichen Niederlage, die man Leben nennt, bleibt, ist der Versuch, es zu verstehen. Das ist die Raison d’être der Kunst des Romans.
Die Despotie der »Story«
Tom Jones ist ein Findelkind; er lebt in dem Herrenhaus,in dem Lord Allworthy ihn fördert und erzieht; als junger Mann verliebt er sich in Sophie, die Tochter eines reichen Nachbarn, und als seine Liebe im Sechsten Teil ans Tageslicht kommt, verleumden ihn seine Feinde mit solcher Tücke, dass Allworthy ihn wütend fortjagt; nun beginnt seine lange Irrfahrt (die an die Komposition des Schelmenromans erinnert, in dem ein einziger Protagonist, ein »Schelm«, verschiedene Abenteuer erlebt und jedes Mal neuen Personen begegnet), und erst gegen Ende (im Siebzehnten und Achtzehnten Teil) kehrt der Roman zur Haupthandlung zurück; nach einem Hagelsturm überraschender Enthüllungen klärt sich das Rätsel von Toms Herkunft auf: Er ist der natürliche Sohn der heiß geliebten Schwester von Allworthy, die schon lange tot ist; er triumphiert und im allerletzten Kapitel des Romans heiratet er seine geliebte Sophie.
Wenn Fielding seine vollständige Freiheit gegenüber der Romanform proklamiert, dann meint er in erster Linie seine Weigerung, den Roman auf jene kausale Verkettung von Handlungen, Taten und Worten zu beschränken, die von den Engländern »Story« genannt wird und die Sinn und Essenz eines Romans sein soll; gegen diese absolutistische Macht der »Story« nimmt er sich insbesondere das Recht heraus, die Erzählung »wo und wann er will« mit seinen eigenen Kommentaren und Überlegungen, anders gesagt mit Abschweifungen, zu unterbrechen. Doch auch er benutzt die »Story«, als wäre sie die einzige sichere Grundlage, um die Einheit einer Komposition zu garantieren, der einzige Bogen, um den Anfang mit dem Ende zu verbinden. So hat er Tom Jones (selbst wenn es vielleicht mit einem heimlichen Lächeln der Ironie geschah) mit dem Gongschlag des »happy ends« einer Heirat beendet.
So gesehen erscheint Tristram Shandy, 1774, fünfundzwanzig Jahre später geschrieben, wie die erste radikale und vollständige Absetzung der »Story«. Während Fielding, um nicht im langen Gang einer Kausalverkettung von Ereignissen zu ersticken, die Fenster der Abschweifungen und Episoden überall weit öffnete, verzichtet Sterne vollständig auf die »Story«; sein Roman ist nichts als eine einzige, vielfach wiederholte Abschweifung, ein einziger unbeschwerter Ball von Episoden, deren absichtlich fragile, ungeheuer fragile Einheit nur durch ein paar originelle Figuren zusammengehalten wird und durch ihre winzig kleinen Handlungen, deren Nichtigkeit zum Lachen reizt.
Sterne wird gern mit den großen Revolutionären der Romanform des 20. Jahrhunderts verglichen; zu Recht, nur war Sterne kein »poète maudit«; ihm wurde von einem großen Publikum applaudiert; seinen grandiosen Akt der Absetzung hat er lächelnd, lachend, scherzend vollzogen. Niemand hat ihm übrigens vorgeworfen, schwierig oder unverständlich zu sein; Ärger verursachte allenfalls seine Unbekümmertheit und Frivolität und mehr noch die schockierende Bedeutungslosigkeit der von ihm behandelten Sujets.
Diejenigen, die ihm diese Bedeutungslosigkeit vorwarfen, hatten das richtige Wort gewählt. Aber erinnern wir uns, was Fielding sagte: »Die Nahrung, die wir unserem Leser hier anbieten … ist nichts anderes als die menschliche Natur«. Sind denn große dramatische Handlungen wirklich der beste Schlüssel zum Verständnis der »menschlichen Natur«? Erheben sie sich nicht vielmehr wie eine Barriere, die das Leben, so wie es ist, verstellt? Ist nicht gerade die Bedeutungslosigkeit eines unserer größten Probleme? Ist sie nicht unser Los? Und wenn ja, ist dieses Los unsere Chance oder unser Unglück? Unsere Demütigung oder, im Gegenteil, unsere Erleichterung, unsere Ausflucht, unsere Idylle, unsere Zuflucht?
Diese Fragen waren unerwartet und provozierend. Erst das formale Spiel in Tristram Shandy hat es möglich gemacht, sie zu stellen. In der Kunst des Romans sind existenzielle Entdeckungen und der Wandel der Form unzertrennlich.
Auf der Suche nach der gegenwärtigen Zeit
Don Quijote lag im Sterben, und doch »hielt das die Nichte nicht vom Essen, die Gouvernante nicht vom Trinken und Sancho nicht davon ab, gut gelaunt zu sein«. Einen kurzen Augenblick lang öffnet dieser Satz den Vorhang ein wenig, der die Prosa des Lebens verbirgt. Aber wenn man diese Prosa noch näher betrachten wollte? Im Detail? Von Sekunde zu Sekunde? Wie kommt Sanchos gute Laune zum Ausdruck? Ist er geschwätzig? Spricht er mit den beiden Frauen? Worüber? Bleibt er die ganze Zeit am Bett seines Herrn?
Per definitionem erzählt der Erzähler, was geschehen ist. Aber jedes kleine Ereignis verliert, sobald es Vergangenheit wird, seinen konkreten Charakter und wird umrisshaft. Die Erzählung ist eine Erinnerung, das heißt ein Resümee, eine Vereinfachung, eine Abstraktion. Das wahre Gesicht des Lebens, der Prosa des Lebens findet sich nur in der gegenwärtigen Zeit. Aber wie soll man vergangene Ereignisse erzählen und ihnen die vergangene Zeit zurückgeben, die sie verloren haben? Die Kunst des Romans hat die Antwort gefunden: indem sie die Vergangenheit in Szenen vorführt. Auch wenn sie grammatikalisch in der Vergangenheit erzählt wird, ist die Szene ontologisch Gegenwart: Wir sehen sie und hören sie; sie spielt sich vor uns ab, hier und jetzt.
Beim Lesen wurden die Leser von Fielding faszinierte Zuhörer eines brillanten Mannes, der sie mit dem, was er erzählte, in Atem hielt. Balzac verwandelte gut achtzig Jahre später die Leser in Zuschauer, die eine Leinwand anschauten (eine Kinoleinwand avant la lettre), auf dem seine Magie als Romancier sie Szenen sehen ließ, von denen sie die Augen nicht abwenden konnten.
Fielding erfand keine unmöglichen oder unglaublichen Geschichten; dabei kümmerte ihn die Wahrscheinlichkeit dessen, was er erzählte, am allerwenigsten; er wollte seine Zuhörer nicht durch die Illusion von Realität betören, sondern durch die Zauberei seines Fabulierens, seiner unerwarteten Beobachtungen, die von ihm geschaffenen überraschenden Situationen. Als die Magie des Romans hingegen in der visuellen und akustischen Evokation von Szenen bestanden hat, ist die Wahrscheinlichkeit die wichtigste Regel geworden: die notwendige Bedingung, damit der Leser an das glaubt, was er sieht.
Fielding interessiert sich wenig für das alltägliche Leben (er hätte nicht geglaubt, dass Banalität eines Tages ein großes Romanthema werden könnte); er tat nicht so, als lauschte er mithilfe von versteckten Mikrophonen den Überlegungen, die seinen Figuren durch den Kopf gingen (er betrachtete sie von außen und brachte hellsichtige und oft komische Hypothesen über ihre Psychologie vor); Beschreibungen langweilten ihn, und er hielt sich weder mit dem Aussehen seiner Helden auf (Sie werden nicht erfahren, welche Farbe Toms Augen hatten) noch mit dem historischen Hintergrund des Romans; seine Erzählung schwebte fröhlich über den Szenen, von denen er nur die Teile erwähnte, die er für die Klarheit der Handlung und für die Reflexion wichtig fand; das London, wo sich Toms Schicksal erfüllt, ähnelt eher einem auf eine Karte gedruckten kleinen Kreis als einer wirklichen Metropole: Die Straßen, Plätze, Paläste werden nicht beschrieben und nicht einmal beim Namen genannt.
Das 19. Jahrhundert wurde in jenen Jahrzehnten explosiver Ereignisse geboren, die ganz Europa mehrfach und von Grund auf verwandelten. Im Leben des Menschen änderte sich damals auf Dauer etwas Wesentliches: Die Geschichte wurde zur Erfahrung jedes Einzelnen; der Mensch begann zu begreifen, dass er nicht in derselben Welt sterben würde, in die er hineingeboren worden war; die Uhr der Geschichte begann überall laut die Stunde zu schlagen, sogar in den Romanen, deren Zeit auf einmal gezählt und datiert wurde. Die Form des kleinsten Gegenstands, jedes Stuhls, jedes Rocks war von seinem baldigen Verschwinden (seiner Verwandlung) geprägt. Man trat in die Epoche der Beschreibungen ein. (Beschreibung: Mitleid mit dem Ephemeren; Rettung des Vergänglichen.) Das Paris Balzacs hat keine Ähnlichkeit mit Fieldings London; seine Plätze haben ihre Namen, seine Häuser ihre Farben, seine Straßen ihre Gerüche und Geräusche, es ist das Paris eines bestimmten Augenblicks, Paris, wie es vorher nicht war und wie es nie wieder sein würde. Und jede Szene des Romans ist von der Geschichte geprägt (und sei es allein durch die Form eines Stuhls oder den Schnitt eines Anzugs), die, aus dem Schatten getreten, das Gesicht der Welt ständig um und um formt.
Ein neues Sternbild ist am Himmel über der Straße des Romans aufgeleuchtet, der in sein großes Jahrhundert eingetreten ist, das Jahrhundert seiner Popularität, seiner Macht; eine »Vorstellung davon, was der Roman ist« hat sich damals eingebürgert und wird bis Flaubert, Tolstoi, Proust über die Kunst des Romans herrschen; sie wird die Romane der vorangehenden Jahrhunderte fast in Vergessenheit hüllen (etwas Unglaubliches: Zola hat Die gefährlichen Liebschaften nie gelesen!) und die künftige Wandlung des Romans erschweren.
Die vielfachen Bedeutungen des Wortes »Geschichte«
»Die Geschichte Deutschlands«, »die Geschichte Frankreichs«: In diesen beiden Ausdrücken ist das Attribut verschieden, während der Begriff Geschichte denselben Sinn behält. »Die Geschichte der Menschheit«, »die Geschichte der Technik«, »die Geschichte der Wissenschaft«, »die Geschichte dieser oder jener Kunst«: nicht nur das Objekt ist verschieden, sondern auch das Wort »Geschichte« bedeutet jedes Mal etwas anderes.
Der große Arzt A erfindet eine geniale Methode zur Behandlung einer Krankheit. Ein Jahrzehnt später entwickelt der Arzt B jedoch eine andere, wirksamere Methode, sodass die vorherige (dabei doch geniale) Methode aufgegeben und vergessen wird. Das typische Merkmal der Geschichte der Wissenschaft ist der Fortschritt.
Auf die Kunst angewandt, hat der Begriff Geschichte nichts mit Fortschritt zu tun; er bedeutet keine Perfektionierung, keine Verbesserung, keinen Anstieg; er gleicht einer Reise in unbekannte Länder, die man erforschen und auf einer Karte einzeichnen will. Der Romancier hat nicht den Ehrgeiz, es besser zu machen als seine Vorgänger, sondern zu sehen, was sie nicht gesehen haben, zu sagen, was sie nicht gesagt haben. Flauberts Poetik bringt die von Balzac ebenso wenig in Misskredit wie die Entdeckung des Nordpols die von Amerika überholt.
Die Geschichte der Technik geht nicht vom Menschen aus, der nur ihr Werkzeug ist; sie kann nicht anders sein, als sie war und als sie sein wird, denn sie gehorcht ihrer eigenen Logik; in dieser Hinsicht ist sie unmenschlich. Hätte Edison nicht die Glühbirne erfunden, wäre sie von jemand anderem erfunden worden. Aber wenn Laurence Sterne nicht die verrückte Idee gehabt hätte, einen Roman ohne jede »Story« zu schreiben, hätte niemand es an seiner Stelle getan, und die Geschichte des Romans wäre nicht die, die wir kennen.
»Eine Geschichte der Literatur sollte, im Gegensatz zur Geschichte als solcher, nur Namen von Siegen enthalten, da die Niederlagen ja niemandes Siege sind.« Dieser einleuchtende Satz von Julien Gracq zieht alle Konsequenzen aus der Tatsache, dass die Geschichte der Literatur, »im Gegensatz zur Geschichte als solcher«, keine Geschichte der Ereignisse ist, sondern die Geschichte der Werte. Ohne Waterloo wäre die Geschichte Frankreichs unverständlich. Aber die Waterloos der kleinen und sogar der großen Schriftsteller haben ihren Platz nur im Vergessen.
Die Geschichte »als solche«, die der Menschheit, ist die Geschichte der Dinge, die nicht mehr da sind und nicht mehr unmittelbar an unserem Leben teilhaben. Weil die Geschichte der Kunst die Geschichte der Werte ist, das heißt der Dinge, die notwendig für uns sind, ist sie immer da, immer bei uns; wir hören Monteverdi und Strawinsky im selben Konzert.
Und da sie immer bei uns sind, werden die Werte der Kunstwerke ständig reflektiert, gewogen, beurteilt, neu beurteilt. Aber wie kann man sie beurteilen? Im Bereich der Kunst gibt es dafür keine exakten Maße. Jedes ästhetische Urteil ist eine persönliche Hypothese; aber eine Hypothese, die sich nicht in ihre Subjektivität einsperrt, die anderen Urteilen trotzt, danach strebt, anerkannt zu werden, auf Objektivität aus ist. Daher befindet sich die Geschichte des Romans in ihrer ganzen Dauer, die sich von Rabelais bis in unsere Tage erstreckt, für das kollektive Bewusstsein in einem ständigen Wandel, an dem die Kompetenz und die Inkompetenz, die Intelligenz und die Dummheit und vor allem das Vergessen beteiligt sind, das Vergessen, das nicht aufhört seinen unermesslichen Friedhof zu vergrößern, wo neben Wertlosem unterschätzte, verkannte oder vergessene Werte ruhen. Diese unvermeidliche Ungerechtigkeit macht die Geschichte der Kunst zutiefst menschlich.
Die Schönheit einer plötzlichen Verdichtung des Lebens
In den Romanen Dostojewskijs hört die Uhr nicht auf, die Stunde anzugeben: »Es war gegen neun Uhr morgens« lautet der erste Satz von Der Idiot