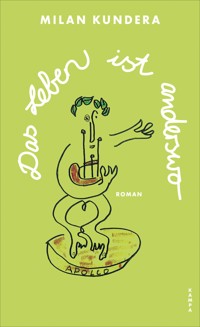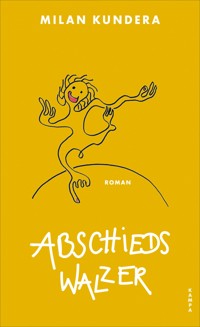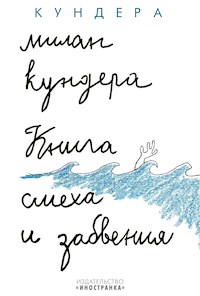19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Milan Kundera umkreist seine Themen mit spielerischer Lust. Rockmusik, das Wesen der Schuld in Kafkas Prozess, Chopins Faible für kurze Stücke – alles scheint verwandt und verbunden. Im Zentrum all seiner Überlegungen steht unverrückbar die Kunst des Romans, der sich als strahlender Schild gegen die drohende Objektifizierung des Menschen in der modernen Welt, diesen grundlegenden Angriff gegen unsere Freiheit, offenbart. Dieser Essay mahnt uns, das Vermächtnis des Romans niemals zu verraten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Milan Kundera
Verratene Vermächtnisse
Essay
Aus dem Französischen von Susanna Roth
Kampa
Erster TeilDer Tag, an dem Panurge die Welt nicht mehr zum Lachen bringt
Die Erfindung des Humors
Madame Grandgousier, schwanger, aß eine UnmengeKutteln, sodass man ihr ein Adstringens verordnen musste; es war so stark, dass die Gebärmutterwände sich lockerten, der Foetus Gargantuas in eine Ader drang, nach oben schlüpfte und durchs Ohr seiner Mama auf die Welt kam. Von den ersten Sätzen an legt das Buch seine Karten offen: Was hier erzählt wird, ist nicht ernst gemeint: was heißen soll: Hier werden nicht (wissenschaftliche oder mythische) Wahrheiten bestätigt; man ist nicht verpflichtet, Tatsachen so zu beschreiben, wie sie in Wirklichkeit sind.
Glücklich die Zeit von Rabelais: Der Schmetterling des Romans fliegt empor, während auf seinem Körper noch Reste der Puppe haften. Durch seine Riesenerscheinung gehört Pantagruel noch in die Vergangenheit der Zaubermärchen, während Panurge aus der damals noch unbekannten Zukunft des Romans kommt. Der außergewöhnliche Moment der Geburt einer neuen Kunst verleiht Rabelais’ Buch einen unglaublichen Reichtum; alles ist darin enthalten: Wahrscheinliches und Unwahrscheinliches, Allegorie, Satire, Riesen und normale Menschen, Anekdoten, Meditationen, reale und phantastische Reisen, gelehrte Streitgespräche, Digressionen nur um der sprachlichen Virtuosität willen. Als Erbe des 19. Jahrhunderts empfindet der Romancier von heute eine neidvolle Sehnsucht nach jenem wunderbar vielfältigen Universum der ersten Romanciers und nach der fröhlichen Freiheit, mit der sie es bewohnten.
Wie Rabelais auf den ersten Seiten seines Buches Gargantua durch Mamas Ohr auf die Bretter der Welt fallen lässt, so fallen in den Satanischen Versen die beiden Helden Salman Rushdies nach einer Flugzeugexplosion in die Tiefe, während sie plaudern, singen, sich komisch und unwahrscheinlich verhalten. Während »über, hinter, unter ihnen im leeren Raum zurückgeklappte Sitze, Pappbecher, Sauerstoffmasken und Passagiere« herumfliegen, schwimmt der eine, Gibril Farishta, »in der Luft, Bruststil, Schmetterlingsstil, rollte er sich zu einer Kugel zusammen, spreizte wie ein Adler Arme und Beine vor der Beinahe-Unendlichkeit dieser Beinahe-Dämmerung«; der andere, Saladin Chamcha, ist »ein pedantischer, kopfüber fallender Schatten, in einem grauen Anzug, alle Jackettknöpfe zugeknöpft, Arme an die Seiten gepresst […] die Melone auf seinem Kopf«. Mit dieser Szene beginnt der Roman, denn Rushdie weiß wie Rabelais, dass die Vereinbarung zwischen Romancier und Leser von Anfang an zu bestehen hat; es muss klar sein: Was hier erzählt wird, ist nicht ernst gemeint, auch wenn es sich um die furchtbarsten Dinge handelt.
Die Vermischung von Unernstem und Furchtbarem: dazu eine Szene aus dem Vierten Buch: Pantagruels Schiff begegnet auf offener See einem Boot mit Kauffahrern; als einer der Händler Panurge ohne Hosenlatz sieht, die Brille an der Mütze befestigt, glaubt er, sich wichtigmachen zu müssen, und schimpft ihn einen Hahnrei. Panurge rächt sich auf der Stelle: Er kauft ihm einen Hammel ab und wirft ihn ins Meer; da es in der Natur von Schafen liegt, dem Leithammel nachzulaufen, springen alle anderen ebenfalls ins Wasser. Entsetzt packen die Händler sie am Fell und an den Hörnern und werden so ihrerseits ins Meer hinuntergerissen. Panurge hält ein Ruder in der Hand, nicht etwa, um sie zu retten, sondern um sie davon abzuhalten, auf sein Schiff zu klettern; er ermahnt sie wortgewaltig, indem er ihnen alles Unglück dieser Welt schildert sowie das Gute und das Glück des Lebens im Jenseits und beteuert, die Verstorbenen seien glücklicher als die Lebenden. Falls es ihnen dennoch gefallen sollte, unter den Menschen weiterzuleben, wünscht er ihnen, sie mögen wie Jonas einem Walfisch begegnen. Als alle ertrunken sind, gratuliert Bruder Jan Panurge, er hält ihm nur vor, den Händler bezahlt und so Geld hinausgeworfen zu haben. Darauf Panurge: »Potz Keil! Hab doch für mehr als fünfzigtausend Franken Spaß dabei gehabt!«
Die Szene ist irreal, unmöglich; hat sie wenigstens eine Moral? Prangert Rabelais die Knauserigkeit der Händler an, deren Bestrafung uns ergötzen soll? Oder will er uns gegen Panurges Grausamkeit aufbringen? Oder mokiert er sich, antiklerikal, über die Dummheit der von Panurge vorgetragenen religiösen Gemeinplätze? Sie dürfen raten! Jede Antwort ist eine Falle für Dummköpfe.
Octavio Paz: »Weder Homer noch Virgil haben den Humor gekannt; Ariost scheint ihn vorauszuahnen, doch der Humor nimmt erst mit Cervantes Gestalt an […] Der Humor ist die große Erfindung des modernen Geistes.« Ein grundlegender Gedanke: Der Humor wird von den Menschen nicht seit unvordenklichen Zeiten praktiziert; er ist eine mit der Geburt des Romans verbundene Erfindung. Der Humor ist also nicht Lachen, Spott, Satire, sondern vielmehr eine spezifische Art des Komischen, über die Paz sagt (und dies ist der Schlüssel, um das Wesen des Humors zu verstehen), »er macht alles, was er berührt, vieldeutig«. Wer keine Freude an der Szene hat, in der Panurge die Schafhändler ertrinken lässt, während er ihnen eine Lobrede auf das Leben im Jenseits hält, wird nie etwas von der Kunst des Romans verstehen.
Der Bereich, in dem das moralische Urteil aufgehoben ist
Fragte mich jemand nach dem häufigsten Grund für Missverständnisse zwischen meinen Lesern und mir, würde ich nicht zögern zu antworten: der Humor. Ich lebte noch nicht lange in Frankreich und war alles andere als blasiert. Als ein bedeutender Professor der Medizin mich sehen wollte, weil er Abschiedswalzer mochte, war ich sehr geschmeichelt. Seiner Meinung nach ist mein Roman prophetisch; mit der Person Doktor Skretas, der in einem Badestädtchen scheinbar unfruchtbare Frauen behandelt, indem er ihnen mit einer Spezialnadel heimlich seinen Samen einspritzt, hätte ich das große Problem der Zukunft angesprochen. Er lädt mich zu einer Tagung über künstliche Befruchtung ein. Er zieht ein Blatt Papier aus der Tasche und liest mir den Entwurf seines Vortrags vor. Die Gabe des Spermas sollte anonym, gratis und (in diesem Moment schaut er mir in die Augen) durch eine dreifache Liebe motiviert sein: die Liebe zu einem unbekannten Ei, das seine Berufung erfüllen möchte; die Liebe des Spenders zu seiner eigenen Individualität, die durch die Spende in die Zukunft verlängert wird, und, zum dritten, die Liebe zu einem leidenden, unerfüllten Paar. Dann schaut er mir abermals in die Augen: Trotz aller Achtung erlaube er sich, mich zu kritisieren: Es sei mir nicht geglückt, die moralische Schönheit des Samenspendens in überzeugender Weise darzustellen. Ich verteidige mich: Der Roman ist komisch! Mein Doktor ist ein Phantast! Man darf nicht alles so ernst nehmen! – Man soll Ihre Romane also nicht ernst nehmen?, fragt er mich argwöhnisch. Ich verheddere mich, und plötzlich wird mir klar: Es gibt nichts Schwierigeres, als Humor verständlich zu machen.
Im Vierten Buch bricht auf dem Meer ein Sturm los. Alle stehen auf der Brücke und versuchen, das Schiff zu retten. Einzig Panurge, gelähmt vor Angst, wehklagt nur: Sein wunderbares Gejammer erstreckt sich über ganze Seiten. Kaum dass der Sturm sich gelegt hat, kehrt sein Mut zurück, und er tadelt alle für ihre Faulheit. Und dies ist das Sonderbare: Dieser Feigling, dieser Faulenzer, Lügner und Komödiant ruft in uns nicht nur keine Empörung wach, gerade im Moment seiner Prahlereien mögen wir ihn am meisten. Solche Passagen sind es, die Rabelais’ Buch voll und ganz zum Roman werden lassen: das heißt: zu einem Bereich, in dem das moralische Urteil aufgehoben ist.
Das moralische Urteil aufzuheben, bedeutet nicht die Immoralität des Romans, sondern seine Moral. Eine Moral, die sich der unausrottbaren menschlichen Gewohnheit widersetzt, sofort, unablässig und jedermann zu beurteilen, zu urteilen, noch bevor und ohne dass man verstanden hat. Unter dem Blickwinkel der Weisheit des Romans ist diese leidenschaftliche Bereitschaft zu urteilen die abscheulichste Dummheit, das gefährlichste Übel. Nicht dass der Romancier die Berechtigung eines moralischen Urteils generell bestreiten würde, aber er verweist es außerhalb des Romans. Klagen Sie, wenn Sie Lust dazu haben, Panurge seiner Feigheit wegen an, klagen Sie Emma Bovary, klagen Sie Rastignac an, das ist Ihre Sache; der Romancier hat damit nichts zu tun.
Die Schaffung eines imaginären Raums, in dem das moralische Urteil aufgehoben ist, war eine Leistung von unermesslicher Tragweite: Nur dort können Romanfiguren sich entfalten, das heißt Individuen, die nicht mit Rücksicht auf eine bereits existierende Wahrheit erdacht wurden, als Beispiele für das Gute oder das Böse oder als Verkörperung objektiver, aufeinanderstoßender Gesetze, sondern als autonome, auf ihre eigene Moral, ihre eigenen Gesetze gegründete Wesen. Die westliche Gesellschaft hat die Gewohnheit angenommen, sich als Gesellschaft der Menschenrechte zu verstehen; bevor ein Mensch jedoch Rechte haben konnte, musste er sich als Individuum konstituieren, sich selbst als solches betrachten und als solches betrachtet werden; dies hätte nicht geschehen können ohne eine lange Ausübung der europäischen Künste und insbesondere des Romans, der den Leser lehrt, neugierig zu sein in Bezug auf den anderen und zu versuchen, Wahrheiten zu verstehen, die sich von den eigenen unterscheiden. In diesem Sinn hat Cioran recht, wenn er die europäische Gesellschaft als die »Gesellschaft des Romans« bezeichnet und von den Europäern als den »Söhnen des Romans« spricht.
Die Profanation
Die Entgötterung der Welt ist eines der typisch neuzeitlichen Phänomene. Entgötterung bedeutet nicht Atheismus, sie bezeichnet die Situation, in der das Individuum, das denkende Ich, Gott als Grundlage von allem ersetzt; der Mensch kann weiterhin seinen Glauben bewahren, in der Kirche niederknien, im Bett beten, seine Frömmigkeit wird fortan nur noch seinem subjektiven Universum angehören. Heidegger hat diese Situation beschrieben und kommt zu dem Schluss: »Ist es dahin gekommen, dann sind die Götter entflohen. Die entstandene Leere wird durch die historische und psychologische Erforschung des Mythos ersetzt.«
Mythen, sakrale Texte, historisch und psychologisch zu erforschen, bedeutet: sie profan zu machen, sie zu profanieren. Das Wort profan stammt aus dem Lateinischen: profanum: der Ort vor dem Tempel, außerhalb des Tempels. Die Profanation ist folglich die Verlegung des Heiligen nach außerhalb, in die Sphäre außerhalb der Religion. Insofern als das Lachen unsichtbar in der Luft des Romans liegt, ist die Profanation durch den Roman die schlimmste aller Profanationen. Denn Religion und Humor sind unvereinbar.
Thomas Manns Tetralogie Joseph und seine Brüder, geschrieben zwischen 1926 und 1942, ist das Paradebeispiel einer »historischen und psychologischen Erforschung« von sakralen Texten, die, im lächelnden und erhaben langweiligen Ton Thomas Manns erzählt, plötzlich nicht mehr heilig sind: Gott, der in der Bibel vom Anbeginn der Ewigkeit existiert, wird bei Mann eine menschliche Schöpfung, eine Erfindung Abrahams, der ihn aus dem polytheistischen Chaos als zunächst übergeordnete, dann einzige Gottheit hervortreten ließ; da Gott weiß, wem er seine Existenz verdankt, ruft er aus: »Es ist unglaublich, wie weitgehend dieser Erdenkloß mich erkennt! Fange ich nicht an, mir durch ihn einen Namen zu machen? Wahrhaftig, ich will ihn salben!« Vor allem aber: Thomas Mann betont, dass es sich bei seinem Roman um ein humoristisches Werk handelt. Die Heilige Schrift gibt Anlass zum Lachen! Wie etwa die Geschichte von Potiphars Weib und Joseph; sie, toll vor Liebe, beißt sich in die Zunge und spricht ihre verführerischen Worte dann lispelnd aus wie ein Kind, »slaf bei mir, slaf bei mir«, während der keusche Joseph der Lispelnden drei Jahre lang Tag für Tag geduldig erklärt, dass es ihnen verboten sei, miteinander zu schlafen. Am schicksalhaften Tag befinden sich die beiden allein im Haus; sie insistiert einmal mehr, »slaf bei mir, slaf bei mir«, und er erklärt ihr nochmals, geduldig, pädagogisch, die Gründe, weshalb sie nicht miteinander schlafen sollten, doch während dieser Erklärung bekommt er eine Latte, er bekommt, mein Gott, eine so phantastische Latte, dass Potiphars Weib bei diesem Anblick völlig verrückt wird und ihm das Hemd vom Leib reißt, und als Joseph davonläuft, um sich zu retten, immer noch mit seiner Latte, fängt sie an zu schreien, verstört, verzweifelt und entfesselt, sie ruft um Hilfe und beschuldigt Joseph, er habe sie vergewaltigen wollen.
Thomas Manns Roman genoss einstimmige Anerkennung; ein Beweis dafür, dass die Profanation nicht mehr als Beleidigung empfunden wurde, sondern mittlerweile Bestandteil der Sitten war. Im Laufe der Neuzeit hörte die Ungläubigkeit auf, suspekt oder provozierend zu sein, und der Glaube seinerseits verlor seine frühere missionarische oder intolerante Sicherheit. Bei dieser Entwicklung spielte der Schock des Stalinismus eine entscheidende Rolle: Indem der Stalinismus versuchte, das christliche Gedächtnis ganz auszuradieren, hat er uns allen, Gläubigen und Ungläubigen, Gotteslästerern und Frömmlern, in brutaler Weise klargemacht, dass wir derselben, in der christlichen Vergangenheit verwurzelten Kultur angehören, ohne die wir nur substanzlose Schatten, wortlose Schwätzer, geistig Heimatlose wären.
Ich bin als Atheist erzogen worden und habe mich als solcher bis zu dem Tag wohlgefühlt, als ich in den schwärzesten Jahren des Kommunismus sah, wie man Christen schikanierte. Mit einem Mal entschwand der provokative und unbeschwerte Atheismus meiner frühen Jugend wie eine kindische Albernheit. Ich verstand meine gläubigen Freunde und begleitete sie, mitgerissen von Solidarität und Rührung, manchmal zur Messe. Doch auch wenn ich dies tat, gelangte ich nicht zu der Überzeugung, dass Gott als ein Wesen existiert, das unsere Geschicke lenkt. Was konnte ich überhaupt darüber wissen? Und sie, was konnten sie darüber wissen? Waren sie sich sicher, sicher zu sein? Ich saß in einer Kirche mit dem seltsamen und glücklichen Gefühl, dass meine Ungläubigkeit und ihr Glaube einander auf merkwürdige Weise nahe waren.
Der Brunnen der Vergangenheit
Was ist ein Individuum? Worin liegt seine Identität? Alle Romane suchen eine Antwort auf diese Fragen. In der Tat, wodurch definiert sich ein Ich? Durch das, was eine Person tut, durch ihre Taten? Doch die Tat läuft ihrem Urheber davon, wendet sich fast immer gegen ihn. Also durch sein inneres Leben, seine Gedanken, seine verborgenen Gefühle? Ist ein Mensch aber fähig, sich selbst zu verstehen? Können seine verborgenen Gedanken als Schlüssel zu seiner Identität dienen? Oder ist der Mensch durch seine Sicht der Dinge, seine Ideen, seine Weltanschauung bestimmt? Das ist Dostojewskis Ästhetik: Seine Personen sind in einer ureigenen persönlichen Ideologie verwurzelt und handeln ihr zufolge mit einer unbeugsamen Logik. Bei Tolstoi hingegen ist die persönliche Ideologie weit davon entfernt, etwas Stabiles zu sein, worauf sich die individuelle Identität gründen könnte. »Stepan Arkadjewitsch wählte weder seine Haltung noch seine Meinungen, nein, die Haltungen und Meinungen kamen von allein auf ihn zu, genauso, wie er weder die Form seiner Hüte noch seiner Mäntel wählte, sondern das nahm, was man trug« (Anna Karenina). Wenn jedoch das persönliche Denken nicht Grundlage der Identität eines Individuums ist (wenn es nicht wichtiger ist als ein Hut), was bildet dann diese Grundlage?
Zu dieser endlosen Suche hat Thomas Mann einen sehr wichtigen Beitrag geleistet: Wir glauben zu handeln, wir glauben zu denken, es ist jedoch ein anderer, es sind andere, die in uns denken und handeln: das heißt uralte Gewohnheiten. Archetypen, die, einmal zu Mythen geworden und von einer Generation zur anderen überliefert, eine ungeheure Verführungskraft besitzen und uns (wie Mann sagt) aus dem »Brunnen der Vergangenheit« herauf fernsteuern.
Thomas Mann: »[…] ist etwa des Menschen Ich überhaupt ein handfest in sich geschlossen und streng in seine zeitlichfleischlichen Grenzen abgedichtetes Ding? Gehören nicht viele Elemente, aus denen es sich aufbaut, der Welt von außer ihm an? […] und die Unterscheidung zwischen Geist überhaupt und individuellem Geist besaß bei Weitem nicht immer solche Gewalt über die Gemüter wie in dem Heute, das wir verlassen haben […]« Und weiter: »In diesem Fall liegt eine Erscheinung vor, die wir als Imitation oder Nachfolge bezeichnen möchten, eine Lebensauffassung nämlich, gegebene Formen, ein mythisches Schema, das von den Vätern gegründet wurde, mit Gegenwart auszufüllen und wieder Fleisch werden zu lassen.«
Der Konflikt zwischen Jaakob und seinem Bruder Esau ist nur eine Wiederaufnahme der alten Rivalität zwischen Abel und seinem Bruder Kain, zwischen dem von Gott Bevorzugten und dem andern, dem Vernachlässigten, Eifersüchtigen. Dieser Konflikt, dieses »mythische, von den Vorfahren festgesetzte Schema«, findet eine neue Ausprägung im Schicksal von Jaakobs Sohn Joseph, der ebenfalls von privilegierter Abstammung ist. Angetrieben vom uralten Schuldgefühl der Privilegierten, schickt Jaakob Joseph los, damit dieser sich mit seinen eifersüchtigen Brüdern versöhne (eine unheilbringende Initiative: Sie werden ihn in einen Brunnen werfen).
Sogar das Leiden, eine anscheinend unkontrollierbare Reaktion, ist nur »Imitation oder Nachfolge«: Wenn der Roman von Jaakobs Verhalten und seiner Klage über Josephs Tod berichtet, kommentiert Mann: »Das waren nicht seine eigensten Worte, man hörte es gleich. Schon Noah sollte, alten Liedern zufolge, so oder ähnlich angesichts der Flut gesprochen haben, und Jaakob machte es sich zu eigen […] Überhaupt sprach und klagte er viel Gemünztes oder Halbgemünztes in seiner Verzweiflung, […] wenn auch niemand glauben darf, dass dadurch seine Unmittelbarkeit im Geringsten vermindert worden wäre.« Wichtige Anmerkung: Imitation bedeutet nicht fehlende Authentizität, denn das Individuum kann nicht anders, als das zu imitieren, was es bereits gegeben hat; wie aufrichtig es auch immer ist, es ist nur eine Reinkarnation; wie wahrhaftig es auch immer ist, es ist nur ein Ergebnis der Anregungen und Befehle, die dem Brunnen der Vergangenheit entspringen.
Koexistenz verschiedener historischer Zeiten in einem Roman
Ich denke an die Tage, als ich den Roman Der Scherz zuschreiben begann: Von Anfang an und ganz spontan wusste ich, dass der Roman in der Figur Jaroslavs einen Blick in die Tiefe der Vergangenheit (der Vergangenheit der Volkskunst) werfen und das »Ich« meiner Figur sich in und durch diesen Blick offenbaren würde. Übrigens sind die vier Protagonisten folgendermaßen konzipiert: vier persönliche kommunistische Welten, aufgepfropft auf vier europäische Vergangenheiten: Ludvik: der Kommunismus, der auf dem scharfen Geist Voltaires wächst; Jaroslav: der Kommunismus als Wunsch, die Zeit der patriarchalischen, in der Folklore konservierten Vergangenheit zu rekonstruieren; Kostka: die dem Evangelium aufgepfropfte kommunistische Utopie; Helena: der Kommunismus als Quelle des Enthusiasmus eines homo sentimentalis. Diese persönlichen Welten sind im Moment ihrer Zersetzung erfasst: vier Formen der Auflösung des Kommunismus; und das bedeutet auch: Zusammenbruch von vier alten europäischen Abenteuern.
In Der Scherz offenbart die Vergangenheit sich nur als Facette der Psyche der Figuren oder in essayistischen Digressionen; später wollte ich sie direkt in Szene setzen. In Das Leben ist anderswo habe ich das Leben eines jungen Dichters unserer Tage vor das Panorama der Geschichte der europäischen Lyrik gestellt, damit seine Schritte mit denen von Rimbaud, Keats, Lermontow verschmelzen. Und in dem Roman Die Unsterblichkeit bin ich in der Konfrontation verschiedener historischen Zeiten noch weiter gegangen.
Als junger Schriftsteller, in Prag, habe ich das Wort ›Generation‹ verabscheut, weil mich der Beigeschmack des Herdenmenschen abstieß. Den Eindruck, mit anderen verbunden zu sein, hatte ich erstmals, als ich später in Frankreich Carlos Fuentes’ Terra nostra las. Wie ist es möglich, dass ein Mensch auf einem anderen Kontinent, durch seinen Werdegang und seine Kultur weit von mir entfernt, von der gleichen ästhetischen Obsession besessen ist, verschiedene historische Zeiten in einem Roman nebeneinander existieren zu lassen, einer Obsession, die ich bisher naiverweise ausschließlich für meine persönliche gehalten hatte?
Man kann unmöglich erfassen, was die Terra nostra, die Terra nostra Mexikos ist, ohne sich über den Brunnen der Vergangenheit zu beugen. Nicht in der Art eines Historikers, um darin den chronologischen Ablauf der Ereignisse abzulesen, sondern um sich zu fragen: Worin liegt das konzentrierte Wesen der mexikanischen Terra? Fuentes hat dieses Wesen in Gestalt eines Traumromans erfasst, in dem mehrere historische Epochen in einer Art poetischer und traumartiger Meta-Historie aufeinanderprallen; auf diese Weise hat er etwas schwer Beschreibbares und jedenfalls in der Literatur noch nie Dagewesenes geschaffen.
Das letzte Mal hatte ich dieses gleiche Gefühl geheimer ästhetischer Verwandtschaft bei der Lektüre von Philippe Sollers’ La Fête à Venise, diesem seltsamen Roman, dessen Handlung zwar in unseren Tagen spielt, aber eine Plattform für Watteau, Cézanne, Monet, Tizian, Picasso und Stendhal ist, für das Schauspiel ihrer Aussagen und ihrer Kunst.
Und inzwischen noch Die satanischen Verse: komplizierte Identität eines europäisierten Inders; terra non nostra; terrae non nostrae; terrae perditae; um diese zerrissene Identität zu erfassen, untersucht der Roman sie an verschiedenen Orten des Planeten: in London, in Bombay, in einem pakistanischen Dorf und dann im Asien des 7. Jahrhunderts.
Die Koexistenz verschiedener Epochen stellt den Romancier vor ein technisches Problem: Wie kann man sie miteinander verbinden, ohne dass der Roman seine Einheit verliert?
Fuentes und Rushdie haben Lösungen im Bereich des Phantastischen gefunden: Bei Fuentes schreiten die Figuren als ihre eigenen Reinkarnationen von einer Epoche in die andere. Bei Rushdie ist es die Figur Gibril Farishtas, welche diese überzeitliche Verbindung herstellt, indem sie sich in den Erzengel Gibril verwandelt, der dann seinerseits Mahounds (romaneske Variante für Mohammed) Medium wird.
Bei Sollers und bei mir hat die Verbindung nichts Phantastisches: Sollers: Die Bilder und die Bücher, die von den Personen gesehen und gelesen werden, dienen als Fenster zur Vergangenheit. Bei mir sind Gegenwart und Vergangenheit durch die gleichen Themen und die gleichen Motive verbunden.
Kann diese unterirdische (nicht wahrgenommene und nicht wahrnehmbare) ästhetische Verwandtschaft durch wechselseitige Beeinflussung erklärt werden? Nein. Durch gemeinsam erlebte Einflüsse? Ich wüsste nicht, welche. Oder haben wir die gleiche Luft der Geschichte eingeatmet? Hat die Geschichte des Romans uns durch ihre spezifische Logik vor die gleiche Aufgabe gestellt?
Die Geschichte des Romans als Rache an der Geschichte
Die Geschichte. Kann man sich noch auf diese veralteteAutorität berufen? Was ich jetzt sage, ist ein rein persönliches Geständnis: Als Romancier habe ich mich immer als mitten in der Geschichte empfunden, das heißt auf einem Weg, im Dialog mit denen, die mir vorausgegangen sind, und vielleicht sogar (weniger) mit jenen, die nachkommen werden. Ich spreche selbstverständlich von der Geschichte des Romans und keiner anderen, und ich spreche von ihr so, wie ich sie sehe: Sie hat nichts gemein mit Hegels außerhalb des Menschen existierender Vernunft; sie ist weder im Voraus entschieden noch mit der Fortschrittsidee identisch; sie ist voll und ganz menschlich, von den Menschen gemacht, von einigen Menschen, und insofern vergleichbar mit der Entwicklung eines einzelnen Künstlers, der bald ganz gewöhnlich, bald unvorhersehbar handelt, bald mit Genie, bald ohne, und manche Gelegenheit verpasst.
Ich bin dabei, eine Beitrittserklärung zur Geschichte des Romans abzugeben, während all meine Romane Abscheu vor der Geschichte ausdrücken, dieser feindlichen, unmenschlichen Macht, die, ungeladen und unerwünscht, unser Leben von außen in Beschlag nimmt und zerstört. Dennoch ist diese zweideutige Haltung nicht inkonsequent, sind die Menschheitsgeschichte und die Geschichte des Romans doch völlig verschiedene Dinge. Wenn erstere dem Menschen nicht gehört, wenn sie sich ihm als fremde, von ihm nicht beeinflussbare Macht aufgedrängt hat, so ist die Geschichte des Romans (der Malerei, der Musik) aus der Freiheit des Menschen geboren, aus seinen ganz persönlichen Schöpfungen, seinen Entscheidungen. Der Sinn der Geschichte einer Kunst läuft dem der Geschichte an sich zuwider. Durch ihren persönlichen Charakter ist die Geschichte einer Kunst eine Rache des Menschen an der Unpersönlichkeit der Menschheitsgeschichte.
Persönlicher Charakter der Geschichte des Romans? Muss diese Geschichte, um ein einziges Ganzes zu bilden, im Laufe der Jahrhunderte nicht durch einen gemeinsamen, durchgängigen und folglich notwendigerweise überpersönlichen Sinn vereinheitlicht werden? Nein. Ich glaube, dass sogar dieser gemeinsame Sinn immer persönlich, menschlich bleibt, denn im Laufe der Geschichte werden die Auffassungen von dieser oder jener Kunst (was ist ein Roman?) ebenso wie der Sinn ihrer Entwicklung (woher kommt sie und wohin geht sie?) unaufhörlich von jedem Künstler definiert und mit jedem Kunstwerk wieder neu definiert. Der Sinn der Geschichte des Romans besteht in der Suche nach diesem Sinn, seiner fortwährenden Schaffung und Wiedererschaffung, die rückwirkend stets die gesamte Vergangenheit des Romans mit einschließt: Rabelais hat seinen Gargantua und Pantagruel bestimmt nie einen Roman genannt. Das Buch war kein Roman; es ist zu einem Roman geworden, in dem Maße, wie spätere Romanciers (Sterne, Diderot, Balzac, Flaubert, Vančura, Gombrowicz, Rushdie, KiŠ, Chamoiseau) sich von ihm inspirieren ließen, wie sie sich offen auf ihn beriefen und ihn auf diese Weise in die Geschichte des Romans integrierten, mehr noch, ihn als Grundstein dieser Geschichte erkannten.
Die Worte vom »Ende der Geschichte« haben in mir folglich nie Angst oder Missfallen hervorgerufen. »Wie beseligend wäre es, jene vergessen zu können, die den Saft unseres kurzen Lebens aufsaugen, um ihn für ihre eitlen Werke zu verwenden, wie schön wäre es, die Zeitgeschichte vergessen zu können!« (Das Leben ist anderswo). Wenn sie enden muss (obwohl ich mir dieses Ende, von dem die Philosophen so gern sprechen, konkret nicht vorstellen kann), dann soll sie sich beeilen! Wird jedoch die gleiche Formulierung vom »Ende der Geschichte« auf die Kunst angewandt, dann wird mir bang ums Herz; dieses Ende kann ich mir nur allzu gut vorstellen, denn der größte Teil der heutigen Romanproduktion besteht aus Romanen, die außerhalb der Geschichte des Romans stehen: Beichten in Romanform, Reportagen in Romanform, Abrechnungen in Romanform, Autobiographien in Romanform, Indiskretionen in Romanform, Denunziationen in Romanform, politische Lektionen in Romanform, Todeskämpfe des Ehemanns in Romanform, Todeskämpfe des Vaters in Romanform, Todeskämpfe der Mutter in Romanform, Entjungferungen in Romanform, Entbindungen in Romanform, Romane ad infinitum, bis ans Ende der Zeit, Romane, die nichts Neues sagen, keine ästhetischen Ansprüche haben, keine Veränderung bringen, weder für unser Verständnis vom Menschen noch für die Form des Romans; sie gleichen einander und sind morgens perfekt konsumierbar, abends perfekt wegwerfbar.
Meiner Meinung nach können große Werke nur innerhalb der Geschichte ihrer Kunst entstehen und indem sie an ihr teilhaben. Einzig innerhalb der Geschichte kann man erfassen, was neu und was nachgesagt, was Entdeckung und was Nachahmung ist, mit anderen Worten, nur innerhalb der Geschichte kann ein Werk als Wert existieren, den man erkennen und schätzen kann. Nichts scheint mir folglich für die Kunst furchtbarer als der Fall aus ihrer Geschichte heraus, denn es ist ein Fall ins Chaos, in dem ästhetische Werte nicht mehr wahrnehmbar sind.
Improvisation und Komposition
Als Cervantes den Don Quijote schrieb, tat er sich keinen Zwang an und änderte im Laufe der Arbeit den Charakter seines Helden. Die Freiheit, durch die Rabelais, Cervantes, Diderot, Sterne uns in Bann schlagen, war an die Improvisation gebunden. Die Kunst der komplexen, strengen Komposition wurde erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur verbindlichen Notwendigkeit. Die Form des Romans, wie sie damals entstand, mit einer auf einen sehr kurzen Zeitraum begrenzten Handlung, eine Art Schnittpunkt, wo verschiedene Geschichten verschiedener Personen sich begegnen, erforderte in Bezug auf Handlungen und Szenen einen genauen Plan: Bevor der Romancier zu schreiben anfing, entwarf er immer wieder von Neuem den Plan seines Romans, er rechnete und berechnete, zeichnete und korrigierte, wie man es noch nie zuvor getan hatte. Man braucht nur in Dostojewskis Notizen zu blättern, die er für Die Dämonen schrieb: In den sieben Notizheften, die in der Pléiade-Ausgabe 400 Seiten umfassen (der ganze Roman hat 750), sind die Motive auf der Suche nach den Figuren, die Figuren auf der Suche nach den Motiven, streiten die Figuren sich lange um den Platz eines Protagonisten; Stawrogin sollte verheiratet sein, aber »mit wem«? fragt Dostojewski und versucht, ihn nacheinander mit drei Frauen zu verheiraten; usw. (Ein nur scheinbares Paradox: Je genauer diese Konstruktionsmaschine berechnet ist, desto realer und natürlicher wirken die Figuren. Das Vorurteil gegen die konstruierende Vernunft als »nichtkünstlerisches« Element, das den »lebendigen« Charakter der Personen entstelle, entspricht nur der sentimentalen Naivität derer, die nie etwas von Kunst verstanden haben.)
Der Romancier unseres Jahrhunderts, der sich nach der Kunst der Altmeister des Romans zurücksehnt, kann den Faden nicht dort wieder anknüpfen, wo er durchschnitten wurde; weder kann er die gewaltige Erfahrung des 19. Jahrhunderts überspringen noch sie vergessen; um zu der ungezwungenen Freiheit eines Rabelais oder Sterne zurückzufinden, muss er sie mit den Erfordernissen der Komposition in Einklang bringen.
Ich erinnere mich an meine erste Lektüre von Jacques le Fataliste; bezaubert vom Reichtum dieser kühnen Vielfalt, wo Reflexion und Anekdote einander berühren, eine Erzählung von einer anderen umrahmt wird, begeistert von dieser Freiheit der Komposition, die sich über die Regel der Handlungseinheit mokiert, habe ich mich gefragt: Beruht diese herrliche Unordnung auf einer bewundernswerten, raffiniert berechneten Konstruktion oder auf der Euphorie einer reinen Improvisation? Ohne Zweifel überwiegt hier die Improvisation; doch die Frage, die ich mir spontan gestellt habe, hat mich verstehen lassen, dass dieser trunkenen Improvisation eine außergewöhnliche architektonische Möglichkeit innewohnt, die Möglichkeit einer komplexen, reichen Konstruktion, die zugleich perfekt berechnet, bemessen und geplant wäre, wie notwendigerweise selbst die überbordendste architektonische Phantasie einer Kathedrale bemessen und geplant war. Lässt eine solche architektonische Absicht den Roman seinen Charme der Freiheit verlieren? Seinen Spiel-Charakter? Doch was ist, genau genommen, das Spiel? Jedes Spiel beruht auf Regeln, und je strenger die Regeln sind, desto mehr ist das Spiel Spiel. Im Gegensatz zum Schachspieler erfindet der Künstler seine Regeln selbst und für sich; wenn er ohne Regeln improvisiert, ist er also nicht freier, als wenn er sein eigenes Regelsystem erfindet.
Die Freiheit eines Rabelais oder Diderot mit den Erfordernissen der Komposition in Einklang zu bringen, stellt den Romancier unseres Jahrhunderts jedoch vor andere Kompositionsprobleme als jene, die Balzac oder Dostojewski beschäftigt haben. Ein Beispiel: Das dritte Buch von Hermann Brochs Roman Die Schlafwandler ist ein »polyphoner«, aus fünf »Stimmen«, fünf voneinander völlig unabhängigen Linien, komponierter Fluss: Die Linien sind weder durch eine gemeinsame Handlung noch durch die gleichen Figuren untereinander verbunden, und jede hat einen ganz anderen formalen Charakter (A – Roman, B – Reportage, C – Novelle, D – Gedicht, E – Essay). In den achtundachtzig Kapiteln des Buchs alternieren die fünf Reihen in dieser sonderbaren Reihenfolge: A-A-A-B-A-B-A-C-A-A-D-E-C-A-B-D-C-D-A-E-A-A-B-E-C-A-D-B-B-A-E-A-A-E-A-B-D-C-B-B-D-A-B-E-A-A-B-A-D-A-C-B-D-A-E-B-A-D-A-B-D-E-A-C-A-D-D-B-A-A-C-D-E-B-A-B-D-B-A-B-A-A-D-A-A-D-D-E.
Was hat Broch veranlasst, ausgerechnet diese und nicht eine andere Reihenfolge zu wählen? Was hat ihn veranlasst, im vierten Kapitel die Linie B und nicht C oder D aufzunehmen? Nicht die Logik der Charaktere oder der Handlung, denn es gibt keine diesen fünf Linien gemeinsame Handlung. Er wurde von anderen Kriterien geleitet: vom Reiz der überraschenden Nachbarschaft verschiedener Formen (Vers, Erzählung, Aphorismen, philosophische Meditationen); vom Kontrast verschiedener Stimmungen, die den Charakter der verschiedenen Kapitel prägen; von der unterschiedlichen Länge der Kapitel; schließlich von der Entwicklung der gleichen existenziellen Fragen, die sich, wie in fünf Spiegeln, in den fünf Linien widerspiegeln. In Ermangelung eines besseren Begriffs wollen wir diese Kriterien als musikalische bezeichnen und den folgenden Schluss ziehen: Das 19. Jahrhundert hat die Kunst der Komposition ausgearbeitet, aber unser Jahrhundert hat dieser Kunst die Musikalität hinzugefügt.
Die satanischen Verse sind aus drei mehr oder weniger unabhängigen Linien aufgebaut: A: die Lebensläufe von Saladin Chamcha und Gibril Farishta, zwei Indern von heute, die zwischen Bombay und London leben; B: die Geschichte aus dem Koran, welche die Entstehung des Islams behandelt; C: der Marsch der Dorfbewohner nach Mekka übers Meer, das sie trockenen Fußes zu überqueren glauben und in dem sie ertrinken.
Die drei Linien werden in den neun Teilen des Buchs nacheinander wieder aufgenommen, und zwar in der Reihenfolge: A-B-A-C-A-B-A-C-A (übrigens: In der Musik heißt eine solche Reihenfolge Rondo: Im Wechsel mit einigen Nebenthemen kehrt das Hauptthema regelmäßig wieder).
Hier der Rhythmus des Ganzen (in Klammern gebe ich den gerundeten Seitenumfang der französischen Ausgabe an): A (100) B (40) A (80) C (40) A (120) B (40) A (70) C (40) A (40). Man erkennt, dass die Teile B und C gleich lang sind, was dem Ganzen eine rhythmische Regelmäßigkeit verleiht.
Die Linie A umfasst fünf Siebtel, die Linie B ein Siebtel, die Linie C ebenfalls ein Siebtel des Raumumfangs. Aus diesem quantitativen Verhältnis ergibt sich die dominierende Position der Linie A: Der Schwerpunkt des Romans liegt im zeitgenössischen Schicksal von Farishta und Chamcha.
Doch obwohl B und C untergeordnete Linien sind, ist die ästhetische Herausforderung des Romans in ihnen konzentriert, denn dank diesen beiden Teilen hat Rushdie es geschafft, das grundlegende Problem aller Romane (das der Identität eines Individuums, einer Figur) auf eine neue Weise zu erfassen, die über die Konventionen des psychologischen Romans hinausgeht: Die Persönlichkeiten von Chamcha oder Farishta sind nicht durch eine detaillierte Beschreibung ihrer Seelenzustände zu erfassen; ihr Geheimnis liegt im Nebeneinander zweier Zivilisationen, der indischen und der europäischen, die in ihrer Psyche beschlossen sind; es liegt in ihren Wurzeln, von denen sie sich losgerissen haben, die aber gleichwohl in ihnen weiterleben. An welcher Stelle sind diese Wurzeln gebrochen, und wie weit muss man hinabsteigen, wenn man die Wunde berühren will? Dieser Blick in den »Brunnen der Vergangenheit« liegt nicht außerhalb des Themas, dieser Blick berührt den Kern der Sache: die existenzielle Zerrissenheit der beiden Protagonisten.
Wie Jaakob unbegreiflich bleibt ohne Abraham (der, nach Thomas Mann, Hunderte von Jahren früher gelebt hat), da Jaakob nur Abrahams »Imitation oder Nachfolge« ist, bleibt Gibril Farishta unverständlich ohne den Erzengel Gibril, ohne Mahound (Mohammed), sogar ohne den theokratischen Islam Khomeinis oder dieses junge, fanatisierte Mädchen, das die Dorfbewohner nach Mekka oder besser in den Tod führt. Sie alle sind seine eigenen Möglichkeiten, die in ihm schlummern und gegen die er seine eigene Individualität behaupten muss. Es gibt in diesem Roman keine einzige wichtige Frage, die ohne einen Blick in den Brunnen der Vergangenheit untersucht werden könnte. Was ist gut und was ist schlecht? Wer ist der Teufel für den andern, Chamcha für Farishta oder Farishta für Chamcha? Ist es der Teufel oder der Engel, der den Dorfbewohnern die Pilgerfahrt eingegeben hat? Ist ihr Ertrinken ein elendiger Untergang oder der glorreiche Weg ins Paradies? Wer wird es sagen, wer wird es wissen? Und wenn diese Unfassbarkeit des Guten und des Bösen jene Qual wäre, unter der die Religionsgründer gelitten haben? Hallen die schrecklichen Worte der Verzweiflung, die unerhörte Gotteslästerung Christi, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?«, nicht in der Seele jedes Christen nach? Liegt nicht im Zweifel Mahounds, der sich fragt, wer, Gott oder der Teufel, ihm die Verse eingeflüstert habe, die Ungewissheit verborgen, auf der die menschliche Existenz gegründet ist?
Im Schatten der großen Prinzipien
Seit den Mitternachtskindern, die zu ihrer Zeit (1980) einstimmig Bewunderung hervorriefen, bestreitet niemand in der angelsächsischen literarischen Welt, dass Rushdie einer der begabtesten zeitgenössischen Romanciers ist. Die satanischen Verse, die im September 1988 auf Englisch erschienen, wurden mit der Aufmerksamkeit aufgenommen, die man einem großen Autor schuldet. Diese Ehre wurde dem Buch zuteil, ohne dass jemand den Sturm voraussah, der einige Monate später losbrechen sollte, als der Meister des Iran, der Ayatollah Khomeini, Rushdie wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilte und ihm bezahlte Killer auf den Hals schickte, eine Hetzjagd, deren Ende nicht abzusehen ist.
Dies geschah, bevor der Roman hatte übersetzt werden können. Mit Ausnahme der angelsächsischen Welt ist der Skandal also überall dem Buch vorausgegangen. In Frankreich wurden sofort Auszüge aus dem noch unpublizierten Roman in der Presse veröffentlicht, um die Gründe des Schuldspruchs zu erläutern. Ein völlig normales, für einen Roman jedoch tödliches Vorgehen. Indem man ausschließlich die beanstandeten Passagen vorstellte, hat man ein Kunstwerk von Anfang an in ein bloßes Corpus delicti verwandelt.
Nie werde ich üble Nachrede über die Literaturkritik betreiben. Denn es gibt für einen Schriftsteller nichts Schlimmeres als ihr Fehlen. Ich spreche von der Literaturkritik als Meditation, als Analyse; von der Literaturkritik, die es versteht, das zu besprechende Buch mehrmals zu lesen (wie eine große Musik, die man endlos hören kann, sind auch die großen Romane für wiederholte Lektüre geschaffen); von der Literaturkritik, die sich der erbarmungslosen Aktualität verschließt und bereit ist, über Werke zu diskutieren, die vor einem, vor dreißig, vor dreihundert Jahren entstanden sind; von der Literaturkritik, die sich bemüht, das Neue eines Werks zu erfassen und dieses so dem historischen Gedächtnis einzuschreiben. Wäre die Geschichte des Romans nicht von einer solchen Meditation begleitet, wüssten wir heute weder etwas von Dostojewski noch von Joyce noch von Proust. Denn ohne sie ist jedes Werk völlig willkürlichen Beurteilungen und einem raschen Vergessen preisgegeben. Der Fall Rushdie hat gezeigt (falls es überhaupt noch eines Beweises bedurfte), dass eine solche Meditation nicht mehr stattfindet. Unbemerkt, unschuldig, durch die Macht der Dinge, durch die Entwicklung der Gesellschaft, der Presse, hat die Literaturkritik sich in eine einfache (oft intelligente, stets überstürzte) Information über die literarische Aktualität verwandelt.
Im Fall der Satanischen Verse war das über den Autor verhängte Todesurteil die literarische Aktualität. In einer solchen Situation von Leben und Tod scheint es beinahe frivol, von Kunst zu sprechen. Tatsächlich, was bedeutet Kunst angesichts der Bedrohung der großen Prinzipien? Überall in der Welt haben sich die Kommentare denn auch auf die Problematik der Prinzipien konzentriert: die Meinungsfreiheit; die Notwendigkeit, sie zu verteidigen (man hat sie tatsächlich verteidigt, man hat protestiert, Petitionen unterschrieben); die Religion; den Islam und das Christentum; doch auch auf die folgende Frage: Hat ein Autor das moralische Recht, Gott zu lästern und so die Gläubigen zu verletzen? Und sogar auf den Zweifel: und wenn Rushdie den Islam nur angegriffen hätte, um Reklame für sich zu machen und sein unlesbares Buch zu verkaufen?
Mit geheimnisvoller Einstimmigkeit (überall auf der Welt habe ich die gleiche Reaktion beobachtet) haben Literaten, Intellektuelle, Angehörige der literarischen Kreise über diesen Roman die Nase gerümpft. Sie beschlossen, einmal jeglichem kommerziellen Druck zu widerstehen, und lehnten es ab, etwas zu lesen, das ihnen als ein simples Skandalobjekt erschien. Sie unterschrieben alle Petitionen für Rushdie, fanden es aber schick, gleichzeitig mit dandyhaftem Lächeln zu sagen: »Sein Buch? O nein, o nein! Das habe ich nicht gelesen.« Die Politiker haben von diesem sonderbaren »Zustand der Ungnade« des Romanciers, den sie nicht mochten, profitiert. Niemals werde ich die tugendhafte Unparteilichkeit vergessen, mit der sie sich damals brüsteten: »Wir verurteilen den Schuldspruch Khomeinis. Die Meinungsfreiheit ist uns heilig. Doch wir verurteilen nichtsdestotrotz diesen Angriff gegen den Glauben. Ein unwürdiger, elender Angriff, der die Seele der Völker beleidigt.«
Aber ja, niemand stellte mehr in Zweifel, dass Rushdie den Islam angegriffen hatte, der Text des Buches hatte keine Bedeutung mehr, er existierte nicht mehr.
Der Schock der drei Epochen
Eine einzigartige Situation in der Geschichte: Durch seine Herkunft gehört Rushdie der moslemischen Gesellschaft an, die zum großen Teil noch in der Epoche vor der Neuzeit lebt. Er schreibt sein Buch in Europa, in der Epoche der Neuzeit oder genauer, am Ende dieser Epoche.
Ebenso wie der iranische Islam sich in jenem Moment von der religiösen Mäßigung zu einer kämpferischen Theokratie hin entwickelte, vollzog sich in der Geschichte des Romans mit Rushdie der Übergang vom liebenswürdigen und professoralen Lächeln Thomas Manns zur entfesselten, aus der wiederentdeckten Quelle des rabelais’schen Humors geschöpften Phantasie. Die ins Extreme gesteigerten Antithesen prallten aufeinander.
Unter diesem Blickwinkel erscheint die Verurteilung Rushdies nicht als Zufall, als Wahnsinn, sondern als tiefer Konflikt zweier Epochen: Die Theokratie liegt im Streit mit der Neuzeit und nimmt deren repräsentativste Schöpfung zur Zielscheibe: den Roman. Denn Rushdie hat nicht Gott gelästert. Er hat nicht den Islam angegriffen. Er hat einen Roman geschrieben. Doch für den theokratischen Geist ist dies schlimmer als ein Angriff; greift man eine Religion an (durch eine Polemik, eine Gotteslästerung, eine Häresie), können die Tempelhüter sie auf ihrem eigenen Terrain, mit ihrer eigenen Sprache mühelos verteidigen; der Roman aber ist für sie ein anderer Planet; ein ganz anderes Universum, das auf eine andere Ontologie gegründet ist; ein Infernum, wo die alleinige Wahrheit machtlos ist und die satanische Vieldeutigkeit sämtliche Gewissheiten in Rätsel verkehrt.
Unterstreichen wir: kein Angriff; Vieldeutigkeit; der zweite Teil der Satanischen Verse (das heißt der beanstandete Teil, der Mohammed und die Entstehung des Islams beschwört) ist im Roman als Traum Gibril Farishtas geschildert, der später nach diesem Traum einen Schundfilm dreht, in dem er selbst die Rolle des Erzengels spielt. Die Erzählung ist auf diese Weise doppelt relativiert (zunächst als Traum, dann als schlechter Film, der zum Misserfolg wird), sie wird also nicht als Behauptung präsentiert, sondern als spielerische Erfindung. Eine beleidigende Erfindung? Ich widerspreche: Sie hat mich zum ersten Mal in meinem Leben die Poesie der islamischen Religion, der islamischen Welt verstehen lassen.