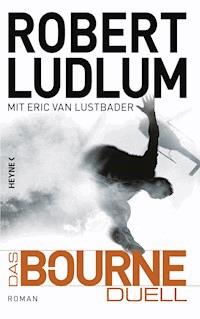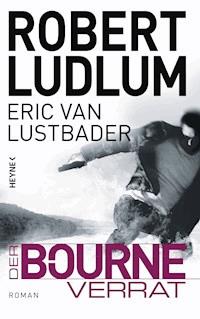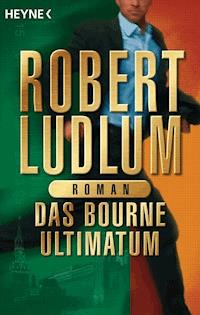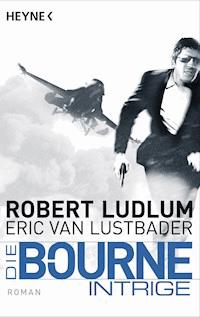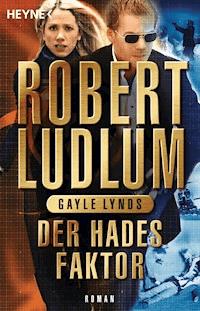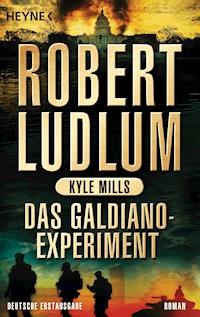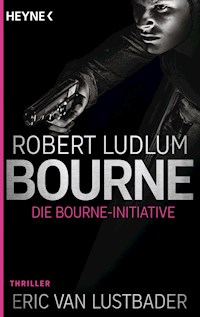
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: JASON BOURNE
- Sprache: Deutsch
Jason Bourne ist auf der Flucht. Das NSA glaubt, er leite die Geschicke seines verstorbenen Freundes Boris Karpow, einst Kopf des russischen Geheimdienstes FSB. Vor seinem Tod hat dieser eine Cyberwaffe entwicklet, die in der Lage wäre, Amerika in die Knie zu zwingen. Mit einem Tötungskommando auf den Fersen, ist Bourne gezwungen, einer Einheit seines Erzfeindes Keyre beizutreten – eines somalischen Terroristen, dem er einst das Handwerk legte. Mächtiger ist als je zuvor ist Keyre der Einzige, der Bourne Schutz bieten kann. Aber zu welchem Preis?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
ROBERT LUDLUM
ERIC VAN LUSTBADER
DIE BOURNE
INITIATIVE
THRILLER
Aus dem amerikanischen Englisch
von Norbert Jakober
WILHELM HEYNE VERLAG
München
Das Buch
Seit sein alter Freund, der russische General Boris Karpow, einem Attentat zum Opfer fiel, kommt Jason Bourne nicht zur Ruhe. Karpow hat kurz vor seinem Tod eine neuartige Waffe entwickelt, die die Abwehrsysteme der USA zu Fall bringen könnte. Geheimdienste halten Bourne für Karpows Komplizen in einem finsteren Komplott und wollen ihn tot sehen. Die Suche nach der Wahrheit führt Jason Bourne nach Griechenland, Somalia und Russland – und in die Arme seines erbittertsten Feindes.
Die Autoren
Robert Ludlum erreichte mit seinen Romanen, die in mehr als dreißig Sprachen übersetzt wurden, weltweit eine Auflage von über 300 Millionen Exemplaren. Er verstarb im März 2001. Die Romane aus seinem Nachlass erscheinen bei Heyne.
Eric van Lustbader ist Autor zahlreicher internationaler Bestseller. Seine Bücher wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt. Er lebt mit seiner Frau Victoria in New York und auf Long Island.
Weitere Titel und Informationen unter heyne.de/ludlum
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe THE BOURNE INITIATIVE
erschien 2017 bei Grand Central Publishing, New York.
Copyright © 2017 by Myn Pyn, LLC
Copyright © 2019 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Alexandra Klepper
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München,
unter Verwendung eines Motivs von © shutterstock/HE68
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN: 978-3-641-19562-5V001
www.heyne.de
Für Victoria, mein Ein und Alles
PROLOG
An der somalischen Küste – Horn von Afrika
Ein Mann auf den Knien – das hat fast etwas Rührendes, dachte Keyre, der somalische Waffenhändler aus dem alten Clan der Yibir. Er stand auf dem harten Kies des Strandes, keine fünf Meter vom sanften Rauschen des Indischen Ozeans entfernt. Er atmete die salzige Meeresluft ein, die vertrauten Gerüche der Wüste und der Ruinen der Ziegelhäuser, die von Panzerbüchsen und Raketen zerstört worden waren. Doch im Moment wurden diese sauberen Düfte überlagert von dem überwältigenden Gestank von menschlichem Schweiß, Exkrementen und Angst.
Doch die Angst war Keyres Lebenselixier, seit er mit acht Jahren zum ersten Mal jemanden getötet hatte. Der Geschmack des Blutes war beim ersten Mal am stärksten, auch wenn es für ihn nicht so wichtig war wie für manchen seiner Landsleute. Sie waren aber auch keine Yibir und wussten nichts von den dunklen Tiefen der uralten Rituale seines Clans. Ihre Nasenflügel blähten sich, wenn sie das Blut aus den Wunden der Getöteten strömen sahen. Doch für Keyre war das Blut nicht mehr als eine Beigabe, genauso unabwendbar wie die Tatsache, dass er den Mann töten musste, der vor ihm kniete und die weiße Flagge schwenkte.
Die weiße Flagge riecht nach Angst, dachte er bei sich. Ich will ihren Duft und ihren Geschmack aufsaugen, bevor ich sie anzünde und verbrenne. Hier an der Küste von Somalia, zwischen dem verwüsteten Land und dem Indischen Ozean, wo er immer wieder Angst und Schrecken verbreitete, war er auf Schritt und Tritt vom Gestank des Todes umgeben.
Vor ihm knieten dreizehn Männer mit gebeugten Köpfen. Manche starrten wie versteinert auf den Kies, auf dem sie kauerten und dessen scharfe Kanten sich in ihre Knie schnitten. Andere drückten ihre Angst durch ein erbärmliches Jammern aus. Dem einen oder anderen rollten Tränen über die Wangen. Keiner murmelte ein Gebet – eine Bestätigung dessen, was Keyre ohnehin wusste.
Er war ein hochgewachsener, gertenschlanker Mann, nur Muskeln und Knochen, mit einem langen, dreieckigen Gesicht, das stets einen düsteren Ausdruck zeigte. Er vereinte die Athletik eines Schwimmers mit der Anmut eines Tänzers. Vor allem aber sah er nicht nur auffallend gut aus, sondern verfügte über ein Charisma, wie es nur wenigen zu eigen war. Eine seiner vielen Fähigkeiten bestand darin, in jeder Situation ein strahlendes Lächeln aufsetzen zu können, mit dem er jeden täuschte.
Dreizehn kniende Männer mit gebeugten Köpfen, die Hände auf dem Rücken gefesselt. In der linken Hand hielt Keyre eine deutsche Mauser-Pistole aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Wem mag sie gehört haben? Einem Gestapo-Mann oder vielleicht einem Angehörigen der Abwehr? Was soll’s, sagte sich Keyre. Heute gehörte sie ihm, und sie war entsichert und geladen.
Er trat zu dem ersten Gefangenen, setzte ihm die Mündung der Mauser an den Hinterkopf und drückte ab. Das trockene Klicken des Hahns hallte so laut wie ein Donnerschlag. Die Knienden zuckten zusammen, doch es kam kein Schuss, keine Kugel. Keyre trat einen Schritt nach rechts und setzte dem zweiten Mann die Pistole an den Hinterkopf. Als er den Abzug drückte, explodierte der Kopf des Mannes. Was von ihm übrig war, sackte nach vorne auf den Kies.
Der Geruch von Blut überschwemmte Keyres geschärfte Sinne, und er spürte die Angst, die in der Luft lag. Über ihm kreisten schwarze Vögel, die einander zuriefen, dass ein Festmahl winkte. Die weißen Wolken am weiten Himmel erinnerten an die angespannten Muskeln eines Gewichthebers.
Noch ein Schritt nach rechts, und er stand hinter dem dritten Gefangenen. Keyre erschoss ihn ebenso wie den zweiten. Als er das Ende der Reihe erreichte, lagen zwölf Leichen mit dem Gesicht voran in ihrem eigenen Blut. Nur der erste Mann kniete noch an seinem Platz. Keyre hatte zwischendurch die Pistole nachgeladen; seine Mauser war nach wie vor bereit zu töten. Er spürte ein Kribbeln im linken Arm, und seine Hand zuckte kurz, wie die Pranke einer Löwin, wenn sie davon träumte, ein Okapi oder eine Gazelle zu reißen. Von dem Moment, in dem sie das Beutetier an der Kehle packte und ihr das Blut über die Zähne lief, während sich die männlichen Löwen näherten, um sich ihren Anteil an der Beute zu holen.
Langsam schritt Keyre zu dem einen knienden Mann zurück. Er trat vor ihn und sah auf ihn hinunter.
»Schau mich an«, befahl er. Der Mann zitterte. »Schau mich an!«, wiederholte er schärfer.
Der Mann hob den Kopf. Keyre sah ihm in die Augen. »Ich weiß, wer du bist«, sagte er in beiläufigem Ton. »Auch, was ihr vorhattet, du und deine Kumpel. Ihr Todesurteil ist vollstreckt, wie du siehst.« Er beugte sich so abrupt hinunter, dass der Gefangene zusammenzuckte. Er war ein kleiner, schlanker Mann, doch sein Oberkörper war auffallend kräftig. Seine Hautfarbe war dunkel, die Nase lang und scharf geschnitten. Die braunen Augen standen nah beieinander. Von seinen aufgesprungenen Lippen schälte sich die Haut ab, als hätte er sich zu lange in der Sonne aufgehalten.
Er ist jedenfalls schon zu lange hier bei mir, dachte Keyre. Das steht fest.
Er fixierte den Mann eindringlich. »Auch dein Todesurteil wird vollzogen, ohne mit der Wimper zu zucken.« Der Gefangene hatte Blutspritzer auf der Wange. Er stank nach Schweiß und Angst und Exkrementen. »Aber du, mein Freund, hast die Chance, es zu verhindern. Du kannst überleben.« Keyre schwieg und wartete ab.
Die Gesichtsmuskeln des Gefangenen zuckten. Seine aschgraue Zunge erschien für einen Moment zwischen den Lippen. »W… Wie?«, stieß er mit dünner Stimme hervor, und Keyre wusste, dass der Mann ihm alles sagen würde, was er wissen wollte.
Trotz des bestialischen Gestanks, der ihn umgab wie ein Mantel, beugte sich Keyre an sein Ohr. »Ich will wissen, für wen du arbeitest.«
Der Mund des Mannes arbeitete, als versuche er, den Mut aufzubringen, um zu antworten, oder etwas Speichel im Mund zu sammeln, um ein verständliches Wort herauszubringen.
Bevor er etwas sagen konnte, fügte Keyre hinzu: »Seinen vollen Namen und seine Position. Nur so kannst du dein Leben retten.«
Der Gefangene schluckte schwer. Seine Augen sprangen hin und her, als fürchtete er, jemand könnte mithören, obwohl sie sich an einem einsamen Strand befanden. »Nicht laut.«
Keyre nickte und erlaubte ihm, sich vorzubeugen. Mit den Lippen an Keyres Ohr flüsterte der Mann sechs Worte.
Diese Worte – die Identität des Mannes, der diese dreizehn Verräter dazu gebracht hatte, seine Truppe zu infiltrieren – veränderten Keyres Haltung schlagartig. Sein Gesicht verfinsterte sich, seine Lippen pressten sich zusammen. Plötzlich wirbelte er herum, packte den Mann mit den Zähnen am Hals und biss ihm die Kehle durch.
ERSTES BUCH
MEME
EINS
Morgana Roy ging um genau 8.36 Uhr zur Arbeit. Als Gewohnheitsmensch marschierte sie täglich die eineinhalb Kilometer von der öffentlichen Parkgarage zu ihrem Büro in einem heruntergekommenen Gebäude an der nicht gerade prächtigen Hauptstraße von Bowie, Maryland. Bowie lag südwestlich von Fort Meade, wo sich der schwarze Glaspalast der NSA wie aus dem Nichts erhob. Wie üblich war sie um sechs Uhr aufgestanden und direkt zu dem Dojo gefahren, in dem sie seit sieben Jahren Mitglied war. Dort trainierte sie intensiv je fünfundvierzig Minuten mit Meistern zweier verschiedener Kampfsportarten, bevor sie sich duschte und ihre Arbeitskleidung anzog.
Ihre Wohnung, die etwa fünfunddreißig Kilometer südwestlich des Büros lag, würde einem Außenstehenden allzu wohlgeordnet, fast steril erscheinen. Abgesehen von den Haushaltsgeräten gab es alle Einrichtungsgegenstände in gerader Anzahl: Sofas, Stühle, Lampen, Beistelltische, Laptops an zwei verschiedenen Arbeitsplätzen. Auf dem Esstisch standen zwei Vasen in gleicher Entfernung zur Tischmitte. Sechs Stühle. Alles in perfekter Symmetrie. Sie führte ein vollkommen geordnetes Leben. Ordnung war überaus wichtig für sie. Chaos war für sie etwas Beunruhigendes, auch wenn ihr die Vorstellung davon manchmal verlockend erschien.
Sie ging diese Strecke in jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter, in einem Tempo, das die meisten ins Schnaufen bringen würde. Eine besondere Herausforderung war der Marsch in der Sommerhitze oder in einem winterlichen Schneesturm. Manche, die sie aus irgendeinem Grund begleiteten, sprachen hinterher vom »Todesmarsch von Bataan«, ein Vergleich, der natürlich scherzhaft gemeint und übertrieben war, aber durchaus einen düsteren Unterton hatte.
Morgana Roy arbeitete in einer kleinen Bürosuite, die an ein Fitnessstudio angrenzte. Vor allem die Neulinge in ihrer Einheit waren von dem Geruch nach abgestandenem Schweiß angewidert, der durch die Fußleisten der Wand hereindrang. Zweimal die Woche wurden die Schweißgerüche mit scharfen Desinfektionsmitteln übertüncht. Morgana schien die Geruchsbelästigung gar nicht zu bemerken; vielleicht hatte sie sich einfach daran gewöhnt.
Mit einer magnetischen Schlüsselkarte öffnete sie eine Tür, die mit einem kleinen, diskreten Schild versehen war: »MEME LLC« war auf ein einfaches Blatt Papier gedruckt, das bei schlechtem Wetter beinahe täglich gewechselt werden musste. Dennoch gab es keine Pläne für etwas Dauerhafteres. Auf der anderen Straßenseite befand sich das kleinste Postamt, das Morgana je gesehen hatte, in einem schmalen Klinkerbau mit einer Rollstuhlrampe, an deren eisernem Geländer ein kümmerliches Transparent mit der Aufschrift »MIETEN SIE HEUTE EIN POSTFACH« hing.
Als Morgana eintrat, stand eine füllige dreiundzwanzigjährige Frau in einem Gabardine-Anzug, der nicht unbedingt zum typischen Outfit einer Regierungsbehörde gehörte, von ihrem Schreibtisch auf, sagte »Guten Morgen«, und ging nach nebenan, um für sie beide einen Cappuccino zu holen.
»Guten Morgen, Rose«, erwiderte Morgana, als Rose zurückkam.
Neben Roses Schreibtisch glänzten die Blätter eines Gummibaums, als würden sie täglich poliert. Auf der rechten Seite stand ein verschlossener Schrank, der völlig leer war. Zur Linken waren Stühle aufgereiht, auf denen noch nie jemand gesessen hatte. Auf einem niedrigen Tisch lagen Ausgaben von Vanity Fair und Wired, die nie gelesen, aber dennoch laufend aktualisiert wurden. Die Einzigen, die die Büros von MEME LLC je betraten, waren die eigenen Mitarbeiter.
Mit dreißig Jahren war Morgana die Älteste im Team. Sieben Leute arbeiteten hier im Büro unter ihrer Leitung, sieben weitere draußen im Feldeinsatz. Alle waren jung, draufgängerisch und hungrig, so wie Morgana sie haben wollte.
In der Wand hinter Rose gab es zwei Türen. Die rechte führte in einen Pausenraum, komplett mit Kühlschrank, Herd, Spüle, Küchenschränken, Kaffeemühle und Espressomaschine. Dahinter erstreckten sich mehrere Lagerräume, über die man in einen Keller gelangte.
Die Tür zur Linken war verschlossen und mit einem Netzhautscanner gesichert. Mit der Kaffeetasse in der Hand schaute Morgana in das Display, öffnete die Tür und wartete noch einen Moment, um einen Schluck von ihrem Cappuccino zu trinken.
Sie trat in einen großen, fensterlosen Raum. An der Wand zur Linken waren mehrere LED-Flachbildschirme installiert, die jedoch keine Kameraaufnahmen von Flughäfen oder Straßenecken in irgendeiner Stadt zeigten, auch keine Ansichten von feindlichen Lagern in der Wüste, die von einer Drohne übermittelt wurden, sondern lediglich Material von diversen Computern. Die Bilder wechselten ständig, oft so schnell, dass sie ineinander verschwammen. Der Text auf den Bildschirmen war oft auf Kyrillisch oder Mandarin, gelegentlich auch auf Hebräisch und Arabisch, einige wenige sogar auf Persisch, Urdu und Paschtunisch.
An der rechten Wand waren hochauflösende Luftaufnahmen der Schweizer Alpen zu sehen. In einer Stunde würden Bilder aus einem Boot in den Malediven hereinkommen, und eine weitere Stunde später Aufnahmen von den belebten Straßen Manhattans. Und so weiter. Niemand beklagte sich über das Fehlen von Fenstern. Niemand blickte auf, als Morgana eintrat, was ihr nur recht war. Ihr sechsköpfiges Team konzentrierte sich ausschließlich auf die Laptop-Bildschirme.
Es gab keine Trennwände zwischen den einzelnen Workstations. Von jedem Platz verliefen dicke Kabel nach oben zu Schienen, die an der Decke angebracht waren, was es Morganas Leuten ermöglichte, sich frei im Raum zu bewegen und zu spontanen Konferenzen zusammenzukommen, um wichtige Informationen auszutauschen. Alles, was auf den Bildschirmen zu sehen war, wurde in Echtzeit eingespielt. Immer auf dem Laufenden zu sein war für die Mitarbeiter von MEME LLC ein entscheidender Faktor. Ihre Aufgabe war es, in Gemeinschaftsarbeit verschlüsseltes Material zu entziffern. Alle Meme-Projekte beruhten auf enger Kooperation, was nicht nur sehr erfolgreich war, sondern auch ein kameradschaftliches Verhältnis zwischen den Mitarbeitern förderte, wie es in den verschiedenen staatlichen Geheimdiensten undenkbar war.
Morgana trat durch eine unscheinbare Tür in der gegenüberliegenden Wand. An der Tür war kein Namensschild angebracht. Dies war Morganas Refugium. Von hier aus konnte sie alles überblicken, was in dem großen Raum vor sich ging. Und sie hatte die Freiheit, alles abzuschalten und im Halbdunkel über Algorithmen und ihre eigene Zukunft nachzudenken.
Sie stellte die Tasse auf ihren Schreibtisch, zog die Jacke aus, hängte sie über ihren ergonomischen Stuhl und setzte sich. Im selben Moment erwachte der Bildschirm ihres Laptops zum Leben. Ihr Daumenabdruck wurde eingescannt, und schon war sie drin.
Im Posteingang des E-Mail-Programms erwarteten sie die üblichen unwichtigen Nachrichten. Eine jedoch war besonders hervorgehoben.
Schau an, dachte sie. Black Star.
»Black Star« stand für außergewöhnliche Angelegenheiten.
Sie klickte das Icon an und wurde direkt mit dem Büro von General Arthur MacQuerrie verbunden. Sein wettergegerbtes Gesicht füllte den Bildschirm aus. Mit seinen babyblauen Augen erinnerte er sie an Doctor Strange, der zusammen mit Wonder Woman ihr liebster Comic-Held war. Der Vergleich war durchaus passend. Ihr Chef von der NSA war tatsächlich so etwas wie ein Zauberer. Es war ihr ein Rätsel, wie es ihm gelang, ihre Einheit vor all den Spezialisten geheim zu halten, die sich in der Buchstabensuppe der Bundesbehörden herumtrieben – von NSA und CIA bis zu FBI, DOD und DHS. Und das war nur einer seiner vielen Tricks. Meme verfügte über großzügige Mittel. Es war noch kein einziges Mal vorgekommen, dass Morgana etwas gewollt und der General es ihr verweigert hätte. Sie verfügten über die allerneueste Technologie – ihre Ausrüstung wurde zweimal jährlich erneuert. Morgana hatte keine Ahnung, wie er es schaffte, die dafür nötigen Mittel von Marshall Fulmer zu bekommen, dem Ex-Senator, der dem Joint Armed Services Appropriations Committee (JASAC) vorstand und nun vom Kongress als künftiger Nationaler Sicherheitsberater des Präsidenten bestätigt worden war.
»Morgen, Mac«, sagte sie und nahm einen Schluck Cappuccino. »Was gibt’s?«
Der General hatte eine breite Stirn und vorstehende Augenbrauen, die seinem diamantförmigen Gesicht eine besondere Ausdrucksstärke verliehen. »Wie es aussieht, ist unser alter Freund Boris Iljitsch Karpow wieder unter uns Lebenden.«
»General Karpow ist tot«, erwiderte Morgana. »Bei seiner Hochzeit letztes Jahr in Moskau wurde ihm die Kehle aufgeschlitzt.«
»Und dennoch sucht er uns wieder heim.« Der General schüttelte den Kopf. »Wie Sie wissen, hat sich Boris Karpow auf einem schmalen Grat bewegt, zwischen dem, was ihm der Kreml vorgab, und dem, was er selbst für richtig hielt. Das ist in Russland schwieriger als irgendwo sonst auf der Welt, abgesehen vielleicht von Nordkorea. Jedenfalls scheint Karpow in seinen letzten Monaten an verschiedenen geheimen Initiativen gearbeitet zu haben.«
Morganas Bildschirm teilte sich. MacQuerrie füllte die eine Hälfte aus, während Zeile für Zeile eines Computercodes erschien, der so komplex war, dass es ihr den Atem verschlug.
»Was in aller Welt ist das?«
»Keine Ahnung«, sagte MacQuerrie. »Deshalb wende ich mich an Sie.«
»Wir kümmern uns sofort darum.«
»Genau das werden Sie nicht tun«, betonte MacQuerrie. »Das hier ist nur für Sie persönlich bestimmt. Niemand darf auch nur ahnen, dass dieses Programm existiert. Haben Sie verstanden?«
»Natürlich. Aber was glauben Sie, worum es sich handelt?«
Der General schien plötzlich um Jahre zu altern. Er fuhr sich mit der Hand übers Gesicht, und zu ihrem Entsetzen bemerkte sie, dass seine Finger leicht zitterten.
»Meiner Einschätzung nach könnte es sich um eine Cyberwaffe handeln, die um vieles raffinierter ist als alles, was wir bisher gesehen oder uns auch nur vorgestellt haben. Es kursieren schon eine Zeit lang Gerüchte, dass eine solche Waffe existieren könnte. Ich habe sie nur deshalb ernst genommen, weil dieser Waffe ein enormes Potenzial zugeschrieben wird.
Und jetzt, vor einer Stunde, ist plötzlich das hier aufgetaucht. Meine Leute haben es zufällig entdeckt, während sie das Darknet nach Informationen über einen Waffenhändler absuchten, hinter dem wir schon seit Jahren her sind, dem wir aber bisher absolut nichts nachweisen konnten. Sobald irgendwelche Spuren auftauchen, verschwinden die Leute dahinter meistens von einem Moment auf den anderen. In solchen Fällen finden wir nicht einmal eine Leiche.«
»Um welchen Waffenhändler handelt es sich?«
»Keyre. Ein somalischer Pirat – zumindest war er einer, bis wir Viktor Bout erwischt haben.« Morgana wusste, dass Bout der berüchtigtste Waffenhändler des letzten Jahrzehnts war. »Seine Festnahme hat ein riesiges Loch im illegalen Waffenhandel hinterlassen, und Keyre ist als Erster in Bouts Territorium vorgestoßen. Er hat einen nach dem anderen aus dem Netzwerk des Russen getötet und durch seine eigenen Leute ersetzt.
Keyre ist noch schlauer und besser vernetzt, als es Bout je war. Seine Kontakte sind breit gestreut und reichen bis in höchste Regierungskreise auf der ganzen Welt. Bout hatte Zollbeamte in einem Dutzend Länder in der Tasche. Aber gegen Keyres Netzwerk nimmt sich Bouts wie eine Kindergartengruppe aus.
Ich weiß noch nicht, was an der ganzen Sache dran ist, aber diese Cyberwaffe macht mir schon seit Langem Kopfzerbrechen. Sie müssen das hier knacken und den Rest dieses Computercodes finden.«
Morgana lehnte sich zurück und nahm sich einen Moment, um die Informationen zu verarbeiten. Etwas daran gab ihr zu denken. »Mac, haben Sie sich nicht gefragt, warum dieses Fragment plötzlich im Darknet auftaucht?«
»Wie meinen Sie das? Es gibt viele Möglichkeiten, wie …«
»Nein, gibt es nicht. Nicht bei einer solchen Sache. Nein, Mac. Ich vermute, dass es jemand mit Absicht dort platziert hat.«
»Aus welchem Grund?«
»Ich glaube, wir müssen damit rechnen, dass diejenigen, die sich die Cyberwaffe nach Karpows Tod angeeignet haben, sie zum Verkauf anbieten.«
»Zum Verkauf?«
»Gibt es einen besseren Weg, das Interesse potenzieller Käufer anzustacheln und den Preis in die Höhe zu treiben, als sie sozusagen hinter den Vorhang gucken zu lassen?«
»Herrgott, an diese Möglichkeit habe ich noch gar nicht gedacht!« Schweißtropfen glitzerten auf MacQuerries Stirn und rollten ihm über die Wangen.
»Könnte dieser Keyre dahinterstecken?«
»Möglich. Sogar wahrscheinlich. Somalia ist der ideale Ort für solche Sachen.« Der General zog die Stirn in Falten. »Aber ich glaube nicht, dass er der eigentliche Drahtzieher ist. So wie ich Karpow kenne, muss es jemand sein, dem er hundertprozentig vertraut hat.«
»Das heißt, es kann kaum jemand im Kreml oder in einer russischen Regierungsbehörde sein, oder?«
MacQuerrie nickte. »Stimmt.«
»Eher jemand, der an der Entwicklung des Projekts beteiligt war.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendeinem Mitarbeiter seinen gesamten Plan verraten hat. Bestimmt hat er das Projekt so aufgeteilt, dass jeder nur seinen Bereich kannte. Eine notwendige Sicherheitsmaßnahme. Niemand konnte ihn verraten, wenn keiner genau wusste, worum es eigentlich geht.«
»In diesem Fall würde ich davon ausgehen, dass mehrere Leute an dem Code geschrieben haben und keiner von der Arbeit der anderen wusste. Könnte Karpow die einzelnen Teile selbst zusammengefügt haben?«
»Der General war ein Mann mit vielen Fähigkeiten«, räumte MacQuerrie ein. »Möglich wäre es, obwohl ich es ehrlich gesagt nicht für sehr wahrscheinlich halte.«
»Okay, kein Programmierer kann Karpows Projekt als Ganzes geleitet haben. Auch die Besten sind reine Fachidioten: in ihrem Bereich absolute Spitze, mehr aber auch nicht. Die finden nicht mal aus einer Papiertüte heraus.« Sie schürzte die Lippen. »Also stellt sich die Frage, wer die Operation jetzt leitet.«
MacQuerrie schwieg. Morgana hatte den Eindruck, dass sie zum Kern der Sache vorgedrungen war, denn sein Gesicht war noch eine Spur grauer geworden. Vielleicht lag es am Licht in seinem Büro, doch sie bezweifelte es. Seine rechte Augenbraue zuckte, was ihr verriet, dass er unter enormem Druck stand. Was kann ihm solche Sorgen machen?, fragte sie sich.
»Eins noch, bevor wir weitersprechen, Morgana.«
Sie schwieg. Auch wenn sie mit haarigen Situationen vertraut war, hatte sie ein flaues Gefühl im Magen. Schließlich war es General Arthur MacQuerrie, der diese Hiobsbotschaft überbrachte, und nicht irgendein eingebildeter Affe von der NSA, der keine Ahnung hatte, worum es ging.
»Für mich besteht kein Zweifel daran, dass Karpows Operation direkt gegen die Vereinigten Staaten gerichtet ist.« Er hielt inne und wischte sich den Schweiß von der Oberlippe. »Das Ziel könnte das Stromnetz des Landes sein, vielleicht sogar – Gott bewahre – die Atomwaffencodes des Präsidenten.«
»Was? Das ist unmöglich. Die Atomcodes sind durch massive Firewalls gesichert und werden außerdem stündlich geändert.«
»Das stimmt alles. Aber was Karpow hier entwickelt hat, ist so völlig anders als alles, was wir kennen, dass ich und meine Leute wirklich glauben, dass es um die Nuklearcodes geht.«
»Wenn die Russen Zugang zu unseren Nuklearcodes hätten …«
»Sie sehen, wie gefährlich die Situation ist.«
Morgana betrachtete einen Moment lang den Code, der ihren Bildschirm ausfüllte. Großer Gott, dachte sie. Das könnte die ultimative Massenvernichtungswaffe sein.
Black Star. Kein Wunder.
»Das ist ein Superwurm«, meinte sie. »Eine solche Malware habe ich noch nie gesehen.«
»Da sagen Sie mir nichts Neues. Das ist eine Katastrophe. Sehen Sie zu, dass Sie eine Antwort finden, aber schnell.«
Ihr gefiel der Ton nicht, der sich in seine Stimme schlich. Es war schon öfter vorgekommen, dass Mac sie in kritischen Situationen wie ein Dienstmädchen behandelte und sie mit einem drohenden Unterton antrieb. Sie biss sich auf die Lippe, doch in ihr begann es zu kochen.
»Das ist noch nicht einmal alles«, fügte Mac hinzu.
Ihre Anspannung wuchs, als der Computercode von ihrem Bildschirm verschwand und durch ein körniges Schwarz-Weiß-Foto ersetzt wurde, das anscheinend mit einem Teleobjektiv aufgenommen worden war. Ein Überwachungsfoto. Männer im Smoking, Frauen in eleganten bodenlangen Kleidern und mit glitzerndem Schmuck. Über ihren Köpfen ein kunstvoller Kronleuchter, der die Szene beleuchtete.
»Moskau.« MacQuerrie nannte ein Datum aus dem letzten Jahr. »Boris Karpows Hochzeit.«
»Ich sehe Karpow«, sagte Morgana. »In der Mitte des Bildes.«
»Erkennen Sie noch jemanden? Er hat dem Mann neben ihm den Arm auf die Schultern gelegt.«
»Ja.«
»Kennen Sie den Mann?«
Sie beugte sich vor und zoomte Karpow und den anderen etwas näher heran, aber nicht zu sehr, damit das Bild nicht unscharf wurde. »Ich fürchte, nein, Mac.«
Der General seufzte. »Okay, das sollte mich eigentlich nicht überraschen.«
Sie spürte, wie der Zorn in ihr zu einem eisigen Klumpen gefror. Am liebsten hätte sie ihn herausgekotzt und Mac ins Gesicht geschleudert, doch sie bemühte sich, ruhig zu bleiben. »Karpow scheint sich zu freuen, dass der Mann zu seiner Hochzeit gekommen ist. Aber Sie haben gesagt, er hatte keine engen Freunde in der russischen Führungselite.«
»Das stimmt.«
Nun war sie sicher, dass MacQuerrie in ernsten Schwierigkeiten steckte. Seine Augenbrauen zogen sich in einem fast verzweifelten Ausdruck zusammen.
»Der Mann ist kein Russe, Morgana. Er ist einer von uns – oder vielmehr war er es einmal. Der Mann, den Sie da sehen, war Boris Karpows bester Freund. Der Einzige, dem er im Falle seines Todes die Fortführung seiner Operation anvertraut hätte.
Der Mann, den Karpow da umarmt, ist Jason Bourne.«
ZWEI
Die Ägäis lag in reinem Kobaltblau in der Spätnachmittagssonne. Das Boot pflügte in westlicher Richtung durch die Wellen. Die Nym, Boris Karpows dreißig Meter lange Jacht, deren Mannschaft sich aus Griechen und Zyprioten zusammensetzte, war das einzige Stück aus dem Besitz des FSB-Direktors, das nicht von der russischen Regierung beschlagnahmt worden war, nachdem Karpow und wenig später auch seine frisch angetraute Frau ermordet worden waren. Boris hatte das Boot schlauerweise in internationalen Gewässern vor Anker gelegt, sodass es sich der Kreml nicht unter den Nagel reißen konnte.
Diese Gedanken gingen Jason Bourne durch den Kopf, während er – an die Backbordreling gelehnt – zu dem Fleck am Horizont spähte, der selbst aus dieser Entfernung als die Insel Skyros zu erkennen war. In nordöstlicher Richtung lag mehrere Tagesreisen entfernt das Marmarameer und dahinter Istanbul, wo sie kurz vor Anker gegangen waren, um nachzutanken und Lebensmittel und Wasser an Bord zu nehmen. Istanbul war für Leute aus dem Westen kein sicherer Hafen mehr, doch Bourne verfügte über vielfältige Kontakte in der Stadt und ihrer Umgebung, sodass er sich anstelle des Kapitäns um alles kümmerte.
Auf Skyros würde er an Land gehen, aber was dann kam, wusste er nicht. Im Moment war er zufrieden hier auf See, genoss den salzigen Wind in den Haaren, der seine Gedanken von den quälenden Ereignissen rund um Boris’ Ermordung reinigte. Boris hatte zuletzt verschiedene Projekte verfolgt, von denen weder der Kreml noch seine Kollegen beim FSB gewusst hatten. Wahrscheinlich würde von all den Plänen nichts übrig bleiben, nun, da der Meisterspion, der sie ersonnen hatte, nicht mehr da war. Bourne empfand es als Erleichterung, nicht an morgen denken zu müssen, nicht an tickende Zeitbomben und drohende Katastrophen, die es abzuwenden galt.
Sein bester Freund hatte ihm das Boot als Erinnerungsstück hinterlassen. In Wahrheit hatte Bourne keine Verwendung für das riesige Wasserfahrzeug, doch jetzt hatte er es nun einmal. Es war für ihn eine Frage der Ehre und der Wertschätzung für seinen Freund, das Geschenk anzunehmen und etwas damit zu machen. Boris hatte es so gewollt, das war für ihn entscheidend.
Er war erleichtert, nicht mehr in Russland zu sein, und hoffte, die Schlangengrube, in die er dort geraten war, nie wiedersehen zu müssen. Das Grübeln über die Vergangenheit – oder den Teil davon, an den er sich erinnern konnte – machte ihn melancholisch. Aber wie hätte er sonst empfinden sollen? Es gab durchaus Momente, in denen er dachte, dass es nun endgültig genug war und er zu seinem Leben als Universitätsprofessor David Webb zurückkehren sollte, der er gewesen war, bevor ihn die Verantwortlichen von Treadstone dazu ausersehen hatten, die Bourne-Identität anzunehmen. Tief in seinem Inneren wusste er jedoch, dass es nicht funktionieren würde. Er hatte es zweimal versucht, doch schon nach wenigen Wochen hatte ihn eine quälende Langeweile befallen. Er war nun einmal der, der er war. Dem konnte er nicht entfliehen, selbst wenn er es noch so sehr gewollt hätte.
Die Nym verlangsamte ihre Fahrt. Kapitän Stavros kam aus dem Ruderhaus, stieg die Leiter herab und trat zu Bourne. In den Händen hielt er eine Flasche eisgekühlten Wodka, zwei Gläser und einen Pfefferstreuer.
»Anlegen oder Anker?«, fragte er in seiner typisch knappen Art.
In den Tagen, seit Bourne an Bord der Nym gekommen war, hatten sich die beiden Männer näher kennengelernt, so weit sich zwei Fremde auf engem Raum kennenlernen konnten. Sie aßen und tranken zusammen, tauschten Geschichten über den ehemaligen Besitzer des Bootes aus, für den Stavros eine tiefe, unerschütterliche Zuneigung hegte. Bei all der Härte bis hin zur Grausamkeit, die Boris gelegentlich an den Tag gelegt hatte, war er ein erstaunlich herzlicher Mensch gewesen. Trotz seiner bisweilen schwermütigen russischen Seele hatte er gerne gelacht und sich an gutem Essen und Trinken erfreut. Das hatte ihm geholfen, die oft trostlose berufliche Laufbahn zu ertragen, die er gewählt hatte.
Boris war zu tiefem Empfinden fähig gewesen und hatte für die wenigen, die ihm nahegestanden hatten, alles getan. Diese Qualitäten, die auch Bourne zu eigen waren, hatten die Grundlage ihrer langjährigen Freundschaft gebildet. Sie hatten einander auch dann immer geholfen, wenn sie in einem Konflikt auf verschiedenen Seiten gestanden hatten. Umso mehr, wenn sie einen gemeinsamen Feind bekämpft hatten. Bourne würde die seltenen Stunden des unbeschwerten Zusammenseins vermissen, und noch mehr die Momente der Gefahr, die sie gemeinsam erlebt hatten.
»Anker.« Bourne nannte ihm die Koordinaten, und Stavros nickte. Er war es gewohnt, nur das Nötigste darüber zu wissen, wohin sein Chef wollte und aus welchem Grund.
Er reichte Bourne ein Glas und schenkte ihnen beiden großzügig von dem feinen russischen Wodka ein. Bevor sie tranken, streute Stavros etwas Pfeffer in ihre Gläser. Er sah Bourne lächelnd an; der lächelte zurück. Die Geste war ein stiller Tribut an Boris, der ein Russe der alten Schule gewesen war. Einst hatte man in Russland seinen Wodka nur mit Pfeffer zu sich genommen, weil er oft schlecht gebrannt gewesen war und deshalb gefährliche Fuselöle enthalten hatte. Der Pfeffer zog das Fuselöl aus dem Wodka und setzte sich damit auf dem Boden des Glases ab.
»Auf unseren großen General!«, rief Stavros aus und erhob sein Glas. Seine tiefe Bassstimme war von jahrelangem Alkohol- und Tabakkonsum geprägt.
»Auf Boris Iljitsch.« Lang lebe die Erinnerung an ihn, fügte Bourne in Gedanken hinzu.
»Wir werden ihn nie vergessen!«
Sie ließen die Gläser klirren und kippten den Wodka in einem Zug hinunter.
Der Himmel über ihnen war wie eine umgedrehte Porzellanschüssel, hellblau und weiß, wie die Wände der Hauptkabine des Bootes. Über ihnen kreisten Möwen mit klagenden Rufen. Sie waren von den Felsklippen an der Ostküste der Insel aufs Meer herausgeflogen, um Futter zu ergattern.
»Werden wir lange auf Skyros bleiben?«
»Einige Tage«, sagte Bourne ausweichend. Der Kapitän akzeptierte die vage Antwort mit einem Kopfnicken. Mehr musste er im Moment nicht wissen.
Er füllte Bournes Glas erneut, dann kehrte er ins Ruderhaus zurück, um die Nym die letzte halbe Meile zum Ankerplatz etwa zweihundert Meter vor der Küste zu steuern. Das Wasser war auf dieser Seite der Insel ziemlich tief.
Bourne ging ein paar Schritte Richtung Bug, um die zerklüfteten Felsen und den Kiesstrand besser sehen zu können. Einzelheiten, dachte er bei sich. Es ging immer um die Einzelheiten. Viele seiner Feinde hatten die kleinen Details außer Acht gelassen und diesen Fehler mit dem Leben bezahlt.
Bourne verlangte das kleine Motorboot mit dem hochgezüchteten Zwillingsdieselmotor. Als er auf dem Fallreep hinabstieg, blickte der Kapitän zu ihm herunter.
»Sind Sie sicher, dass Sie niemanden von der Mannschaft mitnehmen möchten?«
»Ja, absolut sicher.«
Stavros hielt fragend eine Steyr-M-Pistole hoch.
»Danke, die brauche ich nicht.«
»Man kann nie wissen«, grinste Stavros. »Hat der General immer gesagt.«
Da ist etwas Wahres dran, dachte Bourne und griff nach der Waffe, ehe er zum Motorboot hinabstieg. Der Kapitän war genau an der Stelle vor Anker gegangen, die ihm Bourne genannt hatte. Bourne war schon einmal auf Skyros gewesen, damals unter extremen Bedingungen. Doch in Anbetracht dessen, was er hier vorhatte, konnte man es als eine Art Heimkehr betrachten.
Der Matrose, der das Motorboot für ihn vorbereitet hatte, stieg das Fallreep hoch und holte es ein. Bourne warf den Außenborder an und peilte einen Küstenabschnitt an, der wie eine neugierige Nase in die Ägäis ragte. Die Möwen kreisten noch eine Weile über ihm, ehe sie mit enttäuschten Rufen das Weite suchten.
Als das Boot in den Schatten der Landzunge gelangte, lenkte er es weiter nach links, sodass er das Festland zwischen sich und der Nym hatte. Niemand an Bord konnte sehen, was er tat und wer ihn erwartete.
Sie saß auf einer sanften Erhebung im Kies, rauchte eine Zigarette und beobachtete ihn aus halb geschlossenen Augen, während er den Motor abstellte, den Anker auswarf und ins seichte Wasser sprang.
Sie machte keine Anstalten, ihm zu helfen, sondern blieb ruhig sitzen und musterte ihn von der Seite, während er über den Kies zu ihr heraufkam. Sie trug einen tief ausgeschnittenen Badeanzug aus einem metallischen pflaumenfarbenen Material. Sie saß so, dass er die hässliche Narbe sehen konnte, die von der Wade bis hinauf zur Hüfte verlief. Es war deutlich zu erkennen, dass ihr die Wunde als eine Art Folter über einen längeren Zeitraum hinweg zugefügt worden war. Bourne wusste auch, was man ihr in ihren schönen Rücken geritzt hatte.
Sie hatte lange, wohlgeformte Beine und eine schmale Taille. Ihren Nasenrücken zierten ein paar Sommersprossen. Ihre Augenfarbe bewegte sich bei wechselndem Licht zwischen Mitternachtsblau und Schwarz. Alles in allem war sie eine atemberaubende Schönheit.
»Findest du, dass ich passend angezogen bin?«
»Du meinst, für den Strand.«
Sie sah ihn mit einem strahlenden Lächeln an. Sie hatten fast dieselben Worte gewechselt, als sie einander letztes Jahr in Nikosia begegnet waren. Davor hatte Bourne sie nicht mehr gesehen, seit er sie aus Keyres Lager in Somalia befreit hatte. Damals war sie noch ein Mädchen gewesen, was Keyre nicht gehindert hatte, sie monatelang zu quälen, den alten Riten des Yibir-Clans folgend. Bourne hatte keine Ahnung, was der Somalier mit ihr vorgehabt hatte. Falls sie es wusste, hatte sie es ihm jedenfalls nicht verraten.
Sie hieß Mala Ilves und war gebürtige Estin. Heute gab es außer Bourne niemanden mehr, der sie Mala nannte. Nur wenige kannten ihren richtigen Namen. Bekannter war sie als »die Engelmacherin«.
»Für das, weswegen wir hier sind«, sagte sie.
»Was soll ich dazu sagen? Ich weiß ja nicht, warum du dich an diesem abgelegenen Platz mit mir treffen wolltest.«
Sie hob ihr Gesicht der untergehenden Sonne entgegen. »Hier ist es so friedlich, stimmt’s?« Wieder dieser eigentümliche Blick von der Seite. »Aber auch blutig.«
»Das ist lange her, Mala.«
»Nicht für mich.« Sie fuhr mit den Fingerspitzen über ihre Narbe. »Für mich ist es wie gestern.«
Bourne setzte sich neben sie. »Das glaube ich nicht.« Sie roch nach Lakritze, nach Meer und sauberem Schweiß. Keine Spur von dem Gestank nach Blut und faulendem Fleisch, der ihr angehaftet hatte, als er sie von Somalia hierhergebracht hatte.
Sie fuhr sich mit den Händen durch ihr dichtes Haar. »Ich habe dich nie belogen, Jason.«
»Wie oft hättest du es gern getan?«
Sie befeuchtete ihre Lippen mit der Zungenspitze und lachte leise. »Ich habe nicht mitgezählt.«
Er schwieg einen Moment und betrachtete das Spiel der letzten wärmenden Sonnenstrahlen auf den Wellen. Ein Kormoran verschwand unter Wasser und tauchte mit einem silbrig glänzenden Fisch im Schnabel wieder auf. Er hob den Kopf zur Sonne, so wie Mala zuvor, und verschluckte den Fisch.
»Also, warum wolltest du dich eigentlich hier mit mir treffen?«
»Hast du es so eilig? Musst du irgendwohin? Ein Rendezvous vielleicht.«
Die letzte Bemerkung sprach sie nicht als Frage aus, und in seinem Bauch machte sich ein Warnsignal bemerkbar. Wie viel wusste sie über das Leben, das er in den letzten Jahren geführt hatte? Vielleicht alles. Jedenfalls musste er von dieser Annahme ausgehen und sich langsam zur Wahrheit vortasten. Er durfte sie auf keinen Fall unterschätzen. Viele, die diesen Fehler begangen hatten, waren heute tot.
»Nein«, sagte er. »Ich bin ganz für dich da.«
Wieder dieser prüfende Blick von der Seite und ein hintergründiges Lächeln. Glaubte sie ihm, oder begegnete sie ihm genauso mit einer Prise Argwohn wie er ihr?
»Du bist für niemanden ganz da, Jason. Nicht einmal für die Israelin.«
Sie wusste also von Sara. Er war zornig, fühlte sich in seiner Privatsphäre verletzt. Überrascht war er jedoch nicht. So wie Keyre sie behandelt hatte, war es kein Wunder, dass sie kein Gefühl für Privatsphäre hatte. Da ihre eigenen Grenzen nie respektiert worden waren, vermochte sie nun nicht, bei anderen Grenzen einzuhalten.
»Ist das der Grund, warum du dich mit mir treffen wolltest? Eifersucht?« Er sagte es in einem neckenden Ton, doch die Frage war nicht ganz scherzhaft gemeint.
»Wär das so schlimm?« Sie lehnte sich an ihn. Er spürte ihre warme Haut und das sanfte Pulsieren ihres Blutes. »Ich bin eben ein schlimmes Mädchen. Das weißt du doch am besten.«
»Einige haben es noch besser gewusst als ich. Die sind alle tot.«
Sie lachte. »Das mag schon sein.« Sie drückte ihr Bein an seines. Zusätzliche Wärme, während die Sonne hinter dem westlichen Horizont zu versinken begann. »Die Zeit läuft für jeden anders.«
Er wusste, was sie damit meinte. Zeit war das, was man aus ihr machte, wie man sie einteilte, was man davon in Erinnerung behielt und was man vergaß. War das der Grund, warum er sich an nichts erinnern konnte, was vor seinem Sturz ins dunkle Mittelmeer geschehen war? Damals war er beinahe ums Leben gekommen. Hatte es vielleicht irgendein Ereignis gegeben, das noch schlimmer war? So furchtbar, dass sein Gedächtnis es aus reinem Selbstschutz gelöscht hatte? Etwas noch Schlimmeres als das, was Mala durchgemacht hatte? Was, wenn er es nie erfahren würde? Vielleicht wäre das sogar besser für ihn. Dennoch war es eine Qual, mit diesen Fragen leben zu müssen.
»Armer Jason. Du bist ein Mann ohne Geschichte«, bemerkte sie, als hätte sie seine Gedanken gelesen. »Ich weiß wenigstens, wer meine Eltern waren.«
»Und was hat es dir gebracht?«
»Touché. Vielleicht sollten wir auf das Sticheln verzichten.«
»Warum fängst du dann damit an?«
»Ich bin nun mal ein Skorpion.«
Sie spielte auf eine alte Fabel an: Ein Skorpion bittet einen Frosch, ihn über den Fluss zu tragen. Der Frosch sagt klugerweise: Dann wirst du mich stechen. Der Skorpion antwortet völlig logisch: Warum sollte ich das tun? Dann würden wir beide ertrinken. Das leuchtet dem Frosch ein, und er lässt sich darauf ein. Aber auf halbem Weg über den Fluss sticht der Skorpion den Frosch. Bevor sie beide untergehen, fragt der Frosch verzweifelt: Warum hast du das getan? Der Skorpion antwortet völlig logisch: Ich bin ein Skorpion. Das ist nun mal mein Charakter.
Mala zuckte mit den Schultern. »Aber was kümmert es dich? Du bist schließlich kein Frosch.«
Das schwindende Licht wirkte wie geronnen, und die Insel, auf der sie sich befanden, schien in der beginnenden Dunkelheit zu schrumpfen. Bald würde die Nacht vom dunklen Meer beherrscht werden, von der hohen Sternenkuppel mit dem tief am östlichen Himmel aufgehenden Mond.
Sie erhoben sich, und Mala führte ihn über den steiler werdenden Kiesstrand zu dem Felsen, auf dem sie ihre Sachen zurückgelassen hatte: Wanderschuhe, eine gestreifte Strandtasche und ein mitternachtsblaues Sommerkleid, das sie überstreifte, während sie über den Felsen stiegen.
»Hast du Hunger?«, fragte sie.
»Wir könnten auf dem Boot essen«, schlug er vor. »Der Koch ist hervorragend.«
»Ich habe schon etwas reserviert.« Er bezweifelte, dass hier an diesem abgelegenen Fleck in der Ägäis eine Reservierung nötig war. Skyros war kein übermäßig beliebtes Urlaubsziel.
Sie gelangten zu einem Erdweg, der sich über einen Hügel schlängelte. Wenig später folgten die ersten Pflastersteine als Vorboten der nahen Zivilisation, die hier auf der Insel in einer etwas ursprünglicheren Form existierte.
Eine Taverne war mit einer Lichterkette über der betonierten Terrasse erhellt. Die Tische und Stühle wirkten wahllos verstreut. Von hier aus hatte man eine wunderbare Aussicht auf den Felsvorsprung und die Bucht, vor der die Nym hell erleuchtet vor Anker lag.
»Da hat dir dein Freund ein hübsches Erbe hinterlassen«, meinte Mala, nachdem sie sich an einen Tisch gesetzt hatten. »Bestimmt hat er Millionen beiseitegelegt, die er im Ölgeschäft verdient hat.«
Bourne musterte sie prüfend. Versuchte sie ihn aus der Reserve zu locken, oder war es nur harmlose Konversation? So oder so war es kein Thema, über das er mit ihr sprechen wollte. Das Essen wurde serviert. Die Portionen waren riesig. Vermutlich hatte Mala schon vorbestellt. Der Fisch war wunderbar frisch und köstlich. Sie sah ihn kaum an, während sie aßen, sondern blickte in die geheimnisvolle Nacht hinaus, als warte sie auf ein Wort, das nur sie hören konnte.
Wie sich herausstellte, überlegte sie einfach nur, wie sie ein Thema ansprechen sollte, von dem sie wusste, dass es für ihn sehr heikel war. Sie wartete, bis das Geschirr abgeräumt war, Kaffee und Retsina serviert wurden und sie wieder allein auf der nächtlichen Terrasse waren.
»Deine Freundschaft mit General Karpow war vielen ein Dorn im Auge.«
Er sah sie schweigend an und fragte sich, worauf sie hinauswollte. Über den Büschen tanzten Glühwürmchen, und der Mond tauchte die Felsen in ein silbriges Licht. Von der Küste war das ferne Rauschen der Brandung zu hören.
Mit einem spöttischen Lächeln griff sie in ihre Strandtasche, zog ein vergrößertes Foto heraus und legte es vor ihm auf den Tisch. »Du hättest Karpows Einladung zur Hochzeit nicht annehmen sollen. So haben alle Geheimdienste der Welt gesehen, wie dir der General den Arm um die Schultern legte. Zwei dicke Kumpel. Busenfreunde.
Du musst wissen, Jason, dieses Foto hat auch bei euren Geheimdiensten einigen Aufruhr verursacht. Und was den FSB betrifft, hat sich auch einiges geändert, seit der General nicht mehr da ist. Timur Sawasin hat herausgefunden, dass du dich mit Iwan Wolkins gestohlenem Schatz aus dem Staub gemacht hast. Das heißt, der Erste Vizepremierminister hat es auf dich abgesehen.«
»Irgendjemand hat es immer auf mich abgesehen.«
»Und was ist mit deiner israelischen Geliebten?«
Bourne überlegte kurz, ob er gar nicht darauf antworten sollte, doch dann wurde ihm klar, dass sie vielleicht genau das erwartete. »Sie ist Boris begegnet, mehrmals.«
»Feinde – oder Freunde?«
»Boris Iljitsch war nicht so, wie du vielleicht denkst. Wenn du ihn gekannt hättest …«
»Dafür ist es ein bisschen spät, meinst du nicht?«
Er stand auf, um zu gehen, doch sie legte die Hand auf seine. »Sorry.« Sie sah ihm in die Augen. »Wirklich.« Er blieb stehen, und sie fügte mit leiserer Stimme hinzu: »Du kennst jede Wunde, jede Narbe … Du weißt, wie hässlich mein Körper ist.«
Bourne setzte sich wieder hin. »Das macht mich traurig.«
»Siehst du«, fauchte sie. »Ich hab’s gewusst!«
»Mala, du verstehst mich falsch. Ich meine das, was Keyre dir angetan hat mit seinen abartigen Ritualen, damit du ihm gehörst. Aber es muss nicht so sein. Du bist stark.«
»Wie du siehst, sitze ich hier bei dir. Jetzt. Eifersüchtig auf deine Israelin, die bestimmt einen makellosen Körper hat.«
Bourne war fest entschlossen, nichts mehr zu dem Thema zu sagen.
Sie seufzte. »Vielleicht bin ich wirklich ein bisschen besitzergreifend, was dich betrifft. Unsere gemeinsame Geschichte. Und natürlich, was du für Liis getan hast.«
»Das heißt, du hast wenigstens mit ihr gesprochen.«
Mala schüttelte den Kopf. »Ich hab’s versucht, aber Liis wollte nicht mit mir sprechen.«
»Was ist passiert? Sie hat so gehofft, dass du zu einer Vorstellung kommst.«
»Bin ich auch. Ich war letzten Winter in New York, als sie im Lincoln Center aufgetreten ist.«
»Und bist nicht zu ihr hinter die Bühne gegangen?«
»Wir sind nicht aus demselben Holz geschnitzt. Ich bringe sie nur in Gefahr. Lieber komme ich ihr nicht zu nahe.«
Jetzt verstand er: Mala hatte ihn in New York zusammen mit Sara gesehen. Er zog die Stirn in Falten. »Wie lange spionierst du mir schon nach?«
Sie schürzte die Lippen. »Ich möchte gern genauso viel über dich wissen, wie du über mich weißt.«
»Aber das kannst du nicht.«
»Ich versuche es trotzdem.« Sie machte eine wegwerfende Kopfbewegung. »Komm schon, ich führe nichts Böses gegen deine Israelin im Schilde.«
Sara. Ihr Name ist Sara, dachte Bourne. Er hatte die Mossad-Agentin vor fünf Jahren kennengelernt, hatte ihr in Mexico City das Leben gerettet und danach gelegentlich mit ihr zusammengearbeitet. Letztes Jahr war sie fälschlicherweise beschuldigt worden, Boris ermordet zu haben.
Die Vorstellung, ihren Namen in Malas Gegenwart auszusprechen, erschien ihm einfach unerträglich. Diese beiden Bereiche seines Lebens waren für ihn streng voneinander getrennt. Sein Instinkt sagte ihm, dass nichts Gutes daraus entstehen konnte, die beiden Sphären zu vermischen.
»Gegen wen führst du etwas Böses im Schilde?«, fragte er, um das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken.
»Gegen die Leute, die vorhaben, dich zu liquidieren.«
»Das haben schon einige versucht.«
»Ich weiß, aber diesmal ist es anders.«
»Inwiefern?«
»Diesmal haben es die Amerikaner und die Russen auf dich abgesehen. Wenn du nicht achtgibst, nehmen sie dich in die Zange. West und Ost auf der gemeinsamen Jagd nach einem Ziel.«
Er überlegte einen Moment. »Heißt das, du wolltest dich mit mir treffen, um mich zu warnen?«
Sie nickte. »Das – und noch etwas anderes.«
In diesem Augenblick ging die Nym in einem glühenden Feuerball auf. Erst Augenblicke später hörten sie das mehrfache Donnern der Explosionen.
Die Trümmer des Bootes wurden in die Luft geschleudert wie in einem infernalischen Springbrunnen.
DREI
»Habt ihr etwas gefunden?«
»Nichts, Herr Vizepremier.«
Der Erste Vizepremierminister, Timur Sawasin, der zweite Mann im Staat hinter dem Präsidenten, stand auf dem Gelände von Boris Iljitsch Karpows Datscha im dichten Wald nördlich von Moskau, die Hände in die Hüften gestemmt und eine Zigarette im Mundwinkel. Ein Trupp Männer war damit beschäftigt, die Erde umzugraben, gegen Wände und Dielenbretter zu klopfen, in Küchenschränken nach einem Geheimfach und unter Treppen nach einer verborgenen Nische zu suchen. Mit anderen Worten, sie stellten das ganze Haus auf den Kopf. Zur Linken stand ein Bulldozer, dessen Fahrer eine Pause machte, um eine Zigarette zu rauchen. Dahinter der Tieflader, mit dem die Maschine aus Moskau hertransportiert worden war.
»Kein Geld, keine Unterlagen, keine Listen? Gar nichts?«, fragte er frustriert.
»Nein, Herr Vizepremier.«
Der Mann, der seine Fragen beantwortete, war sein Assistent Igor Malatschew. Karpow hatte seinen Einfluss kontinuierlich ausgedehnt und nicht nur die Leitung des FSB, der Nachfolgeorganisation des KGB, sondern auch die des sogenannten FSB-2, der Antidrogenbehörde, an sich gerissen. Nie wieder würde ein Mann über eine solche Macht im Geheimdienstwesen verfügen. Der Präsident hatte Karpows Leute aus allen neun Abteilungen des FSB entfernt und Konstantin Ludmirowitsch mit der Leitung des Geheimdienstes betraut. Die Führungsposition des FSB-2 war immer noch unbesetzt. Für Sawasin war diese Ernennung ein Schock gewesen. Er hatte mit Konstantin seit fünf Jahren kein Wort mehr gewechselt. Vielleicht wollte der Präsident damit die Kluft zwischen ihnen überbrücken. Wahrscheinlicher aber war, dass er damit demonstrieren wollte, wer in der Russischen Föderation wirklich das Sagen hatte. Karpow war direkt vor den Augen des Präsidenten viel zu mächtig geworden. Der schlaue General hatte einen Weg gefunden, das System für seine Zwecke zu nutzen. Eine solche heimliche Eigenmächtigkeit würde es nicht mehr geben, das hatte der Kreml mit der Neubesetzung deutlich gemacht. Für Sawasin war es jedoch ein erniedrigender Albtraum, ab sofort täglich mit Konstantin zu tun zu haben. Immerhin hatte er die Leitung der FSB-Spezialeinheit mit Zustimmung des Präsidenten Oberst Aleks Wolodarski übertragen können.
»Gut. Dann lassen Sie die Hütte abreißen.«
»Wirklich? Eine so schöne Datscha?«
Sawasin lachte leise. Malatschew war so leicht zu durchschauen, was Sawasin nur recht war. Wie hatte sein Vater immer gesagt? »Halte die Zügel deiner Pferde immer schön straff, und füttere sie nur mit dem Hafer, den du selbst anbaust.« Der Alte mochte grausam gewesen sein und dem Wodka ein bisschen zu sehr zugesprochen haben, aber er war immer sein eigener Herr gewesen. Es war eine gute Lektion für Malatschew, zuzusehen, wie die Datscha, die ihm so gefiel, dem Erdboden gleichgemacht wurde, und selbst den Befehl zur Zerstörung geben zu müssen.
Als sie etwas später auf dem bequemen Rücksitz der gepanzerten Limousine saßen und zurück in die Moskauer Innenstadt fuhren, fragte Malatschew: »Wonach haben Sie eigentlich gesucht, Herr Vizepremier?«
Sawasin lehnte sich zurück und stellte sich vor, Boris Karpow würde hier neben ihm sitzen, nachdem sie die Datscha eines verräterischen Generals durchsucht hatten. Karpow hätte diese Frage nicht gestellt, weil er die Antwort längst gekannt hätte. Aber Karpow hatte sich immer seine eigenen Gedanken gemacht und war nie ein reiner Befehlsempfänger gewesen. Er hatte sich nicht einmal vom Präsidenten persönlich manipulieren lassen. Der Hundesohn hatte immer getan, was er wollte. Zuletzt hatte er sogar eine Ukrainerin mit einem höchst zweifelhaften Verhältnis zur Russischen Föderation geheiratet. Leute wie Karpow durften niemals eine solche Machtfülle im Staat erhalten; dafür waren sie einfach zu gefährlich.
Sawasin seufzte und blickte auf die Umgebung hinaus, die zunehmend von hässlichen Zweckbauten geprägt war, je näher sie der Hauptstadt kamen.
»Vieles deutet darauf hin, dass der General mit verschiedenen geheimen Initiativen beschäftigt war.«
»Von denen nicht einmal der Präsident gewusst hat?«
War Malatschew wirklich so schockiert, wie es den Anschein hatte?, fragte sich Sawasin. »Genau. Aber ich bin mir sicher, dass wir alle seine Aktivitäten gestoppt haben.«
»Trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass das noch nicht alles ist, oder?«
»Sie haben recht«, stimmte Sawasin selbstgefällig zu. »General Karpows bester Freund, der Amerikaner Jason Bourne, hat sich im letzten Jahr mehrmals im Land aufgehalten.«
»Er war auch bei der Hochzeit des Generals.«
Der Vizeregierungschef nickte. »Stimmt. Aber er war etwas später noch einmal hier, zu der Zeit, als Iwan Wolkin gestorben ist. Ich bin mir sicher, dass Bourne ihn getötet und ihm ein großes Vermögen abgenommen hat, das Karpow gestohlen haben dürfte.«
»Das heißt, Bourne könnte alle offenen Fragen beantworten«, fügte Malatschew hinzu.
»Zweifellos.« Sawasin verlagerte sein Gewicht auf dem Rücksitz, um einen Krampf in der Wade zu lösen. »Darum würde ich zu gerne eine Wympel-Spezialeinheit einsetzen, um Bourne zu eliminieren – wenn wir nur wüssten, wo er steckt. Erst mit seinem Tod wären wir Boris Iljitsch Karpow wirklich los.«
»Dafür ist Wolodarski zuständig«, erklärte Malatschew. »Aber ehrlich gesagt traue ich es ihm nicht zu.«
»Moment.« Sawasin zog sein Handy hervor. »Wolodarski hat mir versichert, dass er nahe dran ist, Bourne aufzuspüren.« Er begann, eine Nachricht einzutippen, als sie am Ziel ihrer Fahrt ankamen. »Trotzdem möchte ich, dass Sie für alle Fälle Ihre eigenen Ermittlungen anstellen, Igor. Natürlich diskret.«
»Selbstverständlich«, versicherte Malatschew, bevor er ausstieg.
Sawasin entging nicht das wölfische Grinsen im Gesicht seines Stellvertreters.
Françoise Sevigne hörte das Klopfen an der Tür ihres Hotelzimmers und schickte ihre letzte, mit einem Emoji versehene Nachricht ab, bevor sie ihr Handy in die extragroße Handtasche gleiten ließ. Sie trat von dem Fenster weg, von dem sie den Jachthafen in Kalmar, Schweden, überblickte. Kalmar lag im Südosten des Landes, an dem zur Ostsee gehörenden Kalmarsund, einer Meerenge zwischen dem schwedischen Festland und der Insel Öland.
Sie öffnete die Tür, um Justin Farreng eintreten zu lassen, einen schlanken blonden Mann, der immer irgendwie gehetzt wirkte. Er schlüpfte an ihr vorbei ins Zimmer, und sie schloss die Tür hinter ihm ab. Er stürzte sich förmlich auf sie, von einem unbändigen Verlangen getrieben, und sie empfing ihn wie eine Mutter ihr Kind, dessen Bedürfnisse nur sie allein stillen konnte.
Er nahm sie gleich an der Wand, in einem atemlosen, aggressiven Akt, der keinen Aufschub duldete. Sie wiederholten das Ganze im Bett, diesmal langsamer, aber um nichts weniger leidenschaftlich, fast wie in einem intensiven Ringkampf. Erst danach ruhten sie aus, und er gönnte sich zwanzig Minuten tiefen, erholsamen Schlaf. Das dritte Mal war ruhig und entspannt, während warmes Wasser aus der Dusche auf sie herabregnete. Er hob sie hoch, als wäre sie ein Kind, umschloss ihre Hinterbacken mit seinen Händen, und die Glut wurde aufs Neue angefacht und heizte das Wasser und sie selbst auf. Eine Wolke aus heißem Wasserdampf hüllte sie ein.
Später beobachtete sie ihn, auf einen Ellbogen gestützt, vom Bett aus, als er sich anzog. »Du gehst früh.«
»Ich habe viel zu tun.«
Sie lachte leise, kroch über das Bett und setzte sich mit gespreizten Beinen ans Fußende. Mit Genugtuung registrierte sie, wie sein Blick magnetisch angezogen wurde.
»Bleib noch«, sagte sie.
»Ich kann nicht. Ich treffe mich mit …«
Sie spreizte ihre Schenkel noch weiter. Die Innenseiten waren noch feucht. »Ein Mann wie du …«
Halb angezogen kam er zu ihr, so nahe, dass sie den Reißverschluss seiner Hose öffnen konnte. Sie zog ihn zu sich herunter.
Sie schaute in seine Augen, konnte jedoch nichts Interessantes erkennen. Schon vor Wochen war ihr bewusst geworden, dass hinter der glänzenden Fassade absolut nichts war. Justin war in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Sein Vater war sechs Wochen nach einem Fabrikunfall gestorben, bei dem ihm ein Bein und ein Teil der Hüfte abgerissen worden war. Seither hegte Justin einen tief sitzenden Groll gegen die ganze Welt. Er war ein Mann von großer Entschlossenheit, was ihn unvorsichtig und leichtsinnig machte. So unbedacht er manchmal handeln konnte, so messerscharf arbeitete sein Verstand, wenn es um seine Rache ging.
Als sie fertig waren, rollte sie ihn von sich herunter, streckte sich und griff unter ein Kissen. Farreng hatte allen Grund, sich gehetzt zu fühlen. Er wurde in mehreren Ländern gesucht, weil er brisante Dokumente veröffentlicht hatte, die er von Regierungsbehörden, Unternehmen und verschiedenen Institutionen gehackt hatte. Mit diesen Leaks hatte er weltweit einigen Schaden angerichtet. Farrengs Organisation LeakAGE war stolz darauf, sich auf die Mitarbeit zahlreicher Whistleblower und Informanten stützen zu können, deren Identität man schützte wie eine Löwin ihre Jungen. Das Problem bestand darin, die Quellen zu überprüfen, die der Organisation Informationen zuspielten. Menschen wie Françoise Sevigne. Er würde sie niemals aufgeben, das hatte sie sofort gewusst, als sie ihn das erste Mal in die Arme geschlossen und seine Erregung gespürt hatte. Das war vor sechs Monaten gewesen und hatte sich seither kein bisschen geändert. Er begehrte sie immer noch mit derselben Leidenschaft.
Lächelnd reichte sie ihm einen Speicherstick mit Dateien, die Agenten des Vizeregierungschefs Timur Sawasin sorgfältig für ihn zusammengestellt hatten.
VIER
In vollem Lauf gelangten sie zum Motorboot. Seit der Explosion der Nym hatten sie kein einziges Wort gewechselt. Mala stieg zuerst ins Boot und holte den Anker ein. Bourne ging ans Steuer und warf den Motor an. Sobald der Anker aus dem Wasser war, gab Bourne Gas. Hätte Mala sich nicht festgehalten, wäre sie wahrscheinlich über Bord gegangen.
Der Himmel über der Stelle, an der die Nym vor Anker gelegen hatte, zeigte die Spuren der Explosionen, und ein stechender Geruch lag in der Luft. Mond und Sterne waren von einer riesigen Wolke aus Rauch und Trümmerstaub verdeckt.
»Jason, was hast du vor?«, fragte Mala, als ihr klar wurde, dass er direkt auf den Ort der Katastrophe zusteuerte. »Du glaubst doch nicht etwa, dass irgendjemand diese Explosionen überlebt hat.«
»Nein«, bestätigte er grimmig. »Die hat niemand überlebt.«
»Aber warum …?«
»Still.« Sein Blick war starr geradeaus gerichtet. »Sei ganz still.«
Sie sah ihn einen Moment lang an, schüttelte den Kopf und wandte ihre Aufmerksamkeit dem Trümmerfeld zu. Er musste irgendetwas darin gesehen haben, doch sie konnte nichts Auffälliges erkennen. Was er vorhatte, war ihr ein Rätsel, und das beunruhigte sie.
Bald hatten sie den Rand des Trümmerfelds erreicht. Bourne lenkte das Boot immer noch mit Vollgas auf den Ort der Zerstörung zu. Ihre Augen brannten in der heißen Luft. An einer Stelle schien das Wasser zu kochen, wenngleich es der dichte Rauch unmöglich machte, etwas Genaues zu erkennen. Es war, als würden sie in eine tief hängende Nebelbank fahren.
Mala sah ringsum Trümmer im Wasser treiben, die meisten bis zur Unkenntlichkeit verbrannt oder zerrissen, bis sie an einem menschlichen Arm vorbeikamen, völlig verkrümmt und schwarz verkohlt. Wenig später folgte ein Fuß, aus dem die Knochen nach oben ragten. Der Gestank war schwer zu ertragen.
Bourne jagte mit Höchstgeschwindigkeit zwischen den Überresten hindurch. Sobald sie das Trümmerfeld durchquert hatten, sahen sie das Patrouillenboot, das etwa zwei Kilometer entfernt ruhig im Wasser lag.
»Warum sind die noch hier?«, sagte Mala mehr zu sich selbst. »Worauf warten sie?«
»Auf den letzten Taucher.« Bourne stellte den Motor ab.
Er übergab ihr das Steuer und reichte ihr die Steyr-Pistole. Dann zog er Schuhe, Jacke und Hose aus, öffnete einen Schrank und zog ein Gaff hervor, einen langen Stiel mit einem Haken, mit dem größere Fische an Bord geholt wurden. Er atmete tief ein und sprang ins Wasser.
Jenseits des Trümmerfelds hatte der Wind den Rauch bereits zerstreut. Das schimmernde Licht des Vollmonds spiegelte sich im Wasser. Fast augenblicklich sah er den durchdringenden Lichtstrahl, der von der Stirn des Tauchers ausging. Der Mann schwamm auf das Boot zu, das sanft auf den Wellen schaukelte. Bourne hatte mit seiner Vermutung richtiggelegen, dass mehrere Taucher Sprengsätze an der Nym angebracht hatten. Es war die einfachste Methode, ein Boot zu versenken. Er selbst hätte es nicht anders gemacht. Dass die Sprengsätze von außen gekommen sein mussten, war ihm auch deshalb klar, weil während ihres kurzen Aufenthalts in Istanbul niemand an Bord gekommen war. Darauf hatte er selbst geachtet.
Bourne war ein ausgezeichneter Schwimmer, doch der Taucher war zu weit entfernt, um ihn ohne Flossen einholen zu können. Er wollte schon auftauchen, um Luft zu holen, da näherte sich von unten ein dunkler Schatten. Es war, als würde der Meeresboden zu ihm hochsteigen. Die weit ausgebreiteten Flossen sagten ihm alles, was er wissen musste. Er wartete, bis der Mantarochen zu ihm hochgestiegen war, und packte das Tier an der Oberseite des Mauls. Der Rochen schnellte so vehement nach vorne, dass er Bourne beinahe den Arm aus dem Schultergelenk riss. Wie sein naher Verwandter, der Hai, war auch dieser Meeresbewohner unglaublich kräftig. Bourne spürte, wie der Rochen das Wasser in weitem Umkreis in Bewegung versetzte, wie ein Felsbrocken, der in einen See geworfen wurde.
Bournes Lunge brannte, doch er war im Zuge seiner Treadstone-Ausbildung auch der Waterboarding-Folter unterzogen worden, sodass seine Lunge genauso gut trainiert war wie die eines Freitauchers.
Als hätte der Rochen die Absicht seines Passagiers gespürt, beschleunigte er und jagte hinter dem Taucher her. Als dieser nur noch wenige Meter voraus war, spürte er die Druckwelle durch den herannahenden Fisch und drehte sich um. Als er das Tier sah, verharrte er einen Moment lang wie im Schock. Bourne ließ den Rochen los, schnellte sich nach vorne und prallte gegen den Taucher.
Der Mann hatte sein Messer gezogen und schwang es verzweifelt gegen Bourne, während er sich der doppelten Bedrohung durch den Rochen und einen menschlichen Angreifer gegenübersah. Bourne riss dem Taucher das Mundstück heraus und steckte es sich selbst in den Mund. Im nächsten Augenblick ritzte ihm die gezackte Klinge eine lange Wunde in die Brust. Er packte die Tauchmaske des Mannes und riss sie ihm herunter. Der Taucher schlug wild um sich, und Bourne stieß ihm den Haken des Gaffs in den rechten Arm. In einer instinktiven Reaktion ließ der Mann das Messer los, um nach der Wunde am Arm zu greifen.
Der Widerstand des Tauchers war gebrochen. Bourne packte ihn am Hals und zog ihn in Richtung der Stelle, wo Mala im Boot bereitstand. Er tauchte etwas weiter entfernt auf, als er gedacht hatte, doch Mala hatte das Boot klugerweise zurück ins Trümmerfeld manövriert, um sich verborgen zu halten. Mit einigen kräftigen Armzügen war er beim Boot. Er spuckte das Mundstück aus und sog die würzige Nachtluft ein.
Mala legte die Pistole weg und kniete sich hin, um den Taucher festzuhalten, während Bourne seine Druckluftflasche löste und ins Boot warf.
Mala zog den Mann an Bord, und Bourne hievte sich ebenfalls ins Boot. Jetzt erst sah sie seine Brustwunde, doch er bedeutete ihr mit einer Geste, sich um den Gefangenen zu kümmern.
»Ist nur ein Kratzer.« Er drückte dem Taucher eine Hand auf den Mund und zog ihm den Haken aus dem Arm. Der Schrei des Mannes wurde zu einem tiefen Grunzen gedämpft.
Mala hatte bereits begonnen, die Ausrüstung zu begutachten. »Wahrscheinlich von einer amerikanischen Behörde«, meinte sie. »Ein CIA-Kommando, würde ich schätzen.«
»Nicht unbedingt.« Bourne zog ihm die Neoprenhaube herunter und musterte das ihm unbekannte Gesicht. Der Mann verlor immer wieder für Sekunden das Bewusstsein. Bourne schlug ihm hart ins Gesicht, dann noch einmal, bis der Taucher die Augen öffnete.
Der Mann starrte zu ihm hoch. »Wo zum Teufel kommen Sie her?«, fragte er. Im selben Augenblick zog er eine schmale Klinge aus dem Ärmel seines Neoprenanzugs und stieß sie nach Bournes Kehle.
Bourne konnte nicht mehr ausweichen, doch Mala streckte blitzschnell den Arm aus. Das Narbengewebe auf ihrer Haut war so hart, dass sie den Stoß mit dem Messer, der aufgrund der Position des Tauchers zwar schnell, aber nicht allzu kräftig ausfiel, blockieren konnte. Die Klinge prallte von ihrem Arm ab. Bourne rammte dem Mann die Faust ins Gesicht und brach ihm die Nase. Blut strömte aus der Wunde, und Bourne riss ihm das Messer aus der Hand und warf es beiseite.