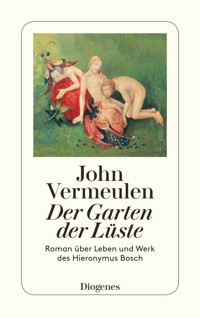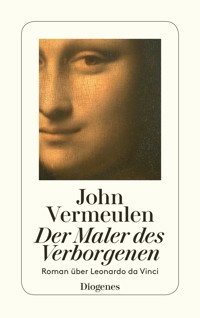11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein Knabe ist heimlicher Zuschauer bei einer grausigen Szene: Menschen werden von den Schergen der spanischen Inquisition an den Galgen geknüpft, eine Meute Schaulustiger feiert die Hinrichtung. Der Junge hält den Eindruck in einer Skizze fest, und Jahre später wird ein weltberühmtes Bild daraus hervorgehen: ›Die Elster auf dem Galgen‹. Ein fesselnder Roman über das Leben und die Zeit des Pieter Bruegel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 755
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
John Vermeulen
Die Elsterauf dem Galgen
Ein Roman aus der ZeitPeter Breugels
Aus dem Niederländischen vonSusanne George
Titel der 1992 bei
Uitgeverij Het Spectrum B.V., Utrecht,
erschienenen Originalausgabe:
›De Ekster op de galg‹
Copyright © 1992 by John Vermeulen
Die vorliegende Übersetzung erschien
erstmals 1994 im Twenne Verlag, Berlin,
und wurde vom Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap unterstützt
Umschlagillustration:
Pieter Bruegel d.Ä.,
›Die Elster auf dem Galgen‹, 1568 (Ausschnitt)
All rights reserved
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2014
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 22830 4 (11. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60613 3
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
Die Natur hat wunderbar ihren Mann gefunden und getroffen,
um wieder von ihm herrlich getroffen zu werden,
als sie in Brabant, in einem obskuren Dorf unter den Bauern,
um Bauern mit dem Pinsel wiederzugeben,
auswählte und zur Malerkunst erweckte unseren
dauernden niederländischen Ruhm, den sehr
geistreichen und humoristischen Pieter Bruegel…
Carel van Mander, 1604
Mein Dank gilt:
Martine Eeckhaut, Kunstkennerin, für die Beratung.
Willem Manteleers, Kunstkenner, aus demselben Grund.
Roberte Van Pract, die mich stets unterstützte.
Johan Vincent, Centrum voor Audio-Visuele Middelen (C.I.A.M.), für seine Ideen.
Paul Arren, Altertumswissenschaftler, für die Richtlinien.
Paul Cammermans, sah alles bereits in Filmbildern und dachte sich die Figur Jobbe, den Fischer, aus.
Het Prentencabinet van Antwerpen und dem Museum
Het Steen, für die bereitwillig gegebenen Auskünfte.
Meiner Frau, Hilde, für ihre Geduld.
[7] 1
Behutsam schob der Junge das Schilfrohr zur Seite, das ihm die Sicht versperrte. Er hatte einige Zeit gebraucht, um durch den Sumpf kriechend so nah an das Nest der Wildenten heranzukommen. Aber nun, als sich der brütende Vogel schwankend erhob und mit unruhigen, ruckartigen Kopfbewegungen um sich blickte, konnte er sogar die Eier sehen.
Der Junge rührte sich nicht, er hielt selbst den Atem an, bis sich die Ente beruhigte und wieder niederließ, wobei sie den Bauch hin und her schob, um die richtige Position auf den wenigen Eiern zu finden, die nicht den Raubzügen von Ratten und gefräßigen Möwen zum Opfer gefallen waren.
Der Junge im Röhricht wartete, bis eine Brise die Schwertlilien um ihn herum zum Rascheln brachte. Erst dann nahm er vorsichtig das schöne blaue Papier, das sein Vater für ihn gekauft hatte, und einen feinen Bleigriffel. In schnellen Strichen zeichnete er das Entennest mit dem wachsamen Weibchen.
Es war Flut, und das steigende Wasser der Schelde strömte blubbernd und rauschend durch die gewundenen Gräben in den Sumpf, wo sich der Junge versteckt hielt. Er achtete jedoch weder auf die Feuchtigkeit, die durch Hose und Wams bis auf seine Haut drang, noch auf die stechende Frühlingssonne, die in seinem Nacken brannte, und die Insekten, die unablässig um seine Ohren schwirrten.
Seine Aufmerksamkeit wurde erst gestört, als die Ente auf dem Nest plötzlich erneut unruhig wurde. Das Tier streckte den Hals, schlug ein paarmal heftig mit den Flügeln, als wolle es ihre Tauglichkeit prüfen, und stieg dann mit kraftvollen Flügelschlägen auf. Entrüstet quakend flog die Ente geschwind zur Mitte des Flusses davon.
Erst jetzt hörte auch der Junge, was die Stille gestört hatte. Das Geräusch kam von jenseits des entfernt gelegenen Deiches: Hufschläge, Waffengeklirr, der Schrei eines Menschen, unverständliche Rufe in bellendem Ton.
Er fühlte, wie sein Herz vor Furcht und Neugier klopfte. Eilig [8] stopfte er die Zeichensachen in die Tasche an seinem Gürtel, lief gebückt durch den sumpfigen Morast und kletterte auf allen vieren den Deich hoch. Als er flach auf dem Bauch in jungem, duftendem Unkraut lag, spähte er durch die noch kahlen Brombeersträucher über den sandigen Weg.
Von der Stadt her kamen etwa zwanzig spanische Reiter im Schritt angeritten. Zwischen den Pferden zogen sie an langen Stricken drei Bürger mit sich her, zwei Männer und eine Frau. Die Gefangenen konnten das Tempo der Pferde kaum halten, so daß sie immer wieder stolperten und taumelten. Wer hinfiel, wurde einfach an dem Strick über den Boden geschleift.
Etwa fünfzig Meter hinter den spanischen Soldaten folgte eine Schar von Männern, Frauen und Kindern. Es waren zumeist Bauern, die Parolen skandierten, die offenkundig nicht gegen die Soldaten, sondern gegen ihre Gefangenen gerichtet waren. Die Kinder rannten aufgeregt zwischen den Erwachsenen herum, rauften und schubsten sich und tanzten zwischendurch mitten auf dem staubigen Weg im Kreis herum, bis sie von den Erwachsenen zur Seite gestoßen wurden.
Der Junge wartete, bis alle vorbeigegangen waren, stand dann auf und folgte dem Zug.
Die Gefangenen sind wahrscheinlich Ketzer, dachte er. Sein älterer Bruder Dinus hatte ihm erzählt, daß jeder, der es wagte, öffentlich Kritik an der spanischen Regierung oder der katholischen Kirche zu äußern, sofort als Spion oder Ketzer gebrandmarkt wurde und in den Kerker, an den Galgen oder auf den Scheiterhaufen kam. Es gab sogar Bürger, die das richtig fanden.
Sein Vater hatte ihm wiederholt ans Herz gelegt, sich von Tumulten und Hinrichtungen fernzuhalten, aber die Neugier des Jungen war zu groß, so daß er der Menschenmenge folgte. Kurz darauf verließen die Reiter den Weg und ritten zwischen Bäumen und Sträuchern einen kleinen Abhang hinunter zu einer tiefer gelegenen Lichtung in einem Wäldchen. Noch einen Bogenschuß weiter lag ein großer Bauernhof mit einem Wasserrad, und in der Ferne zeichneten sich die düsteren Umrisse zweier Burgen gegen den blauen Himmel ab.
In der Mitte der Lichtung ragten auf einem großen Sandsteinblock [9] ein Galgen und ein Holzkreuz empor, umgeben von einigen Gräbern. Die Stützbalken des Galgens waren von Wind und Wetter so verzogen, als würden sie dort schon seit langem stehen. Oben auf dem Galgen hockten zwei Elstern. Als die Soldaten näher kamen, flog einer der Vögel auf und setzte sich ein Stück weiter auf einen großen Stein. Die zweite Elster blieb, wo sie war, und schaute dem Treiben unter ihr interessiert zu.
Die Soldaten stiegen ab. Als einer von ihnen drei Stricke über den Galgen warf, flog die Elster kurz krächzend hoch, ließ sich jedoch sofort wieder auf ihrem alten Platz nieder. Die meisten Bürger stellten sich in einem großen ungeordneten Kreis um die Soldaten. Andere johlten und tanzten und führten sich auf, als hätten sie zuviel getrunken. Einige kleinere Gruppen standen abseits und schauten schweigend zu, manche von ihnen bekreuzigten sich.
Der Junge war auf einen Sandhügel geklettert, von dem aus er alles gut überblicken konnte. Er setzte sich hin, packte Zeichenheft und Griffel aus und begann zu skizzieren: die Bäume, die Burgen in der Ferne, die tanzenden Bauern, das Holzkreuz mit den verstreut liegenden Grabsteinen und den Galgen. Er zeichnete in schnellen, sicheren Zügen.
Ein Jubelgeschrei erhob sich, als die drei Gefangenen von den Soldaten unter den Galgen geschleppt wurden und man ihnen den Strick um den Hals knüpfte. Ein Mönch stieg ungelenk auf den Stein und schickte sich an, die Opfer zu segnen. Die Frau aber spuckte ihm mit solcher Verachtung ins Gesicht, daß der Mönch mit seinem Stab zum Schlag gegen sie ausholte. Die Soldaten hielten ihn zurück und führten ihn mit sanfter Gewalt vom Galgen weg.
Dann zogen drei Soldaten mit ihren Pferden die Stricke an. Die Gefangenen wurden langsam hochgezogen, um ihnen das Genick nicht zu brechen, so daß sie den langsamen und qualvollen Erstickungstod erleiden mußten.
Ergriffen von der Tragödie des Augenblicks, hörte das Kind zu zeichnen auf und starrte auf die drei Unseligen, die verkrampft und zappelnd am Strick hingen, begleitet von dem Gejohle einiger Zuschauer. Ihm war, als würde eine kalte Hand seine Eingeweide zusammenpressen, die kalte Hand des Todes, die ihn auf dem Weg zu ihrem Werk dort unter dem Galgen streifte. Fast hätte er das [10] Zeichenheft fallenlassen, aber er konnte es gerade noch festhalten. In dem Moment flog die Elster, aufgeschreckt durch diese kleine Bewegung inmitten des ganzen Tumults, vom Galgen hoch und verschwand schimpfend zwischen den umstehenden Bäumen.
Der Junge rutschte von seinem erhöhten Platz hinunter und landete mit einem Plumps auf der ebenen Erde. Er war noch damit beschäftigt, seine Zeichensachen in die Tasche zu packen, als er von einigen johlenden Kindern seines Alters fortgezogen wurde, die mit ihm »Papier, Stein oder Schere« spielen wollten. Verärgert über die unsanfte Störung seiner Gemütsstimmung, riß er sich los. Sie ließen ihn stehen und rannten weiter. Nur ein häßliches Mädchen mit roten Zöpfen drehte sich um und schnitt ihm eine Grimasse, bevor sie den anderen folgte.
Als der Junge dem Mädchen hinterherschaute, wanderte sein Blick wieder zu den Gehängten am Galgen, die nun regungslos an den Stricken baumelten. Ihre Gesichter waren zu grotesken Fratzen verzerrt, und die Zungen hingen ihnen weit aus dem Mund heraus. Die leblosen Augen der Frau waren genau auf ihn gerichtet. Ihr starrer Blick ließ den Jungen zurückweichen. Plötzlich fühlte er sich schuldig, weil er den Galgen gezeichnet hatte. Er war davon überzeugt, diese toten Augen sahen alle seine Sünden, er würde in die Hölle hinabgerissen, wenn er nicht schnell und weit genug flüchtete.
Als sich das Kind hastig umdrehte, stieß es gegen jemanden. Es erschrak beim Anblick des stämmigen Bauern, der es an den Schultern packte und auf Armeslänge von sich hielt.
»Ich wußte, daß ich dich hier finden würde«, sagte sein Vater in einem Ton, der nichts Gutes verhieß. »Habe ich dir nicht gesagt, daß du dich von solchen Aufführungen fernhalten sollst?«
»Es war Zufall«, versuchte sich der Junge zu verteidigen. »Sie sind vorbeigekommen, und ich bin ein Stück mitgelaufen und…«
Er verstummte, als er merkte, daß sein Vater nicht zuhörte. Er blickte über ihn hinweg zu den spanischen Soldaten, die gerade die Leichen von dem Galgen herunterließen. »Diese verdammten Spanier!« murmelte er undeutlich. »Die Erde sollte sich auftun unter den Stinkfüßen dieser dreckigen Teufelsboten des Papstes, damit sie geradewegs in ihre eigene Hölle stürzen!«
[11] Der Junge zuckte zusammen und schaute sich ängstlich um, ob vielleicht jemand den Fluch gehört hatte. Sein Blick begegnete dem eines Mönchs, der ein paar Meter von ihnen entfernt stand. Der Mönch hatte mit verschränkten Armen unbewegt der Hinrichtung zugeschaut, doch nun schien er sich nur noch für das Kind und dessen Vater zu interessieren.
Der Junge fühlte einen schmerzhaften Krampf im Leib, als der Mönch sich ihnen langsam näherte, den Blick starr auf ihn geheftet.
Jetzt bemerkte auch sein Vater den Geistlichen. Er schob das Kind mit einer schützenden Bewegung hinter seinen Rücken und schaute den Mönch unfreundlich an. In einem Ton, der fast unverschämt klang, fragte er: »Was wollt Ihr von mir?«
»Von dir vorläufig nichts«, antwortete der Mönch, die Augen noch immer auf das verängstigte Kind gerichtet. »Ich möchte nur mal sehen, was dieser junge Mann da gerade so eifrig hingekritzelt hat.« Gebieterisch streckte er die Hand aus. »Zeig her!«
»Mein Sohn zeichnet alles mögliche. Er zeichnet die ganze Zeit, eigentlich tut er kaum etwas anderes.«
»Interessant«, sagte der Mönch. »Vielleicht ist mit deinem Sohn ein großer Künstler geboren. Vielleicht aber… – er wandte seinen Blick von dem Kind ab, um den Bauern forschend anzuschauen – »zeichnet er auch Dinge, die für Kirche und Obrigkeit eine Beleidigung sind, vielleicht befiehlt ihm auch jemand, solche Zeichnungen zu machen?«
Er hat es gehört! dachte der Junge, zitternd vor Angst. Er hat alles gehört, und jetzt werden sie uns auch aufhängen, oder verbrennen, wie sie es oft mit Ketzern machen!
Er schreckte hoch, als der Mönch befahl: »Gib diese Blätter her, zeig mir, was du treibst, Kunst, Kinderspiel oder Spionage.«
»Mach nur, Junge«, sagte sein Vater ermutigend. »Zeig sie ruhig, du hast nichts zu verbergen, du hast keine bösen Absichten.«
Mit unsicherer Hand nestelte der Junge an seiner Tasche. Als er sie vor lauter Aufregung nicht sofort aufbekam, sagte der Mönch ungeduldig: »Los, Junge, mach schon, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit!« Er riß dem Kind das Zeichenheft aus der Hand und schlug ein [12] Blatt nach dem anderen um, wobei er jede Skizze mit einer Falte zwischen seinen buschigen Augenbrauen kurz studierte. »Kühe«, sagte er, »ein Bauer beim Säen, die Schelde bei Ebbe, die Schelde bei Flut, ein Fischer im Röhricht, ein Fischer, der sein Netz einholt, ein Fischer, der sein Boot vertäut…«
»Das ist Jobbe«, sagte der Junge. »Jobbe ist mein Freund, manchmal darf ich mitfahren…«
»Dein Sohn zeichnet sehr gut«, sagte der Mönch zu dem Bauern. »Er besitzt eine Gabe Gottes. Wie kommt es, daß ich in seinen Werken für dieses Geschenk des Allmächtigen kein bißchen Dankbarkeit erkennen kann?«
Er blätterte mit zusammengezogenen Augenbrauen weiter.
»Er ist doch noch ein Kind«, sagte der Bauer verteidigend. »Er weiß noch nicht viel von…«
»Aha, was haben wir denn da?« Der Mönch hielt das Blatt ein Stück von sich weg, als wolle er es sich besonders genau anschauen. »Der Galgen!« sagte er triumphierend. »Und wo sind die Soldaten und die Gehängten?«
»Mein Sohn zeichnet meistens Landschaften«, sagte der Bauer. »Die Natur und so, Menschen findet er nicht so wichtig. Wäre es nicht umgekehrt, wenn er schlechte Absichten hätte?«
»Menschen sind unwichtig«, gab der Mönch zu. »Aber ihre Seelen nicht. Ist der Körper nicht der Tempel der Seele?«
»Ich bitte um Vergebung«, sagte der Bauer, »aber mir fehlt es an Weisheit, um hierüber ein Gespräch führen zu können.«
»Hm…« Der Mönch spitzte die Lippen, betrachtete ein letztes Mal aufmerksam die Zeichnung und gab dann dem Jungen das ganze Heft mit einer verächtlichen Geste zurück. Zu seinem Vater sagte er: »Du würdest gut daran tun, die Gabe deines Sohnes in die richtige Bahn lenken zu lassen. Die Kirche könnte für eine gute Ausbildung sorgen.«
»Das kann ich nicht bezahlen, ich bin nur ein armer Bauer.«
»Ein armer Bauer?« Der Mönch gab ein herablassendes Lachen von sich. »Du, der du vom Reichtum der Äcker Gottes lebst?«
»Wir wohnen noch nicht lange hier, wir kommen aus der Gegend von Breda. Ich habe meinen ganzen Besitz verpfänden müssen, um ein Haus und Grund pachten zu können. Ich bin schon froh, daß ich [13] mit Gottes Gnade die hungrigen Mäuler meiner Familie stopfen kann.«
»Aber das Geld, um für deinen Sohn teures Zeichenpapier zu kaufen, hast du?«
»Für ein Stück Speck bekommen«, sagte der Bauer mürrisch.
»Warum habt ihr denn die Gegend von Breda überhaupt verlassen?«
»Ich hatte gehört, daß das Leben hier besser sei.«
»Ja ja, die Verlockungen von Antwerpen haben schon viele Sünder angelockt.«
»Ich besitze weder Pfunde noch Dukaten, um den Verlockungen von Antwerpen nachzugeben, selbst wenn ich das wollte.«
Der Klerus und die spanischen Herrscher hatten diese Dukaten sehr wohl, doch die Anspielung schien dem Mönch zu entgehen. »Ich rate dir, nach Hause zu gehen und dich ruhig zu verhalten«, sagte er. »Hier gibt es jetzt nichts mehr zu sehen, auf jeden Fall nichts, das für einen phantasievollen Kopf wie den deines Sohnes gut ist.« Er blickte den Jungen unverwandt an. »Wie heißt du, Bursche?«
»Pieter Bruegel«, antwortete der Junge, der unter dem stechenden Blick des Mönchs wieder Angst bekam.
»Pieter Bruegel, hm…« Der Mönch schaute den Jungen kurz nachdenklich an und hob dann die Schultern, als würde er die Sache als erledigt betrachten. »Ich werde mir diesen Namen merken für den Fall, daß ich noch mal etwas von dir hören sollte, Gutes oder Schlechtes…« Er wandte sich um und ging mit verschränkten Armen weg. Kurz darauf war er zwischen den Leuten verschwunden, die noch immer aufgeregt bei dem Galgen und dem Kreuz standen, wo man die Gehängten nun verscharrte.
»Ich weiß nicht, wer die größeren Halunken sind, sie oder diese spanischen Pestbeulen«, sagte Pieters Vater. »Aber in einem Punkt hatte dieser scheinheilige Blutsauger auf jeden Fall recht: Das ist kein geeigneter Ort für Kinder, das ist für niemanden ein geeigneter Ort. Laß uns zu Mutter gehen.«
Nun, wo die Leichen fortgeschafft waren und der Mönch sich davongemacht hatte, war auch Pieters Angst so gut wie verschwunden. Er hörte kaum zu, was sein Vater sagte, sondern schaute auf die Zeichnung mit dem Galgen, die er in den Händen hielt. Etwas fehlte, [14] fand er, etwas Wichtiges. Dann fiel ihm ein, was ihn zunächst mehr fasziniert hatte als die zum Tode verurteilten Opfer. Er hatte vergessen, die Elster auf dem Galgen zu zeichnen. Aber das hatte Zeit, bis sie zu Hause waren und er die Zeichnung fertigmachen konnte. Er hatte das Bild in allen Einzelheiten im Kopf.
Und sollte es sein Leben lang nicht vergessen.
[15] 2
Die große Scheune, die zu diesem Anlaß als Festsaal genutzt wurde, bebte vor lautem Gerede und Gelächter, gegen das die beiden Dudelsackspieler mit ihrer fröhlichen Musik kaum ankamen. Die Feiernden saßen an rohen Holztischen auf langen Bänken, und das Antwerpener Bier floß reichlich aus den Tonkrügen.
Mitten unter den Gästen, die von nah und fern herbeigekommen waren, saßen Dinus Bruegel und seine frischgebackene Ehefrau Clementine. Sie war die einzige Tochter van ’t Ebbes, eines Bauern, der südlich der Stadt wohnte. Mit ihren zwanzig Jahren war Clementine bereits zweimal so umfangreich wie ihre Mutter, eine verlebte Vogelscheuche, die neben ihr saß und Reisbrei in sich hineinschlang. Außerdem erinnerte ihr Augenaufschlag an einen Karpfen auf dem Trockenen. Aber als einziges Kind eines wohlhabenden Bauern war sie eine gute Partie. Dinus maß materiellen Dingen viel größere Bedeutung bei als sein Bruder Pieter. Und weil er von harter Arbeit wenig hielt, suchte er andere Möglichkeiten, um seinen Status zu verbessern. Diese Heirat betrachtete er als einen Schritt in die richtige Richtung. Clementine mochte zwar nicht sehr schön sein, dafür war sie um so frommer und ergebener. Außerdem lief sie nicht mit lauter Grillen im Kopf herum wie diese närrischen Weiber aus der Stadt, mit denen sich Pieter, der vor kurzem zwanzig Jahre alt geworden war, gern vergnügte.
Pieter saß neben dem großen Scheunentor an einer Tischecke, umringt von einer Horde Bauernsöhne seines Alters. Anfangs hatte er etwas trübsinnig dabeigesessen, als könnte er sich über die Hochzeit seines Bruders nicht so recht freuen. Er hatte jedoch die Bierkrüge nicht unberührt an sich vorüberziehen lassen und war allmählich munterer geworden. In der letzten halben Stunde hatte er kaum geschwiegen, auch wenn er eigentlich nicht sehr gesprächig war. Abwechselnd erzählte er Gruselgeschichten und Witze, vor allem um Eindruck auf Greta zu machen, ein sechzehnjähriges Mädchen, deren Vater die Scheune verlassen hatte, um seine Notdurft zu verrichten, [16] und an der hölzernen Stützwand des Misthaufens sitzend eingeschlafen war. Pieter genoß ihre kurzen Aufschreie des Entsetzens, wenn er seine Gespenster aufziehen ließ, und ihre Lacher hinter vorgehaltener Hand bei seinen zuweilen recht zotigen Witzen.
»Ich habe noch ein Rätsel«, rief er seinen begeisterten Zuhörern zu. »Wißt ihr, was zwei Spanier auf einem Stuhl sind?« Erwartete die Antwort gar nicht ab. »Ein Stuhl voller Scheiße«, sagte er lachend. »Und was sind zwanzig Spanier auf einem Stuhl?« Erwartungsvoll blickte er in die Runde.
»Ein großer Haufen Scheiße?« fragte jemand vorsichtig.
Pieter schüttelte den Kopf. »Ein Haufen Idioten, die nicht wissen, wohin mit ihrem Arsch«, sagte er grinsend. »Und alle Spanier zusammen in der Schelde, was bedeutet das?« Es kam keine Antwort. »Die einzige Lösung der ganzen Misere!« rief er so laut, daß es bis ans andere Ende des Tisches zu hören war. Die meisten schlugen sich vor Vergnügen auf die Schenkel, nur einer blickte besorgt in Richtung des offenen Scheunentores, wo in den einfallenden Strahlen der tiefstehenden Sonne Staubkörner und Insekten tanzten.
Da erschien plötzlich in der Türöffnung die gekrümmte Gestalt einer alten Frau. Sie ging an einem knorrigen Stock und trug einen roten Schal um den Kopf, wie die Zigeuner, die im Osten vor den Stadtmauern ihr Zeltlager aufgeschlagen hatten.
Eine ganze Weile stand sie bewegungslos da und schaute über die Festgesellschaft, bis sie dem Blick von Pieter Bruegel begegnete. Er stockte mitten im Satz und sah erstaunt und beunruhigt zu der Frau, die nun, gestützt auf ihren Stock, in seine Richtung kam, als hätte er sie herangewinkt.
Sie sieht aus wie eine Hexe, dachte er, als sie vor ihm stehenblieb und ihn ernst anschaute, während die Gespräche um ihn herum verstummten. Aber Hexen wurden meist nicht so alt, denn sie entgingen selten dem Scheiterhaufen.
Endlich fragte die Frau: »Wünscht Ihr etwas über Eure Zukunft zu erfahren, junger Mann?«
Pieter blickte kurz um sich. »Warum ich?«
Der ernsthafte Gesichtsausdruck der Alten blieb unverändert. »Das Schicksal webt sein Netz um jeden Menschen«, sagte sie. »Ich kann diese Fäden fühlen…«
[17] »Ich habe kein Geld…« sagte Pieter zögernd.
»Ein bißchen Brot, mehr brauche ich nicht.« Sie hatte sehr helle Augen, die Pieter unverwandt anstarrten. »Darf ich Eure Hand haben, Meister?«
»Meister?« Pieter schaute ein wenig ratlos zu seinen Freunden, aber niemand lachte, so als wären sie alle in den Bann der alten Zigeunerin geraten. Unsicher hielt Pieter ihr seine rechte Handfläche hin.
Die Frau nahm seine Hand in ihre, doch ihr Blick ließ Pieter noch immer nicht los. Ohne hinzusehen, folgte sie mit dem Daumen sanft und leicht zitternd den Linien seiner Handfläche. Ruhig sagte sie: »Es ist außergewöhnlich viel Schönheit, aber auch Häßlichkeit in Euch, Herr. Erwartet sowohl tiefe Ekstase als auch große Schrecknisse. Eure Lebenslinie ist kurz, sehr kurz…« Ihr zitternder Daumen unterbrach kurz seine tastenden Bewegungen, und über ihr gegerbtes Gesicht huschte ein Zug von Mitleid. Kaum hörbar sagte sie: »Zu kurz…« Dann, indem sie sich wieder faßte, mit festerer Stimme: »Drei Frauen, drei Kinder und…« Sie stockte, schloß Pieters Hand und drückte sie kräftig. »Ein Schatten…« Sie schüttelte den Kopf, als würde sie ihren eigenen Gedankengang nicht verstehen. »Ein Schatten über Euch, aber auch in Euch…« Sie schwieg einen Moment. »…Nicht der Tod, der kündigt sich weniger hinterlistig an, nicht das Schicksal, sondern etwas Flüchtiges, etwas Vergängliches, ein stofflicher Körper…« Die Frau schloß die Augen, um sich besser konzentrieren zu können. »Er weigert sich, mir sein wahres Gesicht zu zeigen… Still!« ermahnte sie.
Pieter erschrak. Er fragte sich, wie sie mit geschlossenen Augen gewußt haben konnte, daß ihm eine neugierige Frage auf der Zunge lag.
Die Zigeunerin schaute Pieter wieder an. »Nicht alle Verborgenheiten des Lebens werden mir offenbart…« Sie öffnete seine Hand und schaute sich diesmal seine Handlinien an. »Das Netz Eures Schicksals wird durch eine große schöpferische Kraft erschüttert…« Langsam ließ sie den Blick über die Festgesellschaft schweifen, deren Lärm anschwoll und wieder verebbte. »Bald werdet Ihr dies alles verlassen…« Plötzlich hob sie den Kopf und ließ Pieters Hand los, als hätte sie sich vor etwas erschreckt, was nur sie hören konnte. [18] »Ich muß gehen!« Sie drehte sich um und verschwand, wie vom einfallenden Sonnenlicht verschluckt.
Jemand stieß Pieter an. »Gratuliere, Meister!« sagte er, die anderen lachten.
Pieter blickte ein wenig verstört vor sich hin, es dauerte eine Weile, bis er reagierte. Aber dann richtete er sich auf, als wolle er das seltsame Ereignis abschütteln. Er trank sein Bier aus und gab dem Knecht ein Zeichen, einen neuen Krug zu bringen. Als wäre nichts geschehen, sagte er: »Das ist ein schönes Hochzeitsfest, zumindest wenn einem der Anblick meiner neuen Schwägerin erspart bleibt. Diese Kuh glotzt so heilig, man könnte glatt denken, sie würde jeden Moment schweben.« Er prustete vor Lachen und nahm einen langen Zug aus seinem frischgefüllten Bierkrug. Dann holte er seine Zeichensachen heraus, die er in einer Gürteltasche immer mit sich trug. Schnell machte er eine Skizze von einer gen Himmel fahrenden Clementine. Bei näherem Hinsehen erkannte man, daß er ihr einen spanischen Küraß angepaßt hatte. Die Zeichnung hatte nur vage Ähnlichkeit, aber da jeder in Pieters Umgebung wußte, wer gemeint war, erntete er erneut lautes Lachen.
Plötzlich fiel Pieters Blick auf einen leeren Platz auf der Bank. Während er um sich schaute, fragte er: »Wo ist Greta?«
»Rausgegangen«, antwortete jemand. »Wahrscheinlich muß sie mal.«
Pieter warf die Zeichensachen auf den Tisch und stand auf. »Mal sehen, ob sie vielleicht Hilfe braucht«, rief er übermütig.
Gerade als er nach draußen schlüpfen wollte, hielt ihn sein Vater am Arm fest. Der Bauer schaute ihn eindringlich an, bevor er sagte: »Wenn ich du wäre, würde ich mich ein bißchen zurückhalten und nicht noch mehr Dinge sagen, die zu weit gehen.«
»Ach, wir machen doch nur Spaß.«
»Nimm dich vor Dinus in acht, Pieter, du weißt, wie er ist!«
»Dinus kann mich mal.«
»So spricht man nicht über seinen älteren Bruder!«
»Meinen Bruder soll der Teufel holen«, sagte Pieter. Sein Blick schweifte über den Hof auf der Suche nach Greta.
»Pieter!« rief der Bauer mehr erschrocken als böse. »Läßt dich das Bier so sprechen? Dann rate ich dir, mit dem Trinken aufzuhören!«
[19] »Ich habe schon aufgehört«, sagte Pieter. »Kann ich jetzt?« Er zeigte zum Hof.
Der Bauer ließ Pieters Arm los. »Denk daran, daß noch ein Teil des Heus vom Feld muß, bevor das Wetter umschlägt«, sagte er in mahnendem Ton. »Wir haben also morgen keine Zeit zum Ausschlafen.«
»Aber ich wollte zum Steen und mir die Indianer angucken!«
Auf der Antwerpener Reede lagen drei spanische Kriegsschiffe mit einer Horde Rothäute aus Amerika an Bord, die man als Sklaven für die spanischen Würdenträger mitgebracht hatte. Vorläufig waren sie noch die Attraktion für jedermann, vor allem für Kinder.
»Erst das Heu, die Indianer bleiben bestimmt noch eine Weile.«
»In Ordnung«, seufzte Pieter. Statt sich sinnlos mit seinem Vater zu streiten, würde er lieber morgen versuchen, sich heimlich davonzumachen. Sein Vater war ein ruhiger Mensch, aber wenn es darauf ankam, war er so unbeugsam, wie es einem echten Bauern anstand. Dinus hatte ständig Streit mit ihm, Pieter dagegen hängte lieber sein Mäntelchen nach dem Wind. Außerdem stritten sich die beiden fast immer über Politik oder Religion, und das interessierte Pieter nicht im geringsten.
Pieter fand Greta am Rand des Weizenfeldes, wo sie, ihre Röcke bis über die Knie hochgeschoben, im Gras saß und die Wärme der Sonne auf ihren Beinen genoß.
Zur Begrüßung fragte sie: »Wo bist du so lange geblieben?« Von ihrer Schüchternheit kurz zuvor in der Scheune war nichts mehr zu merken.
Pieter hockte sich neben sie. »Ich wußte nicht, daß du auf mich wartest.«
»Ich will, daß du mich zeichnest«, sagte Greta. »So…« Sie zog ihre Röcke noch etwas höher und gewährte Pieter einen Blick auf ihre schneeweißen Schenkel.
»Ich habe meine Zeichensachen drinnen liegenlassen«, sagte Pieter. Er warf einen unruhigen Blick hinter sich.
»Mein Vater wird vorerst nicht aufwachen. Und du mußt mich auch nicht jetzt sofort zeichnen. Wenn du mich einmal gut anschaust, kannst du es später aus dem Kopf machen. Willst du mich nicht einmal genau anschauen?« Sie lachte herausfordernd und ließ eine Reihe makelloser Zähne sehen.
[20] »Natürlich«, sagte Pieter schnell. »Ich weiß einen Ort, wo sie uns nicht stören werden.«
»Warum sollen wir uns denn verstecken? Ist es denn was Schlimmes, wenn man sich anschaut?«
»Oh!« sagte Pieter enttäuscht. »Ich dachte… Du hältst mich zum Narren!« sagte er, als sie über sein verdattertes Gesicht lachte.
Greta sprang auf. »Natürlich, du Dummkopf! Wo ist dieser Ort?«
»Mein Zimmer, da kommt keiner hin, solange drüben gefeiert wird.«
»Hast du wirklich ein Zimmer, ganz für dich allein?«
»Natürlich, wir haben ein großes Haus«, antwortete Pieter, der nicht sicher war, ob sie ihn nicht doch zum Narren hielt. Er hatte die ganze Zeit das Gefühl, daß sich Greta über ihn lustig machte. Vielleicht war ja der Hof ihres Vater zehnmal größer als ihrer, dachte er. Aber dann schweiften seine Gedanken wieder zu ihren weißen Schenkeln, so daß ihn Nebensächlichkeiten nicht mehr kümmerten.
»Was für Bilder!« sagte Greta, als sie unbemerkt seine Kammer im Bauernhaus erreicht hatten. Diesmal schien ihre Bewunderung aufrichtig zu sein. Mit unverhohlener Neugier schaute sie sich die vielen Skizzen und Zeichnungen an, die an der Wand hingen. »Gott, wie schön!« rief sie bei dem Bild einer Distel, die Pieter mit großer Detailgenauigkeit gezeichnet hatte.
»Das sind nur Kritzeleien«, sagte Pieter geschmeichelt. »Reine Zeitverschwendung, sagt Vater immer.«
»Kritzeleien? Du solltest damit auf den Markt gehen, ich wette, daß du Geld dafür kriegen würdest… Oh, wie düster! Wer zeichnet denn einen Galgen?«
»Der ist fünf Jahre alt«, sagte Pieter etwas unwillig. Er blickte über ihre Schulter auf die Skizze mit dem Galgen und einer kecken Elster darauf. Im Vordergrund stand ein Mönch, der mit bösem Blick in die Kammer starrte. Dieser Mönch mußte wieder weg, sah Pieter auf einmal. Sein Gesicht störte die Ausgewogenheit der Zeichnung. Pieter hielt die Ausgewogenheit der Komposition für besonders wichtig. Außerdem war der Mönch nicht wirklich von Bedeutung, sein Erscheinen hatte keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.
[21] »Ich war dabei«, sagte er. »Sie haben drei Leute gehängt, zwei Männer und eine Frau.« Er dachte an die Frau, deren toter Blick ihn wochenlang in seinen Alpträumen verfolgt hatte. »Das haben die Spanier getan, ich weiß nicht, warum. Vielleicht nur zum Spaß.« Er stellte sich hinter Greta und legte die Arme um sie. »Sollen wir über etwas anderes reden?« Seine Hände streichelten ihre Brüste durch den rauhen Stoff ihres Kleides.
Greta legte ihre Hände auf seine, ohne seine Bewegungen zu unterbrechen. »Wie wirst du mich zeichnen?« fragte sie.
»Das weiß ich noch nicht.« Sein Atem ging schneller. »Das kommt darauf an, welches Bild du in meiner Erinnerung zurücklassen wirst.«
»Willst du mehr von mir sehen?«
»Alles«, murmelte Pieter mit gepreßter Stimme in ihren Nacken. »Ich will alles von dir sehen…« Er griff unter ihren Röcken nach ihren weißen Schenkeln, die noch immer wie ein erregendes Bild auf seiner Netzhaut brannten.
»Bist du sicher, daß niemand kommen kann?«
»Es kommt niemand, selbst wenn du schreien würdest.« Pieters Berührungen wurden kühner.
Greta schnellte in die Höhe, als seine suchenden Finger ihr Ziel fanden. Mit einer Stimme, die auch nicht mehr fest klang, fragte sie: »Wieviele Mädchen hast du schon gehabt?«
»Keine einzige wie dich«, versicherte ihr Pieter. Er zog sie von der Wand weg in Richtung seines Bettes. »Und für wieviele Jungen hast du schon die Beine breit gemacht?«
»Was für eine unverschämte Frage!« rief Greta, ihren Unterleib an seiner Hand reibend. »So etwas fragt man eine Dame nicht!«
»Eine Dame nicht«, gab Pieter zu. Er drückte Greta rücklings aufs Bett und ließ sich auf sie fallen.
»Sie sagen, daß du ein nimmermüder Freier bist…« sagte Greta mit gepreßter Stimme.
Pieter unterbrach seine Fummelei. Überrascht fragte er: »Sie? Wer sind sie?«
»Es steht auf allen Plakaten in der Stadt.«
»Du machst dich lustig über mich, das wirst du bereuen, Weib!« Mit einem Ruck zog er ihre Röcke bis zur Taille hoch.
[22] »Ja!« sagte Greta heiser. »Tu es!« Sie zog die Beine an und schob den Unterleib herausfordernd hoch.
Im Rausch der Begierde dauerte es eine Weile, bis Pieter die Hufschläge und bellenden Stimmen auf dem Hof wahrnahm. Er erstarrte.
»Was ist los?« fragte Greta verstimmt.
»Soldaten, Spanier!« Pieter glitt rasch von ihr hinunter und lief zum Fenster. Vorsichtig, um nicht gesehen zu werden, blickte er hinaus. Sein Herz begann wieder zu klopfen, diesmal aber nicht vor Leidenschaft.
Ein spanischer Hauptmann und einige Soldaten stiegen vor der Scheune ab, wo das Hochzeitsfest in vollem Gang war. Zwei Männer blieben bei den Pferden zurück, die anderen marschierten mit ihren Musketen im Anschlag hinein. Die Festgesellschaft in der Scheune verstummte, es erschallten Befehle in einer Mischung aus halb verschlucktem Spanisch und Französisch.
Pieter ballte die Fäuste. »Diese verdammten Mistkerle! Was haben die hier in Gottes Namen zu suchen? Mit welchem Recht stören sie ein Hochzeitsfest?«
»Mit dem Recht der Stärkeren«, sagte Greta, die sich hinter ihn stellte und mit nach draußen spähte. »Laß uns lieber weitermachen. Wir können doch nichts daran ändern.«
»Weitermachen? Bist du verrückt geworden? Wer weiß, was da drinnen passiert!«
»Dann renn eben hin«, sagte Greta. »Spiel den Helden, laß dich in Ketten schlagen!« Als Pieter tatsächlich hinauslief, trat sie wütend und enttäuscht gegen das Bett.
Pieter schlich um das Bauernhaus und rannte zu der Seite der Scheune, wo ihn die zurückgebliebenen spanischen Soldaten nicht sehen konnten. Mitten in der Wand war in drei Meter Höhe eine Öffnung mit einem herausragenden Balken, an dem ein Seil hing, um Strohballen hochzuziehen.
Pieter packte das Seil und kletterte hoch. Vor Schreck war ihm der kalte Schweiß ausgebrochen, doch es war unerträglich, nicht zu wissen, was da drinnen passierte.
Er erreichte ohne Schwierigkeiten den Heuboden, der so kurz vor der Ernte bis auf etwas Gerümpel leer war. Vorsichtig legte er sich auf [23] den Bauch und schaute durch eine der breiten Ritzen im Holzboden nach unten.
Die Gäste waren in eine Ecke der Tenne zusammengetrieben worden, wo Soldaten sie mit ihren Waffen in Schach hielten. Manche waren so betrunken, daß sie nicht begriffen, was los war, und töricht kicherten.
Einige aus der Truppe hatten sich an einen Tisch gesetzt, wo sie sich an dem Bier und den Resten des Festmahls gütlich taten. Der Hauptmann saß auf Pieters Platz.
Pieter biß sich auf die Unterlippe, als er sah, daß der Offizier seine Zeichnungen vor sich auf dem Tisch ausgebreitet hatte, um sie eingehend zu betrachten. Er hielt eine nach der anderen ins Licht, als wäre er auf der Suche nach allen möglichen Geheimnissen.
Neben dem Hauptmann stand ein Mann, der sich ebenfalls die Zeichnungen ansah. Es dauerte einen Moment, bis Pieter erkannte, daß es sein eigener Bruder Dinus war. Dessen Braut stand zusammen mit ihren Eltern unter den zusammengetriebenen Gästen.
Der Offizier raffte die Zeichnungen zusammen und gab sie einem seiner Soldaten in Verwahrung. »Verrat und Gotteslästerung«, sagte er in gebrochenem Niederländisch mit stark rollendem R. »Ihr verstoßt nicht nur gegen die Verordnungen seiner Majestät, Kaiser Karls, sondern jetzt auch noch das!« Er wies mit einer verächtlichen Gebärde zu dem Soldaten mit den Zeichnungen.
»Entschuldigt, Herr«, sagte Dinus unterwürfig. »Wir haben nicht gewußt, daß bei einer Bauernhochzeit nicht mehr als zwanzig Gäste an der Festtafel sitzen dürfen.«
»Die Plakate haben überall gehangen, manche von euch können doch wohl ein paar Worte lesen, oder?«
»Wir kommen nicht so oft in die Stadt, Herr…«
»Man hat diese neue Bestimmung erlassen, damit ihr nicht all eure Vorräte bei einem Fest verschlingt und danach vor Hunger umkommt oder auf Raub ausgeht.«
»Das haben wir nicht gewußt, Herr«, sagte Dinus nochmals.
»Vielleicht sagst du die Wahrheit, vielleicht seid ihr wirklich so dumm, und vielleicht könnte ich euch eure Dummheit noch nachsehen. Aber das hier«, er zeigte erneut auf das Bündel Zeichnungen, »das ist unentschuldbar und fordert die höchste Strafe!«
[24] Als Pieter den Ton hörte, in dem der Offizier diese gewichtigen Worte aussprach, sträubten sich ihm die Nackenhaare.
»Ich habe meinen Bruder mehrmals darauf hingewiesen, daß sein respektloses Gekritzel zu weit geht, aber er hat nicht auf mich hören wollen.«
Der Hauptmann schaute skeptisch zu Dinus hoch. »Du behauptest, ein gottesfürchtiger Mann zu sein, der kirchlichen Obrigkeit von Rom und der spanischen Krone treu ergeben?«
»Ja, Herr, absolut!«
»Warum bist du dann nicht deiner Pflicht nachgekommen und hast deinen Bruder gemeldet?«
»Ich habe immer gehofft, ihn auf den rechten Weg bringen zu können, Herr.«
»So? Das ist dir aber offensichtlich nicht gelungen. Wo ist dieser Ketzer?«
Pieters Vater trat einen Schritt nach vorn, aber sofort versetzte ihm jemand mit dem Lauf einer Muskete einen harten Stoß gegen die Brust, so daß er nach hinten taumelte. In flehendem Ton sagte er: »Mein Sohn macht diese Zeichnungen nur zum Spaß, er hat nichts Böses im Sinn!«
Der Offizier lachte höhnisch. »Wäre dein Sohn zwanzig Monate statt zwanzig Jahre alt, würde ich dir vielleicht glauben.« Er stand auf und hängte sein Rapier um. »Wo steckt dieser Ketzer?«
Dinus leckte sich über die Lippen. »Er ist weggegangen mit einem Mädchen, Herr, wahrscheinlich liegt er irgendwo im Heu oder ist im Haus, in seiner Kammer.«
»Du dreckiger Lump!« schrie sein Vater.
»Er hat mir mit seiner üblen Stänkerei das Hochzeitsfest verdorben«, brüllte Dinus. »Mein Hochzeitsfest!«
»Silence!« schnauzte der Offizier, der sein Niederländisch zu vergessen schien, wenn er sich aufregte. »Et toi…«, er zeigte mit dem Finger auf Vater Bruegel, »du hast deinen Sohn für Galgen und Rad großgezogen!« Die Hände in die Hüften gestemmt, postierte er sich vor den zusammengetriebenen Gästen. »Zwanzig dürfen es sein, und ich zähle mehr als vierzig«, stellte er fest. »Soll ich diejenigen, die hier zuviel sind, gleich aufhängen lassen?«
[25] Ein paar Soldaten erhoben die Bierkrüge, riefen »olé!« und lachten. Wahrscheinlich hatten sie kein Wort verstanden, doch die verschreckten Gesichter der armen Bauern sprachen für sich.
»Aber zuerst das Wichtigste«, sagte der Hauptmann. Er schnauzte einige Worte auf spanisch, woraufhin die Hälfte der Soldaten alles aus den Händen fallen ließ und hinausrannte.
Als Pieter begriff, daß sie ihn suchten, geriet er in Panik. Zum Davonlaufen war es zu spät. Er konnte nur bleiben, wo er war, und hoffen, daß sie nicht auf den Heuboden kommen würden.
Auf Zehenspitzen schlich er in eine Ecke, wo genug Gerümpel stand, und versteckte sich dahinter. Wenn sie doch heraufkämen, aber nicht allzu gründlich nachschauten, hatte er vielleicht noch eine Chance.
Kurz darauf mußte er sehen und hören, wie Greta von zwei Soldaten vor den Hauptmann gezerrt wurde. Sie schrie entsetzlich, doch die Spanier lachten nur über sie.
»So«, sagte der Hauptmann, der wieder auf der Bank saß und sich ein Bier hatte einschenken lassen. Er lehnte entspannt mit dem Rücken am Tisch, den Krug in seiner rechten Hand. »Das ist also die besagte Hure.« Er musterte sie von Kopf bis Fuß. »Noch jung genug, um nicht allzu verlottert zu sein, hm…« Er setzte den Bierkrug an die Lippen und schlürfte ihn halb leer. Mit dem Handrücken über seinen Spitzbart fahrend, fragte er: »Wo ist dein Liebhaber?«
»Ich habe keinen Liebhaber«, antwortete Greta.
Pieter hielt den Atem an, als er ihre freche Stimme hörte.
Der Offizier blickte erstaunt. »Aha, er war noch nicht mal dein Liebhaber? Das bedeutet also, daß du ohne weiteres für jeden die Beine breit machst? Das wird meinen Männern aber sehr gefallen.« Er lachte geil. Doch plötzlich schmiß er den Krug auf den Tisch, sprang auf, packte das Kleid zwischen Gretas Brüsten und riß es mit einem Ruck bis zur Taille herunter. Er starrte kurz auf ihre entblößten Brüste, schaute dann wieder hoch und fragte in unerwartet sanftem Ton: »Wo ist der junge Bruegel?«
Greta unternahm einen zaghaften Versuch, ihre Arme aus dem Griff der beiden Soldaten, die sie festhielten, zu befreien. »Weg«, sagte sie mit einem Schluchzer. »Davongelaufen, ich weiß nicht, [26] wohin. Er ist weggerannt, als Ihr mit Euren Männern auf dem Hof erschienen seid, er hatte Angst…«
»Und das zu Recht«, meinte der Offizier. »Zumindest, wenn du nicht lügst.« Er packte ihr Kinn und zwang sie, ihm von nahem in die Augen zu schauen. »Sagst du die Wahrheit?«
»Gott möge mich bestrafen, wenn ich lüge.«
»Schweig, dreckige Bauernschlampe, mißbrauche nicht den Namen des Allmächtigen!« brüllte der Hauptmann.
Es ist wahr, was sie sagt! wollte Pieter schreien. Sie weiß doch nicht mehr, als daß ich weg bin! Aber er konnte sich nur auf die Fingerknöchel beißen und beten, daß sie Greta nicht seinetwegen umbringen würden.
»Wo könnte er denn hin sein?« wollte der Offizier wissen.
»Das weiß ich nicht, Herr, ich kannte ihn doch kaum.«
»Ach ja, er war ja nicht mal dein Liebhaber«, sagte der Offizier abschätzig. »Aber seine Familie wird doch sicher wissen, wo ihr Sohn in der Not hinkann, oder?« Er trank wieder aus seinem Krug, rülpste und sagte: »Gut, das Bier stimmt mich gnädig. Solltest du noch leben, wenn meine Männer mit dir fertig sind, bist du frei.« Er gab den Soldaten ein Zeichen, woraufhin diese erneut »olé!« brüllten und das sich sträubende Mädchen feixend hinauszerrten.
Kurz darauf hörte Pieter ihr verzweifeltes Schreien. Er wurde fast krank vor Kummer und Ohnmacht, weil ihm nichts anderes übrigblieb, als sich wie ein Angsthase zu verstecken.
Er sah, wie die Soldaten, die die Gäste bewachten, lüstern um sich blickten, aber der Offizier bedeutete ihnen, auf ihrem Posten zu bleiben. Die Spanier, die kurz zuvor von ihm hinausgeschickt worden waren, hatten dagegen wahrscheinlich ihre Suche unterbrochen, um sich an der Schändung des Mädchens zu beteiligen.
Pieter schlich zu der Öffnung in der Wand und schaute vorsichtig hinaus. Die Sonne stand tief, bald würde die Abenddämmerung anbrechen. Der Teil des Hofes, den er überblicken konnte, lag verlassen da, so daß er vielleicht unbemerkt auf die andere Seite gelangen könnte. In der einbrechenden Dunkelheit hatte er eine gute Chance, nicht in das Blickfeld der Patrouillen zu geraten.
Pieter ergriff das Seil, ließ sich rasch herabgleiten und rannte so leise wie möglich davon.
[27] Er fühlte sich wie ein Feigling, weil er alle im Stich ließ. Aber er wußte auch, daß es sinnlos gewesen wäre, den Helden zu spielen, das hätte ihn das Leben gekostet.
Besser ein lebender Feigling als ein toter Held. Mit diesem Gedanken versuchte er seine Flucht vor sich zu rechtfertigen, während er den Bauernhof und das Elend hinter sich ließ.
Es war eine Erkenntnis, die keinen Trost brachte.
[28] 3
Nur einmal mußte sich Pieter schnell zwischen den Sträuchern am Wegesrand vor einer Patrouille spanischer Reiter verstecken. Sie schienen niemand bestimmten zu suchen, wahrscheinlich hatten sie es nur eilig, um vor Einbruch der Dunkelheit innerhalb der Stadtmauern zu sein.
Als es Nacht geworden war, leuchteten die Sterne und die dünne Mondsichel des ersten Viertels am Himmel, so daß Pieter den Weg erkennen konnte. Er ging strammen Schrittes weiter, doch als er bei der Hütte von Jobbe, dem Fischer, ankam, brannte dort kein Licht mehr. Er wagte nicht anzuklopfen, weil er wußte, daß Jobbe immer früh schlafen ging, da er bei der ersten Morgenröte aus den Federn mußte.
Pieter stand ein Weilchen unentschlossen vor der Hütte. Die Stille war so intensiv, daß er das Blut in seinen Ohren rauschen hörte. Dann drehte er sich um und folgte dem Pfad hinunter zur Bucht, wo Jobbes Ruderboot lag.
Da Ebbe war, mußte Pieter ein Stück durch den Schlamm waten, bis er das auf dem Trockenen liegende Boot erreichte.
Im Boot lagen Taue und Netze, aus denen er sich so gut es ging ein Nachtlager machte. Es war nicht bequem, aber immerhin besser, als auf dem harten Boden liegen zu müssen. Außerdem würde ihn niemand dort suchen.
Die Nacht war kühl, und Pieter hatte nasse Füße bekommen, aber das kümmerte ihn wenig. Als er auf dem Rücken lag und zu den Sternen blickte, ließ er die vergangenen Ereignisse noch einmal vorbeiziehen. Seine Vorstellungskraft war so groß, daß er wieder die Angst und die Ohnmacht verspürte, die ihn auf dem Speicher der Scheune ergriffen hatten. Angst um sein eigenes Leben und um das seiner Eltern, und das alles nur wegen ein paar dummer Zeichnungen. Dann dachte er an die arme Greta, die so furchtbar hart bestraft worden war für einen Augenblick des Vergnügens.
Pieter fühlte eine Träne über seine Wange laufen. Mit einer [29] heftigen Bewegung wischte er sie weg. Morgen früh würde er Jobbe alles erzählen, beschloß er. Der Fischer war ein weiser Mann, er würde sicher Rat wissen.
Von Schlafen konnte kaum die Rede sein. Zwischendurch nickte Pieter ein, doch ein Geraschel im Schilf oder ein beginnender Alptraum ließen ihn jedesmal hochschrecken. Manchmal glaubte er zu sehen, wie sich am linken Ufer der Bucht etwas bewegte, Schatten von Menschen mit Helmen und Brustharnischen. Er drückte sich so flach wie möglich auf den Boden des Bootes und lauschte minutenlang angespannt. Aber alles blieb still, es waren nur die Dämonen seiner Phantasie gewesen, die sich angeschlichen hatten.
Erst als es hell geworden war und die ersten Strahlen der Sommersonne den Horizont abtasteten, schlief Pieter ein. Aber schon nach kurzer Zeit, so schien es ihm, wurde er durch das heftige Schwanken des Bootes geweckt. Sekundenlang sah Pieter wie erstarrt auf die dunkle Figur, die sich vor dem Boot erhob und auf ihn hinunterblickte. »Jobbe!« rief er. Er war so erleichtert, daß ihm fast schwindlig wurde.
»Du bist früh dran heute morgen«, sagte der Fischer. Er beugte sich über das Boot, um besser sehen zu können. Erstaunt fragte er: »Du hast doch hier nicht die Nacht verbracht?«
Pieter raffte sich auf. Sein Rücken schmerzte, er fühlte sich wie ein Hundertjähriger. »Die Spanier suchen mich«, sagte er mühsam. Seine Kehle war trocken und tat weh, und seine Zunge fühlte sich an, als sei sie zu groß für seinen Mund. Das kam sicher vom Bier, dachte er. Er hätte auf seinen Vater hören und sich beizeiten etwas mäßigen sollen.
Als hätte er Pieters Gedanken gelesen, reichte ihm Jobbe schweigend einen Krug. »Die Spanier?« fragte er. Seine Stimme war sanft und freundlich, was überhaupt nicht zu seinem verwitterten Gesicht und abgerissenen Äußeren paßte.
Pieter nahm einen kräftigen Schluck frisches Wasser aus dem Krug. »Die Spanier, ja. Sie sind gestern während des Festes gekommen. Es sei zuviel Volk da, sagten sie.«
»Wohl mehr als zwanzig Leute?«
Pieter nickte und nahm noch einen Schluck Wasser, bevor er den Krug zurückgab. »Das wußten wir nicht, ich meine, daß das verboten ist…«
»Was haben sie getan?«
[30] »Ich weiß es nicht, ich bin geflohen…« Pieter wandte den Blick ab, sich wieder schuldig fühlend. »Ich weiß nicht, was sie mit Vater und Mutter getan haben. Und es war ein Mädchen da, Greta, sie haben sie… Gott!« Pieter ließ sich auf die hintere Bank fallen und vergrub das Gesicht in den Händen. »Vielleicht sind sie alle tot…«
»So etwas passiert in dieser Zeit jeden Tag«, sagte Jobbe. »Nicht daß dies ein Trost wäre…« Er kletterte ins Boot und setzte sich auf die Ruderbank. »Ich muß rausfahren, bevor die Ebbe einsetzt. Kommst du mit?«
Pieter nickte, ohne aufzusehen.
Jobbe löste die Seile und packte die Ruder. In ruhigen Zügen ruderte er das schwere Boot aus der Bucht ins offene Wasser der Schelde. »Weiß jemand, daß du hier bist?«
»Ich habe niemanden gesehen.« Pieter blickte auf, seine Miene verfinsterte sich. »Und das alles nur wegen meiner Zeichnungen! Dieser Hauptmann hat gesagt, daß sie Gott und die Obrigkeit beleidigen würden.«
»Und? Tun sie das?« Der Fischer beantwortete seine Frage mit einem nachsichtigen Lächeln: »Natürlich tun sie das, wir kennen doch unseren Pieter.«
»Ich glaube, Dinus hat sie dem Hauptmann absichtlich gezeigt.«
»Dein Bruder?«
»Dinus verbündet sich mit jedem, der ihm Gewinn bringen kann. Er ist ein Judas, der seine eigene Familie verrät, nicht für Silberlinge, sondern für Dukaten.«
»Du urteilst hart über deinen eigenen Bruder«, sagte der Fischer sanft. Er ließ das Boot mit der Flut treiben, wobei er nur manchmal mit einem Ruder den Kurs korrigierte. Die Schelde strömte ruhig landeinwärts, nirgendwo kräuselte der Wind die glatte Oberfläche. Zwischen dem Schilf und den Sträuchern am Ufer hingen Nebelschleier. »Ich habe dich schon ein paarmal gewarnt, daß du mit dem Feuer spielst, wenn du solche Spottbilder machst. Spanien und die Kirche haben überall ihre Augen und Ohren.«
»Hast du mir nicht noch letztens erzählt, daß die Kirche an Macht verlieren würde?«
»In welche Richtung man auch spuckt, es ist immer gegen den Wind«, sagte Jobbe nachdenklich. »Der Glaube wird schwächer, nicht [31] die kirchliche Obrigkeit, die immer strenger auftritt, um ihre Schäfchen unter Kontrolle zu haben. Und es wird sicher nicht besser werden, wenn demnächst Johannes Calvin und seine Anhänger aus dem Süden kommen und uns die Bibel um die Ohren schlagen.«
»Calvin?«
»Er vertritt die Meinung, daß wir streng nach der Bibel leben müssen und daß es der Kirche nicht zusteht, die Worte der Bibel nach eigenem Gutdünken auszulegen. Außerdem meint er, daß es keinen Sinn hat, Buße zu tun und für sein Seelenheil zu beten. Er sagt, daß Gott keine Liste führt, in der er aufschreibt, wie es um die guten Werke jedes Gläubigen steht. Ob jemand in den Himmel kommt oder nicht, würde nur vom guten Willen Gottes abhängen. Das unterscheidet sich alles nicht so sehr von dem, was Bruder Luther auch schon behauptet hat, und eine Menge Leute haben dafür ein offenes Ohr. Papst Paul hat bereits Angst bekommen, daß es die Katholiken nicht mehr für notwendig erachten, einen Teil ihres Besitzes in die Kirche zu tragen. Deshalb hat er letztes Jahr mit der Unterstützung Kaiser Karls in Twente ein Konzil einberufen.« Als Jobbe Pieters fragendes Gesicht sah, erklärte er: »Ein Konzil ist eine Versammlung von hohen kirchlichen Amtsträgern, auf der sie ihre Strategie besprechen, wie sie die Welt unter ihrer Fuchtel haben können, und Twente liegt in Deutschland.« Er grinste spöttisch. »Wenn du mich fragst, ist seitdem die Verwirrung nur noch größer geworden. So simpel es auch ist, es gibt immer mehr zu kaufen, als gebraucht wird.«
»Woher weißt du das alles?«
Jobbe zuckte mit den Schultern. »Ich liefere Fisch an Leute, die reisen und studiert haben, ich höre ihren Geschichten zu…« Jobbe zog das Ruder ins Boot und ließ an einem Seil einen Stein über den Vordersteven hinab, um das Boot zu verankern. Wenn Pieter dabei war, überließ Jobbe diese Arbeit eigentlich immer ihm, doch nun zeigte Pieter keinerlei Interesse für das, was um ihn herum geschah.
»Und ich kann lesen«, fuhr Jobbe fort. »Plantin hat es mir beigebracht, manchmal gibt er mir auch ein Buch. Viele Leute geben mir lieber irgendwelche Dinge als Geld, sogar reiche Leute.« Er grinste kurz. »Ich glaube, daß diese ganze religiöse Verwirrung nur dazu dient, die Aufmerksamkeit der Leute von den wirklichen Problemen [32] abzulenken. Das wachsende Aufbegehren gegen die spanische Obrigkeit, Terror, Ausbeutung…« Jobbe nahm das zusammengerollte Treibnetz, auf dem Pieter geschlafen hatte, und hängte es über die Steuerbordseite. Mit diesem Netz fing er Lachs, den er wohlhabenden Städtern verkaufte. Diese gaben den billigen Fisch ihrem Hauspersonal.
»Ich verstehe nicht, weshalb uns die Spanier ständig schikanieren«, sagte Pieter. »Was haben wir ihnen denn getan?«
»Es liegt in der Natur der Dinge, daß die großen Fische die kleinen jagen und sie schließlich fressen… bis ein noch größerer Fisch kommt, von dem sie dann verschlungen werden.«
»Wenn also die Spanier jemals weggehen sollten, kommen noch schlimmere Tyrannen?«
»Ich weiß nur, daß sie nicht ewig bleiben werden. Denn in den Niederlanden sind die fremden Herrscher immer wieder von den Unterdrückten selbst oder noch stärkeren Besatzern vertrieben worden.«
»Kein sehr tröstlicher Gedanke!«
Jobbe zuckte wieder mit den Schultern. »Trost findet man in jeder Form von Sicherheit, die nicht von Menschenhand zerstört werden kann: in den Gezeiten der Schelde, im Aufgehen und Untergehen der Sonne, in den vier Jahreszeiten, im Tod…«
»Jobbe…« Pieter schaute nachdenklich auf die gebeugte Gestalt des Fischers, der das Ende des Treibnetzes an einem kleinen Poller auf dem Dollbord befestigte. »Glaubst du eigentlich an Gott?«
Der Fischer schien seine Worte kurz zu bedenken, bevor er antwortete: »Ohne diesen Glauben gibt es keine Antwort auf das Warum der Dinge, unser Dasein wäre vollkommen sinnlos.«
»Du antwortest nicht auf meine Frage«, drängte Pieter.
»Ich will an Gott glauben«, sagte Jobbe ungehalten. »Auch wenn es mir durch diejenigen schwer gemacht wird, die behaupten, daß sie Seinen Willen verkünden und ausführen. Was für eine Anmaßung!« Er schüttelte den Kopf.
»Du sprichst wie ein Ketzer!«
»Man kann kein Ketzer sein, wenn man an die Existenz Gottes glaubt, Pieter. Ebensowenig wie man Gott dienen kann, indem man Menschen auf dem Scheiterhaufen tötet.« Jobbe war fertig mit dem [33] Netz. Erschöpft setzte er sich auf die Ruderbank. Pieter fiel plötzlich auf, daß der Fischer alt wurde.
Die Ebbe setzte ein, hier und dort zeichneten sich bereits auf dem glatten Wasser Strömungen ab. In der Nähe stieg ein Fischreiher aus dem Schilf auf und flog mit majestätischen Flügelschlägen ans andere Ufer.
»Irgendwann will ich auch auf Reisen gehen«, sagte Pieter. »Ich will andere Landschaften sehen, andere Luft einatmen…«
»Reisen kostet Geld, und du kannst unterwegs nicht von Luft leben.«
»Vielleicht kann ich Zeichnungen machen und verkaufen.« Pieter mußte ungewollt an Greta denken, doch er verdrängte schnell die Erinnerung. »So wie du Fisch verkaufst.«
»Eine Zeichnung kann man nicht essen… Aber vielleicht hast du recht. Jetzt, wo die Reichen immer reicher werden, haben sie vielleicht wirklich ein paar Dukaten über für solche frivolen Dinge wie deine Zeichnungen.« Jobbe veränderte seine Haltung, wobei er kurz ein schmerzverzerrtes Gesicht zog. »Ich habe schon mal daran gedacht, dich Plantin vorzustellen. Er beschäftigt mehrere Zeichner, möglicherweise hat er ja Arbeit für dich.«
»Oh, das wäre schön!« sagte Pieter. Sein Gesicht hellte sich kurz auf, aber dann dachte er an die Spanier, und seine Begeisterung schwand. »Sie suchen mich«, sagte er niedergeschlagen. »Ich kann mich in der Stadt nicht blicken lassen.«
»In ein paar Wochen haben sie dein Gesicht schon vergessen. Sie müssen so viele Menschen verfolgen, daß sie unmöglich alles behalten können.«
»Ich wünschte, ich könnte das glauben«, sagte Pieter mutlos.
Er starrte über das ruhige Wasser, auf dem in der Ferne die ersten dunklen Wellen einer Brise erschienen. So still und friedlich war mein Leben gestern morgen noch, dachte er…
Ohne aufzublicken, sagte Jobbe: »Du kannst vorläufig bei mir bleiben. Schlafen kannst du auf dem Boden, außerdem gibt es immer genug Fisch zum Essen. Oder kannst du vielleicht irgendwo anders hin?«
»Ich kann nirgendwo hin. Alle Wege führen zum Galgen. Aber bringst du dich nicht in Gefahr, wenn du mich aufnimmst?«
[34] »Ich kann höchstens ein paar Jahre früher die Antwort auf die wichtigste Frage des Lebens finden«, sagte Jobbe. »Und wäre das eine Strafe oder nicht vielmehr eine Belohnung?«
Erschaudernd sagte Pieter: »Diese Antwort will ich noch nicht wissen!«
Jobbe nickte langsam. »Unwissenheit ist oft das beste…« Er zogan dem Strick des ausgehängten Netzes. »Ich kenne Leute in der Stadt, die vielleicht wissen, was sie mit deinen Eltern gemacht haben. Ich werde versuchen, unauffällig etwas in Erfahrung zu bringen. Es zappelt im Netz, sollen wir mal nachsehen, ob wir schon was gefangen haben?«
Vielleicht werde ich auch Fischer, dachte Pieter, als sie am späten Nachmittag zum Ufer ruderten, den Korb gefüllt mit blau glänzenden Lachsen. Es war gewiß nicht immer ein Vergnügen, bestimmt nicht im Winter und bei schlechtem Wetter. Aber Fischer schienen ein freies und unabhängiges Leben zu führen, und das sprach Pieter irr Augenblick sehr an.
Der friedliche Tag auf dem Wasser hatte ihn ein wenig zur Ruhe kommen lassen. Er war Jobbe dankbar. Seine anderen Freunde waren doch nur Aufschneider, dachte Pieter. Der alte Fischer war der einzige, mit dem er wirklich reden konnte.
Jobbe ruderte sein Boot in die Bucht. Als sie die Strömung verließen und in ruhiges Wasser gelangten, ließ er das Ruder los, so daß sie gemächlich zum Ankerplatz trieben.
Pieter sah, daß Jobbe aufmerksam um sich blickte. Beunruhigt fragte er: »Ist etwas nicht in Ordnung?«
»Es ist hier so still, als würde ein Gewitter aufziehen…« Er schaute kurz zum wolkenlosen Himmel, bevor er sich bückte, um eine der Fangleinen aus dem Wasser zu fischen. Nun nahm auch Pieter diese unnatürliche Ruhe wahr, die wie ein bleischweres Gewicht über der Bucht hing. Die Angst des vorigen Abends sprang ihn von hinten wie ein Tier mit kalten Tentakeln an.
»Jobbe…« sagte er mit gepreßter Stimme. »Ich habe Angst…«
»Wer den Mut hat, das zuzugeben, kann kein Angsthase sein«, meinte Jobbe. Ermunternd legte er eine Hand auf Pieters Arm. »Wir sind gleich zu Hause, dann bekommst du eine Stärkung.«
[35] Kaum hatte Jobbe das gesagt, traten die spanischen Soldaten an beiden Ufern der Bucht aus ihrem Versteck zwischen dem Schilf hervor. Sie richteten ihre Musketen auf das Boot. Pieter erkannte sofort den Hauptmann. In gebrochenem Niederländisch rief er: »Laß alles liegen und komm sofort an Land, oder du wirst erschossen.«
[36] 4
Trotz des sommerlichen Wetters war es im Kerker des Steen kalt und feucht. Es roch nach Schimmel und Moder. Das einzige Licht fiel durch ein kleines vergittertes Loch oben in der Mauer, an das Pieter nicht herankommen konnte. Der Schimmelgeruch kam vor allem aus der Ecke, in der ein Strohhaufen als Schlafplatz diente.
Pieter lehnte sich an die eisenbeschlagene Zellentür, die noch bebte von der Wucht, mit der sie hinter ihm zugeworfen worden war. Seine Beine fühlten sich schwach an, aber es gab keinen Stuhl, und er wollte sich nicht auf den dreckigen Steinboden setzen.
»Oh Jobbe!« wimmerte er.
Er wußte nicht einmal, ob der alte Fischer überhaupt noch lebte. Sie hatten mit den Kolben ihrer Musketen so lange auf Jobbe eingeschlagen, bis er reglos liegengeblieben war. Danach hatten sie sein Boot in Brand gesteckt. Pieters Flehen und seine Versicherungen, daß Jobbe unschuldig sei, waren bei dem spanischen Hauptmann auf taube Ohren gestoßen. Wer glaubte schon einem Gotteslästerer, der zudem aus seiner Verachtung der spanischen Obrigkeit keinen Hehl gemacht hatte?
Ich bringe nur Unglück, dachte Pieter zum wiederholten Male mit einem an Verzweiflung grenzenden Selbstvorwurf. Jedem, dem ich nahekomme, steht nur Unheil bevor. Ich verbreite Unglück wie eine Ratte die Pest. Besser, ich wäre tot…
Die Zellentür wurde an diesem Tag kein einziges Mal geöffnet. Pieter konnte nichts anderes tun, als das Geschehene immer wieder in Gedanken an sich vorbeiziehen zu lassen und sich in finsteren Betrachtungen und Selbstbeschuldigungen zu ergehen. Zu essen bekam er nichts. Seinen Durst konnte er mit dem bitter schmeckenden Wasser aus einem Schöpfeimer löschen, der an einem Strick von der Decke herunterhing, wahrscheinlich damit Ratten und anderes Ungeziefer nicht daran kamen.
Als der Abend hereinbrach und durch das Loch in der Mauer kein Licht mehr fiel, wurde es in der Zelle stockdunkel. Pieter war völlig [37] erschöpft. Seine Füße schmerzten vom langen Stehen, aber er konnte sich nicht dazu überwinden, sich auf das Stroh in der Ecke zu legen. Überall um ihn herum raschelte und knackte es, hin und wieder fühlte er, wie etwas über seine Füße lief. Bei der kleinsten Bewegung, die er machte, wurde alles still, aber jedesmal hörte er kurz darauf wieder die unheimlichen Geräusche.
Das einzige Lebenszeichen, das Pieter außerhalb der Zelle wahrnehmen konnte, war ab und zu ein kaum hörbares Gerassel von Ketten.
Zumindest das hatten sie ihm nicht angetan, dachte Pieter. Sie hatten ihm keine Fesseln angelegt. Er wußte jedoch nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen war. Er hatte überhaupt keine Ahnung, welches Schicksal ihm bevorstand, und konnte nur hoffen, daß es nicht der Scheiterhaufen sein würde. Feuer bereitete Schmerzen, und die Gnade des Todes ließ manchmal lange auf sich warten.
Pieter wußte, daß er nicht die ganze Nacht auf den Beinen bleiben konnte, und er fürchtete sich davor, irgendwann einfach umzufallen. Seine Phantasie füllte die Zelle mit gräßlichen Gestalten, wie er sie einmal auf einem Gemälde von Bosch gesehen hatte. Dieses wahnsinnige Bild hatte ihn eine ganze Weile in seinen Alpträumen verfolgt; er hatte es nie völlig vergessen können. Vielleicht hatte Bosch auch einmal in einer Zelle gesessen, dachte Pieter, und danach die mißgestalteten Kreaturen gemalt, die ihm seine Phantasie in der Nacht vorgezaubert hatte.
Später wankte Pieter todmüde und mit lahmen Beinen tastend zu dem Wassereimer. Er hatte Glück, daß er beim ersten Mal nicht an ihm vorbeilief, sonst hätte er ihn in der Dunkelheit wahrscheinlich nie gefunden. Er wickelte sich den Strick als Halt um den rechten Arm, um nicht zu fallen. Als er jedoch sein Gewicht auf den Arm verlagerte, brach der Haken mit dem Strick aus der Decke, so daß Pieter unter gewaltigem Getöse mit dem Eimer auf den Boden fiel. Er wollte hochspringen, doch durch den Sturz schienen ihn seine letzten Kräfte verlassen zu haben.
Er drehte sich auf die Seite und zog die Beine an. Vor Kummer schluchzend und zitternd vor Kälte und Ekel, verbrachte er in dieser Haltung die restliche Nacht auf dem harten Boden.
[38] Das einfallende graue Morgenlicht verjagte die scheußlichen Geschöpfe, die Pieters Zelle in der Nacht bevölkert hatten. Er fühlte jedoch kaum Erleichterung, als er unter Schmerzen seinen steifen Körper aufrichtete.
Er war durstig, aber der Eimer lag leer auf dem Boden. Hunger hatte er nicht; er dachte, daß er nie mehr einen Bissen herunterbekommen würde. Vor allem aber fühlte er sich elend.
Es schien ein grauer Tag zu sein, denn es wurde nicht richtig hell in der Zelle. Mit den Füßen scharrte Pieter den gröbsten Dreck von einer Stelle auf dem Boden weg und setzte sich im Schneidersitz hin. Zuerst schmerzten seine Beine nur, aber dann wurden sie völlig gefühllos. Nach einer Weile schien diese Gefühllosigkeit seinen ganzen Körper zu ergreifen, bis sie schließlich seinen Geist erreichte und er aufhörte zu denken.
Als irgendwann die Luke in der Tür aufging, schreckte er auf. Ein Stück verschimmeltes Brot rollte vor seine Füße, doch er rührte es nicht an.
Er hatte keine Vorstellung, wie spät es war, als die Zellentür unter großem Lärm aufflog und zwei Gefängniswärter hineinkamen. Sie zerrten Pieter unsanft hoch und zogen ihn hinaus, weil er seine lahmen Beine nicht sofort strecken konnte.
Er wurde zu einem gelangweilt dreinblickenden spanischen Offizier gebracht, der kein Wort Niederländisch sprach und sich deshalb darauf beschränkte, in knurrendem, schnauzendem Ton ein paar Befehle zu geben.
Zu seinem Erstaunen mußte Pieter andere Kleider anziehen. Sie paßten ihm zwar nicht gut, aber sie waren zumindest sauber. Dann wurde er nach draußen gebracht, wo sie ihn in eine Kutsche verfrachteten, die sofort abfuhr.
Außer dem Kutscher auf dem Bock fuhr nur ein Soldat mit, der sich neben Pieter setzte. »Bin ich plötzlich keine Bedrohung mehr für die spanische Krone?« fragte Pieter ihn.