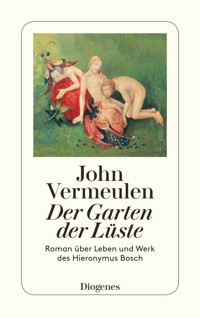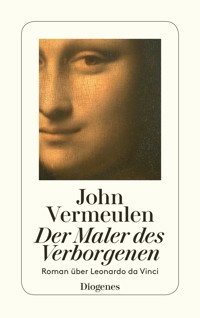11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Gerhard Mercator (1512–1594) gilt als der Begründer der modernen Kartographie. Mit seiner Erfindung der »Mercator-Projektion« gelang es erstmals, die Kugelform der Erde auf eine zweidimensionale Karte zu übertragen. Nur knapp der Inquisition entkommen, verließ Mercator 1552 das niederländische Löwen und suchte mit seiner Familie Zuflucht im liberalen Duisburg. John Vermeulen beschreibt den Menschen hinter dem brillanten Wissenschaftler, sein Lebensdrama, seinen Kampf gegen Intrigen und Ignoranz in dem Jahrhundert, in dem die Welt neu erfunden wurde. – Ein pralles Melodram und eine informative Geschichtsstunde in einem.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 766
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
John Vermeulen
Zwischen Gottund der See
Roman über das Lebenund Werk desGerhard Mercator
Aus dem Niederländischenvon Hanni Ehlers
Titel der 2004 im Verlag Kramat, Westerlo,
erschienenen Originalausgabe:
›Tussen God en de Zee. Roman over het leven
en werk van Gerard Mercator‹
Copyright © 2004 by John Vermeulen
Die deutsche Erstausgabe
erschien 2005 im Diogenes Verlag
Umschlagillustration:
Jan Vermeer van Delft, ›Der Astronom‹,
1668 (Ausschnitt)
All rights reserved
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2014
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23636 1 (2. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60615 7
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Vorwort
Gerhard Mercator wurde am 5.März 1512 unter dem Namen Gerhard de Kremer als siebtes Kind einer armen Schuhmacherfamilie in dem flämischen Dorf Rupelmonde geboren. Dank der Unterstützung seines wohlhabenden Großonkels konnte der begabte Gerhard in Löwen studieren. Und das war gut für die Wissenschaft im allgemeinen und für die Seefahrt im besonderen. Denn mit der von ihm entwickelten Methode zur Übertragung der Kugelform der Erde auf eine plane Kartenfläche, der nach ihm benannten Mercator-Projektion, begründete er die moderne Kartographie, die für die Navigation von bahnbrechender Bedeutung war – auch wenn sie erst Jahre nach seinem Tod allgemein anerkannt und in die Praxis umgesetzt wurde.
Gerhard Mercator war freilich weit mehr als nur Kartograph. Er war Humanist, Theologe und Philosoph, und er interessierte sich sehr für die Sternkunde, die sich zu seiner Zeit aus der Astrologie zu entwickeln begann. In diesem Zusammenhang handelte er sich Schwierigkeiten mit der Obrigkeit ein, weil er der ketzerischen Theorie anhing, daß die Erde nicht Mittelpunkt des Universums sei, sondern schlicht mit anderen Planeten um die Sonne kreiste. Auch sein Hang zum Okkulten war nicht überall gern gesehen. Unbedachte Äußerungen, gepaart mit der Mißgunst einiger [6] zwielichtiger Figuren aus seinem Umfeld, brachten ihn schließlich sogar für neun Monate hinter Kerkermauern. Daraufhin entfloh er mit seiner Familie den Niederlanden und ließ sich im deutschen Duisburg nieder, wo das religiöse Klima weit toleranter war. Dort verbrachte er den größten Teil seines Lebens und entwickelte seine bedeutendsten wissenschaftlichen Ideen. Und das bis ins hohe Alter, als er körperlich bereits so hinfällig war, daß er keinen Stift mehr halten konnte.
Das alles ist hinreichend bekannt. Doch wer war der Mensch hinter dem brillanten Wissenschaftler? Wie zuvor schon bei Pieter Bruegel und Hieronymus Bosch habe ich mit diesem Buch versucht, Gerhard Mercator, der in einer der turbulentesten, aber auch aufregendsten Epochen der Geschichte lebte, als Menschen aus Fleisch und Blut zu neuem Leben zu erwecken. Zwischen Gott und der See erhebt nicht den Anspruch, ein wissenschaftliches Buch zu sein. Es ist keine distanzierte Biographie, sondern ein Roman, den ich um einige bekannte Fakten aus dem Leben jenes Mannes gesponnen habe, der das Wissen über unseren Planeten maßgeblich und nachhaltig beeinflußt hat. Wer war der Mensch Gerhard Mercator? Ich hoffe, mit diesem Buch eine befriedigende Antwort darauf gegeben zu haben.
John Vermeulen13.
[7] 1
Nach dem überreichlichen Regen der vergangenen Juniwochen feierte das Flachland endlich ausgelassen Mittsommer. Schneeball, Sumpfkresse und Saatmargerite, Platterbse, Löwenzahn, Wicke und Wasserminze blühten und dufteten im Grün von Feldern und Wiesen. Sie lockten ganze Schwärme emsig auf und ab fliegender Bienen und Hummeln an, die sich in Blütenstaubwolken am Nektar berauschten. Lerchen jubilierten, und Rauchschwalben schienen darin zu wetteifern, wer den Insekten am akrobatischsten nachsetzen konnte.
Der junge Mann, der in Gedanken versunken die staubige Straße entlangtrottete, blieb hin und wieder stehen, um all das erregte Treiben der Natur mit dem Ausdruck leichter Verwunderung zu betrachten. Er war zu lange in dunkle Klassenräume eingesperrt gewesen, wurde ihm bewußt. Und die Jahreszeiten hatten sich abgewechselt, ohne auf ihn zu warten. Wie überhaupt nichts und niemand auf ihn gewartet hatte. Eine ernüchternde Feststellung, daß sich die Welt so wenig um ihn scherte. Und zugleich hatte es auch etwas Beruhigendes, fand er. Denn es bedeutete, daß man für nichts verantwortlich war, und wenn man keine Verantwortungen hatte, konnte man ungehindert seine Freiheit auskosten. Insbesondere jetzt, da er sein Studium vorerst [8] abgeschlossen hatte. Mochte Rektor Pieter de Corte ihm auch ins Gewissen geredet haben, daß dies erst der Anfang sei, daß sein Zeugnis nicht mehr darstelle als eine Befähigung, auf ehrliche, aber bescheidene Weise sein Brot zu verdienen, vorausgesetzt, daß er hart arbeitete.
Nicht länger von den guten Gaben Großonkel Gisberts abhängig sein, dachte Gerhard. Der Gedanke gefiel ihm. Gisbert war Kaplan im Sint-Jans-Hospiz in Rupelmonde und im Gegensatz zum Rest der Familie, der regelmäßig seiner Hilfe bedurfte, um den Kopf über Wasser halten zu können, äußerst wohlhabend.
Es war von jeher Gisberts Wunsch gewesen, daß Gerhard in seine Fußstapfen trat. Gleichsam zum Dank, wenn das auch nicht ausdrücklich gesagt wurde. Daher hatte der Kaplan ihn zunächst bei der Bruderschaft vom Gemeinsamen Leben in ’s-Hertogenbosch auf die Schule geschickt. Doch Gerhard war ganz offensichtlich nicht aus dem richtigen Priesterholz geschnitzt. Zu stark war seine angeborene Neigung, allerhand Dinge, vor allem Dogmen, in Zweifel zu ziehen. Und die Schule in ’s-Hertogenbosch hatte sich da keineswegs als heilsam erwiesen. Die Brüder vom Gemeinsamen Leben zollten Rom alles andere als blinden Gehorsam, und das blieb nicht ohne Auswirkung auf den jungen Gerhard de Kremer. Mit achtzehn hatte er sich als armer Student an der Universität Löwen eingeschrieben, wo er das Pädagogium ›Castrum‹ besuchte. Seinen Familiennamen latinisierte er zu Mercator Rupelmundanus, weil er fand, daß das besser klang, wenn er das pompöse Rupelmundanus auch rasch wieder fallenließ, als allzusehr darüber gefeixt wurde. Sein Studium der Philosophie hatte Gerhard [9] Mercator noch tiefer über Dinge nachdenken lassen, die in Zweifel zu ziehen unter Umständen gefährlich sein konnte.
Gerhard blieb stehen, um sich umzuschauen, als er einen Pferdekarren hinter sich nahen hörte. Es war ein teilweise beladener zweirädriger Wagen, der von einem schläfrigen Pferd gezogen wurde. Auf dem Bock saßen ein schon etwas älterer Mann und eine junge Frau. Beide blickten sie neugierig auf Gerhard herab.
Wanderer waren hier eher selten, so auf halber Höhe zwischen Löwen und Mecheln. Aber nach einem Wegelagerer sah Gerhard nun wahrlich nicht aus, geschweige denn nach einem jener umhervagabundierenden Soldaten, die, weil sie ihren Sold nicht bekamen, möglichst viele Bürger ihres Geldbeutels beraubten. Die operierten im übrigen nie allein, und Schlupfwinkel, wo sich etwaige Kumpane versteckt halten konnten, gab es hier nicht.
»Guten Tag, junger Mann«, sagte der Mann auf dem Bock, während er das Pferd zum Stehen brachte. »Möchtet Ihr vielleicht bis Mecheln mitfahren?«
Gerhard sah verwundert zu dem anderen auf. In der Regel waren Fremde, die sich auf einer verlassenen Straße begegneten, nicht so freundlich zueinander. »Ich kann Euch nicht bezahlen«, warnte er. »Ich habe kein Geld, nicht einmal einen halben Albus.«
»Meine Tochter wollte, daß ich Euch diese Frage stelle«, erwiderte der Mann. Es klang ein wenig mißvergnügt, als sei er sich mit seiner Tochter uneins, könne sich aber nicht gegen sie durchsetzen.
Erst jetzt fing Gerhard den Blick der jungen Frau auf, die beinahe noch ein Mädchen war. Sie sah ihn mit großen, [10] glänzenden Augen und vagem Lächeln an. Ihr üppiges blondes Haar war nur zum Teil unter einer weißen Haube mit Schößen gebändigt, und sie blies sich aus dem Mundwinkel ein wenig keck eine Locke aus dem rechten Auge. »Wohin geht die Reise?« wollte sie wissen.
»Halt den Schnabel, Barbara«, mahnte sie der Vater barsch. »Man spricht fremde junge Männer nicht so mir nichts, dir nichts an, das geziemt sich nicht für ein Mädchen!«
»Ich bin auf dem Weg nach Antwerpen«, antwortete Gerhard, ohne den Blick von ihr abzuwenden. Und ganz gegen seine Gewohnheit wurde er sich plötzlich stark seines doch etwas unansehnlichen Äußeren bewußt. Er war schlaksig und mager, und sein Kinn überzog ein lächerlicher Flaum, von dem er hoffte, daß dereinst ein Bart daraus würde. Überdies hatten seine Kleider ihre beste Zeit längst hinter sich.
»Bis nach Antwerpen?« Der Mann kratzte sich am Kopf. Seine Haare waren so lang wie die seiner Tochter. »Zu Fuß?«
Gerhard zuckte die Achseln. »Ich wollte lange und tief nachdenken über… über die Dinge.«
»Eine ermüdende Art nachzudenken«, fand die junge Frau. In ihrem Ton schwang kaum verhohlener Spott mit.
»Du sollst den Schnabel halten«, sagte ihr Vater erneut. Doch es klang nicht drohend, sondern eher müde, als habe er sich bereits damit abgefunden, daß seine Tochter ihm ja doch nicht gehorchen werde. »Da müßt Ihr aber gutes Schuhwerk haben«, sagte er zu Gerhard und warf einen Blick auf dessen staubige Füße.
»Mein seliger Vater war Schuhmacher.« Gerhard schaute [11] auf die Bündel gegerbten Leders, mit denen der Wagen beladen war. »Ein Fach, das mit dem Euren verwandt ist, wie ich sehe.«
»Es ist noch Platz auf dem Bock«, sagte die junge Frau. Sie rückte etwas näher zu ihrem Vater heran und klopfte einladend auf das frei gewordene Fleckchen, wo sie gesessen hatte.
»Ehrlich gesagt…«, Gerhard rieb sich mit dem rechten Handrücken über die Stirn, »beginne ich schon ziemlich durstig zu werden. Ich hätte daran denken sollen, Wasser mitzunehmen. Ich bin ein recht unerfahrener Reisender, fürchte ich. Vielleicht sollte ich Euer freundliches Angebot in der Tat annehmen.«
»Dann steigt halt auf«, sagte der Mann ergeben. »Mein Name ist Jan Schellekens«, stellte er sich kurz darauf vor, als Gerhard neben dem Mädchen Platz genommen hatte und sich der Wagen knarrend in Bewegung setzte. »Und das ist Barbara, meine Tochter.« Es gelang ihm, stolz zu klingen und zugleich mißbilligend zu blicken.
»Gerardus Mercator, Magister artium.« Kaum hatte Gerhard das ausgesprochen, war es ihm ein wenig peinlich. Mit dem gerade erworbenen Titel zu prahlen widersprach seiner bescheidenen Art. Aber er wollte Eindruck auf das Mädchen neben sich machen. Auf dieses anziehende Wesen, dessen Körperwärme er durch seine Kleider dringen spürte. Er war gehalten, sich dicht an sie heranzusetzen, um nicht von dem hin und her holpernden Bock zu purzeln, und sie machte keinerlei Anstalten, von ihm wegzurücken.
Sie hatte ein markantes Profil, wie er aus dem linken Augenwinkel sah, mit kräftigem, aber dennoch weiblichem [12] Kinn. Die wenigen Mädchen, die er in Löwen kennengelernt hatte, waren ganz anders gewesen: schwächer, verletzlicher, weniger mundfertig. Genau wie seine Schwester, die zufällig auch Barbara hieß. Und seine Mutter war auch bestens darin bewandert gewesen, die eigenen Interessen hintanzustellen. Gerhard hatte schon gedacht, daß alle Frauen so wären oder zu sein hätten.
»Du darfst mich ruhig anschauen, das brauchst du nicht heimlich zu tun.«
»Barbara! Was bist du nur für ein Satansbraten!« bellte ihr Vater. »Verzeiht, Meister«, sagte er entschuldigend zu Gerhard, »aber es scheint, als hätte sie alle Manieren vergessen, die wir ihr so mühsam beigebracht haben.«
»Nicht weiter schlimm«, erwiderte Gerhard, der prompt dunkelrot anlief.
Meister, so hatte man ihn noch nie genannt. Aber es mußte wohl spöttisch gemeint sein, entschied er, wieder einmal gedämpft durch seine angeborene Bescheidenheit.
»Ich bin Gerber«, sagte Schellekens, als wolle er zu einem neutralen Gesprächsthema überwechseln. »Wie Ihr schon erraten hattet.« Er ließ seine improvisierte Peitsche auf den Rücken des Pferdes klatschen. Das Tier reagierte mit einer leicht beschleunigten Gangart, verfiel aber nach fünf Schritten wieder in sein gemächliches Tempo.
»Vielleicht hat mein Vater sogar Schuhe aus Eurem Leder gemacht«, erwiderte Gerhard. Ein schöner Gedanke, schien ihm, denn das hätte ihn und Barbara ja irgendwie verbunden.
Der Angesprochene zuckte die Achseln. »Ich verkaufe mein Leder auf dem Markt in Mecheln, und wohin es [13] danach geht, kümmert mich ehrlich gesagt wenig. Und wenn’s Margareta von Österreich wäre, die ja ganz närrisch auf Leder sein soll. Wenngleich ich noch nie einen aus ihrem Hofstaat auf dem Markt gesehen habe.«
»Ich wohne in Rupelmonde.«
»Ach ja, stromaufwärts von Antwerpen, nicht wahr?«
Gerhard nickte, ohne sich bewußt zu sein, daß Schellekens das nicht sehen konnte. »Dort, wo die Rupel in die Schelde strömt. Es ist klein, hat aber Stadtrecht.«
»Ich habe davon gehört«, sagte Schellekens, der nicht sonderlich beeindruckt zu sein schien. »Dort macht man es unsereinem nicht leicht. Nichts darf man dort verkaufen, ohne Zoll zu zahlen.«
»Wir haben ein großes Schloß mit siebzehn Türmen.«
»Ja, ja«, Schellekens verzog den Mund zu einem bitteren Grinsen, »die Grafenburg, berüchtigt für ihren Kerker. Also wenn du mich fragst, macht man um Rupelmonde besser einen weiten Bogen. Es sei denn natürlich, man wohnt da.« Er warf seinem Fahrgast einen Seitenblick zu. »Oh, verzeiht, Meister«, sagte er, als er Gerhards Miene sah, »ich entwickle mich wohl allmählich zum alten Brummbär. Und du hältst die Gosche!« warnte er seine Tochter, die schon Luft holte, um etwas zu sagen.
»Ach, es läßt sich dort ganz gut aushalten«, sagte Gerhard verteidigend. Was ihn in Rupelmonde verankerte, war in erster Linie sein Onkel Gisbert, doch darüber wollte er sich Fremden gegenüber nicht weiter auslassen. »Ihr seid aus Löwen, nehme ich an?« fragte er statt dessen.
»Aus der Stadt Löwen«, antwortete Schellekens betont spöttisch.
[14] Schade, daß ich jetzt von dort weggehe, dachte Gerhard. Aber vielleicht kehrte er ja wieder dorthin zurück. Und sei es nur um der langen und tiefschürfenden Diskussionen willen, die er dort mit anderen Studenten führen konnte – und mit manchen Magistern, mit denen er hin und wieder heftig aneinandergeraten war. Insbesondere, wenn es um die Lehre des Aristoteles ging, über die sie sich anscheinend niemals eins werden konnten.
»Vielleicht studiere ich in Löwen noch weiter«, dachte Gerhard laut. »Die Kosmographie zum Beispiel interessiert mich ganz besonders.«
»Weiterstudieren?« Schellekens schüttelte den Kopf. »Als Sohn eines Schusters? Nichts für ungut, Meister«, sagte er hastig, als ihm klar wurde, was er gesagt hatte, »ich wollte nicht anmaßend sein, aber…«
»Ich habe einen wohlhabenden Onkel«, erklärte Gerhard. »Meine Eltern sind beide tot, mein Vater schon seit gut sechs Jahren.«
»Ach ja«, sagte Schellekens, »Ihr sagtet vorhin ›mein seliger Vater‹. Entschuldigt.«
Barbara fragte: »Was ist Kosmographie?«
»Sternkunde«, antwortete Gerhard, und seine Stimme wurde träumerisch, »die Beobachtung und Beschreibung der Himmelskörper und ihrer Bewegungen, die Wissenschaft von Entstehung und Werden des Weltalls…«
»Ich bin Jungfrau«, sagte Barbara. »Mein Sternbild, meine ich.« Sie lachte girrend, als Gerhard schon wieder errötete.
»Ich wollte, ich könnte auch meine Tochter auf dem Markt in Mecheln verkaufen«, knurrte Schellekens.
[15] »Ihr würdet bestimmt einen hohen Preis für sie erzielen«, erwiderte Gerhard kühn.
Schellekens brummte nur etwas Unverständliches in seinen zotteligen Bart und gab seinem Pferd mit abermals geringem Erfolg die Peitsche. Anschließend sagte er: »Ich kann lesen und schreiben und rechnen, aber darüber hinaus geht mein Können nicht.«
»Oh, aber gewiß doch, Euer Können geht durchaus darüber hinaus«, widersprach Gerhard. Er konnte es nicht lassen; wenn er irgendwo einen möglichen Ansatzpunkt für eine Debatte witterte, mußte er reagieren. »Ihr seid ein tüchtiger Gerber und wahrscheinlich auch ein guter Handelsmann. Das muß man unter Können verstehen. Schulwissen ist etwas anderes, das hat man nur im Kopf. Damit kann man weder Möbel tischlern noch Geschirr töpfern.«
»Hm, und wozu, mit Verlaub, soll Schulwissen dann gut sein?«
»Um Antworten auf wichtige Fragen zu finden.«
»Wie zum Beispiel?«
»Wie zum Beispiel…«, Gerhard dachte kurz nach, »wie zum Beispiel: Wie weit ist die Erde vom Mond entfernt?«
»Und was fängt man mit diesem Wissen dann an?«
»Wenn man einmal weiß, wie man diese Entfernung berechnen kann, läßt sich auch bestimmen, wie weit es zur Sonne und zu den Planeten ist. Und vielleicht sogar zu den Sternen.«
»Nichts für ungut, Meister, aber ist das nicht ein wenig vermessen?«
»Wissensdurst hat nichts mit Vermessenheit zu tun. Eher im Gegenteil, man lernt dadurch, demütig zu sein. Denn [16] gerade durch die Erweiterung seines Wissens wird man sich so recht bewußt, wie klein und unbedeutend man selbst ist.«
Schellekens schnaubte. »Dazu brauche ich das ganze Wissen nicht. Und noch etwas: Führt Wissen nicht nur zu weiteren und schwierigeren Fragen?«
»Das ist wohl wahr. Jede beantwortete Frage ist gleichsam ein Schlüssel zu einem Raum voller neuer, unbeantworteter Fragen.«
»Schön gesagt«, bemerkte Barbara. Ihre Miene war ernst, doch ihre Augen sprühten Spott.
»Das ist mir zu schwierig«, sagte ihr Vater. Er spuckte ins Brombeergebüsch am Wegesrand. »Viel zu schwierig!«
Barbara fragte: »Habt Ihr eine Unterkunft in Antwerpen, Meister? Des Nachts kann es dort auf den Straßen sehr gefährlich sein, habe ich gehört.«
Gerhard nickte. »Ich habe die Adresse eines Mannes der Wissenschaft, den ich in Löwen kennengelernt habe. Er hat versprochen, mich bei sich aufzunehmen, wenn ich einmal nach Antwerpen kommen sollte.«
»Wie praktisch, wenn man wichtige Leute kennt.«
»Es reut mich inzwischen gewaltig, daß ich dich mitgenommen habe«, sagte Schellekens zu seiner Tochter. Und zu Gerhard: »Ich bitte Euch, nehmt ihr die dreisten Kommentare nicht übel.«
Ihr könnte ich, glaube ich, niemals etwas übelnehmen, dachte Gerhard, der vielmehr seine Freude an ihrer Mundfertigkeit hatte. »Ich vertrete die Ansicht, daß jedem erlaubt sein sollte, seine Wahrheit zu äußern.«
»Gut und schön«, brummte Schellekens, offenkundig wenig überzeugt, »aber ein bißchen Höflichkeit ist doch [17] wohl nicht zuviel verlangt, würde ich meinen.« Und als wollte er seine Worte bekräftigen, zog er dem Pferd eins mit der Peitsche über, einmal mehr ohne sichtlichen Erfolg.
Wenig später kamen in der Ferne die Türme der Sint-Rombouts-Kathedrale und der Sint-Jans-Kirche in Sicht, die hoch über den Stadtwällen der Residenz Mecheln prangten. Dann und wann sahen sie ein Funkeln von der Sonne, die sich im Wasser der weiter vor ihnen zusammenfließenden Zenne und Dijle spiegelte. Und die Straße, die jetzt zwischen Getreidefeldern hindurchführte, wurde durch Fußgänger und vor allem Pferde- und Eselskarren, auf denen sich Handelswaren türmten, allmählich immer belebter. Belebter und staubiger.
Gerhard war dankbar, als Schellekens ihm irgendwann schweigend einen Zinnkrug reichte. Darin war bitter schmeckendes Bier, und Gerhard bedauerte, daß die Höflichkeit es ihm verbot, den Krug ganz leer zu trinken.
Obgleich ihr Karren kaum schneller vorankam als ein Fußgänger, schien es Gerhard, als wäre die Reise im Nu vorbeigegangen. Das macht Barbaras Nähe, sagte er sich, als sie die Wächter am Mechelner Stadttor passierten. Er würde von der dreisten Dirne nur ungern Abschied nehmen.
Schellekens brachte den Karren auf einem großen, lauten Platz unweit des im Bau befindlichen Palastes für den Großen Rat zum Halten. »Vielleicht findet Ihr jemanden, der Euch nach Antwerpen mitnimmt«, sagte er.
Gerhard schüttelte den Kopf. »Das Stück möchte ich unbedingt zu Fuß zurücklegen.« Er gab Barbara die Hand, die sie ungewöhnlich lange drückte. »Ich hoffe, Euch noch einmal wiederzusehen«, sagte er, und selten hatte er diese [18] Worte so aufrichtig gemeint. »Vielleicht in Löwen«, fügte er hoffnungsvoll hinzu.
Die junge Frau nickte ernst. »Wir sehen einander wieder«, konstatierte sie, »ob wir es nun hoffen oder nicht.« Dabei lächelte sie ein wenig geheimnisvoll.
»Denkt doch tatsächlich, sie könne die Zukunft vorhersagen, die Gans«, sagte Schellekens ungehalten. »Das hat sie von ihrer Mutter.« Er tippte sich kurz an die Stirn. Dann drückte er flüchtig die Hand, die Gerhard ihm spontan reichte. »Viel Glück mit Euren Studien oder was auch immer, Meister.«
Gerhard stieg vom Bock. »Herzlichen Dank«, sagte er noch. Aber Schellekens schwang schon seine Peitsche, und das Pferd zog mit sichtlichem Widerwillen den Karren an.
Gerhard blieb stehen, bis das Gespann hinter der gewaltigen Baustelle verschwunden war. Zu seiner Enttäuschung schaute sich Barbara nicht mehr um.
Begegnungen, dachte er. Sie scheinen zufällig zu sein, doch wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß ein Mann eine Frau, die… Gerhard hatte sich gedankenverloren umgedreht und stieß beinahe mit einem Mönch in dunkelbrauner Kutte zusammen, der, das Gesicht größtenteils in seiner Kapuze versteckt, dastand und sich das lebhafte Treiben auf dem Platz ansah. Einen Lidschlag lang traf Gerhard der stechende Blick aus zwei hellblauen Augen.
»Entschuldigung, Vater«, sagte Gerhard hastig. »Ich hatte gerade nicht achtgegeben.« Mönche flößten ihm immer eine vage, undefinierbare Angst ein. Irgendwie erinnerten sie ihn an Geister, so als weilten sie schon mit einem Bein in der unstofflichen Welt. Und hinzu kamen die Beziehungen, die [19] manche von ihnen zur allgegenwärtigen gefürchteten Inquisition hatten.
Zu seiner Erleichterung wandte der Mönch den Blick sogleich wortlos wieder ab, als sei es unter seiner Würde, sich weiter mit einem schlaksigen jungen Mann zu befassen, der einen etwas eigenartigen Dialekt sprach und die Augen nicht richtig aufmachte.
Gerhard zog schuldbewußt den Kopf ein und sah zu, daß er wegkam. Eigentlich hatte er sich in der lebendigen Stadt noch ein wenig die Zeit vertreiben wollen, doch die Begegnung mit dem Mönch löste eine Art Fluchtreaktion bei ihm aus. Das passierte ihm bei Geistlichen häufiger. Es kam ihm so vor, als könnten sie ihm in die Seele blicken, und die war nicht so makellos rein, wie sie es hätte sein sollen. Außerdem sorgte er besser dafür, daß er vor Einbruch der Dunkelheit in Antwerpen war.
Er trank an einem Brunnen, so viel er konnte, und begab sich dann mit der Sonne im Rücken zum Nordausgang der Stadt.
Als er Mecheln hinter sich gelassen hatte, versuchte er seinen meditativen Gedankenfluß vom Morgen wiederaufzunehmen. Das gelang ihm nur zum Teil, denn es war schwer, abgeklärt nachzudenken, wenn einem fortwährend das Bild einer jungen Frau mit einer widerspenstigen blonden Haarlocke vor dem spottlustigen Gesicht durch den Kopf spukte.
Schon lange bevor Gerhard Antwerpen erreichte, hatte er den Entschluß gefaßt, in Bälde nach Löwen zurückzukehren. Etliche Gründe sprachen dafür. Barbara war nur einer, und gewiß nicht der wichtigste – machte er sich zumindest weis.
[20] Die Sonne war noch nicht ganz hinter dem westlichen Horizont verschwunden, als Gerhard die Antwerpener Torwächter passierte. Sie stellten ihm keine Fragen, ja, einer von ihnen erwiderte seinen Gruß sogar mit einem freundlichen Nicken. Das hatte Gerhard, wie er wußte, seinem unschuldigen Äußeren zu verdanken. Irgendwie trauten ihm die meisten Menschen nicht so leicht etwas Böses zu. Ein praktischer Umstand, den er sich schon mal zunutze machte.
Er mußte dreimal nach dem Weg fragen, ehe er zu der Adresse fand, die er sich fast ein Jahr zuvor auf einen Zettel geschrieben hatte, Haus ›Almagest‹ in der Vissersstraat.
Man müßte an den Stadttoren eine Zeichnung mit allen Straßen und Plätzen aufhängen, dachte er. Dann würde man auch als Fremder selbst in einer großen Stadt wie Antwerpen mühelos den Weg finden können, ohne andere belästigen zu müssen. Darüber sinnierend, wie denn so eine Zeichnung am besten aussehen könnte, hob er den Türklopfer aus Messing und ließ ihn auf die massive Eichentür fallen. Er erschrak über den lauten Knall, den der Klopfer auf dem Holz machte, und dessen Widerhall in der schmalen Gasse. Doch niemand kam, um ihm zu öffnen. Auch nicht, nachdem Gerhard ein zweites und drittes Mal angeklopft hatte.
Das brachte ihn in eine mißliche Lage. Es würde jetzt bald dunkel sein, und was hatte er nicht schon für schaurige Geschichten über Messerstecher gehört, die in den großen Städten bei Nacht und Nebel die Straßen nach wehrlosen Opfern durchstreiften. Er hatte kein Geld, um die Unterkunft in einem Gasthof zu bezahlen. Und überdies war er schon eine ganze Weile ziemlich hungrig, denn seit dem Morgen hatte er nichts mehr gegessen.
[21] Gerhard trat einen Schritt zurück und schaute an der Fassade des schmalen Hauses empor. Alle Fenster waren fest verschlossen und dunkel. Er sah ein, daß es dumm gewesen war, nicht daran zu denken, daß ein Mann der Wissenschaft wie Rochus nicht jederzeit zu Hause sein würde, selbst dann nicht, wenn die Schulen wie gerade jetzt für eine Weile geschlossen waren. Oder vielleicht gerade dann nicht. Womöglich war der Astronom ja auf Reisen, vielleicht sogar ganz nach Italien. Rochus hatte mehr als einmal davon gesprochen, daß er gerne einmal seine italienischen Kollegen besuchen wollte.
Gerhard seufzte und setzte sich ermüdet auf den Blaustein, der die Eingangsschwelle bildete. Dann lehnte er sich mit dem Kopf gegen das Holz der Tür zurück, das sich noch warm anfühlte vom vergangenen Sonnenschein. Der lange Fußmarsch hatte ihm zugesetzt, auch wenn er das größte Stück von Löwen nach Mecheln nicht hatte zu laufen brauchen. Sogleich machten seine Gedanken wieder einen Sprung zu Barbara. Er stellte sich vor, er würde jetzt mit ihr in einem warmen Alkoven liegen – ein so wohliger Gedanke, daß er seine mißliche Situation darüber für einen Moment vergaß. Mochte es auch ein sündiger Gedanke sein, den sein Onkel Gisbert gewiß nicht gutheißen würde. Wie Onkel Gisbert überhaupt so gut wie alles mißbilligte, was nicht unangenehm, fad oder schmerzhaft war. Seiner Überzeugung nach war Leiden offenbar der wichtigste Zweck des stofflichen Lebens. Wer dem zu entrinnen suchte, war von vornherein verdammt.
Ein unbeladener Pferdekarren und drei oder vier eilige Fußgänger kamen vorüber, doch keiner schenkte Gerhard [22] Beachtung. Ansonsten blieb es still in der Gasse. Auch die entfernteren Geräusche städtischer Aktivität klangen beim Einbruch der Dämmerung allmählich ab.
Die Tochter eines Gerbers, dachte Gerhard. Er schloß die Augen, während er sich das Bild Barbaras vergegenwärtigte. Es gelang ihm mühelos, und für einen Moment war ihm, als sähe er sie wirklich vor sich und hörte ihre spöttische Stimme. Seltsamerweise erinnerte er sich nicht an die Farbe ihrer Augen, obgleich sie sie keineswegs vor ihm niedergeschlagen hatte. Grau, dachte er, aber er war sich nicht sicher…
Eine Hand, die ihn hart an der Schulter faßte und grob durchschüttelte, riß ihn unsanft aus seinem Traum. Es dauerte einige Sekunden, bevor er begriff, daß er auf der Schwelle von Rochus’ Haus eingeschlafen war. Irgendwer hielt ihm eine Öllampe vors Gesicht, um ihn sich genauer anzusehen. Hinter dieser Lampe war alles tiefschwarz, es war inzwischen völlig dunkel geworden.
»Wer bist du, und was tust du hier?«
Die Nachtwache, begriff Gerhard sofort, trotz der rauhen Stimme desjenigen, der ihn angesprochen hatte. Straßenräuber würden so etwas nicht fragen. Dennoch empfand er das kaum als Erleichterung. In Löwen sprang die Nachtwache nicht gerade zimperlich mit einem um, der sich ihrer Ansicht nach verdächtig verhielt.
»Mein Name ist Gerardus Mercator«, sagte er. Er versuchte aufzustehen, doch die Hand auf seiner Schulter hielt ihn davon ab. »Ich komme aus Löwen und bin… äh… und bin auf Einladung von Meister Embrecht Rochus hier, der in diesem Hause wohnt.«
»So, so.« Der Mann mit der Lampe ließ Gerhards [23] Schulter los und trat einen Schritt zurück. »Wenn er Euch eingeladen hat, warum schlaft Ihr dann vor seiner Tür?«
»Meister Rochus ist nicht zu Hause.« Jetzt konnte Gerhard im Schein der Lampe schemenhaft drei weitere Gestalten ausmachen. Alle waren sie schwarz gekleidet, als wollten sie mit der Nacht verschmelzen. »Ich hatte kein Geld für eine Unterkunft«, erklärte er.
»Auch der Kerker ist nicht gratis«, sagte einer der Männer, und ein anderer lachte.
Gerhard versuchte ein zweites Mal, sich zu erheben, und jetzt ließen sie ihn gewähren. »Ich bin kein Dieb«, erklärte er unsicher. »Ich bin…«, er zögerte kurz, »…Magister artium…«
»Magister was?«
»Magister artium. Ich habe gerade mein Philosophiestudium abgeschlossen.«
»Oh, là, là, ein studierter Vagabund«, sagte der, der eben schon das Wort geführt hatte, und wieder lachte der andere. »Da müssen wir dann wohl Meisterdieb sagen, was?«
»Ich bin kein Dieb!« wiederholte Gerhard mit Nachdruck. Die Haltung der Männer begann ihn gehörig zu beunruhigen. Bekanntlich bedurfte es nicht viel, um im Kerker zu landen.
»Durchsucht seine Kleider!« kommandierte der Anführer des Grüppchens.
Das taten sie zu zweit, grob und äußerst gründlich. »Kein Geld, keine Waffe, keine Werkzeuge«, sagte einer von ihnen, als sie fertig waren. Es klang hörbar enttäuscht.
»Dennoch traue ich der Sache nicht«, sagte der Anführer. »Daß einer mit leeren Händen ganz von Löwen kommt, [24] scheint mir unglaubwürdig.« Er hielt seine Lampe hoch, um Gerhards Züge ein weiteres Mal zu studieren.
Gerhard mußte an sich halten, um nicht vor dem penetranten Zwiebelgeruch, der ihm ins Gesicht schlug, zurückzuweichen. »Aber es ist die Wahrheit, Herr.«
»Wir nehmen ihn mit, legt ihm Fesseln an.«
Gerhard versuchte nicht, sich zu wehren, als sie ihn erneut packten und ihm die Hände auf den Rücken banden. Im Kerker würde er nachts jedenfalls sicherer sein als auf der Straße, dachte er philosophisch. Und der Schultheiß würde seiner Erklärung letztlich schon Glauben schenken.
Gerade als sich das Grüppchen in Bewegung setzen wollte, ertönte wie aus dem Nichts eine leise, kultivierte Männerstimme: »Guten Abend, die Herren von der Nachtwache. Was geht hier vor, wenn ich fragen darf?«
»Und wer, bitte schön, seid Ihr?« fragte der Anführer leicht ungehalten.
»Meister Rochus!« entfuhr es Gerhard, als er das im Schein der Lampe geisterhaft bleiche Gesicht mit dem langen blonden Bart erkannte. »Gott sei Dank!« Neben dem Astronom stand noch eine zweite Gestalt. Sie war in der Dunkelheit nur schwer zu erkennen, doch allem Anschein nach war es ein Mönch.
»Seid Ihr der genannte Embrecht Rochus, der Bewohner dieses Hauses?« wollte der Anführer wissen.
Der Angesprochene zog schweigend einen großen Schlüssel hervor und öffnete die Tür des Hauses. Danach sah er den Anführer abwartend an.
»Und kennt Ihr diesen Burschen, der behauptet, von Euch eingeladen zu sein?«
[25] »Ja, ich kenne ihn«, antwortete Rochus. »Er heißt Gerardus Mercator Rupelmundanus, und ich möchte Euch darauf hinweisen, daß dieser Bursche, wie Ihr ihn nennt, ein studierter Mann ist. Ich ersuche Euch mit Nachdruck, ihn auf der Stelle von seinen Fesseln zu befreien.«
Die Männer leisteten seiner Aufforderung Folge, und Gerhard huschte rasch an Rochus’ Seite, als suche er Schutz.
»Ich bitte um Verzeihung, Herr«, sagte der Anführer, »aber wir fanden ihn hier auf Eurer Schwelle und…«
Rochus hob abwehrend die Hand. »Ihr tut nur Eure Pflicht, und es ist gut, zu wissen, daß über die Sicherheit der Bürger gewacht wird. Eine gute Nacht weiterhin.«
Die Männer zögerten noch einen Moment, doch als Rochus nicht die erhoffte Bewegung zu seinem Geldbeutel machte, trollten sie sich.
»Geschmeiß!« murmelte Rochus und bedeutete Gerhard und dem Mönch, ihm zu folgen. Er ging ihnen voran ins Haus und zündete links und rechts Kerzen an. »Wer sich zu dieser Arbeit berufen fühlt, muß schon eine Vorliebe für das Dunkle und Verborgene haben. Und wenn sie wirklich einmal auf eine Bande Messerstecher stoßen, dann machen sie einen großen Bogen!« Sie waren in ein kleines Zimmer gelangt, in dem der erregende Duft von Büchern und neuem Leder hing. »Wir waren im ›Roten Löwen‹ an der Ecke, um unseren Durst zu stillen. Ein Wirtshaus, in dem interessante Leute verkehren, mit denen ich mich gern zum Gedankenaustausch zusammenfinde. Ach, verzeih mir meine Unhöflichkeit: Das ist Bruder Monachus von den Minoriten in Mecheln. Monachus ist gleichfalls Astronom.« Rochus zeigte auf einen Ledersessel, in dem ein Stapel Bücher lag. [26] »Setz dich, Gerhard. Was führt dich denn so unverhofft her? Wenn ich von deinem Kommen gewußt hätte, wäre ich natürlich zu Hause geblieben. Und wie es der Zufall will, ist die Magd gerade für zwei Tage bei ihrer kranken Mutter, sonst hätte sie dich hereinlassen können. Darf ich dir etwas zu trinken anbieten?«
Gerhard entfernte die Bücher vom Sessel und ließ sich müde ins Polster sinken. Mit einem mißtrauischen Blick zu dem schweigsamen Monachus hinüber, der ein wenig abseits in einem Buch zu blättern begann, antwortete er Rochus: »Das war eine spontane Anwandlung, es zog mich mit einem Mal nach Antwerpen… Vielleicht fehlten mir ja unsere Gespräche…«
»Hm, was dir fehlt, Gerhard, ist eine Frau, die dir zu einem geregelten Leben verhilft. Seit meine Frau tot ist, komme auch ich mir nur allzuoft wie ein steuerloses Schiff vor. Ein Mann allein…«, er spähte seinerseits kurz zu Monachus hinüber. »Nun ja, wir haben nicht alle die gleiche Natur. – Wein oder Bier?«
»Wein, bitte.« Gerhard rieb sich die brennenden Augen. Er bemerkte, daß seine Hand zitterte, als sei ihm erst jetzt der Schrecken über das, was draußen geschehen war, in die Glieder gefahren. Er haßte Gewalt und fürchtete sie zutiefst. Und wenn man bei Dunkelheit aufgegriffen wurde, konnte man leicht zusammengeschlagen werden. Daran hatte er vorhin kaum gedacht.
Rochus reichte ihm einen Becher Rotwein. »So, und was sind deine Pläne für die nähere Zukunft?« Er befreite einen zweiten Sessel von einem Stapel Dokumenten und ließ sich mit steifen Bewegungen Gerhard gegenüber nieder.
[27] Gerhard kostete von dem Wein. Der war kühl und süß. »In Löwen haben sie mir für mein Gefühl allzusehr auf die Finger gesehen, bei allem, was ich machte oder las oder schrieb oder auch nur dachte…«
Rochus nickte bedächtig. »Für einen, der nicht der Kirche angehört, ist es auch nicht ungefährlich, über die Dinge nachzudenken.«
Jetzt machte Monachus zum erstenmal den Mund auf. »Auch für diejenigen, die der Kirche angehören, bisweilen nicht«, sagte er in neutralem Ton.
»Aber ich bin Christ!« entgegnete Gerhard.
»Das bezweifelt niemand.« Rochus lächelte kurz. »Aber damit gehörst du noch lange nicht der Kirche an.«
Gerhard leerte seinen Becher zur Hälfte und sagte: »Sie können manchmal so verdammt anmaßend sein…« Es klang eher unglücklich denn rebellisch.
»Das sind alle, die absolut davon überzeugt sind, recht zu haben. Eine conditio sine qua non, um sich nicht die Wahrheiten anderer anhören zu müssen.« Rochus deutete mit dem Daumen zur Decke. »Ich habe ein Teleskop angefertigt, kann ich damit dein Interesse wecken?«
»Mein Gott, ja!«
»Zum Auffangen des Bildes habe ich ein schwach vergrößerndes Brillenglas verwendet. Stellst du dann mit einem starken Vergrößerungsglas den Brennpunkt scharf ein, kannst du das Bild zigfach vergrößert sehen. Das Ergebnis ist erstaunlich.«
Gerhard vergaß sofort, was ihn gerade noch beunruhigt hatte, und folgte dem Gelehrten auf den Dachboden des Hauses, der als Observatorium eingerichtet war.
[28] Monachus, der nicht mitging, sah Gerhard grüblerisch nach.
Der Dachboden verfügte über ein ungewöhnlich großes Dachfenster, unter dem das schwarz gestrichene hölzerne Fernrohr im Kerzenlicht glänzte. An einer der Wände hing eine große Sternkarte, die Rochus selbst gezeichnet hatte und die er anhand seiner Beobachtungen regelmäßig überarbeitete. Den größten Teil des kleinen Raums nahm ein robuster Tisch ein, auf dem allerlei Instrumente lagen, zum Beispiel ein geometrischer Quadrant und ein Jakobsstab für Winkelmessung und Abstandsbestimmung. Und mitten auf dem Tisch prangte eine Federzuguhr.
»Die stellen sie in Gent her«, sagte Rochus, als er Gerhards neugierigen Blick sah. »Ein schönes Stück Mechanik, und äußerst praktisch.« Er leuchtete sich mit einer Kerze und öffnete ein Türchen im kupfernen Sockel der Uhr. »Schau, die Feder ist in einen drehbaren Zylinder gefaßt, um den sie eine Schnur gewunden haben. Die ist an diesem Konus an der Achse des ersten Rädchens befestigt, der Schnecke dort, siehst du? Beim Aufziehen wird die Schnur vom Zylinder auf die Achse gewickelt. Ist die Feder ganz aufgezogen, greift die Schnur am schmalsten Stück der Achse an, und dann immer weiter zum breitesten Teil hin, bis die Feder abgelaufen ist. So haben sie die nachlassende Zugkraft der Feder gleichmäßig über die gesamte Laufzeit verteilen können. Die auf die erste Achse einwirkende Kraft bleibt immer gleich, und die Uhr geht richtig. Genial, nicht wahr?« Behutsam schloß er das Türchen wieder. »Hat man die Mechanik einmal richtig gestellt, nach einer Sonnenuhr oder einer Sanduhr, ist sie sehr verläßlich.« Er zeigte in eine [29] Ecke des Dachbodens. »Das dort ist eine Armillarsphäre von Johann Wagner.«
»Was für eine herrliche Konstruktion!« sagte Gerhard, der die Ringkugel in ihrem kunstvoll verzierten Ständer in der dunklen Ecke zunächst gar nicht bemerkt hatte. Mit an Ehrfurcht grenzender Bewunderung fuhr er mit den Fingerspitzen über die vergoldeten Messingringe.
»Eine räumliche und greifbare Wiedergabe des ptolemäischen Systems. Hat ein riesiges Loch in meinen Geldbeutel gerissen, aber ich freue mich, daß ich sie habe.«
»Welche Befriedigung es doch sein muß, solche Instrumente bauen zu können.«
»Hm, meine Befriedigung liegt eher in ihrer Benutzung.« Rochus warf einen Blick durch das Okular seines Fernrohrs. »Ein jeder, der unter Hochmut und Arroganz leidet, sollte das einmal sehen können.« Er trat einen Schritt zur Seite und bedeutete Gerhard, daß er seinen Platz einnehmen solle. »Mit diesem Ring hier stellst du scharf.«
Gerhard folgte seiner Anweisung, und im nächsten Moment benahm es ihm buchstäblich den Atem. »Allmächtiger!« stieß er überwältigt hervor.
»Das ist die denkbar beste Umschreibung«, stellte Rochus ruhig fest.
»Es ist, als… es ist, als werfe man einen Blick in die Ewigkeit.«
Rochus lächelte vage. »Genau das tust du gerade, junger Freund.«
»Was für ein Sternenmeer!«
»In der Tat, es wird noch viele Jahre dauern, sie alle zu kartieren, falls das überhaupt je gelingen sollte. Mit bloßem [30] Auge sieht man nur einen schwachen Abglanz dessen, was ich jetzt durch dieses Instrument beobachten kann. Und ich glaube, man könnte es noch viel besser und leistungsstärker machen.«
Gerhard ließ das Fernrohr los und kniff kurz die Augen zu. »Da dreht sich einem der Kopf, und es ist einem, als falle man gleich von der Erde hinunter.«
»Und dabei kannst du hiermit nur ein ganz kleines Stückchen vom Himmel sehen. Ein Fernrohr, das mit derselben Vergrößerung das gesamte Himmelszelt zeigen würde…« Rochus schüttelte den Kopf. »Vielleicht wäre man nach so einem Blick in die Ewigkeit ein für allemal dem Wahnsinn preisgegeben.«
Gerhard fuhr mit den Fingerspitzen über die Holzkonstruktion, wie er es zuvor bei der Armillarsphäre getan hatte. »Es bedarf schon großer Meisterschaft, um etwas so Wunderbares erfinden und anfertigen zu können«, sagte er neidisch. »Ebenso wie die anderen Instrumente hier.«
»Instrumente bauen ist ein Handwerk, das man erlernen kann, Gerhard. Vorausgesetzt, man bringt das nötige Talent dafür mit.«
»Meint Ihr, ich könnte es lernen?«
»Schon möglich, an Begeisterung scheint es dir jedenfalls nicht zu fehlen, und auch die ist sehr wichtig. In Löwen gibt es eine Abteilung, in der unter anderem der Bau von Schiffahrtsinstrumenten gelehrt wird. Ich könnte dich dort Gaspard van der Heyden vorstellen, einem äußerst versierten Goldschmied, der, soweit ich weiß, einen Erdglobus gebaut hat.«
Gerhard nickte vor sich hin, die Finger immer noch auf [31] der sich warm anfühlenden Ummantelung des Fernrohrs. Es scheint, als will mich das Schicksal nach Löwen zurückführen, dachte er. Er hatte jetzt schon zwei sehr gute Gründe dafür.
»Ich bin nach Antwerpen gekommen, um mich zu besinnen, wie meine weitere Zukunft aussehen soll«, sagte er zu Rochus. »Möglicherweise braucht diese Bedenkzeit gar nicht so lange zu dauern…«
[32] 2
»Lanzarote«, konstatierte Kapitän Manasse, »die nördlichste der Kanarischen Inseln.« Mit schwungvoller, selbstzufriedener Gebärde schob er sein Fernrohr zusammen. »Wir sind trotz des Ostwinds nur unwesentlich vom Kurs abgewichen.« Er gab das Fernrohr dem neben ihm stehenden Adelborst, der, eine Hand schützend über den Augen, gleichfalls in Richtung Süden gespäht hatte. »Nun, Herr Rochat?« Manasse betonte das »Herr« mit leichtem Spott. Er hielt nicht viel von Grünschnäbeln, die nur aufgrund ihrer Herkunft den Offiziersrang ansteuerten, bevor sie überhaupt mitbekommen hatten, wie salzig Meerwasser schmeckte. Und daß Julius Rochat überdies ein Bleichgesicht aus dem Norden war, machte es nur noch schlimmer.
Manasse selbst hatte sich seine jetzige Position hart erkämpfen müssen. Vor allem erbrüllt hatte er sie sich, seiner Besatzung zufolge, doch das wurde selten laut gesagt. Es sei denn zu den Ratten im Schiffsraum, wo sich die Mannschaft in schmutzigen Hängematten von der unmenschlichen Plackerei an Deck und in den Wanten erholen mußte.
Schweigend ergriff Julius das Fernrohr und schob es auseinander. Ein Auge zugekniffen, visierte er die Insel an, die kurz zuvor vom Ausguck im Krähennest gemeldet worden [33] war. Sie war nur ein Punkt am Horizont, hob sich aber durch ihr Weiß deutlich vom stahlblauen Himmel über der ebenso blauen See ab.
Julius ließ das Fernrohr sinken und spähte bedenklich zu den Marssegeln hinauf. Die ›Tempus Fugit‹ legte sich unter der steifen östlichen Brise stark auf die Seite, und die Masten knarrten aus Protest gegen die unerbittliche Hand des Rudergängers, der das Schiff dazu zu zwingen suchte, stets möglichst hart am Wind zu fahren, wofür die Takelung der Galeone nicht ausgelegt war.
Kaum einen halben Tag nach ihrer Abfahrt aus Lissabon waren sie in einen Regensturm geraten, und danach war der Wind ausgeschossen, so daß sie weiter aufs Meer hinausgetrieben waren als beabsichtigt. Bis jetzt hatten sie nicht das kleinste bißchen von der afrikanischen Westküste sehen können, so daß ihre tatsächliche Position schon nach wenigen Tagen Fahrt ziemlich unsicher zu werden begann. So dachte zumindest Rochat. Der Kapitän schien sich da weniger Sorgen zu machen oder tat zumindest so.
Zögernd sagte Julius: »Verzeiht, Kapitän, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das stimmt.«
»Na, wenn du es wärst, müßten wir ja wohl auch die Uniformen tauschen.« Der Kapitän gab sich keine Mühe, seine Worte durch ein Lächeln zu begütigen. Humor gehörte im übrigen auch nicht zu seinen Stärken.
Vielleicht hat es ja mit dem unscheinbaren Äußeren des Schiffers zu tun, daß er immer so auf Prinzipien herumreiten muß, dachte Julius gelegentlich. Manasse war einen halben Kopf kleiner als er und so mager, daß er seine Uniform in den Schultern ordentlich hatte auspolstern lassen, um [34] nicht gänzlich unsichtbar zu sein. So tuschelte man wenigstens außer Hörweite des Kapitäns unter der Besatzung. Einige behaupteten, sie hätten bei ihm schon den Wind durch die Knochen pfeifen hören.
Um Haltung zu wahren, spähte Julius erneut durch das Fernrohr. »Seit wir aus dem Sturm heraus sind, hatten wir eine konstante Abdrift von mindestens fünfzehn Grad, und wir kommen bei diesem Wind auch nicht gerade zügig voran. Wenn wir dann noch die östliche Strömung berücksichtigen, die…«
»Mein lieber Julius«, unterbrach ihn der Kapitän in einem Tonfall, der einem Rüffel nahekam, »du willst doch wohl nicht etwa meine Berechnungen anzweifeln!« Er nannte seine Offiziere nur beim Vornamen, wenn ihn etwas oder jemand irritierte.
»Verzeiht, Kapitän, aber es wird vorausgesetzt, daß ich eigenständige navigatorische Berechnungen anstelle und die dann überprüfe anhand…«
»Anhand der tatsächlichen Gegebenheiten«, sagte Manasse. Er grinste.
Julius nickte ergeben, während er das Fernrohr zuschob. »Meinen Berechnungen nach müßte jene Insel dort Madeira sein.«
»Das ist doch wohl nicht dein Ernst!« Der Kapitän schüttelte den Kopf. »Darf ich dich darauf hinweisen, daß Madeira fünfundsiebzig Meilen weiter westlich und mindestens ein Etmal nördlich der Kanarischen Inseln liegt?« Er nahm das Fernrohr, das Julius ihm zurückgab, und steckte sich das Instrument hinter seinen breiten Ledergürtel. »Ich fürchte, deine Beförderung muß noch auf sich warten lassen.« Ohne [35] den Blick zum Rudergänger zu wenden, rief er: »Was ist unser derzeitiger Kurs?«
»Zweihundertzehn Grad Süd, Kapitän.«
Manasse nickte zufrieden und sah Julius an. »Was ist der Kartenkurs von Lissabon zu den Kanarischen Inseln, Herr Rochat?«
Julius seufzte innerlich, antwortete aber gefügig: »Zweihundertzehn Grad Süd, Kapitän.« Manasse wußte natürlich so gut wie er, daß das Schiff unter den gegebenen Umständen nicht in die Richtung fuhr, in die der Steven zeigte. Durch die Einflüsse von Wind und Strömung bewegte es sich wie eine Krabbe, der Kurs durch das Wasser konnte um etliche Grad vom Kompaßkurs abweichen. Und so konnte die tatsächliche Position schon nach wenigen Tagen Fahrt himmelweit vom gegißten Schiffsort abweichen, ein Umstand, der schon viele Seeleute das Leben gekostet hatte.
Vielleicht stellt er mich nur auf die Probe, dachte Julius. Denn wenn Manasse wirklich so dumm wäre, hätte er niemals das Kommando über ein Marineschiff erhalten. Es konnte natürlich auch schlichte Halsstarrigkeit sein. Was die heikle Frage aufwarf, was Julius nun tun sollte, um sich möglichst wenig Minuspunkte einzuhandeln.
Als hätte Manasse Julius’ Gedankengang mitverfolgt, sagte er: »Die See sieht schmierig aus, was darauf hindeutet, daß wir immer noch in Landnähe sind. Überdies lag heute morgen Wüstensand an Deck, Sand aus der Westsahara, würde ich meinen. Des weiteren schmilzt die Butter, wir dürften uns also erheblich weiter im Süden befinden, als du berechnet hast.« Er sah Julius herausfordernd an. »Aber du bleibst dabei, daß wir vor Madeira liegen?«
[36] »Es wird höchste Zeit, daß eine Methode gefunden wird, nach der man die geographische Länge, auf der man sich befindet, jederzeit exakt bestimmen kann, dann wären derlei Diskussionen nicht mehr nötig.« Eine geschickte ausweichende Antwort, bescheinigte Julius sich selbst.
»Diskussionen, Herr Rochat? Diskussionen?«
Einen Moment lang war Julius’ Verärgerung über den hochmütigen Ton des anderen größer als seine Vorsicht. »Mit Verlaub, Kapitän, aber bekanntlich kann es doch vorkommen, daß Wüstensand viele Hunderte Meilen weit mitgeführt wird, sowohl über Land wie über das Meer. Und Butter beginnt häufig schon auf der Höhe von Portugal zu schmelzen, das habe ich selbst feststellen können.«
Ehe der Kapitän etwas erwidern konnte, wurde seine Aufmerksamkeit abgelenkt, weil der Rudergänger aus Unachtsamkeit zu hoch am Wind steuerte. Die Lateinsegel an den hinteren Masten blieben stehen, doch das Großsegel und die Fock fielen kurz ein, um gleich darauf, als der Steuermann seinen Fehler bemerkte und das Schiff hastig abfallen ließ, mit einem gewaltigen Knall wieder Wind zu fangen. Die Masten knarrten beängstigend, und das Schiff krängte einen Moment lang so stark, daß die Offiziere auf dem Achterkastell einen Halt suchen mußten, um nicht zu stürzen.
Ohne sich umzudrehen, kommandierte der Kapitän: »Zehn Stockschläge für den Rudergänger, und laß diesen Stümper ablösen. Jetzt sofort!«
Julius gab den Befehl weiter. Ausnahmsweise konnte er Manasse nur beipflichten. Bei der herrschenden steifen Brise und dem Kurs, den sie fuhren, konnten sich Steuerfehler im Nu verhängnisvoll auf die Takelage auswirken.
[37] Als wenn nichts geschehen wäre, griff der Kapitän ihre vorherige Diskussion wieder auf. »Ihr wollt mir also meine Autorität absprechen, wenn ich Euch recht verstehe«, stellte er in formellem Ton fest.
»Ganz und gar nicht, Kapitän«, entgegnete Julius. »Ich versuche nur, mein Wissen und meine begrenzte Erfahrung zu evaluieren, indem ich sie der Euren, die so viel größer ist, gegenüberstelle. War das nicht der Zweck meiner Ausbildung?« Es hatte zwar ein Weilchen gedauert, doch allmählich bekam er die Kunst des Arschkriechens in den Griff, fand Julius. Wenn er auch nicht so recht wußte, ob er sich darüber freuen sollte.
Manasse nickte langsam vor sich hin. Dann schlug er urplötzlich vor: »Wollen wir eine Wette darüber abschließen? Wenn das dort hinten die Kliffküste von Madeira ist…«, er verzog kurz das Gesicht, »…dann werde ich Euch der Admiralität zur Beförderung vorschlagen, anstatt meinen Bericht mit einer negativen Bemerkung zu versehen. Erkennen wir nachher freilich die Umrisse Lanzarotes und nicht Madeiras, dann ereilt Euch die gleiche Strafe wie den unachtsamen Steuermann.«
Julius zögerte kurz, bevor er unsicher antwortete: »Ich bin kein Glücksspieler, Kapitän.«
»Wenn Ihr so überzeugt seid, daß Ihr recht habt, handelt es sich nicht um ein Glücksspiel, Herr Rochat.«
Das gilt auch für ihn, dachte Julius unbehaglich. Die Selbstsicherheit des anderen ließ ihn plötzlich an sich selbst zweifeln. Freilich lockte ein lohnender Gewinn, falls er doch recht behalten sollte. Und wenn nicht… ach, zehn Stockschläge hatten noch keinen umgebracht. Obwohl natürlich [38] um einiges härter zugeschlagen wurde, wenn es sich um einen Offizier handelte, darauf konnte er sich gefaßt machen. »Und ich würde nicht unbedingt Mut beweisen, wenn ich die Wette ablehnte, nicht wahr, Kapitän?«
»So ist es.« Manasse griff zu seinem Fernrohr und richtete es auf die allmählich größer werdende Insel in der Ferne.
Julius erstarrte, als er sah, wie sich der rechte Mundwinkel des Kapitäns zu einem befriedigten Lächeln kräuselte.
»Aus wie vielen Inseln besteht Madeira noch gleich, Herr Rochat?«
»Äh… nur einer, dachte ich?«
Manasse nickte und reichte Julius das Fernrohr. »Möglicherweise ist es eine Fata Morgana, das kann man auf See nie wissen, aber ich sehe hinter der ersten eine zweite, allem Anschein nach viel größere Insel auftauchen. Könnte das nicht vielleicht Fuerteventura sein, Herr Rochat? Oder sollten wir noch weiter abgedriftet sein, als selbst Ihr zu vermuten wagtet, und nähern uns womöglich gar den Azoren?«
Sobald Julius das Okular auf sein Auge eingestellt hatte und das Bild scharf war, sah er, daß der Kapitän recht gehabt hatte. Er seufzte und ließ das Fernrohr sinken. »Ich verstehe das nicht…«
»Die Besatzung wird sich freuen«, bemerkte Manasse in neutralem Ton.
»Was habe ich falsch gemacht?«
»Ihr habt Euer eigenes Wissen überschätzt, Herr Rochat.«
»Ihr sagt es mir also nicht«, stellte Julius resigniert fest.
»Ich halte es für besser, wenn Ihr selbst auf die Dummheit kommt, die Euch Schiff und Besatzung kosten könnte, [39] wenn Ihr das Kommando hättet. Was wohl glücklicherweise niemals der Fall sein wird.« Der Kapitän steckte sich das Fernrohr wieder hinter seinen Gürtel. »Und sagt dem neuen Steuermann, daß er mindestens fünf Strich höher halten muß.« Er schüttelte den Kopf. »Schwachköpfe allesamt…«
In dem Moment rief der Ausguck aus dem Krähennest: »Schiff in Sicht!«, und zeigte mit ausgestrecktem Arm nach Osten.
»Es sind drei Schiffe«, stellte Manasse gleich darauf fest, als er durch sein Fernrohr in die angegebene Richtung spähte. »Galeassen, Türken wahrscheinlich.« Mit gefurchter Stirn ließ er das Fernrohr sinken.
»Türken?« fragte Julius verwundert. »Hier? Ist ihnen das Mittelmeer etwa nicht groß genug?«
Der Kapitän überhörte ihn. »Sie fahren einen raumeren Kurs als wir, sind also um einiges schneller. Außerdem haben sie Ruderer.« Er klang verbissen. »Wollen uns offensichtlich den Weg nach Lanzarote abschneiden, diese Prahlhänse.«
»Aber wir befinden uns doch nicht im Krieg mit ihnen?«
»Die Türken machen mit jedem Krieg, das sind verdammte Kaper ohne Kaperflagge.«
»Aber welche Beute erhoffen sie sich denn auf einem Marineschiff?«
»Seekarten, Herr Rochat. Überarbeitete und mit vielen Details versehene Seekarten, wie nur wir im Westen sie besitzen, um die geht es ihnen.«
Julius spähte nach Osten. Er hatte gute Augen und konnte die drei Schiffe als weiße Pünktchen gegen das Blau von Himmel und Wasser unterscheiden. Er hatte noch nie [40] ein Seegefecht mitgemacht und spürte, wie die Aufregung seinen Herzschlag beschleunigte.
»Wir haben drei Möglichkeiten«, erklärte Manasse. »Wir können alles auf eine Karte setzen und versuchen, in den Schutz der Kanonen von Lanzarote zu gelangen, bevor uns die Türken angreifen. Oder wir können die Flucht ergreifen. Wenn wir nach Westen abfallen, legen wir ausreichend an Geschwindigkeit zu, um ihnen davonzufahren. Aber dann verlieren wir so sehr an Höhe, daß Cabo Verde unerreichbar wird, solange der Wind nicht dreht. Und ich möchte mich dort gerne noch in diesem Monat der Flotte anschließen.«
»Und die dritte Möglichkeit, Kapitän?« fragte Julius beunruhigt.
Manasse sah ihn an, doch sein Blick war glasig, als sehe er durch den jungen Mann hindurch. »Wir könnten die Sache ausfechten. Sie sind zwar zu dritt und wendiger als wir, aber wir sind viel schwerer bewaffnet.«
»Vielleicht gibt es ja auch eine Zwischenlösung…«, warf Julius zaghaft ein.
Der Kapitän zog skeptisch eine Augenbraue hoch. »Ist Euer strategisches Talent genauso groß wie das navigatorische, Herr Rochat?«
»Wir könnten unseren Kurs beibehalten, bis wir mit Sicherheit wissen, ob sie schnell genug sind, um uns in der Tat den Weg abzuschneiden. Merken wir, daß wir Lanzarote nicht rechtzeitig erreichen können, bleibt immer noch die Möglichkeit, mit Kurs vor dem Wind vor ihnen zu fliehen, bevor wir in ihrer Schußweite sind.«
Manasse nickte mit gespitzten Lippen. »An sich keine schlechte Idee, doch die Sache hat einen kleinen Haken.«
[41] »Äh… ja?«
Manasse hob die Nase in die Luft. »Was, wenn uns der Wind im Stich läßt?«
»Der Wind bläst schon tagelang mit gleichbleibender Stärke aus derselben Richtung.«
»Was rein rechnerisch die Wahrscheinlichkeit erhöht, daß eine Veränderung ansteht.«
Julius ließ die Schultern hängen. »War nur so eine Idee, Kapitän…«
Manasse nickte. »Die einmal mehr beweist, daß kein Kapitän in Euch steckt.«
»Nur, weil ich nicht…«
Manasse schnitt Julius mit einer ungeduldigen Gebärde das Wort ab. »Mangelnder Schneid, Herr Rochat. Mangelnder Schneid. Als ich noch in Eurer Position war, hätte mich kein Kapitän von einer Meinung abbringen können, von der ich selbst überzeugt war.«
Stockschläge sind ein effizientes Mittel gegen zuviel Schneid, dachte Julius, doch er schwieg ergeben.
»Sagt dem Rudergänger, daß er den Kurs halten soll«, kommandierte Manasse, als Julius nicht reagierte. Er zog eine Grimasse. »Wollen doch mal sehen, was Eure strategischen Fähigkeiten in der Realität taugen, Herr Rochat.« Er richtete sein Fernrohr auf die Galeassen im Osten. »Und danach geht Ihr nach unten und trefft die nötigen Vorbereitungen, daß wir notfalls blitzschnell alle Karten und Aufzeichnungen vernichten können.«
Julius war erleichtert, daß er kurz das Kommandodeck verlassen konnte, wenn es ihm auch merkwürdig erschien, daß der Kapitän ihn in einem solchen Augenblick [42] wegschickte. Bis er in dessen Kajüte kam und den Blick über die auf dem großen Tisch ausgebreitete Seekarte wandern ließ. Da ging ihm ein Licht auf. Manasse wollte ihm einfach die Gelegenheit geben, herauszufinden, warum er mit seiner Ortsbestimmung so weit danebengelegen hatte.
Julius beugte sich über die Karte und starrte auf die überreich ausgeschmückte Windrose in der rechten oberen Ecke. Auf der Karte war zu vieles, was die Aufmerksamkeit ablenkte. Dinge, die nichts mit der Navigation zu tun hatten: kunstvoll und detailliert gezeichnete Ungeheuer wie Drachen und Seeschlangen, geflügelte Fische, die mythologischen Figuren der Tierkreiszeichen, lateinische Spruchweisheiten und Ermahnungen… Faktisch waren die Umrisse von Festland und Inseln wesentlich vager und ungenauer gehalten als alle diese unnötigen Dekorationen. Vieles davon war freilich obligatorisch, wie Julius wußte. Die allgewaltige kirchliche Macht stellte auch ihre Ansprüche an die Kartographen. So waren Wissenschaftler und Zeichner genötigt, zwischen Obligatorien und wirklich Bekanntem zu lavieren.
Julius stemmte sich am Tisch ab, als das hohe Achterschiff der ›Tempus Fugit‹ auf der Dünung ziemlich brüsk schlingerte. Eine große Öllampe aus Messing, die über seinem Kopf an einem Decksbalken aufgehängt war, schwang bedrohlich hin und her. Er konzentrierte sich auf die auf der Karte verzeichneten Daten. In einem der lateinischen Erläuterungstexte am Kartenrand war in der linken unteren Ecke von Strömungen in diesem Teil des Ozeans die Rede, wie sie schon häufig von Besatzungen europäischer Kauffahrer, die um Afrika herum nach Indien fuhren, beobachtet worden waren.
[43] Plötzlich schlug sich Julius mit der Hand vor die Stirn. »Du törichter…« Er schüttelte den Kopf. Vielleicht hatte Manasse ja recht. Vielleicht eignete er sich wirklich nicht zum Kapitän. Darüber hatte er sich eigentlich nie Gedanken gemacht, wurde ihm plötzlich bewußt. Bestimmte Umstände hatten dazu geführt, daß er dorthin gelangt war, wo er jetzt stand, und er hatte sich noch nie gefragt, wie es denn weitergehen und wie seine Zukunft aussehen sollte. Daß die militärische Disziplin ihm trotz seiner Privilegien als Adelborst nicht sonderlich zusagte, stand fest. Falls er denn überhaupt Kapitän werden wollte, sah er sich eher auf der Brücke eines Handelsschiffes. Oder noch besser auf einem Schiff, das auf Entdeckungsreise in neue Welten auszog…
»Wenn von der Windrichtung die Rede ist, ist die Richtung gemeint, aus der der Wind kommt«, sagte er zu Manasse, als er wieder neben diesem auf dem Achterkastell stand. »Strömungen dagegen werden nach der Richtung benannt, in die sie führen. Darin lag mein Fehler: Ich dachte, die Strömung hier verliefe von Ost nach West, während es genau andersherum ist. Ich hätte die Strömung von der Winddrift abziehen müssen, anstatt sie zu addieren. Das ist aber auch reichlich verwirrend, wieso benennt man Wind- und Strömungsrichtung nicht auf die gleiche Weise?«
Der Kapitän antwortete nicht. Er spähte durch sein Fernrohr zu den türkischen Schiffen hinüber. Sie waren sichtlich näher gekommen. Es würde eine äußerst knappe Angelegenheit werden, noch rechtzeitig in den Schutz der Kanonen von Lanzarote zu gelangen.
Ohne den Blick von den Schiffen in der Ferne abzuwenden, fragte Manasse: »Unten alles klar?«
[44] Julius hatte die Karten und alle Papiere, die er hatte finden können, mit Schießpulver bestreut und ein Zunderkästchen bereitgestellt. »Ein Funke, und alles ist dahin«, versicherte er.
»Gut.« Manasse gab Julius das Fernrohr. »Was denkt Ihr, Herr Rochat?«
»Sie kommen rasch näher«, antwortete Julius, der dafür kein Fernrohr benötigte. Die drei Galeassen fuhren nun mal einen viel günstigeren Kurs als die ›Tempus Fugit‹.
»Danach hatte ich nicht gefragt.«
»Ich denke, es steht Spitz auf Knopf.«
»Bitte?«
»Ich meine… ich bin mir noch nicht sicher, ob wir es schaffen werden oder nicht, Kapitän.«
»Hm… Es ist fabelhaftes Wetter für ein Gefecht. Ich würde mit dem größten Vergnügen ein paar dieser verfluchten Heiden versenken oder sie wenigstens in ihr Mittelmeer zurückjagen. Diese dreckigen Diebe haben hier nichts zu suchen.« Der Kapitän verschränkte die Hände auf dem Rücken und wippte ungeduldig auf seinen Fußballen.
»Wir können noch ein Weilchen abwarten.«
Manasse nickte. »Wollen wir wetten? Wenn wir es schaffen, werden Euch die zehn Stockschläge erlassen. Schaffen wir es nicht, bekommt Ihr zwanzig.«
»Habe ich eine Wahl, Kapitän?«
Manasse grinste freudlos. »Nein«, sagte er. Und gleich darauf: »Laßt für alle Fälle die Steuerbordkanonen bemannen.«
In dem Moment, da Julius den Befehl weitergab, fühlte er eine Bewegung durch das Deck unter seinen Füßen gehen. Beide Großmarssegel schlugen kurz, und die ›Tempus [45] Fugit‹ richtete sich aus ihrer Seitenlage auf. Masten und Stagen knarrten, als der Druck auf die Takelage nachließ.
Manasse sah Julius ausdruckslos an. »Hatte ich vorhin nicht von der Unberechenbarkeit des Windes gesprochen, Herr Rochat?«
Julius überlief es eiskalt, als er zum Großsegel blickte und sah, wie es seine straff gerundete Form verlor. Die Geschwindigkeit des Schiffes nahm spürbar ab.
»Alle Kanonen bemannen und laden«, sagte der Kapitän in beinahe normalem Gesprächston. Er wirkte plötzlich völlig emotionslos, und das fand Julius um einiges beunruhigender, als wenn er geschimpft und geschrien hätte. »Bewaffnet die Besatzung, und laßt die Enternetze spannen.« Manasse blickte zu den Wimpeln in den Mastspitzen. »Zum Manövrieren reicht der Wind noch aus, vorerst zumindest. Da wollen wir dem Lumpenpack doch mal zeigen, was kämpfen heißt.«
Julius gab die Ordern weiter und richtete das Fernrohr auf die türkischen Galeassen. Die Schiffe hatten den Kurs geändert und kamen jetzt geradewegs auf sie zu, angetrieben von langen Rudern, die in flinkem Rhythmus ins Wasser bissen. Die Türken machten sich nicht die Mühe, sich zu verteilen.
»Um auf uns feuern zu können, müssen sie beidrehen, sobald sie in Schußweite kommen«, sagte Manasse. »Und dann geben wir eine volle Breitseite.«
Die Galeassen waren auch mit einem beeindruckenden Rammsporn ausgestattet, wie Julius nun sah. Vielleicht wollten sie ja den einsetzen, und nicht ihre Kanonen. Doch da er sich nicht vorstellen konnte, daß Manasse das nicht berücksichtigt hatte, hielt er wohlweislich den Mund.
[46] Der Kapitän wippte erneut ungeduldig auf den Zehen, die Hände auf dem Rücken verschränkt. »Laßt Pulverfäßchen mit Lunten präparieren«, kommandierte er. »Die werfen wir ihnen auf die Schiffe, wenn sie es wagen sollten, uns zu entern.« Und noch während Julius die Order durch den dritten Offizier an die Besatzung weitergeben ließ, die auf dem Deck in fieberhafte Aktivität ausgebrochen war, fügte der Kapitän hinzu: »Und laßt Vorkehrungen dafür treffen, daß wir das Schiff in die Luft jagen können, falls wir den kürzeren ziehen. Ich werde mich diesen Hundsföttern nicht ergeben, nie im Leben!« Und als Julius kurz zögerte: »Lieber mit Zunder unterm Arsch ans Himmelstor gelangen als von diesen Barbaren langsam zu Tode gefoltert werden, Herr Rochat!« Mit Zornesfalte auf der Stirn spähte er zu den sich nähernden Galeassen hinüber. »Eine Salve aus allen Geschützen an Steuerbord. Sie sind noch außer Reichweite, aber sie sollen sich ruhig schon mal in die Hosen scheißen. Wenn sie überhaupt welche anhaben!«
Kurz darauf ließ ein zwanzigfacher Donnerschlag die ›Tempus Fugit‹ erzittern. Der schwach gewordene Wind blies beißenden Pulverqualm über die Decks. Etwa auf halber Strecke zwischen dem Schiff und den Galeassen ließen die ins Meer einschlagenden Kanonenkugeln Wasserfontänen aufspritzen. Die türkischen Schiffe rückten ihnen mit gleichbleibender Geschwindigkeit näher.
»Die Richtung stimmt genau«, stellte Manasse fest. »Sobald sie in Schußweite sind, können sie was erleben, wenn sie so dumm sind, sich nicht zu verteilen.«
In dem Moment schrie der Ausguck aus dem Krähennest [47] ein weiteres Mal, daß ein Schiff in Sicht sei. Diesmal zeigte er vor den Bug.
Der Kapitän riß Julius das Fernrohr aus der Hand und spähte einige Sekunden in Richtung Lanzarote. Dann gab er Julius das Instrument zurück. »Deus ex machina«, sagte er. »Die vierte Option, die ich vorhin nicht zu erwähnen wagte, obgleich sie mehr oder weniger auf der Hand lag.«
Als Julius das Fernrohr ausrichtete, sah er, daß sich zwei spanische Galeonen von der Insel lösten und auf sie zuhielten. Sie kamen zwar nur langsam voran, doch die Distanz war nicht mehr allzugroß. Sie würden mit Sicherheit rechtzeitig dasein, um einzugreifen, falls es zu einem Aufeinandertreffen mit den türkischen Schiffen kommen sollte.
»Die ›Mexoco‹ und die ›Córdoba‹. Ich vermutete bereits, daß sie hier auf uns warten würden.« Manasse klang befriedigt, als hätte er das alles so eingefädelt.
Die Besatzung unter dem Enternetz auf dem Oberdeck brach in Jubelgeschrei aus. Die drei türkischen Schiffe wendeten den Steven. In Kiellinie nahmen sie Kurs nach Norden.
»Feiglinge«, sagte Manasse verächtlich. »Schade, daß wir keine Ruderer haben.«
Von einer der Galeonen, die von der Insel her nahten, wurde ein Kanonenschuß abgefeuert, und man hißte Signalflaggen.
»Pech, Herr Rochat«, sagte der Kapitän, das Fernrohr am rechten Auge. Seine Stimme klang wieder leicht spöttisch. »Die Fleischtöpfe der Kanarischen Inseln bleiben Euch vorenthalten, wir haben Order, gleich nach Cabo Verde weiterzufahren.« Er blickte zum Himmel empor. »Hoffen wir, daß der Wind dreht und auflebt.«
[48] Julius nickte stumm. Das ging ihm alles ein bißchen zu schnell, die Aufregung steckte ihm noch in den Knochen. Er schluckte kurz und fragte: »Soll ich die Karten und Dokumente wieder in Ordnung bringen, Kapitän?«
»Eine gute Idee. Aber tut mir bitte den Gefallen, und steckt das Ganze nicht versehentlich in Brand.« Wie gewöhnlich lächelte Manasse dabei nicht.
»Ich werde mir Mühe geben, Kapitän«, antwortete Julius verdrießlich.
Bevor er verschwinden konnte, fragte Manasse noch: »Ach, Herr Rochat, hättet Ihr die zwanzig Stockschläge lieber morgens oder abends?«