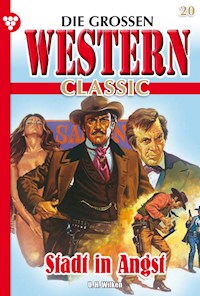Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Sie lauern am Fluß. Das sind verwegene wilde Burschen. Sie wissen, um was es geht. Darum halten sie schwere Colts und weitreichende Gewehre bereit. Diese Hombres aus Mexiko wollen töten. Noch schweigen die Waffen. Die Mexikaner haben den Mann im Fluß noch nicht bemerkt. Hufschlag lenkt sie ab. Hinter der Baumkette am Fluß bewegen sich zwei Reiter. Dumpf klopft der Hufschlag näher – doch der Mann im Wasser hört ihn nicht. Mit kraftvollen Bewegungen schwimmt er gerade zum Ufer hin. Dieser Mann ist Bronson. Schwungvoll steigt der große, sehnige Bronson ans Ufer. Sonnenschein fällt auf den bloßen Körper. Hellbraun glänzt die nasse Haut. Wohlig streckt und reckt er sich. Bronson ist mehr als nackt. Denn sein Colt steckt im schwarzen Leder. Und das hängt mit den Kleidungsstücken am Sattel. Wild schüttelt er das Wasser aus den Haaren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 337 –
Stirb du zuerst!
Unveröffentlichter Roman
U.H. Wilken
Sie lauern am Fluß.
Das sind verwegene wilde Burschen. Sie wissen, um was es geht. Darum halten sie schwere Colts und weitreichende Gewehre bereit.
Diese Hombres aus Mexiko wollen töten.
Noch schweigen die Waffen.
Die Mexikaner haben den Mann im Fluß noch nicht bemerkt. Hufschlag lenkt sie ab. Hinter der Baumkette am Fluß bewegen sich zwei Reiter.
Dumpf klopft der Hufschlag näher – doch der Mann im Wasser hört ihn nicht. Mit kraftvollen Bewegungen schwimmt er gerade zum Ufer hin.
Dieser Mann ist Bronson. Schwungvoll steigt der große, sehnige Bronson ans Ufer. Sonnenschein fällt auf den bloßen Körper. Hellbraun glänzt die nasse Haut.
Wohlig streckt und reckt er sich.
Bronson ist mehr als nackt. Denn sein Colt steckt im schwarzen Leder. Und das hängt mit den Kleidungsstücken am Sattel.
Wild schüttelt er das Wasser aus den Haaren. Barfuß geht er in den Halbschatten. Stille umgibt ihn. Nur der Wind ist da und raunt in den Baumkronen.
Plötzlich weiß er, daß er nicht mehr allein ist. Rasch dreht er sich um, greift unwillkürlich an die nackte Hüfte.
Sie steht drei Schritt vor ihm – blutjung und schön. Der Wind spielt mit ihrem langen schwarzen Haar, bauscht etwas den Reitrock.
»Oh!« entfährt es ihm.
Er macht erst gar nicht mehr den Versuch, seine Blöße zu verdecken.
Das gefällt ihr wohl…
Denn sie lächelt und sagt: »Oho – das ist aber ein starkes Stück!«
»Ach, ja?« dehnt er und grinst, ist ganz hingerissen von ihr und vergißt sein Nacktsein.
Sie reibt sich die Stupsnase und blickt auf das hell funkelnde Wasser hinaus. Dann nickt sie vor sich hin.
»Das ist ja schön hier«, meint sie. »Da bekomm ich Lust.«
Schon entkleidet sie sich und wirft ihm die Sachen zu. Er fängt sie auf und bekommt immer größere Augen.
»Häng sie auf«, sagt sie, läuft an ihm vorbei und wirft sich ins Wasser, holt tief Luft und taucht.
Er überlegt keine Sekunde, schleudert die Sachen weg und springt dem mexikanischen Traummädchen nach. Diesmal kann ihn das Wasser nicht mehr kühlen. Das Feuer in ihm ist heißer als die Sonne.
Er taucht hinterher, bekommt sie zu fassen. Sie tauchen auf und stehen sich im Wasser gegenüber. Da wirft sie sich ihm in die Arme. Wild küssen sie sich, umschlingen einander und gleiten unter Wasser.
Nicht lange bleiben sie im Fluß. Die Erde hat sie wieder. Bronson fragt nicht, warum das alles so ist. Dies alles kann nur ein Wahnsinnszufall sein – und das ist es auch!
Sie aalt sich unter Bronson. Ihre schlanken zarten Hände kraulen seinen Nacken. Sie genießt seine Bewegungen. Flimmernder Glanz ist in ihren Augen. Naß ist die Haut, gibt Wärme ab. Geben und Nehmen macht beide glückselig. Es ist schön, zu leben.
Hufschlag entfernt sich langsam hinter den Bäumen am Fluß im Tal.
Bronson horcht und gleitet zur Seite. Das Mädchen beruhigt ihn.
»Das ist Rio«, haucht es, »mein Bruder Rio.«
Da küßt er sie wieder, und sie schmiegt sich an ihn.
Sein Pferd trottet näher und blickt über einen Strauch hinweg auf die beiden, stampft auf und prustet.
Grimmig ruckt Bronson hoch.
»Hau ab, Kerl, such dir selber eine!«
Das Mädchen kichert, will sich beherrschen und erreicht das Gegenteil: Hell lacht es auf, strampelt mit den Beinen und zieht Bronson zu sich herunter. Beide rollen durch den warmen Sand und sind wie glückliche Kinder, die Vater und Mutter spielen.
Dann liegen sie still nebeneinander. Jeder hat seinen Arm um den Nacken des anderen gelegt. Über ihnen bewegen sich die Blätter der Birken sonnenhell im Wind.
Die Frage hat ihm schon lange auf den Lippen gelegen. Jetzt spricht er sie aus: »Warum ist dein Bruder Rio nicht an den Fluß gekommen?«
»Rio wird bald zurückkommen – mit ein paar Cowboys. Niemand wird dir was tun. Nicht Rio, nicht die Cowboys, nicht die …« Sie verstummt, weil sie nichts verraten will. Seufzend räkelt sie sich. »Möchtest du nicht wissen, wer ich bin?«
»Nein. Wie heißt du denn?«
»Luisa.«
»Du hast einen wunderschönen Namen – Luisa. Ich heiße Bronson.«
Sie zieht den Arm unter ihm weg und beugt sich mit dem Oberkörper über ihn.
»Bronson – das ist auch ein schöner Name. Du bist ein flotter Bursche, Bronson.« Sie streichelt seine Brust und blickt auf einmal irgendwie wehmütig auf den Fluß. Dort steigen schon die Abendnebel. »Eigentlich schade, Bronson – wir werden uns niemals wiedersehen. Ich geh fort.«
»Zum Teufel – wohin, Luisa?«
»Das, zum Teufel, sag ich dir nicht.« Sie lacht wieder, springt auf und verschwindet zwischen den Strauchgruppen und Bäumen.
Als er sie erreicht, steht sie wieder in Rock und Bluse vor ihm. Er findet sie ganz hinreißend schön und zauberhaft.
Sie sieht auf den Feuerball der sinkenden Sonne.
»Gleich wird es kühl. Vergiß nicht, dich anzuziehen, Bronson…«
»Aah, ja«, sagt er und beginnt damit, »und dann?«
»Nichts dann.« Energisch schüttelt sie den Kopf. Das lange schwarze Haar wirbelt über die Schultern. »Du mußt mich vergessen, Bronson!«
»He, das geht aber nicht so einfach. Wir haben uns geliebt!«
»Ja – und das war sehr, sehr schön, Bronson.« Sie kommt zu ihm und bleibt dicht vor ihm stehen. Wie scheu hebt sie die Hand. Weich streichelt sie sein sonnengebeiztes Gesicht. Melancholisch blickt sie ihn an. Ihr Blick versinkt in seinen Augen. »Es war so was wie ein Abschied, Bronson…«
»O Mann, o Mann, das kann doch nicht dein Ernst sein, Luisa!«
»Es ist mein Ernst.« Luisa wendet sich schon ab. »Adios, Bronson. Leb wohl, mein Freund.« Sie tritt an ihr Pferd heran, zieht sich in den Sattel und sitzt wie ein Vaquero drauf. Ihr Blick ist traurig, doch warnend ist ihre Stimme: »Wünsche dir nicht, mir noch einmal zu begegnen, Bronson! Bitte, vergiß mich!«
Aus dem Stand treibt sie das Pferd zu einem wilden Galopp an und rast schräg durch die Baumkette. Schon verschwindet sie hinter den Schattenfeldern. Schnell verliert sich der trommelnde Hufschlag.
Bronson weiß nicht, daß Luisa gar nicht weit wegreitet.
Das Glück ist zerronnen.
Die Sonne geht unter, und Bronson steigt in den Sattel und reitet aus dem Nebelfeld des Flusses hervor.
Da hört er Hufschlag.
Viele Reiter kommen näher. Noch sind sie nicht zu sehen. Der Bodennebel dämpft das Hufgetrappel. Was hinter der Nebelbank geschieht, sieht er nicht.
Luisas Bruder Rio reitet mit vielen Cowboys durch das Tal und bleibt dabei in der Nähe des Flusses.
Und am Fluß lauern die Hombres aus Mexiko noch immer.
Sie hören die näherkommenden Reiter und packen wieder die Colts und Gewehre. Der Tod wartet in den Läufen.
Bronson reitet langsam und sucht nach Luisa. Er will den Reitern nicht begegnen. Was auch geschehen wird – er wird das Mädchen Luisa nicht so schnell vergessen. Er kann das nicht und will es auch nicht.
Gleich wird es geschehen…
Die Nebel verbergen so vieles.
Bronson rückt am schwarzen Leder. Der Colt sitzt richtig in dem Halfter. Die Winchester steckt im Gewehrschuh am Sattel. Er kann schnell danach greifen.
Auf der Suche nach Luisa gerät er zwischen zwei Fronten.
Luisa hat ihn gewarnt.
Plötzlich hört Bronson eine gellende Stimme. Er zuckt beim schrillen Ton heftig zusammen. Das ist Luisa! Sie schreit nur kurz auf, dafür aber laut und durchdringend.
Dann brüllt ein Mann.
Und dann krachen Schüsse, blitzen Mündungsfeuer auf. Orangerote Feuerlanzen durchstoßen die Nebelwand. Pferde wiehern kläglich und schmerzerfüllt. Männer fallen aus den Sätteln. Pferde gehen durch und rasen durch die Flußniederung. Cowboys bleiben in Steigbügeln hängen und werden mitgerissen. Schlaffe leblose Körper überschlagen sich.
Die Falle hat zugeschlagen.
Die Hombres aus Mexiko haben nicht umsonst gewartet. Sie schießen die amerikanischen Cowboys von den Pferden. Immer mehr Sättel werden leer. Blutige Sättel auf schrill davonjagenden Pferden.
Reiterlose Pferde irritieren Bronson. Er weiß nicht so recht, wie er sich verhalten soll. Das Chaos im Nebel ist zu undurchsichtig.
Und nun schweigen die Waffen.
Hufgetrappel schwillt an. Reiter jagen abseits vorbei. Luisa schreit nicht mehr. Sie wird weit fort sein.
Bronson reitet wachsam weiter. Er hält nun die Winchester im Anschlag. Er wird schießen, wenn ihm jemand feindselig zu nahe kommt.
Der Nebel riecht stark nach verbranntem Pulver. Blauer Qualm verbindet sich mit grauem Nebel. Irgendwo ruft noch ein reiterloses Pferd und irrt umher. Dann setzt harter Hufschlag ein. Ein Reitertrupp jagt in geschlossener Formation davon. Wenig später schlagen die Hufe durch den Fluß und trappeln drüben davon.
Wie ein Vorhang senkt sich der Nebel.
Als Bronson noch ein kurzes Stück Weg geritten ist, sieht er im nebelfeuchten Gras die Körper. Dunkel ragen sie aus dem Gras empor. Zusammengeschossen liegen Pferde neben Cowboys.
Wie ein alter Indianer sitzt er im Sattel. Er selber scheint angeschossen zu sein. Doch das täuscht. Die lässige, schläfrige Haltung verbirgt angespannte Wachsamkeit. Er ist jederzeit zum Kampf bereit.
Noch jetzt kreisen seine Gedanken um Luisa.
Sie ist verschwunden – und mit ihr der Bruder.
Denn Bronson kann unter den Toten keinen jungen Mann finden, der Luisa ähnelt.
Sein Pferd trägt ihn hinunter zum Fluß. Dort haben die Hombres aus Mexiko im Hinterhalt gelegen.
Am Fluß entdeckt er keinen einzigen Toten. Zu gut ist die Deckung der Mexikaner gewesen.
Bronson zieht das Pferd herum und reitet kreuz und quer. Die Spur, die Luisas Pferd ins Gras gezogen hat, wird von vielen anderen Spuren überdeckt und verliert sich.
Nebel schwebt flach über die Toten hinweg. Die Stille ist vollkommen.
Noch nicht einmal ein Vogel schreit am Fluß.
Wenn Bronson diesem Fluß folgt, wird er auf die Riesenranch des Senators Ronald Donovan stoßen – auf die Ox Bow-Ranch.
Aber er folgt dem Fluß nicht, sucht noch weiter nach Luisa und hofft, eine Spur von ihr zu entdecken.
Sterne funkeln und tauchen das weite Land in ihr fahles Licht. Die Spuren der Mexikaner verlieren sich auf hartem Boden.
Diese Spuren führen ins Nichts, doch Bronson ist sich sicher, daß die Hombres nach Mexiko unterwegs sind.
Bronson reitet einen anderen Weg. Dieser Weg führt ihn zu Cayuse. Das ist sein Kampfgefährte. Er wird den Gedanken an Luisa nicht los.
Arme Luisa.
*
»Siehst du die Bude da drüben, Cayuse?«
Bedächtig schiebt sich der bullige Bud Pence an Cayuses Seite. Mit der Pranke von Hand zeigt er auf das stille Örtchen. Dabei grinst er über beide Backen.
Cayuse nickt. Der hochgewachsene sehnige Körper bleibt reglos. Kein Muskel bewegt sich in seinem braunen Gesicht. Das gehört sich so für einen Indianer, wie Cayuse einer ist. Man kann ihm das aber nicht ansehen.
»Aah«, dehnt Bud zufrieden, »du siehst das also noch! Das ist schön.«
Er kaut auf dem Stück Tabak herum, spuckt einen Strahl braunen Saft aus dem Mundwunkel hervor und langt nach einem Zigarillo.
Argwöhnisch blickt Cayuse auf die Tabakstange.
Bud schüttelt den Kopf.
»Brasil Fehlfarben«, erklärt er, »volles Aroma. Komm mal mit.«
Er setzt sich in Bewegung und stapft am Rande der Straße entlang. Der Glutwind der Sierra läßt Staubwirbel tanzen. Stahlblau ist der Himmel des roten Grenzlandes. In der schmutzigen Town ist es still – so still wie auf dem Örtchen.
Sie erreichen den Stadtrand. Einsam ragt das Häuschen aus dem Staub hoch. Die Tür ist zu. Hinter dem Häuschen liegen die öden Stangenkorrals. Die Sonne brütet über leeren Viehställen.
Cayuse sieht nach Süden. Dort buckeln sich dunkelgrau die Bergzüge. Dort in rauchiger Ferne beginnt Mexiko. Ein steinerner Garten voll Kakteen und Mesquitesträuchern liegt davor.
Bud bückt sich ächzend. Er hat den Zigarillo schon ausgeraucht, pafft vor sich hin und nimmt den Zigarillo dann aus dem Mundwinkel.
»Was tust du da, Bud?«
»Das wirst du schon noch sehen, Cayuse.« Bud hustet laut, um irgendein Geräusch zu überdecken, überschwenglich herzlich legt er den Arm über Cayuses Schultern. »Willst du auch mal einen Zug nehmen? Danach kannst du gut laufen.«
Er drängt Cayuse sanft weg und lenkt ihn ab.
Da knallt es hinter ihnen. Die Detonation zerschlägt die Stille mit der Wucht einer Bombenexplosion. Cayuse zuckt herum und sieht, wie die Balken und Latten des stillen Örtchens durch die Luft wirbeln. Ein Rauchpilz steigt wallend hoch. Staub wirbelt nach allen Seiten hin weg.
»Bud«, ruft Cayuse, »hat da jemand draufgesessen?«
»Weiß ich doch nicht«, antwortet Bud Pence gelassen, »und wenn – jetzt sitzt er nicht mehr.« Und in Abwandlung seiner Brasil Fehlfarben fügt er hinzu: »Englisch Dynamit – volles Pfund.«
In der Stadt brüllen Männer. Der Rauchpilz wandert über die Stadt. Bud raucht genießerisch und klopft Cayuse auf die Schulter.
»Siehst du es noch immer?«
»Nein.«
»Ich auch nicht.«
Bud ist zufrieden mit der Wirkung seines Dynamits. Er ist auch ein Experte, was Sprengen anbetrifft. »Gehen wir einen saufen? Ich hab Durst wie ’ne Bergziege.«
Schweigend deutet Cayuse in das weite Tal hinaus.
Ein Mann kommt schnell nähergeritten.
Bronson hat die Detonation gehört. Als er das Pferd vor Cayuse und Bud Pence zügelt, sagt er rügend: »Kannst du diese Späße nicht sein lassen, Bud? Verjubel nicht soviel von dem Zeug. Davon brauchen wir noch ’ne ganze Menge.«
»Verdammt, wozu denn?« schnappt Bud. »Warum sagt denn keiner von euch, um was es hier geht, he?«
»Das erfährst du unterwegs«, meint Bronson lächelnd, »irgendwann.«
Grimmig spuckt Bud den Kautabak aus, macht eine wegwerfende Handbewegung und stapft schräg über die Straße davon.
Ernst blickt Bronson seinen Freund an.
Cayuse weiß, was Bronson wissen will. Stilles Lächeln legt sich um seinen Mund.
»Bud ist genau der richtige Mann für uns, Bronson. Er hat Spaß daran.«
»Das sehe ich!« Bronson sieht nach drüben, wo das stille Örtchen seinen altehrwürdigen Platz aufgegeben hat. Dort liegen noch qualmende Latten herum – und es riecht ganz schlimm. »Yeah, unser Bud hat Spaß daran. Hauptsache, er jagt sich nicht selber in die Luft.«
»Dazu wird er eine doppelte Ladung brauchen. Die Fettmassen sind nicht so schnell hochzukriegen.«
»Er könnte sich auch wie ein Maulwurf unter die Erde jagen. Geh ihm nach, Cayuse, sonst spielt er noch Schleuse und läßt sich langsam vollaufen. Wir reiten in zwei Stunden los.«
»Du hast mit diesem Senator Ronald Donovan gesprochen, Bronson?«
»Ja. Inzwischen ist was passiert – davon weiß er noch nichts. Etliche seiner Cowboys sind erschossen worden. Donovan hat recht. Ihm droht von Mexiko her große Gefahr.«
»Und weil er nicht nur ein mächtiger Rinderbaron ist, sondern auch ein Senator, müssen wir rüber.«
»Du sagst es!«
Zwei Stunden später reiten drei Männer aus der Stadt. Sie lenken die Pferde nach Süden. Langsam verschwinden sie im steinernen Garten.
In der Deckung der Häuser steigen zwei Mexikaner auf ihre ausgeruhten Pferde. Ein dritter kommt hinzu und blickt auf die dünne Staubfahne im steinernen Garten.
»Sie sind zum Lobo-Paß unterwegs, Amigos«, sagt er im lauernden Ton. »Ihr müßt sie irgendwie überholen. Das wird nicht schwer sein. Genug Felsen und Höhenzüge geben euch Deckung. Adelante, Amigos! Sorgt dafür, daß diese verdammten Gringos am Paß heiß empfangen werden!«
»Darauf kannst du Gift nehmen!«
Die beiden Hombres reiten an und lenken die Pferde zwischen die heißen Felsklippen.
*
Hart knackt das Bolzenschloß. Kreischend schwingt die Tür in rostigen Angeln auf. Schaurig hallt es durch die weiten Grotten.
»Colonel Tucker Boone! Du sollst hängen!«
Ein Mexikaner nähert sich der kleinen Grotte. Dort kauert im ewigen Halbdunkel ein grauhaariger Amerikaner. Wie Pergament spannt sich die totenbleiche Haut über hervorstoßende Knochen.
Der hünenhafte Mexikaner grinst und bleibt vor der Tür aus Eisenstangen stehen.
Verzückt betrachtet er den Gefangenen.
»Die Geier schärfen schon die Schnäbel an den blutigen Felsen, Colonel Tucker Boone!« sagt er. »Du kannst sie nicht hören. Sie schreien vor Hunger! Sie wollen dich fressen!«
Der Colonel ist verloren. Ohne Hilfe wird er hier niemals herauskommen.
Er kann kaum aufblicken – zu geschwächt ist er bereits. Ewiges Halbdunkel droht ihn zu erblinden.
Doch sie wollen ihn vorher schon aufhängen. Er soll unter der sengenden Sonne von Mexiko baumeln. Tief unten im engen Talkessel. Dort befindet sich der große Platz, wo tagsüber nur für Stunden die Sonne hinreicht. Also genau am Fuß der riesigen Felsenburg!
Als der hünenhafte Mexikaner keine Antwort bekommt, sticht er nach: »Die Schnäbel der Totenvögel werden scharf wie Messerklingen sein! Sie schneiden mühelos deine morschen Knochen durch, Colonel Tucker Boone!« Er gerät ins Schwärmen: »Die Eingeweide werden wie Girlanden von den alten Eukalyptusbäumen hängen und…«
Er spricht weiter und quält den Gefangenen mit schaurigen Worten.
Dieser Mexikaner ist der Herrscher der Felsenburg. Man nennt ihn »den Schrecklichen«. Lorenzo ist ein Satan.
In hündischer Ergebenheit dient er dem mächtigen Rebellenkönig und Gouverneur dieser großen mexikanischen Provinz.
Don Sodorra Bolivar ist so machthungrig, daß er eine Privatarmee aufgestellt hat, um den Präsidenten in Mexiko City zu stürzen. Solche Wunsch- und Wahnsinnsträume haben nicht wenige. Don Sodorra Bolivar aber hat alle Chancen, sein Ziel zu erreichen, Lorenzo der Schreckliche ist also Bolivars rechte Hand.
Lorenzo lacht wild auf, macht kehrt und geht zurück. Wieder kreischen die Türangeln. Laut und dumpf fällt die Tür zu. Noch lange hallt es in den Grotten.
Es ist unmöglich, ihn hier herauszuholen!
Draußen im Talkessel stehen Hunderte von verrückten Soldados bereit – Gewehre bei Fuß. Diese Soldaten sind ein Teil der Privatarmee des Don Sodorra Bolivar.
Der Colonel ist nach Mexiko verschleppt worden. Nachts ist er drüben, jenseits der Grenze, aus seiner militärischen Unterkunft geholt worden.
Er kennt den Grund nicht.
Vielleicht ist der Grund der, daß er an der Grenze erbittert gegen alle Mexikaner gekämpft hat.
Womöglich ist der Grund auch darin zu suchen, daß er der alte Freund des Rinderbarons und Senators Ronald Donovan ist…
Sein Leben ist einen Dreck wert.
Und seine Stunden sind schon gezählt.
Es muß schon ein Wunder geschehen. Doch die US Army drüben wird keine Truppen nach Mexiko entsenden, um einen Colonel herauszuschlagen.
So wird für Colonel Tucker Boone die Nacht ewig sein, diese Nacht vom Leben in den Tod.
Hat die Welt diesen Mann schon vergessen?
*
Sie sind unterwegs zum Lobo Paß.