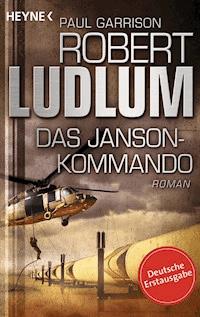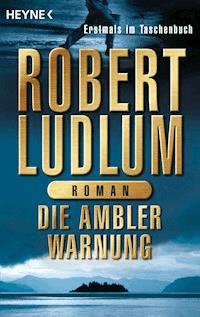9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: JANSON-Serie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Mission Somalia
In Somalia wird die Gattin eines einflussreichen Ölmanagers von Piraten verschleppt. Die Lage ist brenzlig: Am Horn von Afrika tobt ein erbarmungsloser Kampf um Macht und Öl. Jeder Rettungsversuch birgt die Gefahr, zwischen die Fronten zu geraten. Ex-Regierungsagent Paul Janson und Scharfschützin Jessica Kincaid erklären sich bereit, die Mission zu übernehmen. Doch die Entführung war nur der erste Baustein eines perfiden Plans. Als Janson und Kincaid vor Ort eintreffen, erwartet sie bereits ein tödlicher Feind ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Ähnliche
Das Buch
Nach einer langen Karriere in Sachen Mord und Komplott für die Regierung hat sich der Auftragskiller Paul Janson unabhängig gemacht und seine eigene Spezialeinheit gegründet. Zusammen mit seiner neuen Geschäftspartnerin, der Scharfschützin Jessica Kincaid, übernimmt er nur noch Missionen, von denen er glaubt, dass sie dem Wohl der Menschheit dienen.
Die Rettung der in Somalia entführten Allegra, Gattin des einflussreichen Ölmanagers Kingsman Helms, scheint so ein Fall zu sein. Außerdem bietet der Auftrag einen perfekten Vorwand, um mehr über Helms’ zweifelhafte Geschäftsmethoden herauszufinden. Doch in Afrika angekommen, müssen Janson und Kincaid feststellen, dass sich der Einsatz noch weitaus gefährlicher gestaltet als gedacht. War Allegras Entführung vielleicht nur der erste Teil eines viel grausameren Plans?
Nach Der Janson-Befehl und Das Janson-Kommando sind Paul Janson und Jessica Kincaid in Die Janson-Option zum dritten Mal im Einsatz.
Die Autoren
Robert Ludlum erreichte mit seinen Romanen, die in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurden, weltweit eine Auflage von über 280 Millionen Exemplaren. Robert Ludlum verstarb im März 2001. Die Romane aus seinem Nachlass erscheinen bei Heyne.
Ein ausführliches Werkverzeichnis finden Sie hier.
Paul Garrison wurde in New York geboren und lebt in Connecticut. Zum Schreiben inspirierten ihn die Seefahrergeschichten seines Großvaters. Er ist der Autor zahlreicher erfolgreicher Thriller.
Robert Ludlum
Paul Garrison
Die Janson-Option
Roman
Aus dem Amerikanischen von Norbert Jakober
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Für AMBER EDWARDS
und LUCKY,
unseren »präsenten Freund«
Prolog
AUSSCHLEUSUNG
Vor einem Jahr
30°8' N, 9°30' OTunesische Grenze, nahe Ghadames395 Meilen südwestlich von Tripolis
»Checkpoint«, warnte Janson.
Etwa eineinhalb Kilometer voraus standen zwei Toyota Pick-ups Kühler an Kühler quer über der Straße, die etwa zwei Meter über dem Wüstenniveau verlief. Ein Panzer hätte den Kontrollpunkt mit seinen Ketten vielleicht weiträumig umfahren können. Ein gestohlenes Taxi mit einem Amateur am Steuer war hingegen chancenlos.
»Regierungstruppen oder Rebellen?«, fragte Jessica Kincaid auf dem Rücksitz. Sie trug eine abgenutzte Leica-Kamera um den Hals.
Janson saß zur Beruhigung des Fahrers vorne und beobachtete die Pick-ups mit einem monokularen Fernglas. Zivilisten, die zwischen die Fronten von regierungstreuen Truppen und Rebellen geraten waren, verstopften die Straßen zur Grenze mit ihren Autos, deshalb hatte er das Taxi nach Süden in karges Wüstengelände ausweichen lassen.
Er überblickte den Checkpoint mit dem Fernglas. »Schwarze Söldner … Bullpup-Sturmgewehre … der linke Truck ist mit einem Raketenwerfer Typ 63 ausgerüstet.«
Jessica versteckte den Passierschein der Rebellen unter dem Fahrersitz und gab Janson die Geschäftsvisa, die ihnen ein Unternehmer in Tripolis besorgt hatte, der Bewässerungspumpen für das »Great Man-Made River«-Projekt importierte. Bei diesem Projekt wurde eine riesige Pipeline für eine verbesserte Wasserversorgung der Bevölkerung und der Landwirtschaft installiert. Sie war eine junge, athletische Frau und trug ein Tuch über dem kurzen braunen Haar, eine weite Cargohose und ein verschwitztes Hemd. Laut ihren Papieren arbeitete sie in der PR-Abteilung des amerikanischen Bauunternehmens KBR.
Jansons Visum wies ihn als Wasserbau-Ingenieur desselben Unternehmens aus. Er war älter als Jessica, ein unscheinbarer Mann mit kurzem stahlgrauem Haar. Die Narben an den Händen und im Gesicht sowie die muskulöse Statur, die unter dem weiten Hemd kaum hervortrat, ließen vermuten, dass er sich vom einfachen Bohrturmarbeiter hochgearbeitet hatte. Er wirkte ebenso ruhig und gelassen wie die Frau auf dem Rücksitz.
»Wir kommen ohne Probleme durch«, versicherte er dem Fahrer. »Bleiben Sie einfach ruhig.«
Der Fahrer war überzeugt, dass die beiden Amerikaner keine Ahnung hatten, welche Gefahr ihnen drohte. Afrikanische Söldner waren als ausgesprochen schießwütig bekannt. Wären es wenigstens Rebellen gewesen, die vielleicht bestrebt waren, sich auf CNN in einem guten Licht zu präsentieren. Den ausländischen Soldaten aufseiten der Regierung aber war es schnurzegal, was die Welt über sie dachte. Sie kämpften stets mit dem Rücken zur Wand – für sie hieß es »Siegen oder sterben«.
In diesem Fall handelte es sich allem Anschein nach um Soldaten der berüchtigten 32. Brigade, einer Spezialeinheit, die direkt dem Despoten unterstellt war. Der Kommandeur des Trupps wusste um die hohe Belohnung, die für die Ergreifung des übergelaufenen Diktatorensohnes winkte. Falls der Verräter das Glück hatte, von den Rebellen erwischt zu werden, würden sie ihn möglicherweise als Geisel am Leben lassen. Die Regierungstreuen würden ihn auf der Stelle töten, und wer seinem Vater den Kopf des Verräters brachte, konnte mit einem Orden und einer Villa in der besten Gegend rechnen.
Die Soldaten brachten ihre Gewehre in Anschlag.
»Langsam«, forderte Janson den Fahrer auf. »Lassen Sie die Hände auf dem Lenkrad.« Er selbst legte seine Hände gut sichtbar auf das Armaturenbrett und hielt ihre Papiere unter der Linken fest. Jessica legte ihre Hände auf den Fahrersitz.
Der Fahrer, ein kahlköpfiger Mann in den Dreißigern, war mit einer falschen Designerjeans und einem schäbigen weißen Hemd bekleidet, dem typischen Outfit der vielen gut ausgebildeten Afrikaner, die keine adäquate Arbeit fanden. In diesem Moment verspürte er den unbändigen Drang, aufs Gaspedal zu treten und die Soldaten zu überfahren. Wenn er anhielt, konnten sie bestenfalls darauf hoffen, dass sich die Söldner damit begnügten, sie zu verprügeln und das Auto auseinanderzunehmen. Noch schlimmer würde es der Frau auf dem Rücksitz ergehen. War es angesichts dieser Aussichten nicht besser, ihr Schicksal in Allahs Hände zu legen und einen Fluchtversuch zu wagen?
»Langsam«, wiederholte Janson. »Wir dürfen sie nicht reizen.«
Seit er und Jessie sich anschickten, die Grenze zu überqueren, waren ihnen jede Menge verängstigte Zivilisten, schießwütige Söldner und marodierende Rebellen begegnet, was darauf hindeutete, dass die Revolution ins Chaos gekippt war. Kein Wunder nach vierzig Jahren unter der Herrschaft eines psychopathischen Diktators. Bezeichnend auch, dass sich die regierungstreuen Truppen nun vor allem auf die Suche nach einem einzelnen Abtrünnigen konzentrierten.
Fünf der acht Söhne des psychotischen Despoten, der sich selbst »Löwe der Wüste« nannte, waren Personen des öffentlichen Lebens – Playboys, Funktionäre, Minister. Sie waren im Staatsfernsehen in Erscheinung getreten und gaben in Rom und Paris rauschende Feste. Ein weiterer versteckte sich als obskurer Imam in einer abgelegenen Provinz hinter seinem priesterhaften Bart. Der schwule Sohn war nach seiner Flucht nach Mailand seit Jahren nicht mehr in Erscheinung getreten, ebenso wie der jüngste Sohn Yousef, genannt »Welpe«, der in den Vereinigten Staaten Computerwissenschaft studiert hatte. Sein Gesicht war der Öffentlichkeit nicht bekannt. Angeblich hatte er es im Gegensatz zu seinen Brüdern geschafft, das Vertrauen seines Vaters zu erwerben, indem er die Strukturen der inneren Sicherheit modernisiert und für eine lückenlose Überwachung von Handykommunikation und Internet gesorgt hatte. Twitter und Facebook wurden vom Löwen zwar geduldet, er konnte sie aber jederzeit nach seinem Belieben mit nur einem Wort sperren lassen.
Alle Hoffnungen, der Jüngste könnte den alten Despoten in eine gemäßigtere Richtung lenken, zerschlugen sich schon in den ersten blutigen Tagen des Aufstands, als der Herrscher seinen Gegnern schwor, bis zum Tode zu kämpfen. Die Armee spaltete sich auf, sein Kabinett dankte ab, und ein blutiger Bürgerkrieg entbrannte. Die politische Pattsituation und das drohende militärische Eingreifen der NATO bewogen selbst einige der loyalen Gefolgsleute, im Verborgenen das Wort »Amtsenthebung« zu flüstern.
Yousef fürchtete eine mögliche Anklage als Kriegsverbrecher, sodass ihm das Asylangebot Italiens äußerst gelegen kam. Die italienische Initiative zielte einerseits auf ein Ende des Blutvergießens, andererseits jedoch auch auf gute Beziehungen zur Wirtschaftselite des Ölstaates ab. Doch wie so vieles in diesem Konflikt sollte auch dieser Versuch zu spät kommen, und Yousef tauchte in den Wirren des Krieges unter. Zuletzt war er in der Oasenstadt Ghadames gesichtet worden.
»Langsam!«, zischte Janson dem Fahrer erneut zu. Der Mann sah ein, dass es zwecklos war, einen Fluchtversuch zu wagen. Wahrscheinlich würde ihn Janson in diesem Fall töten, noch bevor die Soldaten ihre Gewehre auf den Wagen richten konnten.
Die Söldner gestikulierten mit ihren Gewehren, um sie zum Verlassen des Fahrzeugs aufzufordern. Der Kommandeur begutachtete ihre Papiere. »Kofferraum aufmachen«, befahl er.
»Hab keinen Schlüssel«, antwortete der Fahrer.
»Schießt das Schloss auf.« Die Soldaten richteten ihre Waffen auf den Kofferraum und feuerten erst einmal eine Salve ab, ehe sie mit einem gezielten Schuss das Schloss knackten und einer von ihnen mit dem Gewehrlauf den Deckel hob.
Im Kofferraum lagen ein von Kugeln durchlöchertes Reserverad und eine hellgrüne Fußballtasche. Die Augen des Offiziers weiteten sich, als er sie öffnete. Er griff hinein und zog ein Bündel Hundert-Euro-Scheine hervor. »Gehört das Ihnen?«
»Nein«, antwortete Janson. »Ich hatte keine Ahnung, dass das da drin ist. Vielleicht haben Sie dafür Verwendung.«
Der Offizier machte seinen Männern ein Zeichen. Ein Soldat sprühte mit grüner Farbe einen Halbmond auf die Motorhaube. »Fahren Sie weiter. Damit kommen Sie durch alle Checkpoints. Entschuldigen Sie die kleine Verzögerung. Erzählen Sie der Welt, dass Sie anständig behandelt wurden.«
Der Offizier schlug dem Fahrer auf den Hinterkopf und trieb ihn mit einem Fußtritt zum Auto. Der Fahrer spannte sich unwillkürlich an. Janson schob ihn hinters Lenkrad. Jessica wandte sich an den Soldaten. »Darf ich ein Foto von Ihnen machen?«
Der Offizier straffte die Schultern und registrierte jetzt erst, dass sie eine außerordentlich attraktive Frau war.
Janson schritt ohne Eile um den Wagen herum und setzte sich auf den Beifahrersitz. »Fahren Sie, bevor sie es sich anders überlegen.«
Der Fahrer trat auf das Gaspedal, und das alte Taxi rollte los.
Der Passierschein in Form des aufgesprühten Halbmonds sowie hundert Euro Bestechungsgeld brachten sie schließlich über die Grenze.
Die tunesischen Behörden, überfordert durch den Strom von Flüchtlingen, die dringend Nahrung, Wasser und ein Dach über dem Kopf benötigten, winkten sie sofort zum Flughafen weiter. Dort landete wenig später eine zweistrahlige Embraer Legacy 650. Der Langstreckenjet gehörte Jansons Firma namens Catspaw Associates, die Sicherheitsberatung für Unternehmen anbot. Er hatte ein Netzwerk aus selbstständigen Recherchespezialisten, IT-Experten und Feldagenten zusammengestellt, die rund um die Uhr über das Internet und sichere Telefonleitungen miteinander verknüpft waren.
Paul Janson und Jessie Kincaid halfen ihren Piloten beim Ausladen von Zelten, Decken und Wasserflaschen. Fünfzehn Minuten nach der Landung beförderten die mächtigen Rolls-Royce-Triebwerke das Flugzeug wieder in die Lüfte. An Bord befand sich neben Janson und Jessica auch Yousef, der Sohn des Diktators, gekleidet wie ein Akademiker, der sich als Taxifahrer sein Geld verdienen musste.
Erster Teil
»WER REGIERT HIER?«
Heute, ein Jahr später
5° S, 52°50' O
Indischer Ozean, 700 Meilen vor der ostafrikanischen Küste
Unterwegs von Mahé, Seychellen, nach Mombasa, Kenia
1
Die Superjacht Tarantula lief mit achtzehn Knoten Richtung Mombasa. Mit ihrem Rumpf einer Fregatte der Kortenaer-Klasse besaß sie das Profil eines Kriegsschiffes mit einem hohen Bug und einem niedrigen Heck. Die anmutigen Aufbauten waren ein Entwurf des Pariser Designers Jacques Thomas, der für seine geschwungenen Formen aus Glas und mit Karbonfasern verstärktem Epoxidharz nach dem Vorbild der Art Nouveau berühmt war. Aus der Sicht des kleinen Skiffs, das sich mit hoher Geschwindigkeit der Jacht näherte, schien die Tarantula im Licht des Sonnenuntergangs wie eine leuchtende Libelle über dem Wasser des Indischen Ozeans zu schweben.
Die zwanzigköpfige Besatzung kümmerte sich um das voll automatisierte Schiff sowie um dessen Besitzer Allen Adler und seine Gäste. An Bord befanden sich zwei goldfarbene Hubschrauber, die Adlers Initialen in Rot auf dem Heckausleger trugen – ein zehnsitziger Sikorsky S-76D auf einem Landeplatz mittschiffs und ein fünfsitziger Bell Ranger auf dem Vorderdeck. Zwei schnelle Begleitboote waren im Welldeck am Heck untergebracht, das geflutet werden konnte, um die Boote hinausfahren zu lassen. Hier befand sich auch eine Nautor’s-Swan-Segeljacht, auf die ihr Besitzer besonders stolz war.
Es wurde schnell dunkel, wie immer in Äquatornähe. Fünf von Adlers Gästen – ein ehemaliges Topmodel, ein UNO-Diplomat im Ruhestand mit seiner Frau und eine New Yorker Immobilienmaklerin mit ihrem Mann – saßen in einem Salon unter der Kommandobrücke, tranken Cocktails und betrachteten den Sonnenuntergang.
Der sechste Gast, Allegra Helms, eine dreißigjährige italienische Gräfin mit blassblauen Augen und langem blondem Haar, leistete dem Gastgeber auf der Brücke Gesellschaft. Aus dem geräumigen verglasten Adlerhorst bot sich rundherum freie Sicht auf das sich verdunkelnde Meer. Adler wollte ihr imponieren, indem er selbst die Jacht steuerte. Um seine Hoffnungen auf ein amouröses Abenteuer mit ihr im Keim zu ersticken, hatte sie ein Outfit gewählt, das ihre Mutter für sie ausgesucht haben könnte: eine schlichte weiße Leinenhose und eine Bluse mit Bateau-Ausschnitt, dazu einen Hermès-Schal mit ihrem Familienmotto, so dezent aufgedruckt, dass es nur ein Verwandter oder ein historischer Erzfeind erkannt hätte.
Eine rundliche deutsche Stewardess im engen, kurzen Rock brachte ein Tablett mit marinierten Shrimps und Jakobsmuscheln. Sie ging hinaus und kam mit einem Champagnerkübel zurück, öffnete mit geschickten Fingern eine Flasche Cristal und schenkte zwei Gläser ein.
»Das wär’s.« Allen Adler tätschelte ihr den Hintern. »Raus. Sie auch, Captain Billy«, wandte er sich an den Mann, der die Instrumente und Anzeigen im Auge behielt, obwohl die Jacht unter Autopilot lief.
Allegra Helms bereute inzwischen, die Einladung eines Mannes angenommen zu haben, mit dem sie nichts außer einer gemeinsamen Bekannten verband. Jetzt saß sie hier auf einem Schiff mitten im Meer fest, von langweiligen Leuten umgeben. Den anderen Gästen konnte sie aus dem Weg gehen, nicht aber ihrem Gastgeber, der nicht aufhören wollte, mit seinem Geld und seiner blöden Jacht anzugeben.
»Sie ist die größte der Welt: hundertdreißig Meter lang und eine Verdrängung von über dreitausendfünfhundert Tonnen. Ich habe sie technisch aufrüsten lassen und kann sie mit einer Smartphone-App steuern.« Adler nahm einen Schluck Champagner und forderte Allegra mit einem Kopfnicken auf, sich zu bedienen, ehe er seinen Monolog mit einem Scherz fortsetzte, den sie im Laufe der Fahrt schon zweimal gehört hatte. »Ich weiß gar nicht, wofür ich den Kapitän bezahle.«
Ein Alarm schrillte los. Allegra beobachtete, wie die Augen des Kapitäns sofort zum Radarmonitor sprangen, auf dem ein orangefarbener Punkt aufleuchtete. Adler drückte einen Knopf, um den Alarm abzustellen, der ihn in seinem Vortrag unterbrochen hatte.
»Ich kann dieses Schmuckstück von Kansas aus steuern, wenn ich will. Captain Billy, wofür bezahle ich Sie eigentlich?«
Allegra wandte sich dem Kapitän zu, einem sonnengebräunten Kerl mit lockigem Haar und hohen Wangenknochen – ein Mann weit eher nach ihrem Geschmack, falls sie ein Abenteuer in Erwägung ziehen würde, was nicht der Fall war. Nicht jetzt, da sie sich in Mombasa mit ihrem Mann treffen würde. Und schon gar nicht auf einem Schiff auf hoher See.
»Sie könnten sie natürlich von Kansas aus steuern«, gab Billy Titus mit einem freundlichen Lächeln zurück, während er mit dem Radar beschäftigt war. »Sie bezahlen mich dafür, dass Sie’s nicht tun müssen.«
Allegra lachte.
Adlers Miene verfinsterte sich. »Tatsache ist, ich zahle ihm eine Prämie, damit er Treibstoff spart, und ziehe es ihm vom Gehalt ab, wenn er Sprit vergeudet. Stimmt’s, Captain Billy?«
»Ja, Sir.«
»Essen Sie einen Happen. Die Gräfin und ich steuern das Schiff.«
»Behalten Sie das Radar im Auge.«
»Raus mit Ihnen.«
»Ich mein’s ernst, Sir. Falls Sie Piraten sehen, müssen wir die Turbinen zuschalten und machen, dass wir wegkommen.«
»Ich garantiere Ihnen, dass mir keine Piraten in die Quere kommen. Gehen Sie essen und lassen Sie uns in Ruhe. Ich rufe Sie, wenn ich Sie brauche.«
»Die Jagdsaison hat gerade begonnen, Mr. Adler. Der Monsun ist vorbei, und das Wasser ist wieder ruhig genug für kleine Boote.«
»Gehen Sie schon, verdammt! Los!«
Kapitän Titus warf noch einen Blick auf den Radarschirm, bevor er sich umdrehte und die Brücke verließ.
»Mein Kapitän ist ein Komiker«, bemerkte Adler, als er mit Allegra allein war.
»Che buona figura.«
»Was heißt das?«
»Es heißt, er macht eine gute Figur … sieht nicht nur gut aus, sondern weiß auch, was sich gehört.«
»Wie meinen Sie das?«
»Für Sie ist das wahrscheinlich schwer zu verstehen. Er ist ein Gentleman.«
Ein Seitenhieb, der Adler nicht entging. »Es stört Sie, dass ich dem Mädchen an den Hintern gefasst habe. Was ist denn bitte verkehrt daran?«
Sie kehrte ihm den Rücken zu und schaute auf den Radarmonitor, der in allen Richtungen freie See zeigte. Adler war aufmerksamer, als man ihm ansah, und sie fragte sich, ob er mit seinem großkotzigen Auftreten seine Geschäftspartner dazu verleitete, ihn zu unterschätzen.
»Sie wäre enttäuscht, wenn ich ihr nicht den Arsch betatschen würde«, fuhr Adler fort. »Sie würde denken, ich bin sauer auf sie.«
Als Allegra weiter schwieg, bohrte er nach: »Was denken Sie?«
Sie dachte an ihren Mann, der gerade in Ostafrika herumwühlte, ständig auf der Jagd nach Erdölförderrechten wie ein Trüffelschwein. Wenn Adler noch zudringlicher wurde, wäre es nett gewesen, ihn hier zu haben.
»Ich denke gerade, Sie erinnern mich an meinen Vater.«
Adlers Gesicht verhärtete sich. »Ich bin nicht alt genug, um Ihr Vater zu sein. Ich bin achtundvierzig.«
Sie wusste aus sicherer Quelle, dass er achtundfünfzig war, obwohl er erstaunlich fit wirkte und immer noch gut aussah. »Mein Vater betatscht die Dienstmädchen auch.«
»Ach ja? Was sagt Ihre Mutter dazu?«
»Wir haben nie darüber gesprochen.«
Adler blinzelte einen Moment und änderte seine Strategie, wenn auch nicht sein Benehmen. »Was verdient Ihr Mann eigentlich mit der Leitung von American Synergy?«
»Er leitet nicht das Unternehmen – nur die Erdölabteilung.«
»Die Erdölabteilung bringt ihnen die höchsten Gewinne. Was zahlen sie ihm dafür, dass er den Laden führt?«
»Ich habe nicht die geringste Ahnung.«
Er schaute sie einen Moment verdutzt an. »Es ist Ihnen egal?«
»Ich fühle mich lieber jung als reich.«
Adler zuckte zusammen, wie sie gehofft hatte. Doch er gab sich längst nicht geschlagen. »Was glauben Sie, wie lange das so bleiben wird?«
»Wie können Sie garantieren, dass uns die Piraten nicht angreifen?«
»Ich habe einen Deal mit Bashir Mohamed geschlossen. Bashir ist der König der somalischen Piraten. Er hat mir zugesichert, dass mich niemand angreifen wird.«
»Wie kann er Ihnen garantieren, dass es auch die anderen Piraten nicht tun werden?«
»Sie fürchten ihn. Er hat sie organisiert. Falls sich jemand unabhängig macht, liefert er ihn den Truppen der Afrikanischen Union oder den multinationalen Seestreitkräften aus. Dazu gehören auch die Russen und die Chinesen, und die greifen um einiges härter durch als die USA und die EU. Oder er heuert jemanden an, um den Abtrünnigen zu beseitigen. In der Piraterie ist es wie in jeder anderen Branche: Man macht Gewinne, indem man den Markt beherrscht. Und den Markt beherrscht man, indem man die Unabhängigen verdrängt.«
»Was geben Sie Bashir Mohamed dafür?«
»Sie würden es nicht glauben, wenn ich’s Ihnen sage.«
Endlich wurde Adler doch noch interessant, dachte sie bei sich. Ein Lächeln erhellte Allegras blassblaue Augen, und sie strich sich mit den Fingern durchs Haar. »Erzählen Sie schon«, sagte sie mit einem reizenden italienischen Akzent in ihrem fließenden Englisch. »Jetzt haben Sie mich neugierig gemacht.«
»Kennen Sie New York?«
»Ich bin dort zur Schule gegangen.«
»Wo?«
»Auf die Nightingale-Bamford School.«
»Okay, das erklärt einiges.«
»Was zum Beispiel?«
»Sie benehmen sich mehr wie eine reiche junge New Yorkerin als eine Gräfin.«
»Also, was haben Sie Bashir Mohamed geboten?«
»Ich sitze im Vorstand mehrerer Privatschulen wie Nightingale-Bamford. Dafür, dass die Tarantula unbehelligt diese Gewässer durchfahren kann, bekommt sein erstgeborener Sohn einen Platz in einer guten Vorschule. Ich schwöre, das ist die Wahrheit. Mehr war nicht nötig. Er träumt davon, dass es sein Sohn nach Harvard schafft.«
Allegra Helms lachte. »Gut gemacht, Mr. Adler.«
»Ich hab doch gesagt, Sie sollen mich Allen nennen.«
»Wie Sie wünschen, Allen.«
»Jetzt erzählen Sie mir aber etwas. Warum haben Sie meine Einladung zu dieser Kreuzfahrt angenommen?«
»Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ich bin gerade mit einem Job auf den Seychellen fertig geworden und wollte ohnehin weg.«
»Antiquitäten schätzen?«
Allegra hatte seine protzige Art langsam satt und antwortete mit einer wegwerfenden Geste, die seine Luxusjacht zu einem simplen Gebrauchsgegenstand degradierte. »Es gibt immer wieder Leute, die gerade zu Geld gekommen sind und gerne hören wollen, dass die Kopie eines Holbein-Porträts von einem Schüler des Meisters angefertigt wurde und nicht von einem guten Fälscher.«
»Vielleicht sollte ich meine Bilder von Ihnen prüfen lassen.«
Allegra zuckte mit den Schultern. In den eng vernetzten Kreisen des Kunsthandels wusste jeder, dass sich Adler von Jasagerinnen beraten ließ, die Berge seines Geldes für mäßig Interessantes ausgaben. Für Allegra wenig überraschend, jetzt, da sie ihn persönlich kannte. »Ich habe Ihre Einladung angenommen, weil ich mich in Mombasa mit meinem Mann treffen möchte. Wir waren beide eine Zeit lang unterwegs.«
Adler lachte.
»Was ist daran so lustig?«
»Ich habe schon öfter so eine ›Trennung auf Probe‹ erlebt … und es ist noch jedes Mal eine Trennung auf Dauer daraus geworden.«
Allegra war gekränkt und wütend auf sich selbst, dass sie so viel von sich preisgegeben hatte. »Es war keine Trennung … oder vielleicht haben Sie sogar recht. Vielleicht war es wirklich eine Trennung auf Probe, und sie hat ihren Zweck voll erfüllt. Ich freue mich jedenfalls sehr darauf, meinen Mann in Mombasa wiederzusehen.« Sie konnte selbst nicht glauben, was sie da sagte – und doch hatte sie es getan, laut und deutlich und vor einem Zeugen.
»Sie wirken fast überrascht«, bemerkte Adler.
»Bin ich auch«, lächelte sie mit einem Glücksgefühl, das sie lange nicht mehr empfunden hatte. »Aber ich habe keinen Grund, überrascht zu sein, oder? Er ist immer noch der Mann, den ich vor zehn Jahren wollte. Er sieht gut aus, ist entschlossen. Und mir gefällt, dass er sich alles selbst erarbeitet hat. Das gibt ihm eine innere Sicherheit, weil er spürt, dass er sich den Erfolg verdient hat.«
»Ein Macher, wie ich«, bemerkte Adler. »Ich habe mir auch alles selbst erarbeitet.«
Ihr kam der Gedanke, dass Adler in gewisser Weise tatsächlich wie Kingsman war. Ein Mann mit der Überzeugung, alles zu verdienen, was er wollte, eben weil er es wollte. Das ermahnte sie, sich von ihrer Ehe nicht mehr zu erwarten, als ein kurzes Treffen in Mombasa ihr zu geben vermochte. Aber war es nicht trotzdem einen Versuch wert? Und gab es nicht doch Grund zur Hoffnung?
»Ich kann ja für ihn einspringen, bis wir in Mombasa sind.«
»Versuchen Sie’s doch bei Monique«, gab sie zurück. Die attraktive Monique hatte einst zu Gallianos Lieblingsmodels gehört, bevor dieser seine Karriere ruiniert hatte. Sie war etwas über vierzig – ein Umstand, der sie einigermaßen nervös machte – und schien nicht abgeneigt, sich einen reichen Mann zu angeln, wie Allegra aus den wenigen Sätzen herausgehört hatte, die sie gestern Abend mit ihr gewechselt hatte.
»Mir sind Gräfinnen lieber als Models.« Adler trat näher an sie heran. »Ich habe mir Ihre Familie etwas genauer angesehen. Ich muss sagen, wirklich interessant.«
»Verstehe«, bemerkte Allegra Helms. »Sie haben Monique für den Fall eingeladen, dass es mit mir nicht klappt. Und genau das ist der Fall. Also seien Sie froh, dass sie mit an Bord ist. Ich bin verheiratet und basta. Ich gehe jetzt nach unten und schicke Monique rauf.«
»Sie sind schon eine Nummer.« Adlers Lachen wurde vom lauten Krachen von Gewehrfeuer unterbrochen. Eine Salve nach der anderen, als ob ein Presslufthammer eine Straße aufriss.
Gier macht Männer mutig, dachte Maxamed, der Kapitän der Piraten.
Die Aussicht auf den dreifachen Lohn – drei Millionen Somalia-Schilling (etwa hundert US-Dollar), sowie einen Toyota 4-Runner, sobald das Lösegeld gezahlt wurde – für denjenigen, der als Erster die Jacht betrat, entfachte einen erbitterten Wettstreit zwischen zwei Clanbrüdern, die beide die Strickleiter am niedrigen Heck des fahrenden Schiffes hochklettern wollten.
»Weiter!«, rief Maxamed, ein großer, drahtiger Somalier von fünfunddreißig Jahren, mit einer hohen, breiten Stirn, kräftigen weißen Zähnen und hellbrauner Haut. Gewandt sprang er auf das Vordeck des Schnellboots, das im Kielwasser der Tarantula schaukelte. Er trug als Einziger der Piraten eine Splitterschutzweste und einen MG-Patronengurt – Letzteren nur wegen der abschreckenden Wirkung, da er ihn für seine Waffe, ein kompaktes SAR-80-Sturmgewehr, gar nicht benötigte.
»Los! Weiter!«
Inschallah, so Gott will, schießen sie sich nicht gegenseitig über den Haufen, dachte er. Er konnte auf keinen der ohnehin nur zwölf Kämpfer verzichten, zumal ein Grünschnabel wie gelähmt im Skiff lag, zu erschöpft, um sich zu übergeben, nachdem er seinen Mageninhalt schon vor Tagen losgeworden war.
Maxamed sah eine Schrotflinte über dem Heck auftauchen. »Gewehr!«
Der Pirat, der als Erster die Strickleiter erklommen hatte, erstarrte. Der Matrose auf der Jacht, der mit der Schrotflinte bewaffnet war, ein christlicher Filipino mit einem silbernen Christuskreuz um den Hals, erstarrte ebenfalls, offensichtlich nicht abgebrüht genug, um auf einen Mitmenschen zu schießen, obwohl sein eigenes Leben bedroht war.
Maxamed feuerte sein Sturmgewehr ab. Der Matrose stürzte ins Wasser. Maxamed führte den Rest der Truppe über die Strickleiter an Bord der Jacht und sprintete zur Kommandobrücke, um Satellitentelefone, Funkgeräte und Notsender außer Gefecht zu setzen.
Die schwere Weste und der Patronengurt bremsten ihn etwas, zudem hatte er seit einem Jahr kein Schiff mehr geentert. Er hatte sich darauf verlegt, von der Küste aus die Fäden zu ziehen und sich um das Einsammeln der Lösegelder zu kümmern. Diese Jacht war jedoch ein besonderer Fall.
Seine Männer – Jungen eigentlich, die halb so alt waren wie er und von unvorstellbaren Reichtümern träumten – rannten voraus, die Treppe zur Brücke hinauf. Einer feuerte eine ohrenbetäubende Salve mit seiner AK-47 ab. Maxamed eilte hinterher, um zu verhindern, dass sie wertvolle Geiseln töteten oder Instrumente zerstörten, die für das Steuern der Jacht unverzichtbar waren. Das Schiff zu entern war nur der Anfang; der eigentliche Kampf bestand darin, die Kontrolle zu behalten.
Die Schüsse verstummten.
Frauen schrien.
Während er die Treppe hochlief, sah er einen seiner Männer, der eine Gruppe reicher Europäer in Schach hielt. Er sprang die letzten Stufen zur Brücke hinauf und trat in die kühle, klimatisierte Luft der verglasten Kommandozentrale. Von hier aus konnte er das Meer in allen Richtungen überblicken. Vorne stand ein Hubschrauber, ein zweiter – ein prächtiger, großer Sikorsky – mittschiffs. Ein Schwimmbecken funkelte wie ein blauer Edelstein.
Farole, sein spindeldürrer Stellvertreter, deutete mit seiner Waffe auf einen Mann in mittleren Jahren und eine auffallend schöne blonde Frau. Maxamed hatte sie bereits auf Fotos gesehen und erkannte seine beiden kostbarsten Geiseln: den Amerikaner, dem die Jacht gehörte, und die reiche italienische Gräfin. Die somalischen Frauen waren für ihre Schönheit bekannt – es gab in ganz Afrika, vielleicht sogar weltweit, keine schöneren –, aber diese Gräfin stellte sie alle in den Schatten, auch wenn sie, so wie jetzt, leichenblass war und vor Angst zitterte.
Maxamed bedeutete Farole, mit den beiden Geiseln zur Seite zu gehen, ehe er zum Steuerstand des Schiffs schritt, um GPS, Funk und Radar abzuschalten – kurz, alles, was Signale aussendete, die von einer Seepatrouille empfangen werden konnten. Er wusste, wonach er suchte, und brauchte nur wenige Sekunden, um das Schiff von der Welt abzuschneiden, aus der es kam. Dann stellte er die Maschinen auf manuelle Steuerung um und nahm Fahrt zurück, um ihr Skiff an Bord zu holen.
Der Amerikaner im mittleren Alter erkannte in Maxamed den Anführer der Piraten und wandte sich mit zorngerötetem Gesicht an ihn. »Ist Ihnen klar, mit wem Sie es verdammt noch mal zu tun haben?«
Maxamed war in der Stadt aufgewachsen und sprach mehrere Sprachen: Somali, Italienisch und Englisch. Da er aus der Küstenregion stammte, konnte er sich auch auf Swahili verständigen, wenn er mit Arabern oder ostafrikanischen Söldnern zu tun hatte. Das Englische schätzte er besonders, weil es sich so gut für Wortspiele eignete, für die er als Somalier eine Vorliebe hatte. Leider hatte er nicht oft Gelegenheit, die Sprache zu benutzen, weshalb er einige Augenblicke brauchte, um die deftige Ausdrucksweise des Amerikaners voll und ganz zu verstehen.
»Das weiß ich sehr wohl. Die Frage ist, ob Ihnen klar ist, dass Sie mit dem Tod spielen.«
»Sie spielen mit dem Tod!«, schoss der Amerikaner zurück. »Ich habe euren Piratenkönig dafür bezahlt, in Ruhe gelassen zu werden.«
»Sie sehen den neuen König vor sich«, erwiderte Maxamed. »Bashir hat abgedankt.«
»Ich habe gestern mit ihm gesprochen.«
»Aber nicht heute.«
»Ich rufe ihn sofort an.« Adler zog ein Satellitentelefon von seinem Gürtel.
Maxamed richtete sein Gewehr auf die Stirn des Amerikaners. »Nicht heute.«
»Sie wollen Ihre reichste Geisel erschießen?«, rief der Amerikaner.
»Ich brauche Sie nicht«, gab Maxamed zurück. »Wenn mir Ihre Versicherung nur zehn Prozent vom Kaufpreis der Jacht zahlt, bin ich der reichste Mann in Somalia.«
Der Amerikaner hob die Hände.
Maxamed blaffte seine Befehle. Zwei seiner Männer führten die Leute von unten auf die Brücke herauf.
Maxamed musterte sie eingehend. Zwei Paare und eine Frau: groß und dunkelhaarig, mit Armen und Beinen so dünn wie Bohnenstangen. Sie war ein französisches Model. Der eine Mann und seine Frau waren sehr alt, der Mann gebrechlich und die Frau mit hartem, arrogantem Gesichtsausdruck. Sie waren ehemalige UNO-Mitarbeiter – nicht reich, aber mit dem steinreichen Schiffseigner verwandt. Das andere Paar war jünger, in den Fünfzigern, und hielt sich an den Händen. Armreifen klimperten am Handgelenk der Frau. Ein weißer Streifen am sonnengebräunten Handgelenk des Mannes ließ erkennen, dass er normalerweise eine Uhr trug; eine Wölbung in der Hosentasche deutete darauf hin, dass er seine goldene Rolex noch schnell eingesteckt hatte.
Alle wirkten verängstigt. Sie würden keinen Widerstand leisten.
Seine übrigen Männer trieben die Mannschaft herauf.
Maxamed zählte sechs Gäste und neunzehn Mann Besatzung: Maschinist, Erster Offizier, Bootsmann, Koch und Gehilfen, Matrosen, Stewardessen und ein Hubschrauberpilot.
»Wo ist der Kapitän?«
Keiner antwortete.
Maxamed musterte ihre Gesichter und suchte sich das jüngste Besatzungsmitglied heraus: ein blondes Mädchen mit dem weißen Kostüm einer Stewardess. Der kurze Rock endete oberhalb ihrer strammen Oberschenkel. Er drückte ihr seine Waffe an die Stirn.
»Wo ist der Kapitän?«
Das Mädchen begann zu weinen. Die Tränen verwischten ihr blaues Make-up.
Der chinesische Koch antwortete für sie. »Kapitän ist in sicherem Raum eingeschlossen.«
»Wo?«
»Bei Maschinenraum.«
»Hat er ein Satellitentelefon?«
Der Koch zögerte.
»Sie haben eine Sekunde, um das Leben dieses Mädchens zu retten.«
»Ja, er hat ein Telefon.«
Maxamed schickte Farole mit zwei Männern nach unten. »Sagt dem Kapitän, ich werde die Stewardess erschießen, wenn er nicht rauskommt. Schnell!«
Sie warteten schweigend, die Besatzungsmitglieder wechselten ängstliche Blicke, während die Gäste es vermieden, einander in die Augen zu sehen. Die blonde Schönheit wirkte in sich zurückgezogen, entweder starr vor Angst oder einfach nur resigniert. Seine Männer kehrten mit dem entschlossen dreinblickenden amerikanischen Kapitän zurück und gaben Maxamed das Satellitentelefon.
»Wen haben Sie angerufen?«
»Was glauben Sie?«
»Um Himmels willen, sagen Sie es ihm!«, rief der Schiffseigner. »Sie bringen uns alle um.«
»Ich habe die United States Navy angerufen.«
»Haben Sie ihnen unsere Position durchgegeben?«
»Was glauben Sie?«, murrte der Kapitän.
»Ich glaube, Sie bringen viele unschuldige Menschen in Gefahr.« Maxamed wandte sich an Farole. »Setzt den Kapitän und seine Mannschaft in ein Beiboot. Nehmt das Funkgerät heraus und legt den Motor lahm.«
»Du lässt sie laufen?«
»Wir behalten die reichen Leute.«
»Und die anderen?«
»Zu viele, die wir bewachen und durchfüttern müssten. Außerdem macht es sich gut auf CNN.«
Farole grinste. »Sehr human … das kommt gut an.«
»Außerdem, wer zahlt schon gutes Geld für gewöhnliche Besatzungsmitglieder?« Maxamed erwiderte sein Lächeln. Die praktischen Gründe spielten durchaus eine Rolle, doch es gab noch etwas, das er Farole vorenthielt. Die Luxusjacht und die reichen Geiseln würden ihn vom einfachen Piraten zu einem mächtigen Kriegsherrn in diesem von Konflikten zerrissenen Land machen. Ein Pirat, der unschuldige Arbeiter freiließ und nur die Reichen festhielt, gewann die Achtung und Bewunderung der Menschen. Er würde als Robin Hood dastehen, als Mann mit Prinzipien.
»Gebt ihnen genug Wasser und Essen, aber vergesst nicht, den Motor lahmzulegen. Bis man sie aufgabelt, sind wir längst in Eyl.«
Allen Adler wartete ab, bis die Piraten damit abgelenkt waren, das Beiboot zu Wasser zu lassen. Dazu musste die Geschwindigkeit der Tarantula auf drei Knoten gesenkt werden, ehe das Welldeck geflutet werden konnte, um das Beiboot starten zu lassen. Das alles konnte von der Brücke aus gesteuert werden, wenn man wusste, wie. Zu Adlers Überraschung wussten sie es. Seeleute waren eben Seeleute, dachte er sich, auch wenn es sich um gottverdammte Piraten handelte. Sie schalteten die Arbeitslampen ein, um das Heck zu beleuchten, und führten das Manöver so sauber durch, wie es auch Kapitän Billy nicht besser hinbekommen hätte.
Adler näherte sich langsam der Treppe.
Was die Piraten nicht wussten, und auch sonst niemand auf dem Schiff, nicht einmal der Kapitän: Im Schiffsboden war ein Ein-Mann-Schlauchboot verborgen, das völlig unbemerkt unter dem Schiff gestartet werden konnte und sich an der Oberfläche aufblies. Das Schlauchboot enthielt Lebensmittel und Wasser für eine Woche, zudem ein Funkgerät, GPS und ein Satellitentelefon. Dass niemand davon wusste, hatte einen einfachen Grund: Welchen Sinn hatte ein geheimes Fluchtvehikel, wenn es nicht geheim war? Es würde ein großes Gerangel um den einen Platz im Boot geben. Adler hatte diesen Moment des Öfteren durchgespielt, manchmal ganz real, manchmal nur im Kopf. Entscheidend war, einen kühlen Kopf zu bewahren und nicht zu vergessen, die Türen und Luken hinter sich zu verschließen.
Die Piraten verfolgten ebenso wie seine Gäste, wie das Beiboot aus dem Heck ins Wasser glitt. Adler rannte los.
Maxamed und Farole nahmen sein Spiegelbild im Fenster wahr, wirbelten herum und reagierten instinktiv wie zwei Katzen, die die Krallen ausfuhren, wenn sich etwas bewegte. Maxamed gab zwei Schüsse ab, bevor ihm klar wurde, dass der Narr ohnehin nicht entkommen konnte. Zu spät. Die Schüsse krachten ohrenbetäubend in dem geschlossenen Raum. Adler stürzte zu Boden, schlitterte über das Teakholz und prallte gegen das Treppengeländer.
»Hoffentlich hast du ihn nicht getötet«, sagte Maxamed zu Farole.
»Wir haben ihn beide getroffen.«
»Nein, ich habe in die Luft geschossen. Nur du hast ihn getroffen.«
Farole schüttelte den Kopf. Er wusste, dass es nicht stimmte, brachte jedoch ein anderes Argument vor. »Du hast gesagt, du brauchst ihn nicht.«
»Doch nur, um ihm Angst zu machen, du Idiot. Er ist der Reichste von allen.«
»Wir haben immer noch das Schiff.«
»Wenn das Schiff eine halbe Million wert ist, was glaubst du, wie hoch dann das Vermögen des Besitzers ist? Bete lieber, dass du ihn nicht getötet hast.«
Adler umklammerte seinen Oberschenkel mit beiden Händen und versuchte, sich aufzusetzen. Sein Gesicht war kreidebleich vom Schock. Er starrte ungläubig auf die Piraten und die Geiseln, die an den achterlichen Fenstern standen. Dann sank er zurück auf den Boden, ohne sein Bein loszulassen.
Maxamed beobachtete, wie sich die reichen Leute um ihn scharten. Die Frauen hielten sich die Hand an den Mund, die Männer starrten ihn mit geweiteten Augen an. »O Gott«, flüsterte einer. »Das viele Blut.«
Es sah aus, als würde Adler in Blut schwimmen. Ein Rückenschwimmer in einem Becken mit rotem Wasser, ging es Allegra Helms durch den Kopf. »Wir müssen die Blutung stoppen«, sagte die Frau aus New York. »Eine Arterie ist durchtrennt. Seht ihr, wie es pulsiert?«
Das Blut spritzte in rhythmischen Stößen gegen seine Hose, als würde eine Maus versuchen, sich daraus zu befreien.
»Abbinden«, sagte der weißhaarige Diplomat. »Wir müssen die Wunde abbinden.«
Maxamed drängte ihn zur Seite und kniete sich in die Blutpfütze. Er öffnete Adlers Gürtel, riss ihn aus den Schlaufen und zog ihm die Hose bis zu den Knien herunter. Dann schlang er den Gürtel oberhalb der Wunde um das Bein und zog ihn zu.
Das Blut spritzte weiter hervor. Der Gürtel ließ sich nicht fest genug zuziehen.
»Nehmen Sie das.« Allegra gab ihm ihren Schal. Maxamed band ihn um Adlers Oberschenkel, steckte sein Gewehr in die Schlinge und drehte es mehrmals, bis sich das Tuch fest ins Fleisch schnitt. Das Blut hörte endlich auf zu fließen.
»Halten Sie das!«, befahl er ihr.
Sie kniete sich neben ihn in die Blutpfütze und hielt die Waffe mit beiden Händen. Es kam ihr vor, als spüre sie Adlers Herz durch den Stahl des Gewehrs schlagen. Es fühlte sich sehr schwach an, und ihr wurde schmerzlich bewusst, wie wenig sie über Erste Hilfe wusste. Sie konnte absolut nichts tun, um sein Leben zu retten.
Adler öffnete die Augen und schaute sie an. Sie spürte seinen Herzschlag langsamer werden. Er versuchte zu sprechen, und sie beugte sich zu ihm. »Hey, Gräfin. Hassen Sie Ihren Vater nicht, weil er die Dienstmädchen betatscht.«
Mit überraschender Klarheit wurde Allegra Helms bewusst, dass das wahrscheinlich die feinfühligsten Worte waren, die der Mann je gesprochen hatte. »Ich hasse ihn nicht«, flüsterte sie zurück, so intim wie mit ihrem Mann im Bett. »Er ist bloß nicht mein liebster Verwandter.«
»Wer denn?«
»Cousin Adolfo. Schon seit wir Kinder waren.«
»Haben Sie ihn geküss…?« Ein Ruck ging durch Adlers Körper. Der Druckverband glitt Allegra aus den Händen. Sie versuchte verzweifelt, ihn fester zusammenzuziehen, bis ihr klar wurde, dass es zwecklos war. Wo sein Blut eben noch pulsierend hervorgeströmt war, tröpfelte es nur noch heraus.
»O Gott«, stöhnte jemand.
Allegra stand auf und trat zurück, ohne den Blick von Adlers Gesicht zu wenden. Der geschockte Ausdruck war gewichen. Im Tod sah er wieder fast so aus wie immer: aggressiv und überzeugt von seiner Unverwundbarkeit. Zum ersten Mal verspürte Allegra wirklich Angst. Jetzt, da Adler tot war und Kapitän Billy in einem Beiboot davontrieb, sah sie niemanden mehr, der sie alle noch hätte beschützen können.
Die stets so herrisch auftretende Frau des UNO-Diplomaten fing an zu weinen. Ihr Mann tätschelte ihr unbeholfen die Schulter. Hank und Susan, die beiden New Yorker, hielten ihre Hände so fest umklammert, dass die Knöchel weiß hervortraten. Die arme Monique biss sich auf die Lippe und schüttelte unentwegt den Kopf.
»Lasst euch das eine Lehre sein«, mahnte der Pirat. »Tut ab jetzt, was ich sage. Wenn niemand Ärger macht, bleiben alle am Leben.«
Allegra Helms spannte sich innerlich an. Eben noch hatte sie sich völlig hilflos gefühlt in ihrer Angst, doch nun war sie vor allem wütend. »Sie hätten ihn nicht umbringen müssen.«
»Wenn keiner Ärger macht, braucht keiner mehr zu sterben«, schoss der Pirat zurück.
»Wohin hätte er denn flüchten sollen? Sie haben sein Schiff in der Hand. Er hätte sich nirgends verstecken können.«
»Kein Ärger, keine Toten.« Maxamed wandte sich an seinen Stellvertreter. »Wir nehmen Kurs auf Eyl.«
»Es geht nicht.«
»Warum nicht? Du hast gesagt, du hast schon Schiffe gesteuert.«
»Das habe ich auch. Aber die Instrumente sind tot.«
»Was ist mit dem Radar?«
»Funktioniert auch nicht mehr«, antwortete Farole, der Elektrotechnik studiert hatte. »Ich wette, der Kapitän hat es irgendwie mit einer Überspannung lahmgelegt.«
»Kein Radar?« Maxamed war einen Moment geschockt. Das Radar war lebenswichtig. Die Fischer unter seinen Männern waren sehr wohl in der Lage, das Schiff per Kompass oder sogar nach dem Stand der Sterne nach Hause zu bringen. Doch sie brauchten das Radar, um den Marinepatrouillen ausweichen zu können.
»Wo ist dieses Boot?«, fragte er wütend.
»Schon fortgetrieben.«
»Findet es.«
»Wozu?«
»Werft diesen verfluchten Kapitän ins Meer.«
Farole legte Maxamed die Hand auf den Arm. »Mein Freund, wir müssen das Schiff nach Eyl bringen. Wir haben keine Zeit für Rache.«
Maxameds Gesicht war angespannt vor Zorn, die Augen traten hervor. Farole betete zu Gott, dass er zur Vernunft kommen würde, bevor er wie ein Vulkan explodierte.
»Ein humanes Signal, wie du gesagt hast.«
2
48°9' N, 103°37' W
Bakken-Ölfeld
North Dakota, nahe Montana
Paul Janson schob einen Betrunkenen aus dem Weg des Krankenwagens, der vom Parkplatz des Frack Up Bar & Grill abfuhr. Dann schlängelte er sich durch die Menge der Bohrarbeiter, die johlend den Kampf zwischen zwei Männern in einem Maschendrahtkäfig verfolgten.
Es war ein kalter Abend, die Luft erfüllt von den Dieselabgasen der Trucks, deren Motoren die Leute in der Kälte laufen ließen. Eine dreißig Meter hohe Feuersäule vom Abfackeln der Gase aus der Erdölförderung erleuchtete den Käfig taghell.
Dem größeren Kämpfer lief Blut aus der Nase auf die behaarte Brust.
Eine Frau in einer kurzen Daunenjacke tänzelte mit ihren nackten Beinen durch den Ring und hielt eine Tafel hoch, um die zweite Runde anzukündigen. Handys blitzten auf, als einige Fans sie fotografierten. Als sie heraustrat und die Tür schloss, wandte sich Janson an sie. »Wo kann man sich hier für einen Kampf anmelden?«
»Nirgends. Die Jungs hier haben meistens ihre Gründe, nicht aufzufallen, und tragen sich nicht gern mit ihrem Namen ein. Wenn Sie kämpfen wollen, stellen Sie sich an.«
»Wo?«
»Der Letzte in der Schlange ist der Trucker da drin, der gerade von dem chinesischen Wirbelwind vermöbelt wird. Der zugedröhnte Typ hat schon drei Männer ins Krankenhaus befördert. Sonst hat niemand mehr Lust.«
Der »Wirbelwind« war ein hoch aufgeschossener Amerikaner chinesischer Abstammung, der unermüdlich durch den Ring tänzelte und seine Dreadlocks schüttelte. Er war tatsächlich zugedröhnt, die Augen von Crystal Meth geweitet. Doch sein Körper war steinhart, und er bewegte sich mit der tödlichen Anmut eines Kampfsportmeisters.
Er bot den Leuten eine sehenswerte Show, schnellte in die Luft und vollführte einen blitzschnellen Rückwärtssalto, um mit bestechender Sicherheit auf beiden Beinen zu landen. Mit einem zweiten Salto näherte er sich dem Trucker, der einige Zentimeter größer und mindestens zwanzig Kilo schwerer war. Der Fahrer griff mit einer gekonnten Links-Rechts-Kombination an, doch sein flinker Gegner antwortete mit zwei blitzschnellen Schlägen und sprang sofort wieder außer Reichweite. Am Auge getroffen, ging der Trucker erneut zum Angriff über, um seine Größe und sein Gewicht zum Tragen zu bringen. Sein Gegner vollführte den nächsten Salto, landete auf einem Fuß, scheinbar das Gleichgewicht verlierend, ehe der andere Fuß emporschoss und den Trucker mit einem Tritt gegen das Kinn fällte.
Die Menge johlte und pfiff. Handys blitzten. Die langbeinige Frau bedeutete ihren Assistenten, den Verlierer aus dem Ring zu tragen. Der Sieger beschimpfte die Zuschauer und forderte die Männer auf, sich zum Kampf zu stellen.
Paul Janson zog seine Windjacke aus und trat in den Käfig. Der Boden war rutschig von Blut.
Sein Gegner empfing ihn mit einem Rückwärtssalto und lief im Kreis, um Janson zu provozieren. »Was willst du denn hier, Graukopf? Geh nach Hause, alter Mann.«
Janson sprach ihn leise an.
»Was? Wer bist du? Verdammt, woher kennst du meinen Namen?« Das Crystal Meth machte Denny Chin zu ungeduldig, um auf eine Antwort zu warten. Er wirbelte durch die Luft und tänzelte um Janson herum, um ihn in die Mitte des Rings zu treiben. Ein weiterer Salto, dann setzte er zu einem gezielten Fußtritt an.
Janson machte einen blitzschnellen Schritt zu ihm hin und schlug zu.
Der Kämpfer mit den Dreadlocks landete auf dem Rücken. Er wollte sich aufsetzen, doch Janson war bereits auf ihm. Der Hals des Mannes war kräftig, aber nicht dick. Eine breite Hand umspannte die beiden Halsschlagadern. Als Chin seinen Widerstand aufgab, hievte Janson ihn sich auf die Schulter und trug ihn aus dem Käfig.
»Wo bringen Sie ihn hin?«, rief die Frau.
»Nach Hause.«
»Die ASC kriegt, was sie will«, lautete eine im Ölgeschäft geläufige Umschreibung der Managementpraktiken der American Synergy Corporation. Die arroganten Hundesöhne hatten nichts Sympathisches an sich, doch niemand arbeitete härter und effizienter als die 68 000 Beschäftigten von ASC.
Mitten in der Nacht versammelten sich in Houston, Texas, – 1800 Meilen von den Bakken-Ölfeldern entfernt – sieben Männer und zwei Frauen, die von den 68 000 mit »Sir« und »Ma’am« angesprochen wurden, in einem abhörsicheren Konferenzsaal hoch oben in dem dreißigstöckigen siloartigen Gebäude am Sam Houston Tollway, in dem das Unternehmen seine Zentrale eingerichtet hatte.
Mit nächtlichen Sitzungen verschwendete man keine kostbare Tagesarbeitszeit. Es gab zwar keinen Dresscode für solche Zusammenkünfte nach Mitternacht, doch die Abteilungschefs, die sich an den Palisandertisch setzten, hätten auch bei einer Vorstandssitzung der US-Notenbank oder einer Beerdigung nicht fehl am Platz gewirkt.
Kingsman Helms, der groß gewachsene, gut aussehende, achtunddreißigjährige Direktor der Erdölabteilung, gab den Maßstab vor mit seinem makellos gebügelten grauen Anzug und der perfekt sitzenden roten Krawatte mit dem Sonnensymbol des Petroleum Club. Helms’ Abteilung fuhr die mit Abstand größten Gewinne ein, was ihn zum zweitreichsten der hier Anwesenden machte, doch er strebte ebenso wie seine Rivalen nach der wahren Macht im Unternehmen.
Der Reichste von ihnen war der zurückgezogen agierende Generaldirektor Bruce Danforth – im engsten Kreis der wenigen, denen seine Anwesenheit zuteilwurde, der »Buddha« genannt. Und was seine Macht betraf, so setzte er sie stets kühl kalkuliert und äußerst wirkungsvoll ein. Über vierzig Jahre hinweg hatte Danforth kontinuierlich Ölbohrfirmen, Pipelines und Raffinerien zu einem Unternehmen zusammengeschweißt, das in freibeuterischer Manier weltweit tätig war und inzwischen über mehr Einfluss verfügte als die meisten Staaten dieser Erde. Danforth ging bereits auf die Neunzig zu und sah mit seinem zerfurchten Gesicht und den eingefallenen Wangen auch keinen Tag jünger aus. Doch seine Augen waren immer noch scharf und klar, sie leuchteten wie zwei Scheinwerfer unter dem dichten schneeweißen Haar und dem Spitzbart, der immer noch schwarz durchsetzt war. Er schien über eine derart unverwüstliche Konstitution zu verfügen, dass seine Abteilungschefs fürchteten, er würde nie sterben.
Buddhas Gehör war so scharf wie eh und je, und wenn seine Gedanken in die Ferne schweiften, wussten diejenigen, die ihn am meisten fürchteten, dass sie den Fehler begangen hatten, ihn zu langweilen. Seine Stimme klang dünn, doch es gab keinen, der ihr nicht aufmerksam lauschte, auch wenn er eine Sitzung mit dem Credo eröffnete, das sie alle schon tausendmal gehört hatten:
»Falls Sie glauben, das Geld im Ölgeschäft ist leicht verdient, wird es Zeit, dass Sie Ihre Gewinne steigern.«
Jede Abteilung hatte sechzig Sekunden Zeit, um zu berichten, wie sie ihre Gewinne zu steigern gedachte. Kingsman Helms kam als Letzter an die Reihe, eigentlich eine Ehre, wenngleich ihm schmerzlich bewusst war, dass es Douglas Case war, der Sicherheitschef von American Synergy, der an der Seite des Buddha saß. Angeblich war am Kopfende des Tisches einfach mehr Platz für Cases Rollstuhl. Doch bis vor Kurzem hatte Helms den Platz neben Buddha eingenommen. Die Änderung in der Sitzordnung war erst seit dem empfindlichen Rückschlag im Kampf um die Förderrechte vor der westafrikanischen Île de Forée vorgenommen worden – eine Niederlage, die Buddha nicht vergessen hatte.
Man hatte sich große Hoffnungen gemacht, als Spezialisten aus Helms’ Abteilung riesige Erdölreserven in den Gewässern vor der westafrikanischen Insel entdeckt hatten. ASC hatte durch die Unterstützung eines Putsches beinahe die Kontrolle über den kleinen Inselstaat erlangt. Wären sie nicht im letzten Augenblick gescheitert, so würde American Synergy nun über unermessliche Ölreserven verfügen. Als die unvermeidliche Schuldfrage gestellt wurde, hatte Kingsman Helms versucht, sich so gut wie möglich aus der Affäre zu ziehen, doch die bittere Wahrheit starrte ihn vom Kopfende des Tisches an: Bis vor Kurzem hatte die Sicherheitsabteilung nicht einmal an den Sitzungen teilgenommen. Heute saß Doug Case als Wächter gegen Cyberangriffe, starrköpfige Diktatoren, Verräter und Anschläge auf nigerianische Ölfelder an Buddhas Seite und genoss die vollen Rechte eines Abteilungsdirektors.
Danforth unterbrach Helms in der Mitte seiner sechzig Sekunden.
»Ja, ja, ja, aber wo waren Sie in den letzten zwei Wochen?«
»An nicht näher bestimmten Orten.« Helms lächelte verschwörerisch. Danforth wusste genau, dass er in Ostafrika, genauer gesagt in Somalia, die Interessen des Unternehmens vorantrieb. Doch der Alte liebte ein bisschen Geheimniskrämerei, ein Überbleibsel aus seiner ersten Karriere in einer Regierungsbehörde für geheime Missionen, bevor er seine Ambitionen dem Erdölgeschäft zugewandt hatte.
Der Buddha ließ Helms’ Lächeln unerwidert. »Ich meine, hier zu Hause. Wo um alles in der Welt …«
Das Handy in Helms’ Brusttasche klingelte hinter dem makellos gefalteten Einstecktuch.
Zorn flammte in den Augen des Buddha auf. »Sie kennen die Regel: Keine Anrufe, außer es geht um Leben und Tod.«
Helms fischte das Handy heraus. Die Assistentin, die ihn anrief, die matronenhafte Kate Clark, die er sich aus Doug Cases Sicherheitsabteilung geschnappt hatte, kannte die Spielregeln, und er vertraute auf ihr gesundes Urteilsvermögen.
»Was gibt’s?«
Was sie ihm mitteilte, kam so absolut unerwartet, dass er nur ein geflüstertes Wort herausbrachte: »Piraten?«
Keiner der Kollegen, nicht einmal Case, hatte es gehört.
Doch dem alten Buddha mit seinen feinen Antennen war es nicht entgangen. Als Helms den Konferenzraum verließ, winkte ihn Danforth zu sich. »Kümmern Sie sich darum, und zwar schnell«, murmelte er. »Bevor Ihnen die verdammten Chinesen den Braten wegschnappen.«
Helms eilte zur Tür hinaus und hörte den Alten die Stimme erheben. »Die Sitzung ist geschlossen. Doug, Sie bleiben noch.«
Helms schaute zurück. Doug Case manövrierte seinen Rollstuhl zu dem alten Mann, und Helms hätte ein Jahr seines Lebens gegeben, wenn er hätte hören können, was die beiden besprachen.
Douglas Case wartete, bis die letzte Abteilungschefin den Raum verließ und die Tür schloss.
»Darf ich fragen, worum es ging?«
Buddha starrte Case an, ohne auf die Frage einzugehen. Case senkte den Blick als Eingeständnis, dass er eine verbotene Grenze überschritten hatte. Als der alte Mann schließlich das Wort an ihn richtete, ging es um etwas völlig Unerwartetes.
»Heute hatte ich ein interessantes Gespräch mit Yousef.«
Doug Case sah den alten Mann bewundernd an. Dass Buddha die Verhandlungen mit Yousef in Italien fortsetzte, während er gleichzeitig das Projekt in Somalia vorantrieb, bewies wieder einmal, dass er wie ein Meisterjongleur die Interessen des Unternehmens in Einklang brachte. In dieser Kunst konnte ihm kein anderer Chef eines Erdölunternehmens das Wasser reichen. Natürlich war es kein Nachteil, dass der Buddha Yousefs Familie seit Langem kannte. Die American Synergy Corporation hatte bereits mit dem Diktator Geschäfte gemacht, lange bevor Yousef geboren wurde. Der Buddha hatte Yousefs Vater – und sich selbst – reich gemacht, indem er den Aufbau der Infrastruktur zur Erdölförderung unterstützte und später, als der alte Herrscher unberechenbar wurde, das Ölembargo umging. Als der sogenannte Arabische Frühling ihre gewinnbringende Übereinkunft zunichtemachte, hatte der Buddha die italienische Regierung überredet, Paul Jansons Catspaw Associates damit zu beauftragen, Yousef aus dem Land zu bringen, bevor sie ihn an einem Bohrturm aufhängten.
Die Italiener hatten gehofft, sich in eine günstige Position zu bringen, indem sie dem jungen Mann Asyl gewährten und damit zu einem rascheren Ende der Kämpfe beitrugen. Doch der Buddha hatte seine eigenen Pläne. Er war überzeugt, dass Yousef im Gegensatz zum Rest seiner Familie die Intelligenz und den Ehrgeiz besaß, um die Macht an sich zu reißen, wenn die Revolution auseinanderbrach.
»Ich bewundere Yousef«, bemerkte Case. »Er verfolgt seine Pläne mit großer Geduld und weiß genau, was er will.«
Der Buddha hob ungerührt eine Augenbraue. »Yousef will das zurück, was er als sein Erbe betrachtet – sein Land, das von den reichen Ölvorkommen lebt. Und er weiß, dass ihm der Internationale Strafgerichtshof im Nacken sitzt.«
»Angeblich ist er aus Sardinien geflüchtet. Ist er zurück in Libyen?«
Auch diese Frage würde der alte Mann nicht beantworten. Er sah Case schweigend an, bis dieser den Blick senkte.
»Wir werden Yousef dabei unterstützen, sich vor der Welt und dem amerikanischen Kongress als legitimer Nachfolger seines Vaters zu präsentieren. Dafür wird er uns von den Ressourcen des Landes profitieren lassen. Und es wird ihm gelingen, die Ordnung im Land aufrechtzuerhalten, was er ja schon für seinen verrückten Vater versucht hat. Er hat die technischen Mittel, um für Sicherheit zu sorgen. Und eine Geheimpolizei, die jede Opposition im Keim ersticken wird.«
»Es war sehr weitsichtig von Ihnen, Yousef zu retten.«
»Das will ich meinen. Yousef muss jetzt nicht mehr den Launen seines durchgeknallten Vaters folgen – er kann jetzt selbst regieren. Und ich gebe gern zu, Doug, dass Sie mit Paul Janson recht hatten.«
»Danke, Sir.«
Doug Case hatte den Buddha davon überzeugt, dass niemand besser geeignet war, Yousef aus dem allgemeinen Chaos herauszuholen, als Paul Janson. Er vermochte wie kein anderer eine Situation einzuschätzen und verfügte zudem über äußerst qualifizierte Mitarbeiter. Janson machte sich keine Illusionen, was Yousefs Absichten betraf, doch die Aussicht auf ein baldiges Ende des Bürgerkriegs hatte ihn bewogen, den Auftrag anzunehmen. Zudem ließ sich auf diese Weise verhindern, dass das Arsenal des Diktators den Dschihadisten in die Hände fiel, die die Waffen unverzüglich gegen Algerien und Mali einsetzen würden.
»Janson wird es bereuen, den Job übernommen zu haben«, bemerkte der Buddha ernst. »Können Sie immer noch garantieren, dass er nicht weiß, wer dahintersteckt?«
»Ja. Selbst wenn die Italiener zu viel plaudern – sie kennen nur die Mittelsmänner. Weder Sie noch ich noch ASC insgesamt hat auch nur die kleinste Spur hinterlassen. Janson hat keine Ahnung, dass wir ihm den Auftrag verschafft haben.«
»Es hat mich ein wenig überrascht, dass er ihn angenommen hat.«
»Optimismus ist Jansons Achillesferse«, meinte Case.
Paul Janson musste gewusst haben, dass Yousef kein Dummkopf und auch kein Freund von Freiheit und Demokratie war. Doch die Hoffnung auf einen guten Ausgang der Krise hatte ihn Yousefs Ambitionen unterschätzen lassen.
3
47°55' N, 96°26' W
U.S. Highway 2, Richtung Osten
North Dakota
Als Denny Chin erwachte, schien ihm die Sonne in die Augen. Er saß angegurtet auf dem Beifahrersitz eines F-150 XL SuperCrew Pick-ups, der mit 120 km/h ostwärts rollte. Paul Janson reichte ihm eine Wasserflasche.
»Meth macht durstig.«
»Was du nicht sagst.« Chin nahm einen langen Schluck und warf die leere Flasche über die Schulter zurück auf den Rücksitz. »Wer zum Teufel bist du?«
»Wie hast du mich in dem Käfig genannt?«
»Alter Mann?«
Chin musterte ihn eingehend. Die Narben hätten ihm schon gestern auffallen müssen, wäre er nicht so zugedröhnt gewesen. Ebenso die Augen, die gleichzeitig abwesend und wachsam wirkten. Er hatte sich von der stahlgrauen Haarfarbe des Kerls täuschen lassen.
»Du bist nicht alt.«
»Was du nicht sagst.«
Denny Chin schaute ihn nachdenklich an. »Moment mal. Du bist der Alte. Der Typ, der dieses Phoenix-Rehabilitierungsprojekt durchzieht, oder?«
»Einer von vielen, die es unterstützen.«
Janson gab ihm noch eine Wasserflasche.
Denny Chin trank und legte die leere Flasche in seinen Schoß. »Die Leute in dem Programm reden über dich. Fragen sich, wie du tickst und warum du es machst?«
»Wenn sie eine Antwort finden, haben sie mir was voraus.«