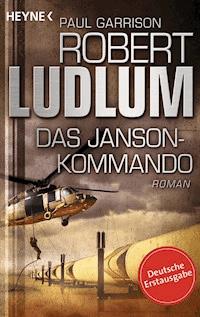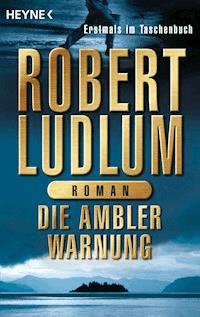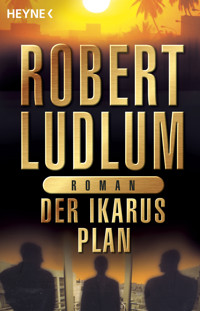9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: JANSON-Serie
- Sprache: Deutsch
Paul Janson hat schon zahlreiche Morde vereitelt. Aber diesmal droht ein Krieg.
Seoul: Gregory Wyckoff ist auf der Flucht vor den koreanischen Behörden. Ihm wird vorgeworfen, seine eigene Freundin erdrosselt zu haben. Gregorys Vater, ein bekannter Senator, hat jedoch eine andere Theorie. Soll sein Sohn geopfert werden, um ein finsteres Komplott des U.S.-Außenministeriums zu vertuschen? Ex-Regierungsagent Paul Janson verspricht, die Wahrheit ans Licht zu bringen – und wird bald selbst von einem erbarmungslosen Killer gejagt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
U.S.-Senator Jamey Wyckoff betraut den ehemaligen Regierungsagenten Paul Janson und die Scharfschützin Jessica Kincaid mit einer heiklen Mission: Sie sollen seinen Sohn Gregory aufspüren, dessen Freundin Lynell in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul tot aufgefunden wurde. Gregory musste fliehen, um einer Mordanklage zu entgehen. Doch Senator Wyckoff ist von der Unschuld seines Sohnes überzeugt. Er glaubt, dass Lynell ermordet wurde, weil sie bei einer kürzlich stattgefundenen internationalen Konferenz eine Unterredung belauscht hat, von der niemand etwas erfahren sollte.
Tatsächlich kommen Janson und Kincaid in Korea einer Verschwörung von ungeahntem Ausmaß auf die Spur. Wenn es ihnen nicht gelingt, die Pläne zu vereiteln, wird bald die ganze Welt im Chaos versinken …
Die Autoren
Robert Ludlum erreichte mit seinen Romanen, die in mehr als dreißig Sprachen übersetzt wurden, weltweit eine Auflage von über 280 Millionen Exemplaren. Robert Ludlum verstarb im März 2001. Die Romane aus seinem Nachlass erscheinen bei Heyne.
Ein ausführliches Werkverzeichnis finden Sie auf heyne.de/ludlum
Douglas Corleone ist der Autor zahlreicher international erfolgreicher Thriller. Er arbeitete als Strafverteidiger in New York City und lebt heute auf Hawaii.
Robert Ludlum
Douglas Corleone
Die Janson-Verschwörung
Roman
Aus dem Amerikanischen von Norbert Jakober
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe THE JANSON EQUATION erschien 2015 bei Grand Central Publishing, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Zitat aus:
Demick B., »Im Land des Flüsterns«.© 2010 Dt. Übersetzung von Gabriele Gockel und Marina Zybak – Droemer Verlag. Ein Imprint der Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG, München
Vollständige deutsche Erstausgabe 10/2017
Copyright © 2016 by Myn Pyn, LLC
Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Alexandra Klepper
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München,
unter Verwendung eines Motivs von © shutterstock (Mieszko9, Ivan Cholakov)
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-13034-3V001
www.heyne.de
Für Jack
Schaut man vom All auf die Erde, gibt es auf dem asiatischen Kontinent, wenn dort die Dunkelheit hereinbricht, einen schwarzen Fleck. Das ist Nordkorea.
Barbara Demick,
Im Land des Flüsterns. Geschichten aus dem Alltag in Nordkorea (2009)
Männer gesucht für gefährliche Reise. Geringer Lohn, bittere Kälte, lange Monate in vollkommener Dunkelheit. Sichere Rückkehr fraglich. Ehre und Anerkennung im Fall des Erfolges.
Ernest Shackleton,
Anzeige in der London Times für seine Südpol-Expedition von 1914
Prolog
Dongchang Road, Neuer Stadtbezirk Pudong
Shanghai, Volksrepublik China
Aus der Lobby des Boutique-Hotels beobachtete Paul Janson verstohlen die drei uniformierten Wachmänner, die starr wie Statuen hinter dem Haupttor der Anlage auf der anderen Straßenseite standen. Es waren keine gewöhnlichen Wachen, sondern Soldaten der chinesischen Volksbefreiungsarmee, die, wie Janson inzwischen wusste, einen Regierungskomplex bewachten, in dem die Einheit 61398 untergebracht war, die für Chinas systematische Cyberspionage verantwortlich war. Ziel des organisierten Datendiebstahls waren Hunderte von Unternehmen und staatlichen Behörden in zwei Dutzend großen Industriestaaten, was den Betroffenen einen Schaden von Hunderten Milliarden Dollar bescherte.
Im Zentrum der Anlage stand das Hauptquartier der Cyberwar-Einheit 61398, ein etwa 12 000 Quadratmeter großes, zwölfstöckiges Gebäude, das Büroraum für gut zweitausend Mitarbeiter bot. Im Laufe der letzten sechs Monate hatte sich Jansons Interesse nach und nach auf eine bestimmte Person konzentriert, einen achtundzwanzigjährigen Mann, der unter dem Online-Namen Stiller Luchs auftrat.
Wie die Raubkatze, die im Norden und Westen Chinas, vor allem im tibetischen Hochland, verbreitet war.
Der für Fußgänger bestimmte Teil des massiven Eisentors wurde geöffnet, und der Mann, den Janson als »Stiller Luchs« kannte, trat hindurch, nickte einem Wachmann zu und ging zu einem der Fahrradständer vor der Anlage. Aus seiner Jacke fischte er einen kleinen Schlüssel, öffnete das Fahrradschloss und schob sein Rad einige Meter, bevor er sich auf den Sattel schwang und losfuhr. Während er langsam davonradelte, schritt Janson durch die Drehtür des Hotels und tauchte in das Meer der Fußgänger ein.
Nach sechs Monaten in Shanghai sehnte er sich nach Einsamkeit. Die Großstadt mit ihren rund siebzehn Millionen Einwohnern und ihren atemberaubenden Wolkenkratzern beeindruckte ihn immer wieder, doch der ständige Verkehr mit seiner Geräuschkulisse – dem Dröhnen der Hupen, dem Brummen der Motoren, dem Kreischen der Bremsen – ließ ihn wehmütig an vergangene Einsätze in Afrika denken.
Während er unter dem tief hängenden grauen Himmel den Gehsteig entlangging, befand sich Janson in einem Zustand höchster Wachsamkeit, auch wenn seine Gedanken für kurze Momente zu dem bevorstehenden Urlaub auf der Hawaii-Insel Maui schweiften, die er zusammen mit Jessie besuchen wollte. Sein Fokus sprang wie der Strahl einer Taschenlampe von einem Gesicht zum nächsten, auf der Suche nach etwas Vertrautem, etwas Auffälligem, einem Blick, der sich allzu schnell von ihm abwandte.
Er selbst hatte sein Aussehen geschickt verändert, sodass er auf den Straßen Shanghais kaum auffiel. Sein grau meliertes Haar war schwarz gefärbt und um einiges länger als gewohnt. Seine grauen, westlich geformten Augen waren hinter einer Ray-Ban-Sonnenbrille verborgen, die rosafarbene Gesichtshaut mit Schminke angepasst. Erstaunlicherweise gelang es dem Amerikaner selbst hier in China, absolut unauffällig zu bleiben.
Aus dem Augenwinkel beobachtete er, wie der Luchs in die Qixia Road einbog und sich der Baustelle näherte. Der Hacker trat nun ungewöhnlich kräftig in die Pedale, und Janson wünschte sich, er würde langsamer fahren, um keine Aufmerksamkeit zu erregen.
Während Janson selbst auf der Dongtai Road in Richtung Lujiazui Park eilte, bereute er, dass er seine Partnerin Jessica Kincaid nicht gebeten hatte hierzubleiben, bis die Mission abgeschlossen war. In diesem Moment hätte sie von einer Aussichtsplattform im Weltfinanzzentrum durch das Zielfernrohr ihres Scharfschützengewehrs das Geschehen beobachten können und ihn über seinen Ohrhörer warnen können, falls sie etwas Auffälliges bemerkte. Doch nun musste er ohne zusätzliches Auge aus der Luftperspektive auskommen. Jessie hatte ihre Aufgabe erledigt und sich die Extrazeit auf Hawaii verdient.
Schließlich verdankte er es ihr, dass er vor einigen Wochen mit dem Luchs hatte Kontakt aufnehmen können. Er hatte den Chinesen monatelang sowohl online als auch in natura beobachtet, bis er endlich beschloss, dass es Zeit war, den geldgierigen, ehrgeizigen Mann zu rekrutieren. Doch wie sollte er sich ihm nähern?
Jessica Kincaids Charme hatte ihm schließlich die Tür geöffnet. Nachdem sie dem Luchs zu einem protzigen Nachtclub gefolgt waren, ging Jessie auf ihn zu. Nach ein paar Drinks und einem kurzen Flirt führte sie ihn nach draußen, ans Westufer des Huangpu-Flusses, wo Janson auf ihn wartete, um dem achtundzwanzigjährigen Hacker das Geschäft seines Lebens anzubieten. Für detaillierte Informationen über die Aktivitäten der Cyberspionage-Einheit würde er eine neue Identität und genug Geld erhalten, um China und die Volksbefreiungsarmee ein für alle Mal hinter sich zu lassen.
Heute würden sie das Geschäft zeitgleich über zwei getrennte tote Briefkästen abwickeln, und Janson würde Shanghai mit handfesten Beweisen verlassen, dass die Volksrepublik China weltweit Wirtschaftsgeheimnisse stahl.
Eines der Opfer der Cyberwar-Einheit 61398 war die Edgerton-Gertz Corporation, ein amerikanischer Biotechnologie-Konzern, der seit sechs Jahren regelmäßig von Cyberdiebstahl heimgesucht wurde und dadurch Milliardenverluste hinnehmen musste. Edgerton-Gertz war Jansons Klient und der Grund, warum er nach Shanghai gekommen war. Der Generaldirektor des Unternehmens, Jeremy Beck, war von einem hochrangigen Angehörigen des amerikanischen Außenministeriums an Jansons Firma Catspaw Associates verwiesen worden, die Sicherheitsberatung für Unternehmen anbot. Immerhin hatte Janson jahrelang als Geheimagent für das State Department gearbeitet, genauer gesagt, für Consular Operations, eine Organisation, in der er regelmäßig mit »sanktioniertem Töten« beauftragt worden war. Seither waren Jahre vergangen, doch die Erinnerung daran begleitete ihn nach wie vor. Nicht zuletzt deshalb hatte er die Phoenix Foundation gegründet, eine Stiftung mit dem Ziel, ehemaligen Feldagenten, deren Leben aus der Bahn geraten und deren Psyche zerstört war, zu helfen, wieder Tritt zu fassen.
Janson warf einen Blick auf seine Uhr und schätzte, dass sich der Luchs nun der Baustelle näherte, auf der bald ein weiteres Hochhaus entstehen und Shanghais ohnehin schon einschüchternde Skyline bereichern würde. Hier, außer Sichtweite der gut gekleideten Passanten, würde der junge chinesische Hacker in einem markierten Versteck Geld und Papiere finden, um aus China flüchten zu können. Was der Luchs nicht wusste, war, dass in der Rückseite seines neuen südkoreanischen Passes ein GPS-Tracker verborgen war, der es Janson ermöglichte, den Mann zu verfolgen, falls er seinen Teil der Abmachung nicht erfüllte.
Janson bog nach links in die Century Avenue ein, eine von Touristen bevölkerte Straße mit Viersternehotels, Restaurants, Bars und Museen. Während er sich mit der Menge treiben ließ, die am Lujiazui Park vorbeiströmte, regte sich in Janson plötzlich ein vertrautes Gefühl. Sein in vielen Einsätzen geschärfter Instinkt meldete ein Alarmsignal. Wurde er beobachtet? Wenn ja, von wem? Von der silberhaarigen Chinesin, die allein auf einer Bank saß? Von dem nordeuropäischen Touristen mit rasiermesserscharfen Gesichtszügen, durchdringenden blauen Augen und langen blonden Haaren, der ihm gerade entgegenkam? Vielleicht von dem Mann und der Frau aus dem Nahen Osten, die in einem Café im Freien ihren Tee tranken?
Oder ist das nur Einbildung?
Fuhr das Taxi schräg hinter ihm nicht ungewöhnlich langsam? Und dieser Polizist auf seinem Segway-Roller – hatte Janson ihn nicht heute schon einmal vor seinem Hotel stehen sehen?
Bevor er Gelegenheit hatte, den Fragen nachzugehen, erkannte er auf der anderen Straßenseite die Einmündung in die Gasse, in der er seinen toten Briefkasten vorfinden sollte.
Janson steckte die Hände in die Taschen, beschleunigte seine Schritte und überquerte an der nächsten Kreuzung die Straße mitten in der Menge. Mit gesenktem Kopf beobachtete er den träge dahinfließenden Verkehr und die Gesichter der Passanten. An der gegenüberliegenden Ecke hob er den Blick zu den zahllosen Fenstern auf der anderen Straßenseite. In jedem von ihnen konnte ein Scharfschütze lauern, der sein Zielfernrohr auf die Gasse oder direkt auf Janson gerichtet hatte. Er suchte jedes einzelne Fenster für einen Sekundenbruchteil nach einem verräterischen Aufblitzen ab, einer kaum merklichen Bewegung eines Vorhangs oder der hervorlugenden Mündung eines Gewehrs.
Janson tauchte rasch in die lange, schmale Gasse ein, in der es nach Sesamöl roch. Aus einer Hintertür trat ein älterer Mann mit einer schmutzigen weißen Schürze und einer Zigarette im Mund, in jeder Hand einen prall gefüllten schwarzen Müllsack. Er warf Janson einen flüchtigen Blick zu, dann drehte er sich um und warf die Säcke in einen offenen königsblauen Container. Er drückte die Zigarette an der mit Graffiti übersäten braunen Klinkerwand aus, öffnete die Tür und verschwand im Haus.
Janson zählte seine Schritte und zog ein altes Blackberry ohne Akku aus der Hosentasche. Einige Augenblicke sah er auf das tote Display, ehe ihm das Gerät scheinbar versehentlich entglitt. Als es auf den Boden prallte, bugsierte er es mit dem Fuß zur Hauswand. Er bückte sich, um das Handy aufzuheben, und lächelte angesichts des eigenwilligen Verstecks, das der Luchs gewählt hatte: eine ausgenommene, gefriergetrocknete Ratte, die aussah, als wäre sie von einem Auto überfahren worden.
Irgendwie passend, dachte er.
Rasch hob Janson die Ratte auf und riss vorsichtig das Klettband auf, mit dem der Bauch verschlossen war. Im Inneren fanden seine Finger einen kleinen schwarzen USB-Stick. Er schloss das Klettband über der Bauchhöhle und legte die Ratte wieder hin. Das nutzlose Blackberry steckte er in die Hosentasche und ging weiter die Gasse entlang, die in eine schmale Straße hinter dem Jin Mao Tower mündete.
Janson bog nach links ab, dann noch einmal links, und kehrte in die Dongtai Road zurück, wo er sich ins Getümmel Richtung Century Avenue mischte.
Als er die Straßenecke erreichte, übertönte ein lauter Knall den Verkehrslärm. Einige Fußgänger drehten sich kurz in die Richtung, aus der das Donnern gekommen war, das manche für die Fehlzündung eines Autos zu halten schienen. Kaum jemand blieb stehen, die Verkehrslawine rollte unaufhaltsam weiter.
Janson hingegen hatte instinktiv gespürt, worum es sich handelte: um den Knall einer Achtunddreißiger. Augenblicke später krachte es ein zweites Mal – eindeutig aus der Richtung der leeren Baustelle, auf der Janson seinen toten Briefkasten eingerichtet hatte.
Er bog nach links in die Century Avenue ein und tauchte mit hämmerndem Puls in der Menge unter. Lautlos sagte er sich sein altes Mantra vor – klar wie Wasser, kalt wie Eis – und überlegte, wie er nun vorgehen sollte. Der Luchs war offensichtlich in eine Falle getappt und ermordet worden; das bedeutete, Janson konnte nicht in sein Hotel zurückkehren.
Zeit für Plan B.
Der bestand darin, ein Taxi zu nehmen und unverzüglich zum Pudong International Airport zu fahren.
Während er zum Taxistand drängte, warf er einen Blick auf die Uhr und stellte sich vor, sich im Fadenkreuz eines Scharfschützen der Volksbefreiungsarmee zu befinden. Falls der Schütze nur noch auf den richtigen Moment wartete, würde Janson wahrscheinlich in wenigen Sekunden tot sein.
Der Schweiß rann ihm über die Stirn, sein Magen krampfte sich zusammen.
Klar wie Wasser, kalt wie Eis.
Nach wenigen Augenblicken gelang es ihm, seine Atmung zu beruhigen, dennoch überkam ihn zum ersten Mal in den sechs Monaten, die er sich in Shanghai aufhielt, das beklemmende Gefühl, vielleicht nicht lebend aus der Stadt herauszukommen.
Janson sprang in ein Taxi und rief dem Fahrer auf Chinesisch zu, wohin er wollte. Im nächsten Moment überlegte er es sich anders, duckte sich tief in den Sitz und wies den Mann an, erst einmal rechts abzubiegen, und danach links in die Fushan Road.
Janson wählte eine Route, von der er wusste, dass der Verkehr nicht zu stark sein würde, und der Fahrer folgte den Anweisungen wortlos.
Nachdem sie fünfzehn Minuten durch das Labyrinth der Shanghaier Straßen gekurvt waren, während Janson den Rückspiegel nicht aus den Augen gelassen hatte, war er sich einigermaßen sicher, dass ihm niemand folgte.
Er dankte dem Fahrer auf Chinesisch für seine gute Arbeit, richtete sich auf dem rissigen Vinylsitz auf und wies den Mann an, ihn zum Flughafen zu bringen.
Sein Puls beruhigte sich, doch wirklich sicher würde er sich erst fühlen, wenn das Flugzeug in der Luft war.
Erster Teil
DER SOHN DES SENATORS
1
Joint Base Pearl Harbor-Hickam
Bei Honolulu, Hawaii
Zehn Minuten nachdem die Embraer Legacy 650 auf dem Militärflugplatz Hickam auf der Insel Oahu gelandet war, trat Paul Janson auf den warmen Asphalt des Rollfelds, wo ihn Lawrence Hammond, der Stabschef des Senators, erwartete.
»Danke, dass Sie gekommen sind«, begrüßte ihn Hammond.
Sie schüttelten einander die Hände, und Janson atmete die frische tropische Luft tief ein und genoss die sanfte Wärme der hawaiianischen Sonne auf dem Gesicht. Nach sechs Monaten unter dem vom Smog verhüllten Himmel über Shanghai wurde ihm erst richtig bewusst, wie viel Gift er in diesem halben Jahr eingeatmet hatte.
Für einen Moment schloss er die Augen hinter der Sonnenbrille und lauschte. Obwohl er von den typischen Geräuschen eines geschäftigen Militärflugplatzes umgeben war, genoss er die relative Ruhe und stellte sich die weißen Sandstrände und das azurblaue Wasser vor, das gleich außerhalb der Air Force Base auf ihn und Jessica wartete.
Hammond, ein groß gewachsener Mann mit glatt zurückgekämmtem, strohblondem Haar, geleitete Janson zu einem olivgrünen Jeep. Am Lenkrad saß ein junger Soldat, ein Private First Class, der seinem Aussehen nach noch nicht einmal Alkohol hätte trinken dürfen. Während sich Janson auf dem Beifahrersitz anschnallte, beugte sich Hammond zu ihm vor. »Erst neulich ist Air Force One hier gelandet.«
»Wirklich?«, fragte Janson, während sich der Jeep vom Jet entfernte.
Hammond interpretierte Jansons höfliche Antwort fälschlicherweise als echtes Interesse. »Ja, zu Weihnachten, genau gesagt. Die First Family hat in dem kleinen Strandort Kailua Urlaub gemacht.«
Den Rest der zehnminütigen Fahrt legten die drei Männer schweigend zurück. Janson hatte eigentlich vorgehabt, auf dem nahen Flughafen Honolulu International zu landen, um sich dort mit Jessie zu treffen und mit ihr nach Waikiki zu fahren, wo sie sich ein schönes Abendessen und ein paar Drinks genehmigen und eine aufregende Nacht im Pink Palace verbringen würden, bevor sie am nächsten Morgen nach Maui weiterfliegen würden. Doch ein Telefonanruf, der ihn vierzigtausend Fuß über dem Pazifik erreicht hatte, brachte seine schönen Pläne durcheinander.
Janson hatte sich in seiner Kabine ausgeruht und war kurz vor dem Einschlafen gewesen, als ihm seine Flugbegleiterin Kayla über die Sprechanlage mitteilte, dass ein Anruf vom Festland für ihn hereingekommen sei.
»Es ist ein US-Senator«, fügte Kayla hinzu. »Ich dachte mir, Sie würden rangehen wollen.«
»Welcher Senator?«, fragte Janson benommen. Er kannte nur wenige persönlich, und auch diese waren ihm nicht alle sympathisch.
»Senator James Wyckoff aus North Carolina.«
Wyckoff gehörte nicht zu der Handvoll, die Janson persönlich kannte. Doch bevor er Kayla anweisen konnte, sich die Telefonnummer für einen Rückruf geben zu lassen, teilte sie ihm mit, dass Wyckoff von seinem aktuellen Klienten Jeremy Beck, dem CEO von Edgerton-Gertz, an ihn verwiesen worden war.
Widerwillig nahm Janson den Anruf entgegen.
Als der Jeep zum Parkplatz eines kleinen Verwaltungsgebäudes einbog, wandte sich Janson an Hammond. »Der Senator ist schon hier?«, wunderte er sich.
Der Flug von Shanghai hatte etwas über neun Stunden gedauert, und Janson war schon zwei Stunden unterwegs gewesen, als ihn Wyckoffs Anruf erreichte. Von Washington, D. C., benötigte man selbst unter den günstigsten Umständen zehn Flugstunden nach Honolulu, und Janson war sich ziemlich sicher, dass Washington zu dieser Jahreszeit unter einer Schneedecke lag.
»Der Senator hat Sie aus Kalifornien angerufen«, erklärte Hammond. »Er hat eine Wohltätigkeitsveranstaltung in Los Angeles abgehalten, als ihn die Nachricht über seinen Sohn erreichte.«
Janson stieg schweigend aus dem Jeep und folgte Hammond und dem jungen Soldaten zum Gebäude. Der milchgesichtige Private First Class schloss die Tür auf und ließ Janson und Hammond eintreten. Im Haus war das Keuchen einer alten Klimaanlage zu vernehmen, und das natürliche Sonnenlicht wurde vom grellen Leuchten der summenden Neonröhren ersetzt.
Hammond führte Janson durch einen kahlen Gang mit abgenutztem Linoleumboden in ein geräumiges, aber sparsam eingerichtetes Büro im hinteren Bereich des Gebäudes. »Senator Wyckoff wird gleich hier sein«, sagte er und ließ ihn allein.
Zwei Minuten später rauschte eine Toilettenspülung, und der Senator persönlich trat aus einem Hinterzimmer und streckte ihm die Hand entgegen.
»Paul Janson, nehme ich an.«
»Freut mich, Senator.«
Janson nahm die Sonnenbrille ab und setzte sich auf den angebotenen Stuhl vor dem verschrammten Metallschreibtisch. Senator Wyckoff nahm auf der anderen Seite Platz, schlug die Beine übereinander und atmete tief durch, bevor er zu sprechen begann.
»Wie ich Ihnen schon am Telefon sagte, Mr. Janson, kann ich Ihnen nichts Genaueres über das Verschwinden meines Sohnes mitteilen. Wir wissen nur, dass Gregorys Freundin, mit der er drei Jahre zusammen war, eine schöne junge Frau namens Lynell Yi, gestern früh ermordet in dem Hanok-Gästehaus aufgefunden wurde, in dem sie und Gregory in Seoul gewohnt hatten. Es deutet alles darauf hin, dass sie erdrosselt wurde.«
Der Senator war etwa fünfzig und wirkte in seinem maßgeschneiderten Anzug sehr gepflegt, doch die dunklen Ringe unter den Augen verrieten, dass er in den vergangenen vierundzwanzig Stunden Höllenqualen gelitten hatte.
»Für die Polizei von Seoul ist Gregory der Hauptverdächtige, was Sie, wenn Sie meinen Sohn kennen würden, genauso absurd fänden wie ich. Meine Frau und ich sind natürlich sehr besorgt. Gregory ist noch keine zwanzig. Wir wissen nicht, ob er entführt wurde oder aus Angst geflüchtet ist. Es muss furchtbar sein, in einem fremden Land des Mordes beschuldigt zu werden. Südkorea ist zwar ein Verbündeter von uns, aber es würde sicher einige Zeit dauern, um die Dinge über die entsprechenden Kanäle ins Reine zu bringen.« Der Senator beugte sich vor und stützte die Ellbogen auf den Schreibtisch. »Ich möchte, dass Sie nach Seoul fliegen und ihn finden. Das hat für uns oberste Priorität. Zweitens, und beinahe genauso dringend, würde ich Sie ersuchen, unabhängige Ermittlungen zu Lynells Tod anzustellen. Jetzt besteht noch die Chance, etwas herauszufinden. Als ehemaliger Prozessanwalt weiß ich genau, dass Beweismittel schnell verschwinden können. Zeugen sind nicht mehr aufzufinden. Die Erinnerung verschwimmt. Wenn wir Gregory nicht in den nächsten 96 Stunden entlasten können, wird es uns vielleicht nie mehr gelingen.«
Janson hob eine Hand. »Einen Moment, Senator. Ich kann mir vorstellen, wie Sie sich fühlen müssen. Es tut mir sehr leid, dass Sie und Ihre Familie so etwas durchmachen müssen, und ich hoffe wirklich, dass Ihr Sohn bald wohlbehalten auftaucht. Sie haben bestimmt recht. Ich bin sicher, er wird zu Unrecht beschuldigt, und ich hoffe ehrlich, dass Sie das auch beweisen können, damit er wenigstens unbelastet um seine Freundin trauern kann. Aber ich muss Ihnen sagen, dass ich Ihnen dabei nicht helfen kann. Ich bin kein Privatdetektiv.«
»Das ist mir schon klar. Aber es handelt sich auch nicht um normale Ermittlungen.«
»Bitte, Senator, lassen Sie mich das erklären. Ich bin nur hergekommen, weil mein Klient Jeremy Beck Sie offenbar an mich verwiesen hat. Aber wie ich Ihnen schon am Telefon klarmachen wollte, ist das kein Fall für mich.« Janson griff in seine Jackentasche, zog ein Blatt Papier hervor und faltete es auseinander. »Während des Flugs habe ich mir erlaubt, ein paar alte Freunde zu kontaktieren. Ich habe hier die Namen und Telefonnummern einiger erstklassiger Privatdetektive in Seoul. Sie kennen die Stadt in- und auswendig und können Informationen direkt von der Polizei beschaffen, ohne sich mit der üblichen Bürokratie herumschlagen zu müssen. Laut meinen Kontakten sind das hier die besten Detektive in Südkorea.«
Wyckoff nahm den Zettel entgegen, legte ihn auf den Tisch, ohne ihn anzusehen, und kniff die Augen zusammen. Jansons Eindruck bestätigte sich, dass der Senator nicht sehr oft ein Nein zu hören bekam. Und dass er ein Nein als Antwort nur selten akzeptierte.
»Mr. Janson, haben Sie Kinder?«
In diesem Augenblick klopfte es energisch an die Tür. Der Senator sprang auf, um sie zu öffnen.
Janson zog die Stirn in Falten, während er über Wyckoffs letzte Bemerkung nachdachte. Er antwortete nicht gern auf persönliche Fragen von Klienten oder möglichen Klienten. Schon gar nicht, nachdem er den Auftrag bereits abgelehnt hatte. Zudem war es keine ganz harmlose Frage. Sie berührte ein Thema, das ihm auf der Seele brannte. Nein, er hatte keine Kinder. Keine Familie – nur die Erinnerung daran. Die schmerzlichen Gedanken an eine schwangere Frau und die zerstörten Träume von ihrem ungeborenen Kind. Die Bombe eines Terroristen hatte ihre gemeinsame Zukunft zunichtegemacht. Sie waren schon vor Jahren gestorben, doch es fühlte sich immer noch so an, als wäre es gestern passiert.
Hinter sich hörte er Hammonds sonore Stimme, gefolgt vom leisen Schluchzen einer Frau.
»Mr. Janson«, wandte sich der Senator an ihn, »ich möchte Ihnen meine Frau Alicia vorstellen. Gregorys Mutter.«
Janson stand auf und drehte sich zu ihnen um, während Hammond die Tür leise schloss.
Alicia Wyckoff stand zitternd vor Janson, mit Tränen in den Augen und zerlaufener Schminke im Gesicht. Sie schien einige Jahre jünger zu sein als ihr Mann, doch die erschütternden Ereignisse drohten sie schnell altern zu lassen.
»Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie gekommen sind.« Statt die gereichte Hand zu schütteln, umarmte sie ihn linkisch. Janson spürte ihre warmen Tränen durch sein Hemd, ihre langen Fingernägel, die sich in seinen Rücken gruben.
Wäre er etwas zynischer gewesen, hätte er vermutet, dass ihr Auftritt genau so geplant war.
Wyckoff schob ein paar Unterlagen beiseite und setzte sich auf die Schreibtischkante. »Ich kenne Ihre berufliche Laufbahn«, begann er erneut. »Als mir Jeremy Ihren Namen gab, kontaktierte ich sofort das Außenministerium und erhielt eine umfangreiche Akte. Es war zwar einiges zensiert, aber was ich darin fand, war trotzdem beeindruckend. Sie sind wie kein Zweiter für diese Sache geeignet, Mr. Janson.« Er machte eine Pause, um seinen Worten mehr Gewicht zu verleihen. »Bitte weisen Sie uns nicht ab.«
»Uns abweisen?«, warf Alicia ungläubig ein. »Wovon redest du?« Sie wandte sich an Janson. »Denken Sie im Ernst daran, Nein zu sagen und uns nicht zu helfen?«
»Wie ich Ihrem Mann gerade erklärt habe, bin ich einfach nicht der Richtige dafür.«
»Aber natürlich sind Sie das.« Sie drehte sich zu ihrem Mann. »Hast du es ihm nicht gesagt?«
Wyckoff schüttelte den Kopf.
»Was gesagt?«
Janson konnte sich absolut nichts vorstellen, was ihn umstimmen könnte. Er hatte Asien eben erst verlassen und brauchte dringend eine Auszeit. Jessica ebenfalls. In den letzten Jahren hatten sie einen Auftrag nach dem anderen angenommen und sich kaum eine Pause gegönnt. Nach zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Einsätzen vor der afrikanischen Küste hatten sie sich fest vorgenommen, einen Urlaub einzulegen. Doch dann weckte Jeremy Becks Anruf und sein Bericht über die unablässigen Cyberattacken durch die chinesische Regierung Jansons Interesse. Genau darum ging es in seinem Leben nach Cons Ops: die Welt mit jeder Mission ein kleines bisschen zu verändern.
Wyckoff stieß sich vom Schreibtisch ab und seufzte tief, als habe er gehofft, das, was er ihm gleich mitteilen würde, für sich behalten zu können. Oder es ihm erst sagen zu müssen, nachdem Janson den Auftrag angenommen hatte.
»Wir glauben, dass Lynell aus einem ganz bestimmten Grund ermordet wurde«, begann der Senator. »Und dass die Polizei von Seoul nicht von selbst darauf gekommen ist, unseren Sohn zu verdächtigen. Jemand hat sie mit Absicht auf diese Spur gelenkt.«
Janson musterte ihn aufmerksam. »Wer?«
Wyckoff schürzte die Lippen. Er sah aus, als wäre er im Begriff, seine Seele zu verkaufen. Oder etwas, das für einen erfolgreichen amerikanischen Politiker noch wichtiger war. »Was ich Ihnen jetzt sage, muss unter uns bleiben, Mr. Janson.«
»Natürlich.«
Der Senator stützte die Hände in die Hüften und atmete langsam aus. »Wir glauben, dass Gregory in eine Falle Ihres ehemaligen Arbeitgebers getappt ist.«
Janson zögerte einen Moment. »Ich verstehe nicht, was Sie meinen.«
»Das Opfer, Lynell Yi, die Freundin meines Sohnes, ist – oder vielmehr, war – eine Koreanisch-Englisch-Dolmetscherin. Sie hat bei heiklen Gesprächen in der demilitarisierten Zone gedolmetscht. An diesen Verhandlungen nehmen neben Nord- und Südkorea auch China und die USA teil. Wir glauben, dass Lynell etwas mitgehört hat, das sie nicht hören sollte, und es unserem Sohn erzählt hat. Daraufhin hatte es jemand in der US-Regierung auf die beiden abgesehen. Genauer gesagt, jemand im Außenministerium.«
»Und Sie vermuten, der Mord wurde von Consular Operations verübt?«, hakte Janson nach.
Wyckoff neigte den Kopf. »Der Mord und die Beschuldigung meines Sohnes … das alles sieht viel zu glatt aus. Unser Sohn ist nicht dumm. Hätte er irgendetwas mit Lynells Tod zu tun – was von vornherein völlig undenkbar ist –, hätte er nicht so offensichtliche Spuren hinterlassen, die ihn belasten.«
»Bei einem Mord aus Leidenschaft«, erwiderte Janson, »handelt der Täter nun einmal nicht überlegt. In so einem Moment spielt die Intelligenz überhaupt keine Rolle.«
»Okay«, räumte Wyckoff ein. »Aber wenn es stimmt, was die Polizei von Seoul behauptet, hätte der Täter genügend Zeit gehabt, um seine Spuren zu beseitigen.«
»Oder eben Hals über Kopf zu verschwinden«, konterte Janson.
Wyckoff ging nicht auf den Einwand ein. »Lynells Leiche wurde erst am nächsten Morgen von einem Zimmermädchen gefunden. Es hing nicht einmal ein ›Bitte nicht stören‹-Schild an der Tür. Der Mörder wollte, dass sie möglichst schnell gefunden wird. Er wollte, dass es wie ein Mord aus Leidenschaft aussieht.«
Janson schwieg. Er wusste, dass Wyckoffs Theorie allein auf dem Wunschdenken eines Vaters beruhte, der seinen Sohn schützen wollte. Aber was sollte der Senator auch anderes tun? Wie hätte Janson reagiert, wenn sein Sohn mit einer solchen Anschuldigung konfrontiert worden wäre?
»Sagen Sie, Paul«, fügte Wyckoff in vertraulichem Ton hinzu, »glauben Sie, dass es in unserer Regierung niemanden gibt, der zu so etwas fähig ist?«
Diese Frage war für Janson nicht schwer zu beantworten. Er wusste nur zu gut, wozu seine Regierung imstande war. Er hatte selbst Aufträge ausgeführt, die sich nicht allzu sehr von dem Szenario unterschieden, das Wyckoff beschrieben hatte. Und er würde sich den Rest seines Lebens um irgendeine Art von Wiedergutmachung bemühen.
»Bevor ich Senator wurde«, fuhr Wyckoff fort, »arbeitete ich als Anwalt in Charlotte. Ich machte ein Vermögen mit Klagen gegen Pharmaunternehmen, die gefährliche Medikamente verkauft hatten. Ich würde die Millionen, die ich verdient habe, hergeben, wenn Sie bereit wären, diesen Fall zu übernehmen. Nennen Sie mir Ihr Honorar, Paul – ich zahle, was Sie verlangen.«
Für einen solchen Auftrag konnte Janson leicht sieben oder acht Millionen Dollar fordern, die der Phoenix Foundation zugutekommen würden. Mit einer solchen Summe konnte er Dutzenden ehemaligen Agenten helfen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen.
Zudem gefiel ihm die Vorstellung, seinem ehemaligen Arbeitgeber auf den Zahn zu fühlen.
Und wenn sich tatsächlich herausstellen sollte, dass das amerikanische Außenministerium den Sohn eines prominenten US-Senators ans Messer liefern wollte, indem es ihn zu Unrecht als Mörder hinstellte, dann musste man davon ausgehen, dass ein massives Interesse dahintersteckte. Irgendein geheimer Plan, der für die gesamte Region, wenn nicht die ganze Welt, schwerwiegende Konsequenzen hätte.
»Unter einer Bedingung«, sagte Janson schließlich.
»Welche?«
»Wenn ich Ihren Sohn finde und die Wahrheit ans Licht bringe, müssen Sie mir versprechen, sie zu akzeptieren, egal wie sie aussieht. Selbst wenn sie dazu führen sollte, dass Ihr Sohn wegen Mordes verurteilt wird.«
Wyckoff blickte zu seiner Frau, die mit einem Kopfnicken antwortete. Er wandte sich wieder an Janson. »Sie haben unser Wort.«
2
»Hör schon auf, dich zu entschuldigen«, sagte Jessica, während das Flugzeug an Höhe gewann. »Du hast die richtige Entscheidung getroffen.«
Janson wusste, dass sie recht hatte, dennoch kamen ihm immer neue Zweifel. Je länger er über die kommenden Tage nachdachte, desto sicherer war er sich, dass er und Jessie bedeutend mehr zu tun haben würden, als in einer Stadt mit zehn Millionen Einwohnern einen neunzehnjährigen Jungen aufzustöbern und die Umstände des Todes seiner Freundin zu untersuchen.
Bevor Jessica in Hickam eingetroffen war und sie in die Embraer eingestiegen waren, hatte Janson noch Morton angerufen, seinen »Computersicherheitsberater« in New Jersey. Zwanzig Minuten später hatte ihm Morton die vollständige und aktualisierte Ermittlungsakte der Polizei von Seoul zum Mord an Lynell Yi geschickt.
Laut Polizeiunterlagen hatte ein dreiundsechzigjähriges Zimmermädchen namens Sung Won Yun die Leiche in einem Zimmer des Gästehauses Sophia gefunden, dem ältesten und traditionsreichsten Hanok der Stadt. Eine erste Untersuchung durch den Rechtsmediziner deutete auf Mord als Todesursache hin. Das Opfer war allem Anschein nach erdrosselt worden, eine Form der Gewaltanwendung, die aufgrund des physischen Vorteils oft von Männern gegenüber Frauen angewandt wurde.
Der Rechtsmediziner setzte den Todeszeitpunkt zwischen Mitternacht und vier Uhr morgens an. Dies stimmte mit den Aussagen von zwei Gästen überein, die behaupteten, kurz nach Mitternacht die lauten, zornigen Stimmen eines jungen Mannes und einer jungen Frau gehört zu haben. Die beiden Gäste hatten zwar nichts verstehen können, doch sie gaben an, dass der hitzige Wortwechsel nicht auf Koreanisch, sondern auf Englisch stattgefunden habe. In Anbetracht dieser Aussagen ging die Polizei davon aus, dass Gregory Wyckoff seine Freundin Lynell Yi im Streit ermordet hatte. Ein genaues Motiv war nicht bekannt.
Die Eigentümer des Hanok bestätigten, dass Gregory Wyckoff und Lynell Yi am Vortag bei ihnen eingecheckt hatten, und händigten der Polizei Kopien der beiden amerikanischen Pässe aus. Der Teilzeit-Rezeptionist, der das Einchecken vorgenommen hatte, erkannte Gregory Wyckoff sofort aus einer Reihe von Fotos.
Die Fingerabdrücke vom Tatort mussten noch ausgewertet und abgeglichen werden. Durch das Verdampfen von Cyanacrylat konnten Teile von Fingerabdrücken vom Hals der Toten sichergestellt werden, die anschließend im Labor untersucht wurden.
In der Akte wurden keine weiteren Verdächtigen genannt. Ebenso wenig wurde die brisante Arbeit erwähnt, der Lynell Yi kurz vor ihrem Tod nachgegangen war.
Sobald der Langstreckenjet seine Flughöhe erreicht hatte, trat Jessica Kincaid in die Mitte der Kabine und streckte sich, während Janson sich vorstellte, wie es wäre, jetzt in Duke’s Barefoot Bar in Waikiki zu sitzen und Mai Tais zu schlürfen.
»Also, wen kennen wir in Seoul?«, fragte sie.
Janson verbannte widerstrebend das Bild von Jessie in ihrem roten Badeanzug aus seinen Gedanken und fuhr den Laptop hoch. Er hatte schon in seiner Zeit bei Consular Operations viele Kontakte geknüpft, die ihm auch heute noch zugutekamen. Sehr wertvoll war außerdem sein Netzwerk der ehemaligen Schützlinge von Phoenix, jener Ex-Agenten, die von der Arbeit der Stiftung profitiert hatten. Einige hatten ein völlig neues Leben begonnen – mit neuer Identität, neuem Zuhause und einer beachtlichen Karriere in der akademischen Welt, im öffentlichen Dienst oder in der Privatwirtschaft. Manche hatten ihre eigene Firma gegründet. Fast alle führten heute ein zufriedenes, erfolgreiches Leben.
Wenn Janson heute ihre Hilfe benötigte, zögerte er nicht, sie anzurufen, um von ihren Positionen oder ihren Fähigkeiten zu profitieren. Die meisten waren froh über eine Gelegenheit, ihm etwas zurückgeben zu können. Bei einigen wenigen brauchte es etwas Überzeugungsarbeit, damit sie bereit waren, ihm zu helfen.
»Was Phoenix gewährt, braucht es wieder, um es dem Nächsten zu geben«, redete er ihnen ins Gewissen. »So funktioniert das bei uns.«
Bisher hatten sich alle einsichtig gezeigt. Dennoch machte Janson nicht den Fehler, diese Leute als seine Privatarmee zu betrachten. Er setzte sie nur für Missionen von Catspaw ein, bei denen es um Millionen für die Phoenix Foundation ging.
Janson hielt schon beim ersten Namen inne, der ihm unterkam. Er hätte seinen Computer nicht gebraucht, um zu wissen, dass Jina Jeon ganz oben auf seiner Liste stand. Jessie sollte jedoch nicht denken, dass er von allein auf sie gekommen war, so als wäre sie ständig in seinen Gedanken.
Janson kannte Jina Jeon bereits aus seiner Zeit bei Cons Ops; zudem gehörte sie zu jenen, die mithilfe der Stiftung wieder auf die Beine gekommen waren. Außerdem hatte er ein Verhältnis mit ihr gehabt, lange bevor er Jessica Kincaid kennengelernt hatte.
Janson scrollte zum nächsten Namen auf der Liste.
»Nam Sei-hoon«, sagte er. »Er ist beim südkoreanischen Geheimdienst.«
»Und du vertraust ihm hundertprozentig?«, fragte Jessie.
»Nam Sei-hoon ist einer meiner ältesten und engsten Freunde. Ich kenne ihn aus meiner Zeit beim SEAL Team Four.«
Janson vergaß nie, dass es diese eine Entscheidung war, die seine Laufbahn geprägt und ihn das Handwerk des Tötens hatte erlernen lassen – der Moment, als er nach dem Besuch der University of Michigan der Navy beigetreten war. Schon bald nach seiner Rekrutierung hatte er durch herausragendes Kampftalent auf sich aufmerksam gemacht. In der Navy hatte man natürlich ein Auge dafür. Als er sich seinem Team im Hauptquartier in Little Creek, Virginia, anschloss, war Paul Janson der Jüngste, der je eine SEAL-Ausbildung absolviert hatte – eine Leistung, die ihm heute nichts mehr bedeutete. Nach seinem ersten Einsatz in Afghanistan wurde ihm das Navy Cross verliehen, die zweithöchste Auszeichnung, die die Navy zu vergeben hatte. Es folgte eine Mission nach der anderen, ohne Pause, bis er irgendwann in einem afghanischen Dorf nahe Kabul den Taliban in die Hände fiel. Achtzehn Monate wurde er in einem eineinhalb mal zwei Meter kleinen Käfig gefangen gehalten. Er hungerte, wurde gefoltert und nach zwei Ausbruchsversuchen jedes Mal beinahe getötet. Sein dritter Versuch hatte endlich Erfolg. Als man ihn fand, war er bis auf die Knochen abgemagert und wog nur noch siebenunddreißig Kilo. Er sprach nur selten über die Zeit nach seiner Erholung. Erwähnte allerhöchstens, dass er die Cambridge University besucht und sich danach einer Sondereinheit des Außenministeriums angeschlossen hatte.
»Gibt es auch in Südkorea Absolventen von Phoenix?«, fragte Jessica.
Janson nickte, ohne aufzublicken. »Jina Jeon. Obwohl ich lieber nicht auf sie zurückgreifen würde, wenn es nicht sein muss.«
Kincaid unterbrach ihre Dehnübungen. »Warum das?«
Sicher lag es auch an ihrer einstigen Beziehung, dass sich Janson nicht an Jina Jeon wenden wollte. Doch das war nicht der Hauptgrund. Wie alle ehemaligen Schützlinge von Phoenix besaß auch Jina ein Telefon mit einem Verschlüsselungschip, das Janson eine abhörsichere Verbindung zu ihr ermöglichte. Sie wusste, dass sich die Verantwortlichen der Phoenix Foundation jederzeit bei ihr melden konnten, wenn sie ihre Hilfe benötigten. Jina hatte jedoch keine Ahnung, dass Janson hinter der Stiftung stand – und er wollte, dass das auch so blieb.
Es gab noch einen weiteren Grund, warum er gern auf ihre Mithilfe verzichten wollte. Diesen nannte er Jessica.
»Sie hat ein Problem damit, sich an die Regeln zu halten.«
Alle Phoenix-Schützlinge hatten bestimmte Regeln zu befolgen, wenn sie für ihn arbeiteten. Drei Grundsätze waren ihm besonders wichtig, die sogenannten »Janson-Regeln«:
Keine Folter.
Keine zivilen Opfer.
Es wird niemand getötet, der nicht versucht, uns zu töten.
Für einen ehemaligen Feldagenten war es leichter gesagt als getan, dies auch einzuhalten. Doch Janson hatte den Verdacht, dass es Jina Jeon ganz besonders schwerfiel. Nicht weil sie charakterlich ungeeignet war, sondern weil Consular Operations sie zur Skrupellosigkeit erzogen hatte.
Ganz so, wie es diese Organisation auch mit ihm selbst gemacht hatte.
»Sie waren ›die Maschine‹«, hatte der Cons-Ops-Direktor Derek Collins in einem der vielen Gespräche vor seinem Ausstieg betont. »Sie hatten eine Granitplatte an der Stelle, wo andere ein Herz haben.«
Er hatte nicht unrecht gehabt. Janson war eine Maschine gewesen, hatte die Befehle seiner Vorgesetzten ohne zu zögern ausgeführt und im Dienst für sein Land Verbrechen verübt. Er hatte wieder und wieder getötet, ohne es zu hinterfragen. Bis er eines Morgens schweißgebadet aufwachte und an all die Menschen denken musste, die er exekutiert hatte. Gewiss waren Leute darunter, die selbst Mörder und Schlächter waren. Doch es gab auch andere, die einen solchen Tod nicht verdient hatten. Diese sanktionierten Morde waren es, die er nicht länger ausführen wollte.
»Sie sagen, Sie haben das Töten satt«, hatte Collins gemeint. »Ich glaube, Sie werden eines Tages draufkommen, dass es diese Momente sind, in denen Sie sich wirklich lebendig fühlen.«
Janson weigerte sich, das zu glauben. Er wusste, es gab eine Heilung. Wenn er sich bemühte, konnte er gerettet werden. Als Erstes musste er sich eingestehen, dass er ein eiskalter Killer gewesen war. Als er dieser Wahrheit ins Gesicht sehen konnte, schwor er sich, ab sofort ein ganz anderes Leben zu führen. Er konnte nicht ungeschehen machen, was er getan hatte. Doch er konnte ein anderer Mensch werden.
Stunden später, als Jessica schlief, sah Janson die unzähligen Online-Artikel durch, in denen Senator James Wyckoff aus North Carolina vorkam. Er kombinierte den Namen des Senators mit Suchbegriffen wie »Seoul«, »Pjöngjang« und »Peking« und erweiterte die Suche mit Themen, die in den aktuellen Gesprächen zwischen Nord- und Südkorea behandelt wurden. Es ging dabei vor allem um Nordkoreas Atomprogramm, die Sanktionen gegen die nordkoreanische Regierung wegen wiederholter Menschenrechtsverletzungen und ihrer Weigerung, sich an internationales Recht zu halten. Natürlich wurde auch über einen – wenn auch unwahrscheinlichen – Friedensvertrag gesprochen, der an die Stelle des Waffenstillstandsabkommens treten würde, mit dem der Koreakrieg vor sechs Jahrzehnten zu Ende gegangen war.
Wyckoffs Haltung zur Koreafrage schien sich je nach der öffentlichen Meinung zu ändern, was nicht weiter überraschte, wenn man bedachte, dass der Senator die Nominierung als nächster Präsidentschaftskandidat seiner Partei anstrebte. Er hatte mehrmals für Sanktionen gegen Nordkorea gestimmt, war jedoch mit Sicherheit kein Hardliner. Tatsächlich war es schwer zu erkennen, welche Meinung er zu den wichtigsten Problemen im Zusammenhang mit der Koreakrise vertrat. Er war ein cleverer Politiker. Mit seinem Abstimmungsverhalten ließ er sich einigen Spielraum nach rechts und links offen, je nachdem, wohin die öffentliche Meinung im Wahljahr driften würde. So wie es derzeit aussah, betrachtete das amerikanische Volk das Regime in Pjöngjang zwar als Feind, doch nach den langen und teuren Kriegen in Irak und Afghanistan wollte sich kaum jemand auf militärische Maßnahmen einlassen. Insofern schienen strenge Sanktionen gegen Nordkorea die klügste politische Haltung zu sein.
Janson hielt es jedenfalls für nicht sehr wahrscheinlich, dass Gregory Wyckoff aufgrund der politischen Positionen seines Vaters zu Korea in diese missliche Lage geraten war.
Nach den vorliegenden Informationen beschäftigte Janson vor allem eine Frage: Warum hatten sich Gregory Wyckoff und Lynell Yi in dem Hanok einquartiert, obwohl Gregory eine Wohnung am anderen Ufer des Han-Flusses gemietet hatte. Er hatte den Senator und seine Frau danach gefragt, doch sie hatten die Tatsache als unwichtig abgetan.
»Billige Mietwohnungen in Seoul sind oft recht düster«, hatte Wyckoff gemeint, »vor allem im Winter. Ich habe Bilder von Gregorys Wohnung gesehen – sie ist zwar sauber und ordentlich, aber nichts Besonderes. Drei oder vier Zimmer, durch Schiebetüren getrennt. Sie konnten wegen Lynells Arbeit keine Reisen unternehmen, deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass sie gelegentlich ein, zwei Nächte in einem traditionellen Hanok verbracht haben.«
Janson sah das nicht so, und seine Theorie sprach sogar für die Unschuld von Gregory Wyckoff. Falls Lynell Yi bei den Friedensgesprächen tatsächlich etwas Brisantes mitgehört und ihrem Freund erzählt hatte, war es absolut denkbar, dass die zwei jungen Leute aus Angst seine Wohnung verlassen hatten, bis sich die Lage beruhigte. Oder bis sie einen Entschluss gefasst hatten, was sie mit der heiklen Information anfangen sollten.
Die Frage war: Was hatte Lynell Yi gehört?
»Etwas zu trinken, Mr. Janson?«
Die Stimme klang angenehm sinnlich, und Janson hätte sich beinahe zu ihr umgedreht und Kayla daran erinnert, ihn Paul zu nennen. Doch er fing sich rechtzeitig und lächelte. »Ich bin zwar ein bisschen benebelt, Jessie, aber so benebelt auch wieder nicht.«
Jessica ließ sich anmutig in den bequemen Ledersitz neben Janson sinken. Offenbar schauspielerte sie immer noch; Anmut war normalerweise keines ihrer herausragenden Merkmale – es sei denn, man nannte es anmutig, mit einem M82-Scharfschützengewehr ein menschliches Ziel aus 1600 Metern Entfernung auszuschalten.
Janson schaute in ihre graugrünen Augen. »Sag jetzt nicht, du bist eifersüchtig auf Kayla.«
Jessica verzog das Gesicht und verdrehte die Augen. »Eifersüchtig? Hör mal, ich bin grundsätzlich nicht eifersüchtig.«
Tatsächlich Eifersucht, dachte Janson. Er kannte sie gut genug, um zu wissen, dass ein Rückfall in den ländlichen Dialekt ihrer Heimat immer bedeutete, dass sie innerlich angespannt war.
»Weißt du«, Janson streichelte ihr über die Wange, »du bist besonders schön, wenn du eifersüchtig bist.«
Ihre Augen weiteten sich, und sie errötete so wie in der Nacht, als sie sich zum ersten Mal geliebt hatten, in einem schlichten Hotelzimmer in der ungarischen Stadt Sárospatak.
»Ich sehe, wie Sie mich anschauen«, hatte sie an jenem Abend gesagt.
»Ich weiß nicht, was Sie meinen«, hatte er gelogen.
Ihre Beziehung war von Anfang an schwierig gewesen, vor allem auch, weil Janson es schwer ertragen konnte, Jessica in Gefahr zu sehen. Zwar wusste er genau, dass sie sich besser zu helfen wusste als die meisten Soldaten auf diesem Planeten. Dennoch begleitete ihn die ständige Angst, sie zu verlieren.
Sie hatte es natürlich gespürt und ihm deshalb Vorwürfe gemacht. Auf keiner ihrer Missionen hatte Jessie es sich nehmen lassen, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, wenn es die Situation erforderte. Und Janson wusste nicht, wie er sie davon abhalten oder sie schützen sollte.
»Hast du wenigstens ein bisschen schlafen können?«, fragte er.
»Ein wenig – aber ich bin bereit. Die acht Tage in Waikiki waren die reinste Verjüngungskur. Ein Urlaub in den Tropen hilft immer. Solltest du bei Gelegenheit mal ausprobieren.«
Janson lächelte und ließ das Kinn auf die Brust sinken.
»Also, wer ist jetzt eifersüchtig?« Jessica beugte sich vor und hauchte ihm einen Kuss auf die Lippen.
Wie jedes Mal genoss er ihre zärtliche Geste. Wenn ihn das Leben etwas über die Liebe gelehrt hatte, dann dass jeder Kuss – auch der beiläufigste, flüchtigste – der letzte sein konnte.
Einige Minuten später klappte Janson seinen Laptop zu. »Ich habe eine strategische Entscheidung getroffen. Wir haben zwei unterschiedliche Aufgaben zu erledigen und nicht besonders viel Zeit, darum ist es das Beste, wenn wir uns in Seoul trennen.«
»Hältst du das für eine gute Idee, falls tatsächlich Cons Ops damit zu tun hat? Die haben schon einmal versucht, dich zu töten.«
Janson verzog das Gesicht. »Du hast das auch schon mal versucht – und werfe ich es dir vielleicht heute noch vor?«
»Kommt mir schon so vor, sonst würdest du es nicht so oft erwähnen.«
Janson legte ihr die Hand aufs Knie und drückte es sanft. »Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass Cons Ops in die Sache verwickelt ist, verschwindend gering. Senator Wyckoffs Verdacht beruht auf nichts anderem als seiner Paranoia. Es gibt nicht den kleinsten Hinweis, dass das State Department etwas damit zu tun haben könnte – es sei denn, er weiß etwas, das er uns verschweigt. Wir wissen nicht, wen oder was Lynell Yi zufällig gehört hat, falls sie überhaupt etwas mitbekommen haben sollte. Und wenn sie tatsächlich von irgendeiner Seite getötet wurde, die an den Gesprächen beteiligt ist, dann kommen China oder Nordkorea – und sogar Südkorea – viel eher infrage als die Vereinigten Staaten. Immerhin ist es der Sohn eines US-Senators, der reingelegt und als Schuldiger hingestellt wurde. Vorausgesetzt, Gregory Wyckoff ist unschuldig. Und das ist eine Annahme, für die es überhaupt keine Anhaltspunkte gibt und die sich wahrscheinlich als falsch herausstellen wird.«
»Okay«, stimmte Jessie nach einigem Überlegen zu. »Wir trennen uns in Seoul. Wer übernimmt was?«
»Ich mache mich als Erstes auf die Suche nach dem Sohn des Senators. Bis wir ankommen, hat er einen Vorsprung von etwa achtundvierzig Stunden. Trotzdem stehen die Chancen nicht gut, dass es ihm gelingt, aus Südkorea rauszukommen.«
»Warum dann die Eile?«
»Weil Gregory Wyckoff nur dann eine echte Chance hat, sich gegen die Anschuldigungen zur Wehr zu setzen, wenn wir ihn finden, bevor es die Polizei tut.«
Kincaid nickte. »Und während du den Jungen suchst …«
»Kannst du mit den Ermittlungen zu Lynell Yis Tod anfangen. Dazu brauchst du entsprechende Unterstützung. Deshalb wirst du zuerst einen gewissen Owen Young aufsuchen.«
»Owen Young? Den Namen hab ich doch schon mal gehört.«
»Kein Wunder. Er ist der amerikanische Botschafter in Südkorea.«
3
Botschaft der Vereinigten Staaten
Jongno-gu, Seoul, Südkorea
Jessica Kincaid war nicht besonders glücklich. Ihrer Einschätzung nach schickte Janson sie direkt in die Höhle des Löwen, ohne ihr auch nur eine Peitsche mitzugeben.
Ihr Taxi hielt gegenüber dem Botschaftsgelände an, und sie beugte sich vor, um für die Fahrt in südkoreanischen Won zu bezahlen. Als sie die Autotür öffnete und ausstieg, schlug ihr ein kräftiger Wind entgegen.
Tja, wir sind nicht mehr in Honolulu.
Jessica steckte die Hände in die Taschen ihres schwarzen Mantels, während der Hyundai Sonata wieder in den Verkehr einfädelte. Sie stand einige Augenblicke nur da und sah sich um. Es machte ihr immer wieder Freude, neue Städte zu erkunden, vor allem solche wie Seoul, die darum kämpften, die richtige Balance zwischen Tradition und Moderne zu finden.
Den Kopf gegen die bittere Kälte gesenkt, marschierte sie zum Ende des Blocks und wünschte sich, sie wäre in der Wärme des Incheon International geblieben, des beeindruckendsten Flughafens, den sie je gesehen hatte. Sie hatte leider nicht die Zeit gehabt, das vielfältige Angebot zu nutzen, doch waren ihr die Schilder nicht entgangen, die Passagiere ins Casino, Spa, Theater mit Live-Vorstellungen, Museum oder gar in einen Zen-Garten locken wollten. Es hätte außerdem eine Eislaufbahn, Designerläden und erstklassige Restaurants zu erkunden gegeben. Ein längerer Aufenthalt auf dem Flughafen hätte Jessica gut über den viel zu kurzen Urlaub auf Hawaii hinwegtrösten können.
An der Kreuzung blieb sie stehen und betrachtete das markante Botschaftsgebäude. Im Gegensatz zum architektonischen Meisterwerk des Flughafens erinnerte die US-Botschaft ein wenig an ein Hochsicherheitsgefängnis. In einer Stadt voller moderner Wolkenkratzer stand das Botschaftsgebäude fast isoliert da, wie ein Schulrowdy, von dem sich alle fernhielten.
Während sie sich dem architektonischen Ungetüm näherte, fielen ihr die Scharen von südkoreanischen Polizisten auf, die hinter den hohen Zäunen postiert waren. Einige uniformierte Wachen hatten sich um ein Zivilfahrzeug versammelt, das soeben in das Gelände eingefahren war. Der hellhäutige Fahrer stand daneben, die Arme vor der breiten Brust verschränkt, während die Wachmänner den Wagen gründlich durchsuchten. Jessica fragte sich, ob für sie als ehemalige Angehörige einer Regierungsbehörde nicht besonders strenge Sicherheitsbestimmungen galten. Verdammt, vielleicht würde sie sich einer Leibesvisitation unterziehen müssen, einschließlich der Körperöffnungen.
Sehnsuchtsvoll drehte sie sich zu den Galerien und Theatern um, die sie hätte besuchen können, und warf einen flüchtigen Blick zu dem einsamen, schneebedeckten Berg in der Ferne. Jessica war im Begriff, amerikanischen Boden zu betreten, doch sie fühlte sich, als würde sie sich hinter die feindlichen Linien schleichen.
Eigentlich seltsam, dachte sie, wo sie sich schon immer als amerikanische Patriotin gefühlt hatte.
Schließlich ging sie zum äußeren Tor und zeigte ihren amerikanischen Pass vor. »Ich bin mit Botschafter Young verabredet.«
Der Blick, mit dem der Wachmann sie von Kopf bis Fuß musterte, war fast genauso aufdringlich wie eine Leibesvisitation.
Eine knappe Stunde später durfte sie vor der Tür zum Büro des Botschafters Platz nehmen, nachdem man ihr das Smartphone und alle anderen elektronischen Geräte abgenommen hatte. Ihr Mantel hing an einem Garderobenständer an der Wand gegenüber. Mit übereinandergeschlagenen Beinen und gesenktem Kopf saß sie da und wartete. Es wäre nicht übermäßig einschüchternd gewesen, sich in einer US-Botschaft aufzuhalten, wäre es nicht gleichzeitig das Territorium ihres ehemaligen Arbeitgebers gewesen, des US State Department.
Noch vor wenigen Jahren hatte Jessica Kincaid zu Consular Operations gehört, einem Geheimdienst des Außenministeriums. Sie hatte nicht nur als Feldagentin gedient, sondern sogar einer Eliteeinheit, dem Lambda-Scharfschützenteam, angehört. Und sie war die Beste auf ihrem Gebiet gewesen. Deshalb hatte man sie nach London geschickt, mit der Direktive, Paul Janson zu eliminieren.
Liquidierung mit aller Konsequenz, wie es in der Welt der Geheimdienste hieß.
Natürlich hatte sie nicht gewusst, dass man sie belogen hatte. Janson war nicht der Verräter und Feind, als der er hingestellt wurde; er hatte es nicht verdient zu sterben. Als ihr das klar wurde, drängte sich zwangsläufig die Frage auf, wie viele Unschuldige sie schon exekutiert haben mochte. Wie viele waren schon von der eigenen Regierung oder einer ihrer Behörden verraten worden? Leute, die vielleicht Kinder hatten, liebende Frauen oder Männer.
Angesichts ihrer beider Vergangenheit bei Cons Ops verstand sie nicht ganz, warum Janson sie gleich nach ihrer Ankunft in Seoul zur Botschaft geschickt hatte. Wie konnte ausgerechnet er noch irgendjemandem aus dem amerikanischen Außenministerium vertrauen?
Andererseits war Paul Janson der klügste Mensch, der ihr je begegnet war. Er hatte für seine Entscheidungen immer gute Gründe, auch wenn er sie oft für sich behielt. Es stand ihr nicht zu, seine Anweisungen anzuzweifeln, auch wenn sie im Privatleben eine intime Beziehung hatten.
Dennoch überlief es sie kalt, während sie hier auf für sie feindlichem Territorium saß und wartete. Tatsächlich waren Cons Ops und das State Department für sie der Feind, und daran würde sich nichts ändern, selbst wenn Paul Janson weiter Kontakte zu einigen ihrer Vertreter unterhielt.
Zwanzig Minuten später trat endlich ein gut gekleideter junger Mann mit kurz geschnittenem, blondem Haar aus dem Büro. »Der Botschafter kann Sie jetzt empfangen«, teilte er ihr mit.
Jessica stand auf und bereitete sich innerlich auf eine Konfrontation vor.
Botschafter Owen Young stand steif an seinem Schreibtisch, als sie sein Büro betrat. Der koreanischstämmige Vertreter der Vereinigten Staaten bedankte sich mit einem kaum merklichen Kopfnicken bei seinem Assistenten, ehe er Jessica die Hand schüttelte und sie mit einem oberflächlichen Lächeln bat, Platz zu nehmen.
Während des Fluges hatte Janson ihr einiges über die koreanischen Sitten verraten. Owen Young war zwar in San Francisco aufgewachsen und hatte die University of Pennsylvania sowie die Cornell Law School besucht, doch er war in Seoul geboren und diente schon seit elf Jahren in der Botschaft – zunächst als Verantwortlicher für politisch-militärische Angelegenheiten, später als Botschafter. Wie die meisten Koreaner würde er sehr auf Jessicas Körpersprache achten und auf Anzeichen, dass sie etwas von der koreanischen Kultur verstand und sie vor allem respektierte.
»Danke, dass Sie mich empfangen, Herr Botschafter«, begann sie mit einer leichten Verbeugung, ehe sie sich setzte.
»Selbstverständlich«, antwortete er. »Wer von uns könnte dem legendären Paul Janson einen Wunsch abschlagen?«
Jessica war sich nicht sicher, wie sie die Bemerkung verstehen sollte, doch sie unterließ es, ihn danach zu fragen.
»Also«, begann der Botschafter, nachdem er sich ebenfalls gesetzt hatte, »wie ich höre, sind Sie im Auftrag von Senator Wyckoff nach Seoul gekommen. Ich weiß natürlich, in welch schwieriger Situation sich sein Sohn befindet, und bin entsprechend besorgt. Aber wie ich schon Mr. Janson gesagt habe, sind meine Möglichkeiten, Ihnen zu helfen, sehr begrenzt. Vielleicht kann ich die eine oder andere Kleinigkeit beisteuern, aber ich fürchte, Sie werden sich mit Ihren Ermittlungen an die örtliche Polizei wenden müssen. Die rechtlichen Dinge müssen vonstattengehen, wie es das Gesetz verlangt. Sobald Mr. Wyckoff gefasst wird, bekommt er einen fairen Prozess, das kann ich Ihnen versichern. Ich persönlich habe jedenfalls keinerlei Einfluss auf die Polizei oder die koreanischen Gerichte.«
Die Belehrung des Botschafters war genauso steif wie seine Haltung. Jessica hatte sich online über Youngs Lebenslauf informiert und fragte sich, wie der Mann einst in Washington als US-Staatsanwalt hatte erfolgreich arbeiten können. Vielleicht war er in jungen Jahren dynamischer gewesen; heute jedenfalls würde er die Geschworenen bestenfalls einschläfern.
»Senator Wyckoff und Mr. Janson sind sich bestimmt bewusst, wie eingeschränkt Ihre Möglichkeiten unter diesen Umständen sind. Uns würde vor allem interessieren, ob Sie uns irgendetwas über Lynell Yi sagen können, das uns bei unseren Ermittlungen weiterhelfen könnte.«
Young, dessen glänzend schwarzes Haar von silbernen Strähnen durchsetzt war, lehnte sich in seinem Stuhl zurück und blickte zur Decke hinauf, als fände er dort die Antwort. Schließlich krümmten sich seine Mundwinkel nach unten. »Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht viel über Ms. Yi erzählen. Ich habe sie nur sehr kurz gekannt.«
Jessica zeigte keine Regung. Janson hatte ihr erklärt, dass die Koreaner oft ausweichend antworteten, anstatt klipp und klar Nein zu sagen. Diese kulturelle Eigenheit war ein Schutzmechanismus, der es ihnen ermöglichte, das Gesicht zu wahren.
»Es kann sein, dass du mehr aus dem herauslesen kannst, was der Botschafter nicht sagt, als aus dem, was er ausspricht«, hatte Janson hinzugefügt.
»Soweit ich weiß«, begann Jessica aufs Neue, »hat Ms. Yi in den letzten sechs oder sieben Monaten als Dolmetscherin hier gearbeitet.«
»Da müsste ich in ihren persönlichen Unterlagen nachsehen«, erwiderte Young. »Ich glaube nicht, dass sie so lange hier war.«
Jessica gab sich keine Mühe, ihre Skepsis zu verbergen. »Sie wurde doch eigens für die Vier-Parteien-Gespräche engagiert, oder?«
Der Botschafter zog es vor zu schweigen.
»Die Verhandlungen in der demilitarisierten Zone«, hakte sie nach.
»Ja, ich weiß, von welchen Verhandlungen Sie sprechen. Ich sehe nur keinen Zusammenhang. Nach allem, was ich gehört habe, ist Ms. Yi das bedauernswerte Opfer eines Beziehungsstreits. Alle Hinweise, die mir aus den Medien bekannt sind, deuten darauf hin, dass sie im Affekt getötet wurde.«
Jessica legte den Kopf auf die Seite und versuchte es mit einem anderen Zugang, um den Botschafter aus der Reserve zu locken. »Herr Botschafter, war Lynell Yi eine gute Dolmetscherin?«
Young zuckte mit den Schultern. »So gut wie alle Dolmetscher, mit denen ich bisher gearbeitet habe.«
»Hat sie manchmal über ihr Privatleben gesprochen?«
Der Botschafter schüttelte den Kopf. »Sie war ein stilles Mädchen. Ich habe mit ihr nie über etwas anderes als ihre Arbeit gesprochen.«
»Sie meinen die aktuellen Gespräche in der demilitarisierten Zone«, hakte Kincaid nach.
»Ja, natürlich.«
»Wer ist an diesen Gesprächen beteiligt?«
»Nord- und Südkorea natürlich. Zudem wir – damit meine ich die Vereinigten Staaten – als Hauptverbündeter von Südkorea. Und die Chinesen. Aber das wissen Sie ja sicher. Es ist ja allgemein bekannt, Ms. Kincaid.«
»Trotzdem ist mir nicht ganz klar, worum es bei diesen Gesprächen genau geht.«
Der Botschafter lächelte herablassend. »Das ist natürlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Darüber kann ich mit Ihnen genauso wenig sprechen wie mit einem Reporter von CNN oder BBC.«
»Aber Sie können uns zumindest einen Eindruck davon geben, mit welchen Themen Ms. Yi zuletzt beschäftigt war.«
»Sie werden verstehen, Ms. Kincaid, dass ich dazu nicht befugt bin.«
»Haben Sie nicht mit der Polizei von Seoul gesprochen?«
»Nur kurz mit einem Ermittler. Er hat mir mitgeteilt, dass Ms. Yi einem Mord zum Opfer gefallen ist. Über ihre Arbeit haben wir kein Wort verloren.«
»Hat ihn diese Frage gar nicht interessiert?«
Ein leises Lächeln huschte über seine Lippen. »Nein, natürlich nicht. Dazu hatte er vermutlich keinen Grund. Gäste des Hanok, in dem Ms. Yi starb, haben einen Streit zwischen ihr und ihrem Freund gehört, kurz bevor sie ermordet wurde. Soweit ich das verstanden habe, sprechen die Hinweise eine eindeutige Sprache. Die Tatsache, dass Mr. Wyckoff geflüchtet ist, belegt ja ebenfalls, was …« Er verstummte kurz, als suche er nach den richtigen Worten. »… was sich leider in dieser Nacht zugetragen hat.«
»Apropos ›etwas mithören‹«, hakte Jessica nach. »Halten Sie es für möglich, dass Ms. Yi bei den Vier-Parteien-Gesprächen etwas aufgeschnappt hat, was sie nicht hören sollte?«
Young zögerte keinen Augenblick. »Das kann ich mir nicht vorstellen, obwohl ich nicht verstehe, inwiefern das relevant sein soll.« Er faltete die Hände auf dem Schreibtisch. »Ich hoffe sehr, dass Sie und Mr. Janson nicht irgendwelche Verschwörungstheorien konstruieren und Senator Wyckoff damit falsche Hoffnungen machen. Der Senator und seine Frau haben es ohnehin schon schwer genug.«
»Meine Frage bezieht sich auf eine konkrete Vermutung, die der Senator geäußert hat«, erwiderte sie mit einem freundlichen Lächeln. »Es gehört zu unserem Job, andere Möglichkeiten auszuschließen.«
»Ich verstehe.« Der Botschafter erhob sich von seinem Platz. »Nun, ich wünsche Ihnen und Mr. Janson viel Glück bei Ihren Ermittlungen. Und bitte übermitteln Sie Senator Wyckoff und seiner Frau mein tiefstes Mitgefühl.«
Kincaid machte keine Anstalten aufzustehen. »Zwei Fragen hätte ich noch, Herr Botschafter, wenn es Ihnen keine Umstände macht.«
Young seufzte tief, nahm aber wieder Platz. »Ich habe diesen Nachmittag noch einen Termin. Also bitte … aber ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie sich kurz fassen.«
»Diese Gespräche, mit denen Sie gegenwärtig zu tun haben – können wir davon ausgehen, dass es dabei um viele der Themen geht, die schon bei den vorangegangenen Sechs-Parteien-Gesprächen behandelt wurden, an denen auch Russland und Japan teilgenommen haben?«
»Die Probleme zwischen den koreanischen Staaten sind auf der ganzen Welt bekannt, Ms. Kincaid.«
»Also geht es auch um das nordkoreanische Atomprogramm? Um eine Normalisierung der Handelsbeziehungen? Eine Aufhebung der Sanktionen?«
»Ich schätze, diese Themen werden jedem vertraut sein, der Chosun Ilbo oder die New York Times liest.«
Jessica spürte, dass der Botschafter nicht mehr dazu sagen würde. »Eine letzte Frage noch.« Sie beeilte sich fortzufahren, um ihm nicht die Chance zu geben, Nein zu sagen. »Gab es irgendjemanden in der Botschaft, der Ms. Yi nahegestanden hat? Jemanden, der sie ein bisschen besser gekannt hat als Sie?«
Youngs Augen sprangen kurz zur Tür, durch die sein Assistent zuvor hinausgegangen war. »Nicht dass ich wüsste«, antwortete er. »Sie war sehr introvertiert, nach allem, was ich gehört habe.«
»Hatte sie direkte Kontakte zu anderen Verhandlungsteilnehmern?«
Young erhob sich erneut. »Mir ist davon nichts bekannt. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, Ms. Kincaid. Ich muss mich auf meinen nächsten Termin vorbereiten.« Er drückte auf einen Knopf der Sprechanlage.
Der junge Mann, der Jessica in Youngs Büro geführt hatte, meldete sich. »Ja, Herr Botschafter.«
»Jonathan, bitte bringen Sie Ms. Kincaid zum Ausgang. Unser Gespräch ist beendet.«
4
Fünfzehn Minuten nachdem Jessica Kincaid die amerikanische Botschaft verlassen hatte, nahm Botschafter Owen Young seine Aktentasche, zog seinen jägergrünen Mantel an, setzte den schwarzen Filzhut auf und wies seinen Chauffeur an, das Auto bereit zu machen. Youngs Leben war um einiges schwerer geworden, nachdem er und der Rest der Welt erfahren hatten, wie gründlich die National Security Agency nicht nur verfeindete Staaten, sondern auch Verbündete und sogar die eigenen Bürger ausspionierte. Man musste davon ausgehen, dass die NSA auch die Telefone innerhalb der Botschaft in Seoul abhörte, weshalb Young sie nur noch für belanglose Gespräche benutzte. Von seinem Büro aus rief er beispielsweise die Reinigung oder den Innenarchitekten seiner Frau an, er vereinbarte einen Termin beim Friseur, beim Zahnarzt oder in seiner Autowerkstatt. Mit seinem persönlichen Handy wiederum rief er nur zu Hause oder im Büro an. Für alles andere benutzte er Telefone, von denen nur er wusste.
Eines davon war ein Festnetztelefon in einer Wohnung, die er unter falschem Namen im zwanzigsten Stock eines Hochhauses im Gangnam-Viertel gemietet hatte. Dank des südkoreanischen Rappers Psy war Gangnam heute in der gesamten westlichen Welt ein Begriff. Das Wort bedeutete ursprünglich »südlich des Flusses«, und genau dort – südlich des Han – lag Gangnam-gu.
Während er im Verkehr auf der Brücke wartete, überlegte der Botschafter, was er Edward Clarke, dem Direktor von Consular Operations, sagen würde. Ihm war klar, dass die ganze Sache um einiges komplizierter geworden war. Young war ein wenig beunruhigt, wie Clarke reagieren würde.
Doch es war nicht seine Schuld, dass Paul Janson und Jessica Kincaid nach Seoul gekommen waren, also musste er sich auch keine Sorgen machen. Es war vielmehr Clarke, der ihm eine Erklärung schuldete.