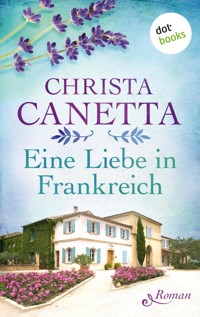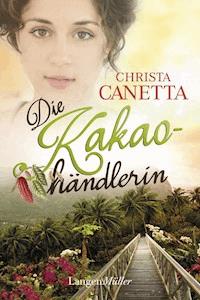
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Am Rande des Urwaldes wird sie jetzt leben. Laura, Tochter eines Hamburger Buchhändlers, reist als Hauslehrerin einer reichen Familie nach Brasilien. Als der Plantagenbesitzer erschossen wird, erbt die junge Frau überraschend die Hälfte seiner Ländereien. Kann sie die Kakaoplantage vor dem Ruin retten? Ihr Freund Mikael möchte sie nach Europa mit zurücknehmen - doch Laura kämpft für ihre Plantage. Als er sie dort besucht, kann auch sie ihre Gefühle nicht mehr verdrängen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Christa Canetta
Die Kakaohändlerin
Roman
LangenMüller
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.langen-mueller-verlag.de
© für das eBook: 2016 LangenMüller in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
© für die Originalausgabe: 2011 LangenMüller in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Covergestaltung: Atelier Seidel – Verlagsgrafik, Teising
Titelmotiv: Getty Images, München (© Cultura)
www.istockphoto.de / www.Thinkstockphoto.de / Maria Seidel
eBook-Produktion: F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
ISBN 978-3-7844-8292-7
Für Olegaria Lundgren, denn das ist auch ihre Geschichte.
1
Laura Bredenstedt drehte sich unwillig auf die andere Seite. Sie wollte die Hand abschütteln, die sie an ihrer Schulter packte und ihr befahl: »Aufstehen, es wird höchste Zeit.«
Das Leben in der Familie Bredenstedt war nicht mehr schön. Nach dem Großen Brand vor sechs Jahren, bei dem die Familie ihren gut frequentierten Buchladen in der Kleinen Rosenstraße verloren hatte, führte der Vater ein strenges Regiment. Und dazu gehörte, dass die Nächte morgens um vier Uhr für die Familie zu Ende waren.
»Vom Schlafen können wir nicht leben, also ran an die Arbeit«, war sein gebräuchlichstes Wort, wenn er sich selbst zur Arbeit antrieb, denn Heinrich Bredenstedt ging mit bestem Beispiel voran. Er, der den Buchhandel so liebte und auf so tragische Weise sein kleines, von Eltern und Großeltern geerbtes Geschäft verloren hatte, ging jeden Morgen mit einer Handkarre voller alter Bücher in die Hamburger Vororte, um den Menschen dort, die so wenig Gelegenheit hatten, in den Stadtgeschäften nach Büchern zu suchen, Lesestoff an die Haustür zu liefern. Das gleiche Engagement forderte er aber auch von seiner Frau Florine und von seiner Tochter Laura.
Florine, die als junges Mädchen die Kunst der Weißnäherei erlernt hatte, musste nun für eine fremde Schneiderei Herrenhemden nähen, waschen und bügeln, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn sie spätabends von der Schneiderei nach Hause kam, beladen mit einem Arm voller Hemden, dann mussten diese gewaschen, in der Küche zum Trocknen auf Wäscheleinen gehängt und morgens, bevor sie ihren Dienst antrat, abgenommen und gebügelt werden.
Laura, inzwischen zwanzig Jahre alt, die bis zur Zeit des Unglücks eine gute Schule besucht und eine Ausbildung in Pädagogik gemacht hatte, musste sich ihr Geld als Hauslehrerin verdienen. Aber nicht nur das, sie musste, wie Vater und Mutter, morgens früh aufstehen und zwischen fünf und sieben Uhr die Brötchen vom Bäcker Frontmann aus der Breitenstraße in jene Haushalte bringen, die sich einen solchen Dienst leisten konnten. Sie zog morgens in der Dunkelheit mit einem Karren, voll beladen mit Brötchenkörben, durch die wieder aufgebauten Straßen und füllte, je nach Bestellung, Brötchen in die Leinenbeutel, die an den Haustüren hingen.
Was aber für Laura noch schlimmer war als das frühzeitige Aufstehen und die Verteilung von Brötchen, war die Männerkleidung, die sie tragen musste. Um nicht von Strolchen und Vagabunden belästigt zu werden, musste sie wie ein Bäcker mit einer schwarz-weiß karierten Hose, einer weißen Jacke und einer großen weißen Mütze, in der sie ihre langen Locken verstecken konnte, durch die Straßen ziehen. Erst wenn sie diese Aufgabe erledigt hatte, konnte sie sich zu Hause wieder in Laura Bredenstedt verwandeln und ihre Arbeit als Hauslehrerin antreten.
Es war ein hartes Leben, das die Familie Bredenstedt nach dem Großen Brand führen musste. Und Laura weinte oft, wenn sie von der Brötchenrunde nach Hause kam. »Es ist so kalt«, klagte sie im Winter, wenn sie über dem Küchenherd die klamm gefrorenen Finger wärmte.
Florine, die um diese Zeit die restlichen Kohlestückchen in die Bügeleisen schob, um die letzten Hemden zu bügeln, nahm die Tochter tröstend in die Arme. »Ist schon gut, Laura, der nächste Sommer kommt bestimmt«, flüsterte sie in die dunkle Lockenpracht, die unter der Bäckermütze hervorquoll. »Ich fürchte mich auch vor dem kalten Weg. Ist es wieder glatt auf den Straßen?«
»Es geht, Mama, ein paar Leute haben Asche auf die Bürgersteige gestreut, aber viele schlafen noch.«
»Ich habe so große Angst, hinzufallen und mir die Beine zu brechen, dann kann ich nicht mehr arbeiten und Vater würde sehr ärgerlich sein.«
»Ach, Vater, er bestimmt immer nur, was wir machen sollen, er nimmt so wenig Rücksicht auf uns.«
»Aber Laura, Vater kann doch auch nichts für diese schreckliche Situation. Er selbst nimmt die härteste Arbeit auf sich und schleppt die schweren Bücher bis nach Altona und bis nach Hasselbrook, um ein wenig Geld zu verdienen.«
»Wenn ich doch wenigstens morgens nicht die Brötchen verteilen müsste«, meinte Laura.
»Kind, du weißt doch, welch große Hilfe es für uns ist, dass du zweimal in der Woche die nicht verkauften Brötchen mit nach Hause bringen kannst. Ich koche Suppen daraus und mache Puddings, und ich habe ein Rezept für Brottorten entwickelt, wir leben von diesen Brötchen, jedenfalls dein Vater und ich. Du musst zum Glück nicht hier bei uns essen, aber ich bin sehr froh, diese Reste zu bekommen.«
Florine stellte das letzte Bügeleisen zum Erkalten auf einen Untersetzer, betrachtete die Tochter, die sich umgezogen hatte, und küsste sie zum Abschied. »Einen schönen Tag, mein Liebling, gut siehst du wieder aus.«
»Die alte Hose vom Bäcker hasse ich, sie ist so hart und scheuert zwischen den Beinen. Nur gut, dass es morgens dunkel ist und mich keiner sieht.«
»Umso besser siehst du jetzt aus. Der graue Mantel mit dem breiten Kragen und die Kappe stehen dir. Pass gut auf dich auf, mein Liebling, einen Verehrer können wir nicht gebrauchen.«
Laura lachte und küsste die Mutter zum Abschied. »Bis heute Abend, Mama.« Und lachend lief sie die Treppen hinunter, hin zum Alsterdamm, wo ihre eigentliche Arbeit um acht Uhr begann.
Die Tätigkeit bei der Reederfamilie Merlinius machte ihr Spaß. Sie durfte morgens mit der kleinen Marie zusammen frühstücken und dann das intelligente Mädchen im Schreiben, Lesen und Rechnen unterrichten. Während die älteren Söhne bereits in Lehranstalten lebten, wurde die kleine Marie verwöhnt und durfte zu Hause bleiben. »Söhne gehören in die Hand starker Männer«, sagte der Reeder immer wieder, wenn die Söhne maulten und über das verzogene Schwesterchen lachten, im Grunde aber war Jacobus Merlinius froh, wenigstens seine kleine Marie noch eine Weile in der Familie zu haben.
Von der Großzügigkeit des Vaters seiner Tochter gegenüber profitierte auch Laura. Marie musste schwimmen lernen, Laura durfte sie begleiten und ebenfalls an dem Unterricht teilnehmen. Marie lernte reiten, Laura auch, Marie bekam Tanzunterricht, Laura ebenfalls. Seit vier Wochen musste Marie nun Klavier spielen lernen. Zwei Mal in der Woche kam ein Lehrer ins Haus der Reederfamilie und unterrichtete das Kind. Und weil Laura die Übungsstunden an den anderen Tagen beaufsichtigen musste, lernte sie ebenfalls das Spielen auf dem Klavier. Außerdem war sie bei vielen Veranstaltungen der Stadt für Kinder dabei. So genoss die Tochter des einfachen Buchhändlers und der Hemdennäherin die Vorzüge im Hause wohlhabender Leute. Und wenn sie morgens bei Wind und Wetter unterwegs war, um die Brötchen zu verteilen, tröstete sie sich mit dem Gedanken an diese so angenehme Lebensart und mit der Hoffnung, auch einmal ein leichteres Leben zu haben, sobald sie erwachsen wäre.
Laura lehrte nicht nur, sie lernte auch, und sie lernte für das Leben, das wusste sie genau. Sie konnte natürlich nicht mit dem Reichtum der Damen im Hause Merlinius Schritt halten, aber sie konnte lernen, wie man sich pflegt, wie man sich kleidet, wie man sich unterhält und wie man sich benimmt. Sie nahm dieses Wissen in sich auf und wusste, eines Tages würde sie davon profitieren.
Laura ging die knarrenden Stufen der alten Holztreppe hinunter. Der Vater hatte die kleine Wohnung in dem schmalen Haus, das vom Großen Brand verschont geblieben war, pachten können, als das eigene abgebrannt war.
Wie schön es daheim gewesen ist, dachte Laura, als sie langsam die Stufen in der Dunkelheit ertastete. Dort hatten wir eine breite Treppe und eine Petroleumlampe sorgte immer für Licht. Und überhaupt, niemals musste ich in der Zeit so früh aufstehen. Bevor dieses schreckliche Feuer kam, war unsere Welt noch in Ordnung, schimpfte sie leise vor sich hin. Vater hatte seinen Laden, in dem er glücklich und immer gut gelaunt arbeitete, Mutter kümmerte sich um die Wohnung über dem Laden und um den Haushalt, und ich ging in meine Mädchenschule, traf mich mit Freundinnen und durfte sie zu uns nach Hause einladen. Und dann kam vor sechs Jahren dieses furchtbare Feuer und zerstörte unser ganzes Leben. Gerade einmal einen Arm voller Kleidungsstücke konnten wir retten, dachte sie und verließ den dunklen Hausflur, in dem es schon wieder nach Kohl roch.
Auf der Straße angekommen, zog sie die Kappe tief ins Gesicht, um wenigstens die Ohren vor der Kälte zu schützen. Beklommen schaute sie auf ihre Füße in den nassen Stiefeletten. Jeden Morgen musste sie bei diesem Wetter mit feuchten, halb erfrorenen Füßen den weiten Weg zum Alsterdamm gehen. Aber sie hatte nur das eine Paar Winterschuhe, und erst nach Feierabend konnte sie die Schuhe auf dem Rand von Mutters Küchenherd trocknen.
Laura lief den Schopenstehl entlang, über den Fischmarkt und die Schmiedestraße hinauf bis zur Petrikirche, und dann die Bergstraße hinunter zur Binnenalster. In den Straßen sah man oft noch die Schäden, die das Feuer angerichtet hatte. Viele Ruinen der abgebrannten Häuser waren noch nicht beseitigt und der Straßenbau ging auch nur zögerlich voran.
Erst als sie unten am Wasser ankam, wurde der Anblick der Häuser wieder freundlicher. Die Banken, Hotels und Villen an den Uferstraßen waren in den vergangenen Jahren neu erbaut und prächtig hergerichtet worden, und auch der Jungfernstieg mit seinen Geschäften und Kaffeehäusern war völlig hergestellt, sodass die feinen Damen und Herren wieder auf dem Boulevard flanieren konnten.
Schön muss das sein, dachte Laura, genügend Geld zu haben, ein feines Kleid mit Spitzen und Volants und einen passenden Hut mit Federn und Schleiern auf dem Kopf zu tragen, in denen der Wind spielt – und überhaupt keine kalten Füße. Und dann im Kaffeehaus eine Tasse heiße Schokolade trinken, das würde mir gefallen.
Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Ich werde jetzt mit Marie frühstücken, das ist natürlich auch sehr schön, denn die Köstlichkeiten, die ich da essen darf, habe ich noch niemals vorher probieren können, und irgendwann im Laufe des Vormittags werden dann auch meine Füße wieder warm.
Laura warf einen letzten Blick auf die an diesem frühen Wintermorgen noch vom Nebel bedeckte Alster mit der blanken Eisdecke, über die ein paar Möwen flogen. Dann drehte sie sich um und zog an der Klingelschnur zum Dienstboteneingang der Stadtvilla des Reeders Jacobus Merlinius. Gleich darauf kam eines der Hausmädchen, adrett im schwarzen Kleid mit weißer Schürze und dem Spitzenhäubchen auf dem Kopf, und ließ sie eintreten.
»Das nenne ich eine schicke Uniform«, lächelte Laura, grüßte höflich und dachte an die harten, kratzenden Bäckerhosen, die sie morgens tragen musste. Sie legte ihren Mantel und die Kappe ab, strich Rock und Bluse glatt und folgte dem Mädchen in die obere Etage, wo sich die Zimmer von Marie befanden. »Wir servieren gleich das Frühstück, Fräulein Bredenstedt, und Herr Doktor Merlinius hat angeordnet, dass er heute das Fräulein Marie und Sie zum Reitunterricht begleiten wird. Die Kutsche fährt in einer Stunde vor.«
»Danke, Nelli, wir werden das Essen früh genug beenden.«
Laura betrat Maries kleinen Salon, in dem das Frühstück imer eingenommen wurde, und fand eine weinende Marie vor.
»Hallo, Kleines, was ist denn los?«
»Papa will mit uns zum Reiten fahren und ich wollte doch heute den Puppenspielern vom Gänsemarkt zusehen. Die kommen doch nur einmal im Jahr hierher und heute ist der große Tag.«
Laura nahm sie in die Arme. »Wir schaffen beides, Marie, wir reiten so gut, dass dein Papa zufrieden ist, und am Nachmittag gehen wir zum Puppenspiel.«
»Aber manchmal ist Hannes so störrisch, dass ich nicht mit ihm fertig werde, und dann dauert der Unterricht immer so lange.«
»Ach was, Marie, wir nehmen ihm ein paar Möhren mit, dann wird er gleich zufrieden sein und brav seine Runden drehen.«
Das Frühstück wurde serviert und Laura bestellte gleich noch vier Möhren. Verwundert schaute Emma, das Serviermädchen, von einem zum anderen und Laura verriet: »Wir müssen die Pferde bestechen. Der Herr Doktor will uns zusehen und da müssen sie sich von ihrer besten Seite zeigen.«
Achselzuckend verließ Emma den Salon. Laura goss Kakao in die Tassen und reichte Marie die Platte mit den Honigbrötchen. Sie freute sich auf die Reitstunde, denn der Reitlehrer war ein charmanter junger Mann und lobte seine beiden Schülerinnen, selbst wenn sie Fehler machten.
Marie hingegen war noch immer enttäuscht und versuchte so schnell wie möglich zu essen und zu trinken, um möglichst zeitig fertig zu sein. Dabei verbrannte sie sich den Mund an dem heißen Kakao und spuckte ihn in die Tasse zurück. »Dass der auch immer so heiß sein muss«, jammerte sie und wischte sich den Mund mit der Serviette ab. Laura erklärte: »Er muss so heiß sein, sonst bilden sich Klumpen und die magst du nicht. Ich bin froh, dass er so heiß ist, ich habe einen kalten Weg hinter mir, da tut er richtig gut.«
»Warum bilden sich denn Klumpen?«
»Das Pulver löst sich nur in heißer Milch richtig auf.«
»Warum ist der Kakao denn ein Pulver?«
Laura lächelte heimlich, Marie konnte sehr intensiv und ausdauernd fragen, da kühlte der Kakao schnell ab. »Der Kakao ist eigentlich eine Bohne, die wird dann zu Pulver gemahlen.«
»Und wo wächst so eine Bohne?«
»Ich glaube, in den heißen Ländern. Die Bohne braucht viel Wärme.«
»Und wie kommt sie hierher?«
»Na, ich denke mal mit den Schiffen von deinem Papa.«
»Das glaube ich nicht, die bringen doch Seide mit und Holz und Pfeffer und Zucker.«
»Du könntest ja deinen Papa fragen.«
»Ja, das will ich jetzt genau wissen. Jeden Morgen trinke ich dieses heiße Pulver, verbrenne mir den Mund und weiß nicht einmal, woher das Zeug kommt.«
»Nein, Marie, heiß ist nur die Milch, ich denke mal, das Pulver in der Dose ist ganz kalt.«
»Ja, du hast recht. Ich habe einmal in der Küche zugeschaut, wie die Friedel einen Kuchen gebacken hat, da hat sie etwas von diesem Pulver in den Teig geschüttet. Ich hab heimlich mit dem Finger von dem braunen Zeug genascht, aber das hat gar nicht geschmeckt, bitter war das und kalt, ja, das stimmt, in der Dose war das Pulver kalt und im Mund war es gleich ein Klumpen.«
»Man muss es eben in heißer Milch aufkochen und Zucker hineintun.«
»Was du alles weißt, Laura, weißt du eigentlich alles?«
»Aber nein, Marie, ich muss auch noch viel lernen.«
»Aber wenn ich dich etwas frage, weißt du immer Bescheid.«
»Nun ja, ich bin schon ein bisschen älter und ich habe viel in meiner Schule lernen müssen. Und ich lese viel.«
»Du bist neugierig.«
»Das muss man sein, wenn man leben lernen will.«
»Ich will das auch, aber ich brauche nicht zu lesen, du kannst mir ja alles sagen.«
»Aber das Lesen ist sehr wichtig, Marie, es gibt so vieles, was man aus Büchern erfährt. Deshalb lernen wir beide ja auch das Lesen.«
»Na ja, ein bisschen kann ich es ja auch schon.«
»Du kannst sehr gut lesen, Marie, und wenn du fleißig übst, kannst du deine Gutenachtgeschichten abends bald allein lesen.«
»Aber das will ich ja gar nicht, es ist viel schöner, wenn du die Geschichten vorliest, du kannst die Stimme so schön verstellen.«
Laura lachte laut und schaute auf die Kuckucksuhr über dem Kamin. »Marie, es wird höchste Zeit, wir müssen uns fertig mahen, dein Papa wartet nicht gern.«
»Ich würde lieber hierbleiben und mit dir reden, das macht mehr Spaß als das Reiten.«
»Eine junge Dame muss reiten können«, erklärte Laura sehr ernsthaft, »und nun trink deinen Kakao aus, jetzt ist er sicher abgekühlt.«
»Aber jetzt hat die Milch eine Haut und die mag ich nicht.«
Laura schöpfte mit einem Teelöffel die Haut von dem Kakao und reichte Marie die Tasse. »Komm, trink aus, deine Mama möchte, dass du morgens mit allem Drum und Dran frühstückst.«
»Ja, ja, ich weiß.«
Nelli klopfte an die Tür und kam mit den Mänteln und Mützen. »Die Kutsche ist vorgefahren und der Herr Doktor ist auch schon bereit.«
»Wir sind sofort unten.« Laura half Marie in den Mantel, zog sich selbst rasch an und hoffte, dass ihre Füße in den dünnen Stiefeln endlich etwas wärmer wurden. Aber damit war nicht zu rechnen. Und jetzt die kalte Kutsche und die Fahrt bis zum Schweinemarkt, wo die offene Reithalle ist, dachte sie, da werde ich mit eisigen Füßen aufsitzen müssen und wärmer wird’s dann beim Reiten auch nicht.
Unten in der großen Halle wartete Doktor Merlinius. Laura war wie immer überrascht von der Dominanz des Hausherrn. Obwohl er klein, dick, kahlköpfig und kurzsichtig war, strahlte er Würde und Gelassenheit aus, ein Mann, zu dem man aufschauen konnte, obwohl er kleiner war als die schlanke, hochgewachsene Laura. Und wie immer, wenn sie ihm begegnete, was nicht oft geschah, begrüßte sie ihn mit einem tiefen Knicks.
»Na, da seid ihr ja endlich. Los, Marie, raus aus dem Haus und rein in die Kutsche, die Pferde warten nicht gern, wenn es kalt ist.« Nelli öffnete die Haustür, Doktor Merlinius eilte nach draußen, seine Marie an der Hand und Laura hinter sich. Alle drei nahmen Platz in der Kutsche, Laura, wie es sich für Angestellte gehörte, auf der Rückbank und ohne die wärmenden Wolfsfelldecken. Aber Kutscher Hansmann hatte unter die Gummimatten auf dem Boden heiße Backsteine geschoben und die spürte Laura. Sie nahm sich vor, Hansmann zu danken, wenn sie angekommen waren.
Die Fahrt führte am Alsterdamm entlang zum Glockengießerwall und dann über den Steintorwall auf den Schweinemarkt. Zweimal in der Woche wurden hier in der großen offenen Halle Schweine von Bauern aus der Hamburger Umgebung geprüft, geschätzt und gehandelt. An den übrigen Tagen wurde sie als Trainingshalle für Reiter genutzt, aber ihren penetranten Geruch nach Schweinen wurde sie nie los.
Hansmann zügelte seine Pferde vor dem Eingang, stieg vom Kutschbock und half seinen Gästen aus der Kutsche. Auch Laura reichte er die Hand und sah sie lachend an. »Na, war’s angenehm, mein Fräulein?«
»Danke, Herr Hansmann, das hat gutgetan.«
»Hab ich mir gedacht«, nickte er und wandte sich an seinen Dienstherrn. »Wollen Sie die Mäntel in der Kutsche lassen oder wird heute mit Mantel geritten?«
Doktor Merlinius sah seine Tochter fragend an. »Mit oder ohne Mantel?«
»Bitte mit, Papa, es ist ganz schön kalt.« Marie lächelte heimlich, sie wusste genau, mit Mantel konnte der Vater so manchen Haltungsfehler nicht erkennen und sie musste sich nicht so viel Mühe geben, alles richtig zu machen.
»Also gut«, er nickte dem Kutscher zu. »In einer Stunde holen Sie uns wieder ab.« Damit drehte er sich um und ging schnellen Schrittes in die Halle, wo der Reitlehrer mit zwei Pflegern und drei Pferden auf die Kundschaft wartete.
2
Jacobus Merlinius machte wie immer eine gute Figur auf dem Pferd. Trotz der Korpulenz saß er fest im Sattel und Laura beneidete ihn. Er kann mit beiden Beinen die Hilfen geben, während wir Mädchen im Damensattel es viel schwieriger haben, das Pferd zu dirigieren, dachte sie und bemühte sich trotzdem um einen korrekten Sitz in dem unbequemen Sattel. Mit dem steifen Leinenunterkleid, dem weiten Rock und dem dicken Wintermantel hatte sie bereits beim Aufsteigen Mühe, und während der Reitlehrer die leichte Marie beschwingt in den Sattel hob, musste Laura mithilfe einer kleinen Leiter den Sitz erreichen.
Nach einer halben Stunde, in der im Schritt, im Trab und im Galopp die Hallenmitte umrundet worden war, befahl Doktor Merlinius dem Reitlehrer, mit zwei niedrigen Strohballen und einer bunt bemalten Stange darüber ein Hindernis aufzubauen.
Aber Marie protestierte. »Papa, heute will ich nicht springen. Mit dem Mantel und dem dicken Winterkleid kann ich nicht richtig sitzen, und wenn ich runterfalle, steige ich nie wieder auf ein Pferd.«
»Unsinn, Mariechen«, entgegnete der Papa. »Du fällst nicht. Die Stange ist nicht höher als ein größerer Galoppsprung, du wirst ihn gar nicht merken und schon bist du darüber.«
»Aber warum soll ich denn springen?«
Laura lachte heimlich. Wenn Marie mit ihren Fragen begann, würde es noch eine Weile dauern, bis es mit der Reiterei weiterging, und dann war die Zeit ganz schnell vorbei und sie selbst konnte absitzen. Ich habe zwar keine Angst vor dem Sprung, dachte sie, aber ich möchte eine gute Figur vor dem Reitlehrer machen und das ist mit der dicken Winterkleidung einfach unmöglich. Und während der Lehrer den Sprung in der Mitte der Halle aufbaute, fragte Marie ihren Vater: »Wieso muss ich springen können. Hier in der Halle geht es doch immer nur rechts oder links herum.«
»Irgendwann werden wir draußen im Wald reiten, und wenn dann plötzlich ein Baum im Weg liegt, musst du darüberspringen können.«
»Aber in was für einem Wald denn, Papa?«
»Ich werde im Sommer ein Ferienhaus in der Lüneburger Heide mieten und da gibt es jede Menge Wälder.«
Der Reitlehrer war mit dem Aufbau fertig und nickte dem Doktor zu. Aber Marie fragte unbeirrt weiter. »Papa, wo denn in der Heide?«
»Ich dachte an Luhmühlen. Es ist ein ganz kleines Dorf, dort wohnen beinahe mehr Pferde als Menschen, es gibt feinen Heidesand und viele Wälder und man kann sogar in der Luhe reiten.«
»Was ist das, die Luhe?«
»Ein kleiner Fluss, der da durch die Wiesen und Wälder fließt. Er ist nicht tief und die Pferde brauchen nur selten zu schwimmen.«
»Aber Papa, ich will doch nicht auf einem Pferd schwimmen. Ich kann es selbst und dann die ganzen nassen Kleider.«
»Im Sommer hat man nicht so viele Kleider an.«
»Aber die Mama wird das nicht wollen.«
»Deine Mama ist eine gute Reiterin, sie wird den größten Spaß daran haben.«
»Warum reitet die Mama nicht hier mit uns?«
»Die Damen mögen diese Art von Unterricht nicht. Da schauen so viele Leute zu und das gefällt ihnen nicht.«
Marie sah nach draußen, wo tatsächlich ein paar Männer und Frauen standen und beobachteten, was in der Halle geschah. »Ich mag diese Art von Unterricht auch nicht. Ich will jetzt aufhören.«
»Erst wird das Springen geübt, dann hören wir auf.«
Jacobus Merlinius nickte dem Reitlehrer zu, gab seinem Pferd einen kleinen Hieb mit der Gerte, galoppierte an und sprang mit leichtem Schwung über das Hindernis, das kaum höher war als fünfzig Zentimeter. Der Reitlehrer knallte mit der Peitsche und auch Lauras Pferd sprang nach einem kurzen Anlauf über die Stange. Und ohne dass Marie es verhindern konnte, lief ihr Pferd hinterher und überwand die Stange mit einem kleinen Sprung.
»Na bravo, mein Mädchen«, rief der Vater und klatschte in die Hände.
Auch Laura freute sich, nicht nur dass Marie ihre Angst überwunden hatte, sondern dass sie selbst so zügig darübergesprungen war. Sie wollte das Reiten wirklich lernen. Eines Tages, wenn ich älter bin, will ich es mit den feinen Damen aufnehmen können. Ich werde nicht immer Brötchen austragen und Hauslehrerin sein, ich will, dass man mir selbst eines Tages die Brötchen an die Haustür hängt und ich mit einem eigenen Pferd durch einen Heidewald reiten kann.
Nach mehreren Sprüngen, die sie alle problemlos absolvierten und zu denen zum Schluss die Zuschauer Beifall klatschten, hob Doktor Merlinius die Hand. »Danke, das reicht für heute.« Er stieg ab, hob seine Marie aus dem Sattel, küsste sie dankbar und wandte sich dem Ausgang zu. Laura folgte wie immer als Letzte, aber diesmal leicht errötet, weil der Reitlehrer persönlich ihr aus dem Sattel geholfen hatte. »Sie haben eine Gabe für Pferde«, hatte er ihr zugeflüstert und ganz leicht ihre Hand gedrückt. »Kommen Sie doch mal allein vorbei, ich könnte Ihnen vieles zeigen.«
Laura hatte verlegen geantwortet. »Ja, vielleicht, wenn ich einal Zeit habe«, und folgte dem Reeder und seiner Marie.
Seltsam, dachte sie, plötzlich habe ich gar keine kalten Füße mehr.
Im Haus am Alsterdamm angekommen, wurde den Mädchen ein zweites Frühstück serviert und Maries Mutter leistete ihnen Gesellschaft. Die gnädige Frau liebte es, morgens etwas länger zu schlafen, dann gemütlich und allein zu frühstücken und dabei die neue Tageszeitung zu lesen, bevor ihr Mann das Blatt in die Hand nahm und dann unsortiert und leicht zerknittert beiseitelegte.
Esther Merlinius war eine schlanke, gut aussehende Frau von vierzig Jahren, die ihren wenig attraktiven Mann um mehrere Zentimeter überragte, aber nie ein Hehl daraus machte, dass sie ihn, so wie er war, liebte.
In den gesellschaftlichen Kreisen, denen die Familie Merlinius angehörte, wurde zwar hin und wieder gemunkelt, dass sie sein Ansehen und seinen Reichtum mehr liebte als ihn, aber Esthers Benehmen und ihre offene Zuneigung zeigten, wie unrecht diese Klatschmäuler hatten.
Obwohl sich beide bereits als Kinder kannten, hatten sie spät geheiratet. Esther war schon fünfundzwanzig Jahre alt, als sie seinem Drängen nachgab. Es war eine prunkvolle Hochzeit, die in der Sankt-Petri-Kirche vollzogen wurde und tagelang das Gesprächsthema in der Stadt war. Doktor Jacobus Merlinius war nicht irgendjemand, sondern einer der anerkanntesten Reeder und Bankiers Hamburgs und in sehr umfangreichem Maße an dem Wohlstand der Stadt beteiligt. Und seine Frau, eine geborene Esther Silberblatt aus Altona, galt in ihren Kreisen als eine der begehrtesten jungen Frauen. Sie war hübsch, sportlich, sehr gebildet und sehr hilfsbereit. Sie spendete Geld für die Bekämpfung der Armut, gründete einen Mittagstisch für Obdachlose im Gängeviertel um Sankt Katharinen herum und teilte selbst das Essen aus, wenn es ihre Zeit erlaubte. Als sie nach dem Großen Brand von dem Verlust der Buchhandlung des Heinrich Bredenstedt hörte, in der sie eine häufige Kundin gewesen war, überlegte sie, wie dem ehemaligen Besitzer und seiner Familie zu helfen sei. Und so kam es, dass sie die gebildete, wohlerzogene Laura als Hauslehrerin für ihre Tochter Marie engagierte. Und mit dem Engagement verband Esther Merlinius nicht nur den Unterricht im Schreiben, Lesen und Rechnen, sondern auch das gemeinsame Essen, die Betreuung tagsüber und die Beteiligung an allen Aktivitäten der eigenen Tochter, und gleichzeitig bekam Laura dadurch einen Einblick in das Leben der besseren Gesellschaft. Und mit Freude erkannte Esther Merlinius, wie begeistert die junge Dame von ihr lernte.
Sie genoss oft, und so auch heute, das gemeinsame kleine zweite Frühstück mit Laura und Marie. Sie erzählte ihnen von den Berichten in der Zeitung, von Begebenheiten in der Stadt und von den großartigen Neuerungen, die der Londoner Ingenieur William Lindley einführte, indem er die Stadt mit einem modernen Kanalisationsnetz ausstattete, eine Gasbeleuchtung in den Straßen installierte und für frisches Trinkwasser aus der Elbe sorgte.
»Was haben die Leute denn vorher getrunken, Mama?«
»Das Wasser aus den Kanälen und das war nicht sauber.«
»Igitt, da fallen doch die Sachen aus den Klosetts rein.«
»Ja, genau, und deshalb war es gefährlich, das Wasser zum Essen und Trinken zu benutzen.«
»Haben wir das etwa auch getrunken?«
»Nein, natürlich nicht, wir haben bis vor wenigen Wochen von dem Brunnenmann das Wasser gekauft. Das war sehr umständlich und man musste immer sparsam damit umgehen.«
»Und woher hatte der das Wasser?«
»Er hat es mit dem Pferdewagen von der Alsterquelle geholt, das war ein weiter Weg und er war die ganze Nacht unterwegs, um morgens die Hamburger zu bedienen. Du kennst doch den Mann mit den beiden Eimern, die er an einer Schulterstange trägt. Wenn man ihn sieht, ruft man ›Hummel-Hummel‹ und er ruft ›Mors-Mors‹ zurück!«
»Ja, den kenne ich. Und jetzt haben wir Wasser aus der Elbe? Aber da fahren die vielen Schiffe, die sind doch auch nicht sauber.«
»Der Ingenieur Lindley baut Ablagerungsbecken für den Schmutz und ein Pumpwerk und einen Wasserturm und dann fließt das Wasser durch viele Kanäle und Rohre bis zu uns in die Küche und in die Badezimmer.«
»Das ist ja toll. Und warum ist der aus London hergekommen?«
»London ist eine sehr moderne Stadt, sie ist ein Vorbild für Hamburg.«
Esther sah Laura an. »In der Kleidung werden wir uns auch immer mehr der englischen Mode annähern.«
»Ich kenne sie nicht, ich bin froh, dass Mutter mit ihrer Nähkunst für mich sorgt. Ich glaube, sie weiß gar nicht, wie englische Mode aussieht.«
Esther, peinlich berührt von ihrer eigenen Dummheit, Laura auf moderne Damenkleidung anzusprechen, korrigierte sich sofort.
»Ich bin auch nicht angetan von diesen modischen Dingen. Ich finde eine Kleidung, wie deine Mutter sie zaubert, viel schöner und attraktiver. Du siehst immer sehr gepflegt aus, Laura.«
»Danke, Frau Merlinius, ich weiß die Nähkunst meiner Mutter sehr zu schätzen.«
Esther lenkte gekonnt von den Modefragen ab. »Ich werde euch heute zum Puppenspieler begleiten.«
»Oh, Mama, das ist ja schön, spendierst du uns heiße Schokolade in ›Sillem’s Bazar‹?«
»Vielleicht, ich möchte mir diese erste deutsche Passage zwischen Jungfernstieg und der Königstraße auch einmal ansehen. Sie wird von vielen Hanseaten und auch von vielen Touristen sehr gelobt.«
Esther stand auf. »Wir sehen uns nach der Mittagsruhe, bis dahin wird aber noch fleißig gearbeitet, mein Schatz.« Liebevoll strich sie ihrer Tochter über die dunklen Haare. Sie war so glücklich, dieses Kind noch in den späteren Jahren bekommen zu haben. Zu ihren Söhnen Lennard und Lombard hatte sie nie diesen innigen Kontakt, sie waren ihr fast fremd.
Erst wusste ich nichts mit kleinen Jungen anzufangen. Da haben sich die Kindermädchen um sie gekümmert, dachte sie, bemüht, das schlechte Gewissen zu beruhigen, dann kamen die Erzieher, und dann zogen sie ins Internat. Sie waren nie so niedlich und so anhänglich wie Marie. Zum Glück hat mir Jacobus nie Vorwürfe gemacht. Er ist sehr glücklich mit diesen prächtigen jungen Männern und einmal hat er mir strahlend gesagt: »Esther, unsere Firmen sind gerettet. Die Reederei und das Bankhaus werden vorzügliche Direktoren bekommen. Ich denke, dass Lennard eines Tages die Schifffahrt übernimmt, er ist derjenige, der von fernen Ländern träumt und auch ein größeres Talent für die Sprachen hat, und Lombard wird mit seiner Gründlichkeit und mit der Gewissenhaftigkeit, die ihn jetzt schon auszeichnet, ein guter Bankdirektor werden.«
Und dann hatte er sie dankbar in die Arme genommen, ihr zärtliche Worte gesagt und neun Monate später hatte sie ihm die kleine Marie geschenkt.
Doch Esther Merlinius war zufrieden mit ihrem Leben.
Nur mit der elterlichen Familie klappte es nicht so gut, wie Esther sich das wünschte. Die Silberblatts, anerkannte jüdische Geschäftsleute in Altona, waren nicht begeistert von der Verbindung ihrer einzigen Tochter mit einem protestantischen Hanseaten. Sie hatten andere Pläne und andere Verbindungen vorgesehen und konnten sich gar nicht damit abfinden, dass Esther konsequent ihren eigenen Weg gegangen war.
Aber wahrscheinlich wissen sie auch, dass sie selbst an meiner Entwicklung schuld sind. Sie haben mich sehr großzügig erzogen, mir viel freien Willen gelassen und dafür gesorgt, dass ich ein selbstbewusster Mensch geworden bin. Und dann waren sie entsetzt, als ich mit meiner Selbstständigkeit mir auch meinen eigenen Mann gesucht habe. Esther lächelte still vor sich hin, während sie ihren Salon aufsuchte. Sie haben nicht an meiner Hochzeit teilgenommen und eine wichtige Reise nach Frankreich vorgeschoben und keines meiner Kinder haben sie bei der Taufe auf dem Weg in die christliche Gemeinschaft begleitet.
Sie schüttelte unwillig den Kopf. Aber es ist mein Leben, und so gern ich ihnen Freude bereiten würde, gängeln lass ich mich nicht.
Der Nachmittag wurde ein voller Erfolg. Esther, Marie und Laura gingen zu Fuß über den Jungfernstieg bis zum Gänsemarkt, wo der Puppenspieler sein kleines Theater am hinteren Ende der Schwieger Straße aufgebaut hatte. Eine enge, schmutzige Gasse, in der die alten, schmalen Häuser mit ihren schäbigen Giebeln einen ärmlichen Eindruck hinterließen. Esther war verärgert, hatte doch dieser Puppenspieler seinen Platz auf dem großen Gänsemarkt angekündigt und nicht in dieser schmuddeligen Straße.
»Ich habe keine Erlaubnis für den Gänsemarkt bekommen. Ich musste hierher ausweichen, sonst wäre mein Puppentheater ausgefallen«, entschuldigte er sich und bot den Besuchern wackelige Stühle an, die auf dem schlecht gepflasterten Bürgersteig kaum stehen konnten.
Nun ja, dachte Esther, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, wenn meine Tochter auch einmal sieht, wie andere Leute leben. Man sollte ein Kind gar nicht immer vor unliebsamen Eindrücken oder Begebenheiten schützen.
Getröstet wurde sie dann, als das Spiel begann, denn der Puppenspieler und seine Familie waren wirkliche Künstler und zogen die wenigen zahlenden Zuschauer sofort in ihren Bann. Man vergisst den Gestank, den schlechten Platz, die Menschen, die aus den Fenstern schauen, um keinen Eintritt bezahlen zu müssen, und die Kälte, dachte sie zufrieden. Sie spielen wirklich gut und erzählen ihre Geschichten, dass selbst ich mit Spannung das Ende erwarte, freute sich Esther.
Zur Krönung des Nachmittags gingen die drei dann in ›Sillem’s Bazar‹ und Esther bezahlte gern die fünf Schilling Eintritt, die von wohlhabenden Passanten entrichtet werden mussten. Die drei Gäste bewunderten die Auslagen der mehr als dreißig Geschäfte, die riesige Glaskuppel, die Oktogon genannt wurde und das Tageslicht spendete. Sie wärmten sich schließlich im Foyer des Hotels ›De Russie‹ mit heißem Kakao auf. Glücklich und zufrieden flanierten sie schließlich über den Jungfernstieg zurückzum Alsterdamm, wo Jacobus seine Frau aufgeregt erwartete.
»Wo wart ihr denn, warum kommt ihr so spät zurück, ich habe mir Sorgen gemacht.«
»Aber weshalb denn?«, fragte Esther erstaunt, denn so aufgeregt erlebte sie ihren Mann nur sehr selten.
»Wir haben unerwarteten Besuch bekommen. Die Familie Baisanson aus Pernambuco ist eingetroffen. Früher als erwartet, aber wohlbehalten und zufrieden mit unserem Personensegler.«
»Wie schön, wo sind sie?«
»Sie haben im großen Salon Platz genommen. Wenn du abgelegt hast, Esther, komm doch bitte gleich und begrüße sie.«
»Selbstverständlich, aber ein paar Minuten musst du mir schon gestatten, ich möchte mich umziehen, denn ich fürchte, der Geruch aus der alten Schwieger Straße haftet noch an unserer Kleidung.«
»Was wolltet ihr denn in dieser Gasse?« Jacobus Merlinius war es zwar gewohnt, seine Frau in den armen Gegenden der Stadt unterwegs zu wissen. Aber er konnte sich nicht vorstellen, dass sie an so einem kalten Tag und dann mit Marie und Laura im Gefolge gerade dort war.
»Aber Papa, wir sind doch beim Puppenspieler gewesen«, erklärte Marie dem Vater, »und der musste vom Gänsemarkt in die kleine Straße umziehen. Aber es war ganz wunderbar und hinterher haben wir ›Sillem’s Bazar‹ besucht und heißen Kakao getrunken. Wer sind denn diese Gäste, die wir haben, und wo ist dieses Pernambuco?«
Jacobus lachte. »Mein Gott, Kind, so viele Fragen auf einmal. Pernambuco ist ein Teil von Brasilien und Brasilien ist in Südamerika.«
»Ach, Papa, das von Brasilien weiß ich doch. Und was machen sie da?«
»Sie haben große Zuckerrohr- und Kakaoplantagen.«
»Für richtigen Kakao, solchen, den ich hier trinke?«
»Genau solchen.«
»Ob die mir erzählen, wie das so geht mit dem Kakao?«
»Aber sicher, mein Mädchen. Doch jetzt, denke ich, solltest du dich auch umziehen. Denn besonders fein riecht deine Kleidung nicht.«
Laura sah sich unschlüssig um, sollte sie noch bleiben? Konnte sie schon nach Hause gehen, brauchte man sie noch?
Aber Doktor Merlinius winkte ab. »Laura, ich glaube, Sie können heute einen frühen Feierabend machen. Sie haben einen langen Tag hinter sich und um Marie kann sich Nelli kümmern.«
Die junge Hauslehrerin nickte zufrieden. Sie war müde, die vielen neuen Eindrücke, das Zusammensein mit der Hausherrin, bei der sie sich besondere Mühe gab, um wohlerzogen und gebildet zu erscheinen, und dann die Reitstunden am frühen Morgen, sie war wirklich müde. »Danke«, sagte sie erfreut, ging hinaus auf die dunkle Straße und betrachtete die feuchten Stiefeletten, in denen ihre Füße wirklich den ganzen langen Tag über gefroren hatten, denn nur für einen kurzen Augenblick nach dem Reitunterricht waren sie warm gewesen.
3
Albert Baisanson war ein erfolgreicher Plantagenbesitzer und ein miserabler Geschäftsmann. Er verstand viel vom Klima in der Nähe des Äquators, von Bodenbeschaffenheiten am Rande des Regenwaldes, von Pflanzen und von Anbaumethoden, aber vom Handel verstand er gar nichts. Und das wusste er. Deshalb hatte er in Hamburg einen Prokuristen ernannt, der den Verkauf seiner wertvollen Waren beaufsichtigen sollte. Aber dieser Prokurist lieferte falsche Zahlen, wirtschaftete in seinen eigenen Geldbeutel und betrog den fernen Eigner, wo es nur möglich war. Aus diesem Grunde war Albert Baisanson nach Hamburg gekommen.
Mit Jacobus Merlinius verband ihn eine alte Freundschaft, er nutzte die Frachtschiffe des Reeders, die seine Waren in erstklassigem Zustand über die Meere schifften, bezahlte natürlich auch die hohen Frachtkosten, die aber immer angemessen waren, und war dann entsetzt, wenn der Verkauf der Waren kaum die Unkosten beglich.
Kurz entschlossen hatte er sich auf die Reise gemacht und seine Frau mit den beiden Töchtern und der Gouvernante mitgenommen, denn die Frauen auf der einsam gelegenen Plantage am Rande des Urwaldes allein zu lassen war undenkbar.
Die Familie Baisanson hatte ihren Ursprung in Frankreich. Als in der portugiesischen Kolonie Südamerikas Anfang des 18. Jahrhunderts Gold und Diamanten gefunden wurden, setzte ein ungeheurer Goldrausch ein und viele Europäer wanderten in den fremden Erdteil aus. Dabei waren auch die Brüder Pierre und Louis Baisanson, die in dem fernen Land ihr Glück versuchen wollten. Während Pierre in den Südosten weiterreiste, um in Ouro Preto Gold zu suchen, und dann sehr schnell als verschollen galt, erkannte Louis den Reichtum des Landes in der Landwirtschaft des Nordostens und blieb dort, um die in Europa dringend benötigte Baumwolle anzubauen. Später gründete er Kaffeeplantagen. Seine Söhne setzten diese Arbeit fort und machten ihr Geld zusätzlich mit Zuckerrohr. Sein einziger Enkel Albert Baisanson, inzwischen alleiniger Erbe der Plantagen, stellte dann die Baumwollgewinnung ein und begann mit dem Anbau von Kakaobäumen. Baumwolle war nicht mehr lukrativ, denn die Europäer bezogen sie nun aus den Südstaaten Nordamerikas, Kakao hingegen wurde zu einem heiß umworbenen Produkt der Schokoladenindustrie und ein außerordentlich begehrter Exportartikel.
Aber nur, wenn man ihn auch gewinnbringend verkaufte!
Und das konnte Albert Baisanson eben nicht.
»Ich muss diesem Prokuristen auf die Schliche kommen, aber ich habe keine Ahnung, wie.« Nachdem die Gouvernante mit den Kindern in das Hotel gefahren war und die Damen es sich im Kaminzimmer gemütlich machten, hatten sich die Herren nach dem Abendessen in den Rauchsalon zurückgezogen, genossen den Cognac, den Jacobus servieren ließ, und diskutierten, um eine Lösung zu finden.
»Du bist doch ein Banker, du hast doch Verbindungen, wenn einer hier helfen kann, dann bist du das, Jacobus.«
»Mein lieber Albert, ich bin kein Geschäftsmann. Ich verwalte Gelder und ich gebe sie aus, aber ich habe mit Händlern nicht den kleinsten Kontakt. Du hast ja nicht einmal ein Konto auf meiner Bank, ich habe also nicht die geringsten Einsichten in deine Vermögensverhältnisse.«
»Nimmst du mir übel, dass ich mein Konto nicht bei dir habe, mein lieber Jacobus? Mein Vater und mein Großvater haben immer mit dem Berenberg-Bankhaus zusammengearbeitet, ich bin einfach dabei geblieben, das hatte nichts mit dir zu tun.«
»Das weiß ich doch, aber dann solltest du dich auch an diese Banker halten. Sie müssen die genaue Übersicht haben.«
»Sie haben die genaue Übersicht, ich war schon dort, es war mein erster Weg auf Hamburger Boden, nachdem ich meine Frauen ins Hotel begleitet hatte. Aber es war eine Übersicht, die mir die Sprache verschlug. Die Konten sind fast leer.«
»Dann solltest du dir schnellstens einen Advokaten suchen und mit diesem Rechtsbeistand deinen Prokuristen mal unter die Lupe nehmen.«
»Das will ich ja, aber woher nehme ich einen Advokaten, ich kenne hier doch niemanden.«
»Bei der Suche werde ich dir gern behilflich sein. Aber das besprechen wir morgen in meinem Büro. Erzähle mir lieber, wie es euch in Pernambuco so geht.«
»Im Großen und Ganzen geht es uns gut. Nachdem die portugiesische Kolonialherrschaft beendet ist und auch das Militär sich größtenteils zurückgezogen hat, können wir frei und unbehindert arbeiten. Brasilien ist auf dem Wege zum Wachstum und unser Kaiser ist sehr daran interessiert, das Land zu einer Welthandelsmacht zu gestalten.«
»Das hört sich doch vortrefflich an.«
»Ist es auch, wenn nur meine persönlichen Probleme nicht wären.«
»Wir werden sie lösen.«
Die Damen im Kaminzimmer unterhielten sich prächtig. Bei ihnen standen die Mode, die Emanzipation der Frauen, die Bildung und die Erziehung der Kinder im Mittelpunkt des angeregten Gespräches. Feline Baisanson, eine korpulente Dame Mitte der vierzig, war eine couragierte Person und trotz ihres Lebens in der Abgeschiedenheit am Rande des Regenwaldes nahm sie regen Anteil an den Aufgaben der Frauen in der Welt. Sie ließ sich die neuesten Bücher aus Frankreich schicken, sie las französische Zeitungen, auch wenn sie seit Wochen veraltet waren, und sie verfolgte die Bemühungen der europäischen Damen, Zutritt zu Universitäten und gehobenen Berufen zu bekommen, mit großem Interesse.
Zum Leidwesen ihres Mannes interessierte sie sich mehr für den Freiheitsdrang extrovertierter Frauen als für die Veredelung von Kakaobohnen und die Ungezieferbekämpfung rund um das Haus am Regenwald.
Sie war eine gute Hausfrau und führte die Dienstboten mit fester Hand, aber für die beruflichen Belange ihres Mannes hatte sie nie Zeit. Sie korrespondierte mit Frauen in England und Frankreich, nahm kein Blatt vor den Mund, wenn es um die unerträgliche Vorherrschaft der Männer ging, und seit einiger Zeit schrieb sie sogar Zeitungsartikel, die dann in Portugal veröffentlicht wurden.
Albert Baisanson hätte gern eine ruhige, liebevolle, gütige Gattin an seiner Seite gehabt, die seine Sorgen und Freuden und seine sexuellen Bedürfnisse mit ihm teilte, aber zu spät hatte er bemerkt, dass er mit einer Kämpferin verheiratet war, die nun auch begann, ihre Töchter zu selbstbewussten, eigenständigen Persönlichkeiten zu erziehen.
Esther und Feline hatten großen Spaß an ihren Gesprächen. »Weißt du, wenn ich dich so höre, dann muss ich denken, ich führe hier ein Leben weitab von jeder Aufregung«, lachte Esther. »Hier geht alles einen geregelten, oft sogar langweiligen Gang. Man kümmert sich um die neueste Mode, um ein paar Theateraufführungen, um Klatsch und Tratsch in der Gesellschaft, um arme Leute, weil sich das so gehört – und um das Wohl des Ehemannes und das war es dann auch schon.«
»So könnte ich nicht mehr leben. Als Albert mich nach Brasilien holte, ich war damals zwanzig Jahre alt, hat mich das Abenteuer gelockt, das ist längst vorbei. Heute will ich mitreden.«
»Wobei denn?«
»Na, wenn es um die Freiheit der Frauen geht, dafür, dass wir den Mund aufmachen dürfen, wenn die Männer gegen unseren Willen agieren. Du glaubst nicht, wie wichtig das ist.«
»Aber das Schweigen ist bequemer.«
»Wie dumm! Du musst doch deine Ängstlichkeit und deinen Kleinmut bekämpfen.«
»Anders ist es weniger aufregend und nicht so gefährlich, Feline.«
»Aber so ein Leben ist langweilig und inhaltslos. Mich erhalten diese kleinen Kämpfe am Leben.«
»Du führst ein sehr einsames Leben, meine Liebe.«
»Ich würde es ohne meine kleinen Streitereien nicht ertragen. Zum Glück haben wir häufig Gäste und mit ihnen zu disputieren, in aller Höflichkeit natürlich und wie es sich gehört, ist wunderbar. Eine eigene Meinung haben zu dürfen, der ein Gast natürlich nicht zu widersprechen wagt, ist großartig. Diese kleinen Kämpfe sind mein Lebenselixier, sonst hielte ich es dort draußen nicht aus.«
»Und was machst du, wenn du nicht deinem Lebenselixier frönst?«
Feline lächelte. »Ich reite, ich habe eine kleine Pferdezucht aufgebaut. Ich bewache die Wächter der Arbeiter.«
Esther lachte. »Du bewachst die Wächter?«
»Natürlich, einer muss das doch tun. Dort drüben herrschen andere Arbeitsmethoden als hier im zivilisierten Europa. Ich will nicht sagen, dass wir dort drüben nicht eine fabelhafte und funktionierende Zivilisation haben, aber am Rande der Wildnis herrschen andere Bedingungen und andere Bestimmungen, und mit denen muss man fertig werden.«
Von den afrikanischen Sklaven, die auf ihren Pflanzungen die niedrigsten und die schwersten Arbeiten verrichten mussten, erzählte sie nichts.
»Und was machst du, wenn du auf Schwierigkeiten stößt?«
»Ich versuche es mit Gesprächen, und wenn die nicht ausreichen, dann mit Drohungen. Auf einer Plantage kann nur ein Einziger das Sagen haben, und das ist der Arbeitgeber, der Ernährer, der Versorger, und wenn der keine Zeit hat, und die hat Albert nie, dann bin ich seine Vertreterin. Und dann muss ich auf Ordnung achten. Schließlich hängen wir alle von reichen Ernten, von guten Produkten, vom Fleiß und von der Gewissenhaftigkeit aller ab. Das fängt beim kleinsten Schlangenschläger an und hört beim Kakaobohnentrockner auf.«
»Willst du damit sagen, Kinder werden zur Arbeit eingesetzt?«
»Selbstverständlich. Sie sind begeistert, wenn sie auf Schlangenjagd gehen dürfen. Aber keine Sorge, Esther, ich habe eine gute Schule für sie eingerichtet. Wer jemals unsere Plantage verlässt, kann lesen, schreiben und rechnen, wie es sich gehört.«
»Du hast wirklich viel um die Ohren, Feline.«
»Das muss ich auch, sonst verkomme ich in der Einsamkeit.«
»Ich kann dich verstehen. Aber so eine Reise, wie jetzt, die wird dir doch gefallen.«
»Ja und nein. Ich werde den Luxus einer großen Stadt genießen, aber meine Gedanken sind in Brasilien. Wir haben finanzielle Probleme und die werden mit jedem Tag größer, an dem ich nicht die Arbeiter bewache.«
»Finanzielle Probleme?«
»Ja, aber darüber unterhalten sich unsere Männer nebenan. Sie werden eine Lösung finden. Erzähle du jetzt vom Klatsch und Tratsch in dieser Stadt. Hamburg erholt sich langsam vom Großen Brand?«
»Ja, Gott sei Dank.«
Und Esther berichtete von der ersten neuen Eisenbahnstrecke zwischen Hamburg und Bergedorf, die aber bald bis nach Berlin fortgeführt werden sollte und deren Bau auch der englische Ingenieur William Lindley beaufsichtigte, der zurzeit die Kanalisation und die Trinkwasserversorgung einführte. Sie erzählte von dem neuen Thalia Theater mit 1800 Plätzen und sehr sehenswerten Aufführungen, die sie besucht hatte. Sie empfahl den Besuch von Sillem’s Bazar und einen Spaziergang durch die gerade fertiggestellten Alsterarkaden.
»Unsere neue Gasbeleuchtung der Straßen wirst du gleich sehen, wenn ihr ins Hotel fahrt.«
»Na ja«, seufzte Feline, »das alles fehlt mir natürlich in Pernambuco, aber eines kann man nur haben, entweder die Lust auf ein abenteuerliches Leben oder die Eleganz einer Weltstadt.«
»Ach weißt du«, erklärte Esther, »mit der Eleganz ist es gar nicht so weit her. Wir haben viel mehr arme Leute als reiche. Da gibt es ein paar Flaniermeilen mit geschmackvollen Geschäften und viele, viele Gängeviertel, wo die Menschen in armseligen Verhältnissen leben müssen. Und jetzt kommen noch die vielen Auswanderer dazu.«
»Auswanderer?«
»Ja, viele Menschen aus den ärmeren Ländern im Osten und auch viele Deutsche wollen nach Amerika, weil sie hier keine Lebenschancen haben und denken, in Amerika wartet das Paradies auf sie.«
»Na, die werden sich wundern. Die Zeiten mit dem Goldrausch und den Diamantenfunden sind längst Vergangenheit.«
»Sie träumen eben von einem besseren Leben und nun kommen sie hierher, um dann von hier aus die Schiffe zu besteigen. Aber sie überschwemmen die Stadt und sie tragen auch viele Krankheiten hier herein. Früher fuhren sie von Bremen aus, aber jetzt kommen die meisten nach Hamburg.«
Feline lächelte. »Paradiesische Zustände gibt es eben nirgendwo. Man muss sich das Leben so angenehm wie möglich gestalten.«
»Aber du bist eine Kämpfernatur, wie ich nun erfahren habe.«
»Ja, und ich will Erfolge sehen.«
»Und welche Kämpfe stehen jetzt an?«
»Ein Kampf mit meinem Mann. Ich suche eine deutsche Hauslehrerin für meine Töchter, ich will, dass sie europäisch und nicht nur portugiesisch und brasilianisch erzogen werden.«
»Und deshalb kämpfst du mit deinem Mann?« Esther lächelte verhalten, sie wollte die Freundin nicht kompromittieren.
»Na ja, nicht so richtig. Er will die Kinder als echte Brasilianerinnen erziehen, sie sollen sich dort absolut heimisch fühlen und keine Sehnsüchte nach Europa entwickeln.«
»Aber ist das so schlimm, wenn sie sich zu Europa hingezogen fühlen, schließlich seid ihr als Eltern doch französischer Herkunft?«
»Albert will nicht, dass sie sich teilen, halb Brasilien, halb Frankreich, das sei dann weder Fisch noch Fleisch, behauptet er.«
»Also, ich finde das gar nicht schlimm, wenn sie in beiden Erdhälften ihre Wurzeln haben«, Esther dachte an die eingeschränkten Lebensverhältnisse, die ihre Kinder hatten. »Ich wünschte, ich könnte meinen Kindern mehr Freiheiten bieten, aber Jacobus ist so ein eingefleischter Hanseat, für ihn gibt es keine bessere Lebensgrundlage als die in einer Hansestadt.«
»Siehst du, genau so ist es bei uns. Ich will die Freiheit für meine Töchter, er will die Begrenzung. Aber ich gewinne natürlich.«
»Und was willst du machen?«
»Ich engagiere eine deutsche Hauslehrerin, dann können sie gleichzeitig auch noch die deutsche Sprache erlernen und sind eines Tages Weltbürger.«
»Weltbürger, wie sich das anhört!«
»Du, das ist ein Begriff, der bei emanzipierten Frauen schon lange die Runde macht.«
»Und wie willst du hier eine Hauslehrerin finden, die bereit ist, in ein so fernes Land zu reisen?«
»Ehrlich gesagt, Esther, ich hoffe, du hilfst mir bei der Suche. Leicht wird es nicht sein, das weiß ich schon.«
»Für eine junge Hauslehrerin ist so ein Wechsel unter Umständen eine Lebensentscheidung. Wer hat schon das Geld für eine so weite Heimreise, wenn es in der Ferne nicht klappt?«
»Ach, das kann man ja vertraglich regeln. Ich könnte mir denken, dass es auch hier junge Menschen gibt, die gern ein fernes Land kennenlernen möchten.«
»Aber du hast von der Einsamkeit erzählt, die bei euch herrscht. Was kann sie dort kennenlernen?«
»Na ja, das muss man bei der Suche ja nicht gleich verraten. Kennst du vielleicht jemanden?«
»Nein, aber ich könne Laura fragen. Sie ist Maries Lehrerin, vielleicht hat sie eine Freundin, die an so einem Abenteuer interessiert wäre.«
»Ja bitte, frage sie, du würdest mir einen großen Gefallen tun.«
»Gut, versprochen, sie ist morgen wieder bei uns.«
»Danke, Esther, du bist eine wirkliche Freundin.« Sie sah auf die Standuhr in der Ecke. »Es ist Mitternacht, ich glaube, es wird Zeit, dass wir unsere Ehemänner von ihren Gesprächen erlösen. Bei dem guten Cognac fällt ihnen das sicher schwer. Morgen ist auch noch ein Tag, und bis zum Dänischen Hof in Altona ist es ein weiter Weg.«
»Warum seid ihr in Altona abgestiegen?«
»Der Klipper hat im Altonaer Hafen angelegt, es war der kürzeste Weg in ein Hotel und wir waren die engen Kabinen auf dem ständig schwankenden Schiff leid. Weißt du, so eine lange Reise ist wirklich kein Vergnügen.«
»Das glaube ich dir gern Ich werde den Kutscher bestellen und dann holen wir die Herren aus ihrem verrauchten Salon.«
4
»Verdammt noch mal, warum passt diese dämliche Takelage nicht.«
Mikael Lundborg zerrte an der Persenning, dass die Nähte zu platzen drohten.
»Hör auf mit dem Gezerre, du machst alles nur noch schlimmer. Wenn so ein Segel nicht passt, kannst du es mit Gewalt auch nicht ändern.«
»Aber wir haben die genauen Größen angegeben, der Spinner hat uns glatt betrogen.«
»Rede keinen Quatsch, wir haben die genauen Größen selbst nicht gewusst.«
»Wir haben’s Segel am Kai ausgelegt und abgemessen.«
»Ja, mit Schritten, aber wie du siehst, reicht das nicht. Wir hätten uns eine Messlatte leihen müssen.«
»Blödsinn. Mein Schritt ist genau einen Meter lang, das musste genügen.«
»Du mit deinen langen Beinen, wenn du was abmisst, machst du noch längere Schritte als gewöhnlich.«
Mikael Lundborg setzte sich auf das Kombüsendach und schob die Schiffermütze aus der Stirn. »Seit einer Woche hängen wir jetzt in diesem wintergrauen Hamburg herum und ich wollte so schnell wie möglich in die indische Sonne. Verdammt noch mal, und unser Schiffer treibt sich an Land umher und lässt uns hier sitzen.«
»Er hat uns eine Aufgabe gegeben und die haben wir vermasselt, und deshalb sitzen wir hier fest.« Max hatte keine Lust, sich das Geschimpfe von diesem reiseverrückten Schweden länger anzuhören. »Ich geh jetzt in die Koje, heute passiert nichts mehr.«
»Wasch dich vorher, sonst schmeiße ich dich raus.«
»Du hast mir gar nichts zu sagen. Du bist hier nur der Junge für die Drecksarbeiten, mach nicht so einen Lärm, wenn du kommst.«
»Ich mache, was ich will, und wenn’s stinkt, fliegst du raus.«
Mikael Lundborg starrte auf die anderen Schiffe. Zahllose Masen dümpelten im Hafenbecken am Baumwall. Einige wurden gerade beladen, andere entladen. Überall herrschte Hektik und fremdländisches Leben. Die Matrosen verständigten sich in den unterschiedlichsten Sprachen, genauso unterschiedlich wie die Hautfarben, die sie trugen.
Wenn das hier nicht bald weitergeht, fahre ich mit einem anderen Frachter, dachte Mikael. Ich bin doch nicht vom winterlichen Schweden gestartet, um hier festzuliegen. Ich will in die Sonne, ich will die Welt kennenlernen, Abenteuer erleben, egal wo. Fragt sich nur, wer mich mitnimmt. Ohne Geld ist das so eine Sache mit den Abenteuern. Der Kapitän hier war einverstanden, dass ich die Reise abarbeite, weil er auch ein Schwede ist, aber die meisten Frachter haben ihre Schiffsjungen für die Drecksarbeit längst an Bord. Hier hatte ich gerade Glück, weil der Bursche abgehauen war. Und jetzt dieses Desaster mit der zerrissenen Takelage. Wenn die neu hergestellt werden muss, kann das Wochen dauern, bis es weitergeht. Aber wenn der Käptn morgen wieder an Land herumlungert, schleiche ich mich weg und hör mich mal auf den anderen Frachtern um. Zum Schaden kann’s nicht sein, wenn ich mich anbiete.
Mikael Lundborg war ein gewiefter junger Mann. Mit achtzehn hatte er die Schule beendet, in der moderne Sprachen die Hauptfächer waren. Dann hatte er, um festzustellen, was er überhaupt einmal machen wollte, ein halbes Jahr in einem Advokatenbüro gearbeitet, um etwas über die Jurisprudenz zu erfahren, danach ein paar Monate in einem Zollbüro, um den Im- und Export zu studieren und seine Fremdsprachenkenntnisse zu vervollständigen. Zum Schluss war er in einem Geschäft für Schiffsausrüster tätig. Da war ihm die Idee gekommen, sich erst einmal auf der weiten Welt umzusehen, bevor er sich für eine Arbeit entschied. Und nun war er mit einundzwanzig Jahren aufgebrochen, um diese Welt tatsächlich kennenzulernen. Aber seine Reise sollte nicht schon am Hamburger Hafen enden.
Seine Eltern hatten ihn für verrückt erklärt, und sein Vater, ein Erzhändler aus dem hohen Norden, der ihn eigentlich in seinem Geschäft einstellen wollte, hatte sich geweigert, auch nur eine einzige Krone für seine Spinnereien, wie er es nannte, auszugeben. Also wanderte Mikael nach Stockholm, ergatterte eine Stelle als Schiffsjunge auf einem Frachter nach Indien und war in Hamburg gelandet. Er rutschte vom Kombüsendach und suchte die stickige Doppelkoje auf, die er mit diesem Max aus Uppsala teilen musste.
Am nächsten Morgen, die Wolken hingen tief herunter bis zu den Mastspitzen und eisige Hagelschauer hüllten Land und Wasser in graue Schleier, machte sich Mikael Lundborg auf die Suche nach einem startbereiten Schiff. Er schlenderte vom Binnenhafen über die Alstermündung hinweg zum Niederhafen und weiter bis zum Inneren Jonas Hafen. Die Frachter und Skipper, die Fregatten und Vollschiffe, die Barken und Ewer dümpelten eng beieinander in dem aufgerauten Elbewasser, als suchten sie gegenseitigen Schutz vor dem Winterwetter.
Mikael hatte den Kragen seiner Lammfelljacke bis über die Ohren hochgezogen und versuchte, Kinn und Nase ebenfalls mit der Wolle zu schützen. Am Inneren Jonas Hafen herrschte emsiger Passagierbetrieb. Hier lagen ein paar Skipper, die anscheinend Überseereisende erwarteten. Mikael beobachtete das Hin und Her eine Weile, dann ging er über die Gangway auf das Schiff, das dem Kai am nächsten lag. An Bord wurde er von einem Matrosen angebrüllt. »Runter, hier gibt’s nichts zu sehen.«
»Ich will ja bloß was fragen.«
»Dann frag mich.«
»Ich such ’ne Stelle auf einem Überseeklipper.«
»Was kannste denn?«
»Ich mach alles, und ich mach’s umsonst.«
»Kannste melken?«
»Was?«
»Melken.«
»Machst du Quatsch?«
»Nee, aber wir haben Ziegen an Bord, die müssen gemolken werden. Und Hühnerställe und Karnickelställe, die müssen gereinigt werden. Na, solche Sachen eben.«
»So ein Viehzeug habt ihr an Bord?«
»Wir sind wochenlang unterwegs und wir haben Passagiere, die frische Lebensmittel brauchen. Wir sind sehr fortschrittlich, wir nehmen das lebende Vieh gleich mit.«
»Eine Arche Noah?«
»Kannste so sagen.«
»Also, melken kann ich nicht, aber ich kann’s lernen.«
»Dann kannste mit dem Smutje reden, komm mit.«
Der Matrose brachte Mikael in die Kombüse, wo der Schiffskoch an einem kleinen Tisch saß und eine Warenliste zusammenstellte.
»Smutje«, meldete sich der Matrose zurückhaltend von der Tür aus, »ich hätte da jemanden fürs Vieh.«
Der hagere Mann, der so gar nicht nach einem Koch aussah, richtete sich langsam auf und sah zur Tür herüber. »Wen haste da?«
»Einen Jungen fürs Vieh. Und das Melken kann er lernen, hat er gesagt.«
»Hol ihn rein.«
Mikael zwängte sich an dem Matrosen vorbei, der ihm einen Knuff in die Hüfte versetzte und grinsend zur Seite ging. »Hallo, ich bin Mikael Lundborg und ich würde mich gern um Ihr Vieh kümmern.«
»Was machste sonst und was willste dafür?«
»Ich bin Schiffsjunge, aber unser Viermaster hat Probleme und ich will nicht den ganzen Winter in Hamburg verbringen. Wohin fahren Sie denn?«
»Nach Chile, ist ’ne weite Tour.«
»Würde ich gern mitmachen. Die Reise arbeite ich ab.«
»Darüber können wir reden. Verstehste sonst was vom Vieh?«
»Klar, wir hatten immer Vieh auf dem Hof«, log er unbekümmert, »nur ums Melken musste ich mich nie kümmern.«
»Dann kannste anfangen.« Er besah den jungen Mann, der da ohne Seesack in der Tür stand. »Hol deine Sachen, der Matrose zeigt dir die Koje, wir fahren in zwei Tagen. Bis dahin kannste dich ans Vieh gewöhnen und das Melken musste sofort lernen, ich habe keine Zeit mehr dazu.«
»Sie können es mir gleich zeigen, ich hole meinen Sack später.«
»Dann komm mit.« Der Smutje stand seufzend auf, er war viel zu groß für die kleine Kombüse und musste gebückt darin stehen. »Wenn wir ablegen, arbeite ich in der großen Kombüse, aber hier für den Hafen und die Besatzung reicht die kleine«, erklärte er und ging vor Mikael durch den Rumpf zur hinteren Treppe und dann hinauf auf das Achterdeck. Vor dem Ruderhaus erstreckte sich ein langer, abgedeckter Verschlag, in dem gackernde Hühner den Graupelschauern trotzten. Auf der Rückseite des Verschlages waren die Kaninchen in kleinen Ställen untergebracht. Vor der Nässe von oben wurden die Tiere mit leeren Jutesäcken geschützt. Hinter dem Ruderhaus befand sich der Ziegenstall, ein Verschlag, in dem sechs Tiere angebunden waren. Über dem Verschlag, nur durch einige Bretter geschützt, lagerten die Futtervorräte und zahlreiche Strohbunde.
»Du musst täglich alle Ställe sauber halten, sonst stinkt’s und die Passagiere ekeln sich und wollen hier nicht sitzen.«
»Und der Mist?«
»Geht über Bord.«
»Und wie komme ich ran an die Hühnerställe?«
»Oben sind Deckel, die kannst du hochklappen. Und dann musst du auch gleich die Eier mit einsammeln. Aber pass auf, dass dir die Hühner nicht rausfliegen, die sind verdammt schnell.«
»Ich pass auf.«
»Dann komm mit zum Melken.«