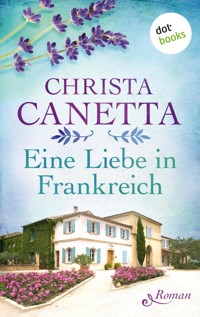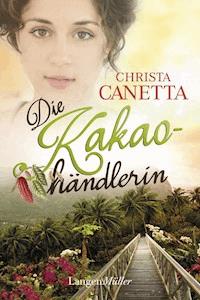Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn das Schicksal Amor spielt … Der romantische Roman »Schottische Engel« von Bestseller-Autorin Christa Canetta jetzt als eBook bei dotbooks. Eine dramatische Rettung in letzter Sekunde, die zwei Leben verändern wird … David McClay, Lord eines schottischen Adelsgeschlechts, wird auf dem Weg zu seinem Landsitz in einen Unfall verwickelt. Im letzten Moment kann er die schöne Mary Ashton vor dem Ertrinken bewahren – und bietet ihr an, sich im idyllischen »Lone House« von ihren Schock zu erholen. Doch Mary muss an einer Auktion teilnehmen, denn sonst verliert sie ihren Traumjob im Kunstmuseum von Edinburgh! David will sie vertreten – und kehrt mir leeren Händen zurück: ein unbekannter Bieter hat sich die Engelsskulptur gesichert, die einst Maria Stuart gehörte. Ist damit jede Hoffnung verloren? David beschließt, Mary zu helfen, zumal er sich von Tag zu Tag mehr zu ihr hingezogen fühlt. Aber es gibt noch einen anderen Mann, der Mary erobern will, und zu allem bereit ist, um sie für sich zu gewinnen … Große Gefühle in den schottischen Highlands – eine traumhafte Liebesgeschichte! Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das Romantik-Highlight »Schottische Engel« von Bestseller-Autorin Christa Canetta. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Bei einem Unfall am St. Mary's Loch in Schottland kreuzen sich zum ersten Mal die Wege von David McClay und Mary Ashton. David McClay, Lord of the Border-Hills und auf dem Weg in sein Landhaus, kann den Zusammenstoß nicht vermeiden, und so stürzt Marys Wagen in den See. McClay kann die Bewusstlose in letzter Sekunde vor dem Ertrinken retten.
Da die Beschaffung eines marmornen Engels für die Antiquitätenexpertin Mary karriereentscheidend ist, fährt der Lord am nächsten Tag an ihrer Stelle nach Dumfries zur Auktion, um den Engel zu ersteigern. Doch der Engel wird nicht mehr angeboten: Er ist bereits verkauft worden. Verliert Mary jetzt ihre Arbeit im Museum, und wird der unglückselige Unfall Mary und David für immer entzweien, bevor sie sich überhaupt näher kennen gelernt haben?
Leidenschaftliche Augenblicke und große Gefühle: Die schottischen Highlands als Kulisse einer traumhaften Liebesgeschichte!
Über die Autorin:
Christa Canetta ist das Pseudonym von Christa Kanitz. Sie studierte Psychologie und lebte zeitweilig in der Schweiz und Italien, arbeitete als Journalistin für den Südwestfunk und bei den Lübecker Nachrichten, bis sie sich schließlich in Hamburg niederließ. Seit 2001 schreibt sie historische und Liebesromane.
Von Christa Canetta erschienen bei dotbooks bereits „Das Leuchten der schottischen Wälder“ und „Schottische Disteln“.
***
Neuausgabe Juni 2013
Copyright © der Originalausgabe 2007 Moments in der area verlag gmbh, Erftstadt
Copyright © der Neuausgabe 2013 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de
ISBN 978-3-95520-273-6
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Schottische Engel an: [email protected]
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
www.gplus.to/dotbooks
Christa Canetta
Schottische Engel
Roman
dotbooks.
I
Vom scharfen Ostwind gejagt, fuhr Mary Ashton viel zu schnell das Moffat Water Valley entlang. Im Rückspiegel sah sie die schwarze Wolkenwand, die sich über dem Ettrick Forest drohend aufbaute. Hin und wieder zuckte ein Blitz durch die Wolken, aber ein Donner war nicht zu hören. Dieses erste Frühlingsgewitter über den Uplands war noch zu weit entfernt, und der Fahrtwind verschluckte sowieso jedes Geräusch.
›Hoffentlich erreiche ich Tibbie Shiels Inn, bevor das Unwetter mich einholt‹, dachte Mary und gab Gas. Aber die Landstraße war feucht und unübersichtlich. Und immer wieder gab es kleine Abzweigungen zu Gehöften, die vorsichtiges Fahren erforderten. ›Aber morgen Nachmittag muss ich in Dumfries sein, sonst beginnt die Auktion ohne mich. Dann bin ich nicht nur einen wichtigen Auftrag los, sondern gelte als unzuverlässig und leichtfertig.‹
Sie sah wieder in den Rückspiegel. Seit zehn Minuten folgte ihr ein schnittiger Maserati. Schon zweimal hatte der Fahrer versucht, sie zu überholen, aber die vielen kleinen Biegungen vereitelten das Manöver. »Ich würde dir ja Platz machen, wenn ich eine Lücke fände, aber mein Tempo und das Unwetter im Nacken verhindern so viel Höflichkeit«, sagte sie leise und gab wieder Gas.
Wie schön es hier war. Sie warf hin und wieder einen Blick auf die schroffen Felsen rechts neben der Straße, die dann wieder von hügeligen Wiesen abgelöst wurden, die mit gelb blühenden Frühlingsprimeln bedeckt waren. Im Hintergrund präsentierten sich die über 600 Meter hohen Berge, und links führte der Yarrow River das Schmelzwasser der Berge dem Meer entgegen.
Der Maserati kam wieder einmal bedrohlich nahe. »Wenn ich plötzlich bremsen muss, sitzt du mir im Kofferraum, und ich lande im Fluss«, schimpfte sie jetzt laut und schaute in den Rückspiegel. ›Zum Glück ist er höflich genug, nicht zu hupen und zu blinken‹, überlegte sie und suchte noch einmal nach einer Möglichkeit auszuweichen. Aber die Straße war zu schmal, und dann setzte der Regen ein. Im gleichen Augenblick war Mary von einer grauen Wasserwand umhüllt. Sie nahm den Fuß vom Gaspedal und schaltete alle verfügbaren Scheinwerfer und Rücklichter ein. Auch der Maserati war im Regendunst verschwunden. »Jetzt könntest du gern vor mir fahren, damit ich mich an deinen Bremsleuchten orientieren kann«, flüsterte sie und versuchte, das graue Asphaltband der Straße nicht aus den Augen zu verlieren.
Draußen war es kalt geworden. Mary begann zu frieren und schaltete die Heizung ein. Sofort beschlugen die Fenster, und sie musste den Ventilator anstellen. Als das nichts half, drehte sie die Heizung wieder ab. »Verflixt«, schimpfte sie, »und von Tibbie Shiels Inn ist immer noch nichts zu sehen.«
Als sie für einen kurzen Augenblick den Fluss neben sich sah, stellte sie fest, dass sein gegenüberliegendes Ufer verschwunden war. ›Dann hab ich St. Mary's Loch erreicht, dann ist es nicht mehr weit‹, dachte sie zufrieden und konzentrierte sich wieder auf die Straße. Im gleichen Augenblick kreuzte ein Schatten ihren Weg. Mary bremste mit aller Kraft. Und dann stieß mit einem ohrenbetäubenden Krachen der Maserati hinten in ihren Landrover. Mary, vom Sicherheitsgurt gehalten und vom Airbag vorn aufgefangen, schlug mit dem Kopf gegen die Seitenscheibe und wurde ohnmächtig. Dass ihr Wagen seitlich die Böschung zum See hinabrutschte, spürte sie nicht mehr.
Die Hinterräder hatten bereits den schlammigen Uferrand erreicht und wurden vom Wasser umspült, als die Tür aufgerissen wurde und ein Mann versuchte, Marys Sicherheitsgurt zu lösen und die bewusstlose Frau aus ihrem Wagen zu zerren. Er selbst stand bereits bis zu den Hüften im Wasser, als er sie endlich freibekam und auf den schmalen Uferstreifen des Sees legen konnte. Sie blutete aus einer Wunde über der linken Schläfe, und er wagte nicht, sie durch das Tätscheln der Wangen aus der Ohnmacht zu wecken. So griff er zum Handy, wählte die Notrufnummer der Polizeistation von Tibbie Shiels Inn und schilderte die Situation, während der Landrover bis zum Dach im Uferschlamm versank. Dann lief er zurück zu seinem Wagen und holte eine Decke und seinen Regenmantel, um die durchnässte Frau vor dem prasselnden Regen zu schützen und den Kopf auf eine weiche Unterlage zu betten. Danach erst konzentrierte er sich auf den Anlass dieses halsbrecherischen Bremsmanövers und kontrollierte die Straße. Rechts im Graben lag ein Kinderfahrrad. Von einem Kind aber fand sich weit und breit keine Spur. Da das Rad keine Schäden aufwies, konnte die Frau mit ihrem Wagen das Kind auch nicht gestreift haben.
Nach unendlich erscheinenden Minuten des Wartens hörte McClay weit entfernt die Sirene des Polizeiwagens. Er wartete am Straßenrand, bis der Kombi neben ihm hielt. Zwei Sanitäter stiegen aus und eilten mit einer Trage zum See hinunter. Der Polizeimeister begrüßte den Mann am Straßenrand: »Sorry, Mister McClay, schneller ging es nicht. Ich musste erst die Sanitäter abholen. Wir sind ja nur eine kleine Station, wie Sie wissen. Was ist eigentlich passiert?«
»Ich habe den Wagen vor mir gerammt. Er bremste plötzlich, und die Sicht war gleich null. Da vorn im Graben liegt ein Fahrrad. Ich nehme an, ein Kind hat die Straße gekreuzt, und die Frau hat es im letzten Augenblick gesehen.«
»Man erkennt wirklich nichts bei dem Regen.« Der Polizist stieg zum See hinunter und sprach mit den Sanitätern. »Was ist mit ihr?«
»Eine Wunde am Kopf, eine Gehirnerschütterung vermutlich, sie ist noch bewusstlos, aber der Herzschlag ist stabil. Wir versorgen die Wunde provisorisch. Wenn sie zu sich kommt, wird sie höllische Kopfschmerzen haben. Aber was machen wir mit ihr? Sollen wir sie bis nach Moffat in die Klinik bringen oder nur zum Doc beim ›Rodono Hotel‹?«
»Erst mal zum Doc, dann sehen wir weiter.«
Die Sanitäter zeigten auf den Geländewagen. »Was ist mit dem? Wenn das Wasser bei dem Regen steigt, wird er fortgespült.«
»Ich rufe die Werkstatt an, die müssen ihn so schnell wie möglich rausholen.«
David McClay war wieder zum See heruntergekommen. »Wenn Sie alles notiert haben«, wandte er sich an den Polizisten, »sorge ich für den Abtransport. Und die Dame kann bei mir wohnen, bis sie sich erholt hat. Ich bitte den Doc, zum ›Lone House‹ zu kommen.«
»Gut, dann bestellen Sie ihn in Ihr Haus. Was ist mit Ihrem Wagen?«
»Ich habe eine exzellente Stoßstange, die hat kaum einen Kratzer abbekommen.«
»Dann fahren Sie schon einmal vor, ich muss mich noch um das Kind kümmern. Haben Sie eine Ahnung, um wen es sich handeln könnte? Viele Kinder leben in dieser Gegend doch gar nicht.«
»Bei meinen Angestellten gibt es ein Mädchen, könnte sein, dass sie auf dem Heimweg von der Schule war, bei dem Wolkenbruch die Autos nicht gesehen hat und dann vor Schrecken davongelaufen ist.«
Die Sanitäter trugen Mary Ashton hinauf zum Straßenrand und betteten sie vorsichtig auf den schmalen Rücksitz des Maserati. Einer blieb neben ihr sitzen, der andere ging zum Polizeiwagen.
»Wir suchen noch die Gegend ab, um sicher zu sein, dass hier kein Kind mehr ist«, rief Kommissar Paul Shipton und ging hinüber zur Straßenseite, wo das Rad lag. Als sie oberhalb der Böschung einen Feldweg fanden, der zum Park von ›Lone House‹, dem Anwesen von Lord McClay führte, und gleich darauf einen Schulranzen entdeckten, wussten sie, dass hier ein Kind fortgelaufen war.
»Fahren wir rüber zum Schloss«, erklärte Shipton, »die Meilen zu Fuß können wir uns sparen.«
Als sie zur Straße zurückkamen, war McClay gestartet und im Regendunst verschwunden. Shipton legte das Kinderfahrrad und den Ranzen auf den Rücksitz und folgte ihm.
Bevor die ersten Häuser von Tibbie Shiels Inn auftauchten, ging es rechts ab zum ›Lone House‹. Das Schloss machte seinem Namen alle Ehre. Es lag einsam und versteckt in einem Seitental zwischen Dryhope und Cappercleuch und war für Fremde fast unauffindbar. Kein Hinweisschild, kein Zufahrtstor deuteten auf die Nähe des Schlosses. Die Generationen der McClays, die hier seit dem 16. Jahrhundert ihr Domizil hatten, liebten die Abgeschiedenheit, die Ruhe, die einzigartige Lage am Fuß der Berge, und David McClay, der Letzte der Familie, hatte nicht die Absicht, daran irgendetwas zu ändern. Im Gegensatz zu anderen Schlössern dieser Gegend war es nicht im wuchtigen Tudorstil gebaut, sondern besaß die Schlichtheit eines zweigeschossigen schottischen Landhauses. Es gab zwar Anbauten, je nachdem wie groß die Familie gerade war, aber Prunk und Masse waren nie ein Maßstab gewesen.
David McClay liebte sein Zuhause. Hier hatte er seine Wurzeln, hier war er aufgewachsen. ›Lone House‹ war sein ruhender Pol. Glasgow, London, Los Angeles, Paris und Tokio waren die Orte der Arbeit, der Hektik, der Rastlosigkeit.
Dass er heute nicht auf kürzestem Wege über die Autobahn gefahren war, lag an Produktionsgesprächen in Galashiels, die er persönlich leiten musste. Umso mehr hatte es ihn gedrängt, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Aber dann hatte er den Landrover vor sich gehabt, dessen Fahrer, anscheinend fremd in dieser Gegend, mehr als vorsichtig unterwegs war. ›Ich bin zwar ein höflicher Mensch, aber ein bisschen schneller hätte sie schon fahren können‹, dachte er auf dem schmalen Schotterweg, der über die letzten Meilen nach ›Lone House‹ führte. Er warf einen Blick in den Rückspiegel. Der Sanitäter sprach leise mit der Fahrerin. ›Anscheinend ist sie wieder bei Bewusstsein. Trotz der blutverschmierten Gesichtshälfte und dem Kopfverband eine gut aussehende Frau‹, dachte er. ›Hoffentlich behält sie keine bleibende Narbe.‹ Der Sanitäter nickte ihm zu, als wollte er sagen: Ist nicht so schlimm, wird schon wieder!
Die Männer von Tibbie Shiels Inn kannten den Lord. Trotz seiner überragenden Persönlichkeit war er hier ein allseits beliebter Mann, weil er nie den Lord hervorkehrte, sondern immer nur den Nachbarn und Arbeitgeber, denn die meisten der wenigen Einwohner des kleinen Orts waren bei ihm beschäftigt – im Schloss, in der Landwirtschaft und vor allem im Wald. Manchmal kam er täglich nach ›Lone House‹, dann wieder dauerte es Wochen oder Monate, bis er sein Heim aufsuchte. Die Arbeit bestimmte sein Leben, und die Erfolge der von ihm produzierten Filme bestimmten seinen Aufenthaltsort.
McClay war mit seinen achtundvierzig Jahren weltweit einer der besten Produzenten historischer Filme. Eine Koryphäe mit großem Ansehen, meldeten die Medien, ein schwieriger, ehrgeiziger, unruhiger Mensch, flüsterten die Mitarbeiter am Set. Ein hinreißender, faszinierender Mann, tuschelten die Frauen, und enttäuschte Mädchen schimpften: ein hochmütiger, arroganter Angeber. Fachleute behaupteten: McClay ist der Beste, er ist genial und nicht zu übertreffen, und Neider erklärten ganz unbeeindruckt: Er ist ein rücksichtsloser Egoist. Nur was er wirklich war, wusste keiner: David McClay war ein einsamer Mensch, deshalb fühlte er sich in ›Lone House‹ so wohl.
Er sah wieder in den Rückspiegel, und als sich seine Augen mit denen des Sanitäters trafen, lächelte er ihm zu. Er wusste, was die Leute von ihm dachten – es war ihm gleichgültig. ›Ruhm‹, dachte er, ›ein großes Wort!‹ Hatte er seinen Höhepunkt schon erreicht?
Die Produktion in Galashiels war fast abgeschlossen, erste Kritiker sprachen in höchsten Tönen von dem neuen Film über die römischen Truppen auf den Britischen Inseln, obwohl die Cutter kaum mit der Arbeit begonnen hatten.
McClay liebte seine Arbeit, obwohl sie so aufreibend war. Sie hetzte ihn von Termin zu Termin, jagte ihn durch die ganze Welt, versuchte, seine Gesundheit zu rauben und die Persönlichkeit zu fressen; aber sie machte ihn reich – auch an Geld, und das brauchte er für ›Lone House‹, ›mein geliebtes Fass ohne Boden‹, dachte er lächelnd und zufrieden. Nein, die Arbeit machte ihn vor allem reich an Erfahrungen, an Wissen und an Menschen. An solchen, die ihn liebten, und an solchen, die ihn hassten – Ruhm? So war Ruhm!
McClay war müde. Es war wieder ein langer, ein aufreibender Tag gewesen und dann dieser vermaledeite, unnötige Unfall. ›Warum bin ich auch so schnell gefahren?‹, dachte er und sah endlich durch die Bäume hindurch die Lichter von ›Lone House‹. Er bog in die lange Allee ein, die vom Schotterweg zum Rondell vor dem Herrenhaus führte, und wischte sich mit der Hand über das Gesicht, als könne er die Erschöpfung fortstreichen. Er fuhr durch das Spalier grauer Bäume, die wie Kulissen im Scheinwerferlicht auftauchten und sogleich wieder im Regendunst versanken. Als er vor dem Portal hielt, wurde die Tür sofort geöffnet. Hanna und der Butler kamen gleichzeitig heraus. Hinter ihnen knickste ein Zimmermädchen. Man erwartete ihn schon seit einer Stunde, denn McClay hatte von Galashiels aus sein Kommen angekündigt, und normalerweise brauchte er nur die Hälfte der Zeit, die er heute unterwegs gewesen war. Ein Hausdiener öffnete die Wagentüren, um das Gepäck zu holen, und sah dann bestürzt zu, als McClay dem Sanitäter und einer unbekannten Frau aus dem Wagen half.
»Es gab einen Verkehrsunfall hier in der Nähe, ich habe die Lady mitgebracht. Bitte führen Sie sie in das Gartenzimmer. Hanna, Sie kümmern sich um sie, ich muss den Arzt anrufen.«
»Ja, Sir, aber Sie brauchen auch trockene Kleidung. Sie sind ja ganz nass.«
»Ich habe mich für kurze Zeit im St. Mary's Loch aufgehalten, ich komme allein zurecht. Kümmern Sie sich um die Lady.«
Hanna führte die Verletzte und den Sanitäter in das Gartenzimmer und rückte Sessel und Sofa so zurecht, dass die fremde Frau bequem Platz nehmen konnte.
»Wo bin ich hier eigentlich, und was ist passiert?« Mary Ashton, noch immer benommen, befühlte ihren Kopf. »Ein Verband?« Fragend sah sie den Sanitäter an.
»Sie hatten einen Unfall, Madam, Sie sind mit dem Kopf an die Tür Ihres Wagens geknallt. Und dann ist der Wagen ins Wasser gerutscht, und der Lord hat Sie rausgeholt, im letzten Augenblick, sozusagen.«
»Welcher Lord? Und welches Wasser? Mein Gott, mein Kopf dröhnt, ich kann gar nicht klar denken.«
»Lord McClay hat Ihren Wagen gerammt, dabei sind Sie von der Straße abgekommen, und nun sind Sie in seinem Schloss.«
»War er der Drängler? Ich erinnere mich. Ein Auto wollte mich mehrmals überholen, aber ich konnte nicht ausweichen, die Straße war zu schmal.«
Hanna, der es nicht gefiel, dass ihr Herr mehr oder weniger beschuldigt wurde und man ihn als Drängler hinstellte, unterbrach das Gespräch. »Gnädige Frau, ich lasse jetzt einen Tee für Sie kommen, der wird Ihnen guttun. Oder möchten Sie sich lieber hinlegen?« Sie klingelte und befahl dem Mädchen: »Helen, bitte Tee für die Gäste.«
»Nein, danke, ich möchte nicht liegen, ich glaube, dann dreht sich alles. Wie ist es denn zu dem Unfall gekommen? Ich erinnere mich nur an Regen und beschlagene Scheiben.«
Der Sanitäter schüttelte den Kopf. »Genau weiß ich es auch nicht, wir sind ja erst später dazugekommen. Aber ich glaube, ein Kind ist vor Ihr Auto gefahren, und da mussten Sie scharf bremsen.«
»Ein Kind, um Gottes willen, ist ihm etwas passiert?«
»Nein, aber wir fanden das Fahrrad und einen Schulranzen, es ist weggelaufen. Ihm ist also nichts passiert.«
»Und mein Auto? Was ist mit meinem Auto? Und mit meinem Gepäck? Meine Tasche, meine Papiere, wo sind denn meine Sachen?«
»Bitte, Madam, regen Sie sich nicht auf. Der Lord lässt den Wagen aus dem Wasser ziehen. Die Männer sind bestimmt gerade dabei. Dann kriegen Sie alles wieder.«
»Ich fasse es nicht. Alles im Wasser?«
»Ja, und Sie waren auch mittendrin. Als der Lord Sie rausholte, stand er schon bis zur Hüfte im Wasser und bekam Ihre Autotür kaum noch auf.«
Mary Ashton schloss die Augen, alles drehte sich vor ihr, und sie klammerte sich an die Lehnen ihres Sessels. Hanna trat zu ihr. »Ist Ihnen nicht gut, Madam?« Draußen in der Halle hörte man Männerstimmen. »Der Doktor ist gekommen, Madam, gleich geht es Ihnen besser«, tröstete Hanna. Dann ging die Tür auf, und der Lord trat mit einem Fremden ein.
»Ich lasse Sie hier allein«, erklärte David McClay dem Arzt. »Hanna, richten Sie bitte eines der Gästezimmer Die Lady wird hier übernachten müssen.«
»Selbstverständlich, Sir.«
Der Doktor stellte sich vor. »Ich bin Doktor Grantino, wie geht es Ihnen?«
»Mir ist schwindelig, es kommt mir vor, als drehe sich der Sessel mit mir kopfüber.«
»Sie haben eine heftige Gehirnerschütterung mit einer Drehschwindelattacke. Das geht vorbei, kann aber ein paar Stunden andauern. Außerdem haben Sie ein Schleudertrauma. Sie müssen sich jetzt hinlegen, aber den Kopf dabei erhöhen. Versuchen Sie, die Augen offenzuhalten und auf einen festen Punkt im Zimmer zu heften, dann haben Sie einen kleinen Halt.« Er untersuchte den Kopf und die Augen mit einer Speziallampe, klammerte die Wunde, erneuerte den Verband und legte ihr eine Nackenstütze um.
»Doktor, ich muss dringend nach Dumfries.«
»Daran ist gar nicht zu denken. Sie müssen sich in den nächsten Tagen ganz ruhig verhalten. Ihr Gehirn und Ihr Genick haben einen gewaltigen Schlag abbekommen, da muss erst einmal alles zur Ruhe kommen. Rechnen Sie mit mindestens acht Tagen, vorher übernehme ich keine Verantwortung für Ihre Genesung.«
Erschöpft lehnte sich Mary zurück. »Das kostet mich meine Stellung und damit auch meine Existenz«, stöhnte sie und war den Tränen nahe.
»Nicht aufregen, Madam. Das tut Ihnen nicht gut. Was nützt Ihnen Ihre Existenz, wenn Sie dann nicht mehr leben?«, versuchte er zu scherzen.
»Es war der erste richtig große Auftrag für mich.«
»Andere werden folgen.«
An der Tür klopfte es, dann kam Hanna herein. »Ich habe das Zimmer für die gnädige Frau fertig, Doktor Grantino.«
Der Arzt wandte sich an Mary. »Können Sie ein paar Schritte gehen, wenn wir Sie stützen?«
»Ist nicht nötig, Herr Doktor. Wir haben einen Stuhl mit Rollen und einen Lift. Den hat sich Lord McClay einbauen lassen, als er die Schusswunde am Bein hatte.«
»Na, wunderbar. Und wo ist der Stuhl?«
»Hier, ich habe ihn gleich mitgebracht. Er gehörte der gnädigen Frau, der Mutter von Lord McClay, bevor er ihn selbst brauchte.«
Grantino musste sich ein Lachen verbeißen, als Hanna den altmodischen Regencystuhl mit den vier kleinen Rollen an den kunstvoll gedrechselten Beinen sah. »Nun ja, er wird genügen. Kommen Sie, Madam, wir helfen Ihnen beim Umzug.« Er winkte den Sanitäter herbei, und gemeinsam halfen sie Mary Ashton in den Stuhl. Sie krampfte sich sofort an den Lehnen fest. »Alles dreht sich«, stöhnte sie und ließ sich vom Arzt, vom Sanitäter und von Hanna in den Lift und oben in ein Gästezimmer schieben.
Als die beiden Männer den Raum verlassen hatten, half ihr Hanna beim Auskleiden. Ein leichter Schüttelfrost ließ Mary zittern, und Hanna beeilte sich, die Verletzte ins Bett zu bringen. »Ich habe nicht einmal einen Pyjama dabei«, stöhnte Mary und ließ sich ein elegantes Nachthemd überstreifen.
»Machen Sie sich keine Sorgen, so etwas haben wir immer parat«, tröstete Hanna, »und alles andere auch: Seifen, Zahnbürsten – na, eben alles, was ein Gast so braucht.«
»Was wird denn bloß aus meinem Auto?«
»Die Werkstatt hat es schon aus dem Wasser geholt. Die Männer bringen Ihr Gepäck zum Trocknen her, und dann reparieren sie das Auto. Das hab' ich gehört, als der gnädige Herr telefonierte. Morgen ist alles wieder in Ordnung«, tröstete Hanna ihre Patientin.
»Danke, hoffentlich erkennen die Behörden auch meine aufgeweichten Papiere und die Bank meine nassen Kreditkarten an.«
»Da machen Sie sich keine Sorgen. Der Herr kümmert sich um alles. Wenn er die Schuld an dem Unfall hat, bringt er auch alles in Ordnung.«
»Nein, schuld war er nicht. Schuld war ein Kind. Hat man es gefunden?«
»Ja, es ist ihm nichts passiert, es gehört zum Gutshof, darum kümmert sich die Polizei.«
»Hauptsache, es ist gesund«, flüsterte Mary und war gleich darauf fest eingeschlafen, während draußen das Gewitter die ganze Nacht über tobte.
II
David McClay ging nach oben in seine Suite. Er war erschöpft. Die anstrengende Autofahrt bei dem schlechten Wetter, die Verhandlungen mit den beiden Regisseuren in Galashiels, die mit diversen Meinungsverschiedenheiten endeten, und dann zum Abschluss dieser Unfall – es reichte ihm für heute.
Langsam schlenderte er durch den eleganten Wohnraum mit den Teppichen und Vorhängen im Schottenmuster des McClay-Clans und sah aus dem Fenster. Draußen lärmte noch immer das Gewitter. ›Wenn es sich hier zwischen den Bergen einnistet, dauert es lange, bis es sich ausgetobt hat und weiterzieht‹, überlegte er. ›Das wird eine unruhige Nacht.‹ Er schenkte sich einen Whisky ein. Lächelnd erinnerte er sich an seine letzte Fahrt über den Whisky Trail, an die interessanten Diskussionen mit den Anbietern und an die Käufe, die er, wenn er schon einmal in der Gegend war, eigenhändig und in nicht gerade kleinem Umfang getätigt hatte.
Er nahm einen letzten Schluck, dann erst ging er ins Badezimmer, entledigte sich der nassen Kleidung, nahm ein Bad und zog die trockenen Sachen an, die der Butler im Schlafzimmer bereitgelegt hatte.
Der Lord hatte nach dem Tod seines Vaters, als er das Schloss und den Titel übernehmen musste, das Haus modernisiert. Während die Eltern sich ein Leben lang gesträubt hatten, irgendetwas in dem alten Gebäude zu verändern, hatte er einen kompetenten Innenarchitekten aus Edinburgh mit dem Umbau beauftragt. Neue Strom- und Wasserleitungen und eine moderne Heizungsanlage wurden neben den gemütlichen Kaminen eingebaut, ohne den traditionellen Stil und das gemütliche Ambiente des Schlosses zu beeinträchtigen. Später kamen der Lift, eine neue Küche mit einem Aufzug ins Esszimmer, damit die Speisen heiß serviert werden konnten, sowie neue Fenster und Türen hinzu.
McClay liebte das alte Haus, aber er liebte auch die fortschrittliche Lebensart, die so vieles erleichterte. Im Kamin brannte ein Feuer, und der Duft von Kiefernholz und Wacholderzweigen durchzog die Suite.
›Endlich Ruhe‹, dachte er, goss sich einen zweiten Whisky ein und ließ die letzten Tage noch einmal Revue passieren.
Glasgow, was war Glasgow diesmal gewesen? Ein Umsteigeplatz vom Flugzeug in den Wagen, ein Telefongespräch mit den Geschäftsführern und ein Kurzbesuch bei Joan. Wie immer eine fruchtlose Diskussion mit der Mutter seiner Tochter und die vergebliche Bitte, das Kind häufiger und länger sehen zu dürfen. Dann endlich ein Augenblick mit Tatjana – mein Gott, das Kind war schon fünf Jahre alt –, sie hatte ihn diesmal nicht erkannt und nur widerstrebend Daddy zu ihm gesagt.
Joan wurde zu einem Problem! Die elegante, rassige Schottin mit den roten Haaren und den unzähligen Sommersprossen, eine Schönheit damals, als er sie kennenlernte, wurde von Jahr zu Jahr eigensinniger, arroganter und anspruchsvoller. ›Habgierig wäre der richtige Ausdruck‹, dachte er und erinnerte sich an die immer maßloser werdenden Wünsche seiner einstigen Geliebten, die geheiratet werden wollte und ihm, einer Erpressung gleich, schließlich die Schwangerschaft und dann Tatjana präsentiert hatte.
›Aber ein McClay lässt sich nicht erpressen‹, dachte er. ›Ich habe sie schnell durchschaut: Eine Dame der besten Gesellschaft wollte sie werden, Weltreisen mit mir machen, in meinem Ruhm schwelgen und von meinem Ansehen profitieren‹, erinnerte er sich. ›Sie nutzte meine Sehnsucht nach innerer Geborgenheit schamlos aus, und als sie merkte, dass ihre Wünsche nicht akzeptiert wurden, als ich ihr klarmachte, dass eine Heirat mit ihr nicht infrage käme, begann sie Forderungen zu stellen, in denen ihre Gier nach Reichtum und Ansehen nur zu deutlich wurde. Und dann kam Tatjana, dieses zauberhafte Kind, dieser Sonnenschein, in den ich sofort verliebt war.‹
Dennoch hatte er auf Anraten seiner Anwälte einen Vaterschaftstest machen lassen, und als dieser positiv ausgefallen war, hatte er sich zu seinem Kind bekannt und hätte dem Drängen um eine Heirat beinahe noch nachgegeben.
Aber zum Glück war er standhaft geblieben. Die Liebe zu Joan war verraucht, was geblieben war, waren das kleine Mädchen und seine Sehnsucht, das Kind im Arm zu halten. Aber genau das verwehrte ihm die Frau. Er musste unendlich viele Wünsche erfüllen, wollte er das Kind sehen. Ein eigener Modesalon in Glasgow musste es sein, ein Bungalow am Stadtrand, ein elegantes Auto und die teuerste Garderobe wurden angeschafft. An den wertvollen Schmuck, der mit jedem Besuch verbunden war, durfte er gar nicht denken. Aber Joan war die Mutter, sie war eine unbescholtene Frau und hatte das alleinige Sorgerecht bekommen. Und damit hatte sie alle Rechte auf ihrer Seite.
So musste er sich die Treffen mit Tatjana jedes Mal erkaufen. Waren seine Geschenke großzügig, gestattete sie eine längere Besuchszeit, fielen sie bescheiden aus, so wie heute, weil er keine Zeit für den Kauf anspruchsvoller Geschenke gehabt hatte, blieben ihm nur Minuten mit dem Kind. Und diese Minuten fanden auch noch im Beisein der Nanny im Hinterzimmer des Modesalons statt.
»Lass uns doch nach drüben in den Park gehen, dort kann das Kind spielen und bekommt etwas von der Frühlingssonne mit«, hatte er vorgeschlagen, aber Joan hatte sofort protestiert.
»Nein, David, wo denkst du hin? Ich kann das Geschäft nicht verlassen. Hier herrscht Katastrophenstimmung. Die neue Kollektion muss am Fünfundzwanzigsten heraus, da entscheiden Minuten über Verkaufserfolg oder Misserfolg.«
Er hatte wenig Verständnis gezeigt, obwohl er im Geheimen zugeben musste, dass die Frau ihr Geschäft erfolgreich führte. Dann hatte er zehn Minuten mit Tatjana gespielt und versucht, ihr begreiflich zu machen, dass er ihr Vater sei, auch wenn sie ihn so selten sah. Es waren zehn peinliche Minuten im Beisein der Nanny gewesen, Minuten, in denen sich der weltberühmte, erfolgreiche Lord McClay in einen bittenden, beinahe hilflosen Mann verwandelt hatte.
Er schenkte sich noch einen Whisky ein. Seine Gedanken verweilten bei Joan und Tatjana. Er hatte die junge Frau bei einer Filmproduktion in Edinburgh kennengelernt. Ein paar Kostüme mussten geändert werden, und sie kam einige Male zum Set. Ihre Jugend, ihre Natürlichkeit hatten ihn verzaubert. In all dem Staub der Kulissen, unter der Hitze der Scheinwerfer, zwischen den bis zur Unkenntlichkeit geschminkten Schauspielern war ihr Erscheinen für ihn wie saubere, klare Luft, in der er wieder atmen konnte.
Aus einem kleinen Flirt wurde ein intimes Verhältnis. Joan war fünfzehn Jahre jünger als er; sie gab ihm von dem Glanz ihrer Jugend, er gab ihr vom Glanz seines Ruhms. Ihr glückliches Strahlen, wenn sie an seiner Seite bewundert wurde, war wie neu geschenktes Leben für ihn.
Erst allmählich spürte er die Veränderung der Geliebten, die sich von einem natürlichen Mädchen in eine berechnende Frau verwandelte. Während sie in den ersten Jahren die wenigen Ferientage gemeinsam verbrachten, wurden die Zeiten der Zweisamkeit immer kürzer, und seit zwei Jahren sahen sie sich kaum noch. McClay fühlte sich benutzt, wenn er zu einem der Feste ihrer sogenannten Freunde gebeten wurde und seine Teilnahme zusagte, nur, um vorher ein paar Minuten mit Tatjana verbringen zu können. Joan liebte die Festivitäten des Jets Sets, bei denen die Reporter vor den Türen Schlange standen und jeder ihrer neuen Freunde behaupten konnte: »Der berühmte Filmproduzent Lord McClay verkehrt in unserem Hause.«
McClay stand auf und stellte das leere Glas ab. Dann legte er zwei Holzscheite auf das Feuer und zog das Gitter vor den Kamin. ›Zeit zum Dinner‹, dachte er und freute sich auf die Speisen, die Sophie in der Küche zauberte. Viel zu selten kam er in den Genuss ihrer Kochkünste. Er vergaß den Ärger der letzten Stunden und dachte nur noch an die kurze Freizeit, die er hier genießen würde. Dass sie nicht ungestört werden würde, dafür sorgte sein Sekretär, der bereits Akten, Daten und Unterschriftenmappen vorausgeschickt hatte. Dennoch, das gemütliche ›Lone House‹, die Pirsch durch die Wälder, die Ritte in das wilde Vorgebirge des Black Law – alles wollte er unternehmen, alles auskosten, was seine Heimat ihm bot.
›Hoffentlich hört der Regen bald auf, sonst sind die Wege verschlammt und Lancelot findet keinen Tritt in den Bergen.‹ Er dachte kurz an den Hengst, den er heute noch nicht begrüßt hatte, und dann fiel ihm die junge Frau wieder ein, die er vor mehr als drei Stunden aus dem versinkenden Landrover gezerrt hatte. ›Ich muss mich bei ihr sehen lassen‹, dachte er und klingelte nach dem Butler, um zu erfahren, in welchem der Gästezimmer Hanna die Fremde untergebracht hatte.
Mary lag still in dem fremden Bett, in dem fremden Zimmer, in dem fremden Haus in dieser unbekannten Gegend. Sie lag ganz still, denn sobald sie den Kopf bewegte, drehte sich der Raum, und ihr wurde übel. Aber ihre Augen wanderten, und was sie sah, gefiel ihr. Das Zimmer war im Landhausstil eingerichtet, es verkörperte Gemütlichkeit und Wärme – ein Zimmer nach ihrem Geschmack. Aber sie erkannte auch, dass es kein Raum war, der nach neuester Mode eingerichtet worden war. ›Er ist mit den alten, gepflegten Möbeln gewachsen und zu dem geworden, was er jetzt darstellt: ein Ort der Ruhe und Geborgenheit, ein Zimmer zum Wohlfühlen. Wenn ich nur etwas mehr über dieses Haus und seine Leute wüsste‹, dachte sie und versuchte, sich an die vergangenen Stunden zu erinnern.
›Es hat einen Crash gegeben‹, überlegte sie. ›Der Drängler ist hinten in mich hinein gefahren, so viel weiß ich noch. Dann hat mich jemand in ein Haus gebracht, ein Arzt hat mir den Kopf verbunden, und danach haben mich eine Frau und ein Sanitäter in einem Sessel zu einem Fahrstuhl gerollt und in dieses Zimmer gebracht. Und da liege ich nun. Wie lange schon? Vor dem Fenster ist es dunkel. Dann habe ich wohl zwischendurch geschlafen. Mein Gott, ich schlafe hier in einem fremden Haus, ohne zu wissen, wo ich bin und wie es weitergeht. Draußen donnert ein Gewitter, richtig, das hat mich kurz vor dem Crash eingeholt, und plötzlich konnte man vor Regen nichts mehr sehen. Ob es noch dasselbe Gewitter ist?‹
Es klopfte. Bevor sie antworten konnte, wurde die Tür geöffnet.
Ein Mann stand im Schein der Flurbeleuchtung und fragte: »Darf ich Licht machen und eintreten?«
»Ja, natürlich.« Mary versuchte sich aufzurichten, aber es ging nicht.
»Bitte bleiben Sie ganz still liegen. Der Arzt hat strenge Ruhe verordnet. Ich bin David McClay, wie fühlen Sie sich?«
»Es geht. Ich bin Mary Ashton. Sind Sie mein Retter?«
»Ja, und der, der Ihnen hinten in den Wagen gefahren ist.«
»Ich musste plötzlich bremsen.«
»Ich weiß. Betty hat vor Ihnen die Straße gekreuzt. Aber es ist ihr nichts passiert.«
»Gott sei Dank. Und wer ist Betty?«
»Ein Kind vom Gutshof.«
»Was ist mit meinem Wagen?«
»Eine Werkstatt hat ihn aus dem Wasser gezogen, und wenn er trocken ist, wird er gereinigt und hierher gebracht. Ihr Gepäck ist drüben in der Wäscherei, morgen sind die Sachen wieder in Ordnung.«
»Und meine Tasche, meine Papiere, mein – ja, Geld, das mir nicht gehört, ist da auch drin gewesen.«
»Die Sachen trocknen in meinem Büro, keine Sorge, da sind sie sicher.«
»Danke.«
»Übrigens eine ganze Menge Geld. Warum so viel in bar?«
»Es gehört dem ›Museum of Art History‹, ich war auf dem Weg zu einer Versteigerung. Wenn ich morgen die Skulptur nicht bekomme, bin ich wahrscheinlich meine Stellung los. Und Bargeld als Anzahlung ist erwünscht.« Mary schloss die Augen, das Sprechen strengte sie sehr an.
»Geht es Ihnen nicht gut?«
»Ich werde so leicht schwindelig, so etwas kenne ich gar nicht.«
»Bleiben Sie ruhig liegen. Wir reden morgen weiter, und das mit der Versteigerung versuche ich zu regeln. Sie erzählen mir morgen Früh, um was es geht, und ich versuche mein Bestes. Schlafen Sie jetzt wieder.« Beruhigend strich er mit einer Hand über ihr Haar.
»Ja, danke«, flüsterte sie und hörte, wie die Tür geschlossen wurde. Und während sie einschlief, sah sie ihn vor sich, diesen interessant aussehenden, leicht ergrauten Mann mit der tiefen Stimme und der sanften Hand.
III
Mary Ashton verbrachte eine unruhige Nacht zwischen Wach- und Albträumen. Sie träumte von ihrer verzweifelten Suche nach einer Stellung, die ihrer Ausbildung als promovierter Kunsthistorikerin entsprach, und wie sie in der Edinburgher Morgenzeitung erfolglos die Stellenangebote studierte. Wie sie Angst hatte, ihre geliebte kleine Dachwohnung nicht mehr bezahlen zu können, und ihren Landrover verkaufen musste, um die Miete zu beschaffen. Angstschweiß bedeckte sie, als sie von diesem Traum erwachte.
›Gott sei Dank, das war nur ein Traum‹, dachte sie, ›und seit zwei Jahren habe ich meine Arbeit im ›Museum of Art History‹. Aber ständig muss ich darum kämpfen, die Arbeit zu behalten, die Konkurrenz ist zu groß. Ich habe mir zwar inzwischen einen Namen als Expertin für Echtheitszertifikate und Expertisen gemacht, aber ein Fehler, und ich stehe wieder vor dem Nichts.‹
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!