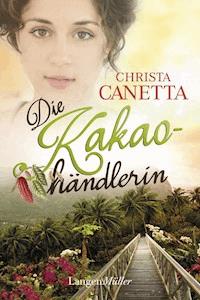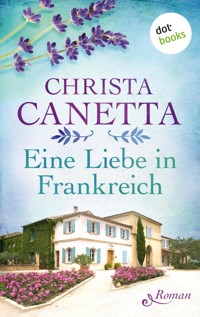
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Große Gefühle an einem wunderschönen Ort: Der romantische Roman »Eine Liebe in Frankreich« von Bestseller-Autorin Christa Canetta als eBook bei dotbooks. Eigentlich kann die junge Tierärztin Jana nichts erschüttern, doch nun droht eine schlechte Nachricht, ihr den Boden unter den Füßen wegzuziehen: Um das Vermächtnis ihres geliebten Vaters für die Nachwelt zu bewahren – ein Patent, das zum Wohl der Menschheit eingesetzt werden soll –, braucht sie Geld. Viel Geld! Ihre große Hoffnung ist der Unternehmer Julien Montellet, ein ausgesprochen attraktiver Mann … und ein arroganter Snob, wie sie bei der ersten Begegnung auf seinem französischen Landsitz entsetzt feststellt. Wie gut, dass sie ihn nach Abschluss des Geschäftes niemals wiedersehen muss. Dann aber gerät Jana in Gefahr – und es gibt nur einen, der sie retten kann! Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das Romantik-Highlight »Eine Liebe in Frankreich« von Bestseller-Autorin Christa Canetta entführt uns in die Camargue, eine der schönsten Regionen Südfrankreichs am Mittelmeer. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Eigentlich kann die junge Tierärztin Jana nichts erschüttern, doch nun droht eine schlechte Nachricht, ihr den Boden unter den Füßen wegzuziehen: Um das Vermächtnis ihres geliebten Vaters für die Nachwelt zu bewahren – ein Patent, das zum Wohl der Menschheit einsetzen werden soll –, braucht sie Geld. Viel Geld! Ihre große Hoffnung ist der Unternehmer Julien Montellet, ein ausgesprochen attraktiver Mann … und ein arroganter Snob, wie sie bei der ersten Begegnung auf seinem französischen Landsitz entsetzt feststellt. Wie gut, dass sie ihn nach Abschluss des Geschäftes niemals wiedersehen muss. Dann aber gerät Jana in Gefahr – und es gibt nur einen, der sie retten kann!
Über die Autorin:
Christa Canetta ist das Pseudonym der deutschen Journalistin und Autorin Christa Kanitz (1928 – 2015). Sie studierte Psychologie und lebte in der Schweiz und Italien, bis sie sich in Hamburg niederließ. Sie arbeitete für den Südwestfunk und bei den Lübecker Nachrichten; 2001 begann sie in einem Alter, in dem die meisten Menschen über den Ruhestand nachdenken, mit großem Erfolg, Liebesromane und historische Romane zu schreiben.
Von Christa Kanitz erschien bei dotbooks der historische Roman »Die Liebe der Kaffeehändlerin«.
Unter ihrem Pseudonym Christa Canetta veröffentlichte sie bei dotbooks die Liebesromane »Das Leuchten der schottischen Wälder«, »Schottische Engel«, »Schottische Disteln«, »Die Heideärztin« und »Die Heideärztin unter dem Kreuz des Südens«.
Ebenfalls bei dotbooks erschienen die Romane »Jenseits der Grillenbäume« und »Im Land der roten Erde« aus dem Nachlass von Christa Kanitz: Zwei unvollendete Romane, denen ihre Töchter – darunter die erfolgreiche Autorin Brigitte D’Orazio – gemeinsam den letzten Schliff verliehen und die nun unter dem Namen von Christa Kanitz‘ Enkeltochter Virginia veröffentlicht wurden.
***
eBook-Neuausgabe April 2019
Dieses Buch erschien unter dem Titel »Der Tanz der Flamingos« bereits 2004 bei Moments und 2014 bei dotbooks.
Copyright © der Originalausgabe 2004 by Moments in der HOF DORT HEYNE Verlag GmbH, Erftstadt
Copyright © der überarbeiteten Neuausgabe 2014, 2019 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion der Neuausgabe: Stephanie Ehrenschwendner
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von Bildmotiven von Adobe Stock/chiyacat, shutterstock/Scisetti Alfio und shutterstock/Kote-Kit
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-95824-086-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Eine Liebe in Frankreich« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Christa Canetta
Eine Liebe in Frankreich
Roman
dotbooks.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Lesetipps
Kapitel 1
Julien Montellet unterbrach die Konferenz und ordnete eine viertelstündige Erfrischungspause an. Er wusste, dass er seine Gesprächspartner nicht überfordern durfte. Einige waren hochbetagt und hatten Mühe, dem schnellen Wortwechsel, dem Tempo der Argumente und Gegenargumente, den Vorschlägen und Abmachungen zu folgen. Aber gerade auf die Meinung der Alten, alles loyale und rechtschaffene Geschäftsleute, legte er größten Wert, denn sie waren es, die das Konsortium, das er schon so lange anstrebte, endlich ins Leben gerufen hatten. Außerdem schätzte er ihre jahrzehntelange Erfahrung, die sie in die Arbeit einbrachten.
Während zwei junge Frauen von einem Cateringservice Getränke und Horsd’œuvres herumreichten, ging Julien in sein Büro, um einige Telefonate zu erledigen. Als er das Vorzimmer betrat, kam ihm seine Sekretärin Claudine aufgeregt entgegen.
»Ich wollte Sie nicht in der Sitzung stören, Monsieur Montellet, aber Sie sollten unbedingt den Wetterbericht hören. Seit einer Stunde gibt die Seewetterwarte von Port de Bouc überaus beängstigende Sturmwarnungen für die Camargue durch.« Sie reichte ihm zwei Seiten Papier. »Ich habe alle Meldungen für Sie ausgedruckt.«
»Lassen Sie sehen.«
Während Julien die Seiten überflog, stellte Claudine das Radio lauter. Denn der Sender gab die Sturmflutwarnung gerade erneut durch.
»Stellen Sie eine Verbindung zum Gut her, und sagen Sie Jacques, er soll mit dem Wagen in der Tiefgarage auf mich warten.«
Julien ging in sein Büro, griff nach seinem Terminkalender und rief ins Vorzimmer: »Sagen Sie bitte sämtliche Termine für die nächsten Tage ab, Claudine. Ich werde sicher nicht zu erreichen sein.«
Ein paar Minuten später stellte die Sekretärin Maurice, den Verwalter seines Anwesens, zu ihm durch. Maurice war ein älterer, sehr gewissenhafter Mann, der bereits seit vielen Jahren für Julien arbeitete und wusste, was er zu tun hatte.
»Wir haben alle Maßnahmen nach Plan eingeleitet, Monsieur«, erklärte er in höflichem Ton. Claude ist mit allen verfügbaren Männern seit der ersten Meldung am frühen Morgen unterwegs. Sie wollen versuchen, die Rinderherden zum Mas des Iscles zu treiben, damit sie die Wasser nicht erwischt. Das ist die höchste Erhebung, sagt Claude, die in der kurzen Zeit zu erreichen ist. Er hofft, dass auch einige der Wildpferde mitlaufen.«
»Die Pferde, die an den Seen an der Küste sind, werden das vielleicht nicht schaffen«, sagte Julien und zog dabei verärgert die Stirn in Falten. Warum war er gerade jetzt nicht auf seinem Anwesen, wo er so dringend gebraucht wurde.
»Claude will es versuchen«, beruhigte ihn der alte Mann. »Er hat die Hirten und ihre Pferde mit den Transportern bis zum Ende der befahrbaren Straße bringen lassen. Von dort aus haben sie mit dem Treiben angefangen. Sie sind bereits seit Stunden unterwegs, Monsieur. Ich glaube, sie schaffen das.«
»Wie ist das Wetter im Augenblick bei Ihnen, und welche Richtung wird der Sturm nehmen? Weiß man das schon?«
Julien sah aus dem Fenster und konnte kaum fassen, dass hier in Marseille, kaum hundert Kilometer weiter westlich, ungetrübtes heißes Sommerwetter herrschte, während in der Camargue ein Unwetter bevorstand.
Maurice unterbrach seine Gedanken: »Im Augenblick ist hier alles ruhig, unheimlich ruhig, Monsieur. Es ist sehr diesig, und die Sonne durchdringt nur mühsam den Dunst. Und heiß ist es, unglaublich heiß. Über die Richtung, die der Sturm nehmen wird, ist noch nichts durchgesagt worden: Aber es scheint, als käme er direkt auf uns zu.«
»Rufen Sie die Wetterstation in Port de Bouc stündlich an, und geben Sie Alarm für das gesamte Gut. Die Häuser müssen gesichert und die Frauen und Kinder der Hirten sowie der Landarbeiter in Sicherheit gebracht werden. Am besten lassen Sie sie aufs Festland bringen. Erklären Sie ihnen, dass die großen Seen und das Schwemmland vielleicht einen beachtlichen Teil der angekündigten Wassermassen auffangen. Doch wenn der Wind sich nicht dreht und direkt von Süden kommt, wird das Wasser bis zum Gut heraufgedrückt. Sagen Sie den Leuten, dass ich in etwa einer Stunde da bin.«
»Jawohl, Monsieur Montellet.«
»Und nun rufen Sie bitte Miss Browning an den Apparat.«
Einen Augenblick später hatte Julien die Erzieherin seiner Töchter am Telefon.
»Miss Browning, fahren Sie bitte sofort mit Sylvie und Chantal in die Villa nach Marseille. Es wird nichts gepackt! Sie müssen so schnell wie möglich von der Küste weg!«
Als er merkte, dass die Erzieherin etwas fragen wollte, unterbrach er sie schnell: »Ich sagte sofort, und ich meine sofort. Bitte, Miss Browning, jede Minute zählt.« Dann legte er auf.
Er war sicher, dass die couragierte Frau, die seit dem Tod seiner Frau vor vier Jahren die Kinder betreute, nicht zögern würde, seiner Anweisung zu folgen. Sie war zuverlässig und umsichtig und würde wissen, dass er sie nicht ohne zwingenden Grund zu dieser Eile antrieb. Es stand tatsächlich zu befürchten, dass die Küstenstraße innerhalb kürzester Zeit unbefahrbar und unter Umständen sogar gesperrt sein würde. Dann war kein Durchkommen mehr in Richtung Marseille. Dieses Problem betraf ihn natürlich auch in umgekehrter Richtung. Wenn er nicht umgehend aufbrach, würde er sein Anwesen nicht mehr erreichen.
Beim Verlassen des Büros nickte er Claudine kurz zu und ging in Richtung Aufzug.
Claudine sah ihm durch die verglaste Tür nach und seufzte. So lief das immer. Ständig war dieser Mann in Eile. Er zeigte nicht den leisesten Hauch von Interesse an ihr, es fiel kaum ein persönliches Wort, nie machte er ihr ein Kompliment, dabei gab sie sich so viel Mühe, nicht nur mit ihrer Arbeit … Dass sie verliebt in ihn war, spürte er anscheinend nicht.
Für Claudine war ihr Chef ein Mann wie aus dem Bilderbuch: breitschultrig, sportlich, hochgewachsen, selbstbewusst und – unermesslich reich. Wie gerne hätte sie die kantigen Züge seines Gesichts gestreichelt, bis sie weich und sorglos wären. Doch seine braunen, wachsamen Augen übersahen ihre liebevollen Blicke stets, und sein perfekter Mund lächelte nur selten, als hätte er es nie richtig gelernt.
Claudines geschulter Blick hatte vom ersten Moment an seinen Eigensinn, aber auch seine Großzügigkeit erkannt. Sie wusste um seine Ungeduld ebenso wie um seine Toleranz, die so oft im Widerstreit lagen. Julien Montellet war ein eher konservativer Mann, von Traditionen geprägt und mitunter richtig altmodisch. Mit eiserner Selbstbeherrschung kämpfte er gegen eine angeborene Wildheit, die ihn manchmal aggressiv und unausstehlich machte. Dennoch war er genau der Mann, den sie haben wollte. Aber sie ahnte, dass ihre Bemühungen vergeblich waren. Seit dem Tod seiner Frau schien das weibliche Geschlecht für Monsieur Montellet nicht mehr zu existieren.
Auf dem Weg zum Aufzug lief er am Konferenzraum vorbei, wo seine Anwälte, die Geschäftspartner, Anlageberater und ein paar seiner Direktoren in angeregter Unterhaltung zusammensaßen.
»Meine Herren«, unterbrach er die Runde, »ich bitte um Ihr Verständnis, aber ich muss diese Konferenz abbrechen. Wir haben soeben die Warnung bekommen, dass eine außergewöhnliche Sturmflut die gesamte Küstenregion bedroht. Ich muss mich um meine Leute, das Gut und die Herden kümmern. Sollten Sie Besitz in Küstennähe haben, rate ich Ihnen, umgehend Schutzmaßnahmen zu ergreifen und die Wetterlage zu verfolgen. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte.«
Ohne sich auf Fragen oder Diskussionen einzulassen, verließ er zügig den Raum.
Während er kurz darauf in seinem Privataufzug in die Tiefgarage fuhr, war er in Gedanken auf seinem Besitz nahe dem Sumpfland der Camargue. Das Gut und das schlichte schöne Haus, LaMaison, wie er es nannte, waren seit Generationen im Besitz seiner Familie.
Früher hatte es häufiger Sturmfluten gegeben, die Alten in der Gegend erzählten sogar von versunkenen Dörfern und haushohen Wellentürmen, die alles Hab und Gut niedergewalzt hatten.
Aber in den letzten fünfzig Jahren war das Meer friedlich geblieben, und die Menschen in der Umgebung hatten fast vergessen, wie brutal die Gewalt der Natur sich gebärden konnte.
Welch ein Glück, dass es den Plan gab. Julien hatte trotz der Ruhe in den letzten Jahren einen Notfallplan zur Rettung von Menschen und Vieh sowie zum Schutz der Häuser ausgearbeitet.
Doch ein Plan war immer nur Theorie. Würden die Maßnahmen in der Praxis tatsächlich greifen, damit niemand zu Schaden kam? Bei diesem Gedanken schlug Julien das Herz bis zum Hals.
In der Tiefgarage angekommen, stieg er sofort in den Wagen, der bereits mit laufendem Motor am Aufzug wartete, und wies Jacques, den Fahrer, an, den kürzesten Weg aus der Stadt in Richtung Westen in die Camargue zu nehmen. Dann ließ er die Trennwand im Wagen nach oben fahren, um eine Weile in Ruhe seinen Gedanken nachzuhängen. Er musste dafür Sorge tragen, dass man nicht nur die Rinderherden vor dem Wasser rettete, sondern auch die Wildpferde, die sich alle im bedrohten Schwemmland befanden. Seit Jahren versuchte er, die wilden Tiere mit domestizierten Arabern zu kreuzen, um den immer kleiner werdenden Bestand der echten Camarguepferde aufzufrischen. Beinahe bedauerte er, es stets abgelehnt zu haben, Hubschrauber anzuschaffen, wenn die Tiere gezählt, getrieben oder auch nur beobachtet werden sollten. Seit er einen Absturz mit dem Helikopter nur durch ein Wunder überlebt hatte, verspürte er eine Aversion gegen diese fliegenden Senkrechtstarter. Außerdem empfand er es als reine Tierquälerei, mit Maschinen Herden nicht nur zu überwachen, sondern auch zu treiben, ganz egal, ob das in Nord- und Südamerika und in Australien längst üblich war. Aber jetzt hätte er die Hubschrauber vielleicht sinnvoll einsetzen können, um die Tiere zu retten. Die vielen Fohlen und Kälber, die in den letzten Wochen geboren worden waren, würden nicht in der Lage sein, einer kopflos fliehenden Herde zu folgen – denn die Pferde und Rinder mit Hilfe eines Hubschraubers zu treiben, war nichts anderes, als sie in panikartiger Flucht in eine bestimmte Richtung zu hetzen. Die Jungtiere würden zurückbleiben und, getrennt von den Müttern, qualvoll verenden.
So in Gedanken versunken, bemerkte Julien nicht mal den sorgenvollen Blick seines Fahrers. Jacques, der die Strecke in- und auswendig kannte, sah immer wieder in den Rückspiegel. Sein Chef hatte den Laptop auf dem Schoß und schien konzentriert zu arbeiten. Er gönnte sich keine Minute Ruhe, sondern arbeitete in Marseille in der Firma und in der Camargue auf seinem Gut. Dabei musste er eigentlich gar kein Geld mehr verdienen.
Jacques hatte sich genau erkundigt, bevor er sich vor acht Jahren um die Stelle als Privatchauffeur beworben hatte. Schließlich wollte er wissen, mit wem er es zu tun hatte. Nicht ein einziges Mal hatte er es in all den Jahren bedauert, in den Dienst von Julien Montellet getreten zu sein. Sein Chef war stets korrekt, wenn auch streng, und immer gentlemanlike. Er warf abermals einen Blick in den Rückspiegel. Müde sah er aus, kaputt und abgespannt – und das mit gerade mal achtundvierzig Jahren. Ein Infarktkandidat, wenn er nicht aufpasste, dabei hätte er leben können wie Gott in Frankreich.
Das Vermögen von Julien Montellet war enorm und schien sich wie von selbst noch weiter zu vermehren. Die alten Montellets hatten gut vorgesorgt und ihre Kautschukplantagen in Französisch-Guayana, kurz bevor das Land selbständig und fremdes Eigentum konfisziert wurde, für Milliarden verkauft.
Jacques richtete seinen Blick wieder auf die Straße. Glücklich machte den Chef das ganze Geld aber nicht. Im Gegenteil, er schien das Unglück regelrecht anzuziehen. Erst der tragische Verlust seiner Eltern, deren Yacht während einer Kreuzfahrt im Mittelmeer verschollen war, dann der Tod seiner Frau, die jahrelang krank gewesen war. Und nun, allein mit den beiden Töchtern …
Jacques beobachtete im Rückspiegel, wie sein Chef den Laptop weglegte und telefonierte. Da die Trennscheibe geschlossen war, konnte er nicht hören, mit wem er sprach. Aber an seinem Mienenspiel erkannte er, dass er kurze Anweisungen gab. Wahrscheinlich telefonierte er mit dem Verwalter.
Der Wagen bog von der Schnellstraße nach links in eine Asphaltstraße ab, die an den ausgedehnten Ländereien der Montellets vorbeiführte: Hier wurden Reis, Mais und Zuckerrohr angebaut, die Pflanzen wuchsen so hoch, dass es den Anschein hatte, als würde man durch eine grüne Wildnis fahren. Jacques verringerte das Tempo, denn die Straße war schmal. Auch wenn man kilometerweit geradeaus nach Süden sehen konnte, kam es doch immer wieder vor, dass plötzlich Wild aus dem dichten Grün brach und die Fahrbahn überquerte. Vor allem Wildschweine fühlten sich in dem Gewoge wohl, und einen Keiler auf der Kühlerhaube wollte er sich ersparen, sonst würde vom Schwein, vom Auto und vom Chauffeur nicht viel übrig bleiben.
Die Stimme seines Chefs, der die Trennwand heruntergelassen hatte, unterbrach Jacques’ Gedanken.
»Jacques, ich werde mit dem kleinen Pferdetransporter Titus nach Süden bringen und mit ihm ins Schwemmland reiten, um nach zurückgebliebenen Tieren zu suchen. Ich möchte, dass Sie mich gleich begleiten. Sie müssen den Transporter zurückfahren.«
Julien Montellet hatte bereits die Krawatte abgelegt und die obersten Hemdknöpfe geöffnet. Er wollte so schnell wie möglich in seine Reitkleidung und aufs Pferd.
»Darf ich daran erinnern, Monsieur, dass ich ein sehr guter Reiter bin? Ich würde Sie gern begleiten, es ist bestimmt nicht gut, ganz allein im Schwemmland mit einer Sturmflut im Nacken unterwegs zu sein.«
»Danke, Jacques. Ich bin hier groß geworden und kenne mich da draußen gut aus. Es ist viel wichtiger, dass Sie auf dem Gut bleiben und die Koordinierung aller Hilfsmaßnahmen überwachen. Wir müssen mit Handy und Funkgerät Verbindung halten, damit ich ständig über neueste Meldungen der Wetterwarte informiert bleibe. Maurice wäre allein mit all diesen Aufgaben überfordert.«
»Wie Sie meinen, Monsieur«, antwortete Jacques. Er wusste, wie gefährlich dieser Ritt werden konnte, und war eigentlich ganz froh, im Haus bleiben zu können, auch wenn er es für seine Pflicht hielt, seine Hilfe anzubieten.
Ein paar Minuten später erreichten sie das Anwesen. Jacques fuhr auf den riesigen, mit Rasenflächen und Blumenrabatten geschmückten Vorplatz und hielt vor dem Eingang. Das Haus, seit mehr als hundertfünfzig Jahren im Besitz der Familie und auf der einzigen Anhöhe der ganzen Gegend angelegt, war ein U-förmiger, nach Süden hin geöffneter, weißgetünchter Flachbau mit mehr als dreißig Zimmern. Das Haus war von einer breiten, überdachten Veranda umgeben, die im Sommer für Schatten sorgte und im Winter die eisigen Nordstürme abhielt, die so oft über das Rhônedelta fegten. Im Mitteltrakt des Gebäudes befand sich die große Wohnhalle, an die sich nach hinten Wirtschaftsräume anschlossen. Im linken Flügel lagen die privaten Räumlichkeiten der Familie und im rechten zahlreiche Gästezimmer, denn die Montellets waren immer eine gastfreundliche Familie gewesen und liebten es, das Haus voller Freunde zu haben. Das hatte sich jedoch mit der Krankheit und dem Tode der Hausherrin geändert – nun bestimmten Ruhe und Eintönigkeit das Leben auf dem Landsitz.
Vor allem die beiden Mädchen langweilten sich oft und beklagten die Einsamkeit, wenn sie die Sommerferien auf dem Gut verbrachten.
Im Herbst sollten Juliens Töchter aufs Internat nach Montreux kommen. Die zwölfjährige Sylvie und die vierzehnjährige Chantal hatten vor ein paar Wochen die Aufnahmeprüfungen in den entsprechenden Klassen bestanden, und im September würde ein neuer Lebensabschnitt für sie beginnen. Julien war nicht sicher, ob es ihnen im Internat gefallen würde, aber zumindest waren sie dort unter jungen Menschen. Er hatte sich in den letzten Monaten Sorgen gemacht, weil die Mädchen, wie Miss Browning ihm berichtete, niemals Freunde mit nach Hause brachten. Sie behaupteten, die große Villa in Marseille, in der so lange getrauert worden war, würde ihre Freunde deprimieren. Es würde den beiden guttun, im Internat mehr mit Gleichaltrigen zusammen zu sein. Aber ob sie sich auf die Zeit im Internat freuten, wusste er nicht wirklich. Er verbrachte einfach zu wenig Zeit mit seinen Kindern. Daran musste sich endlich etwas ändern. Wenn Sylvie und Chantal künftig während der Ferien nach Hause kamen, würden die Villa in Marseille und das Gut in der Camargue seine Töchter und alle Freunde, die sie mitbringen wollten, in einer gemütlichen Atmosphäre willkommen heißen.
Auf dem Weg zur Tür blickte sich Julien kurz um. Überall, wo sich Platz bot, standen große, alte Terrakottakübel mit leuchtend roten Geranien und Petunien, von den Balken des Verandadaches hingen Kaskaden rosafarbener Begonien herab. Nichts deutete beim Anblick der Blumenpracht auf einen Sturm hin. Die drückende Hitze aber verriet, was in der Luft schwelte, und die schweren Holzläden vor den Fenstern, die Maurice bereits geschlossen hatte, gaben einen Hinweis auf die drohende Katastrophe.
Julien schaute hinüber zu den Stallungen, die ein paar hundert Meter vom Herrenhaus entfernt hinter Baumgruppen verborgen lagen. Alles um ihn herum schien menschenleer. Diese Stille beunruhigte ihn aufs äußerste.
Noch bevor er die Klingel betätigen konnte, öffnete Maurice, der grauhaarige, untersetzte Gutsverwalter, die schwere Eichentür, die den Wassermassen sicher standhalten würde.
»Gut, dass Sie da sind, Monsieur.«
»Guten Tag, Maurice«, antwortete Julien und fragte, noch bevor er eingetreten war, »was sagt der Wetterbericht?«
»Die Sturmflut wird gegen 22 Uhr die südlichen Inseln und Küstenstreifen erreichen. Ich habe das bereits telefonisch an die Treiber durchgegeben. Ein Glück, dass alle mit Handys ausgestattet sind.«
»Sehr gut, Maurice, sind die Mädchen abgefahren?«
»Ja, schon vor einer Stunde. Miss Browning hat keine Minute gezögert, nachdem Sie angerufen haben. Aber die jungen Damen waren nicht begeistert von ihrer Abreise.«
Julien lachte.
»Das kann ich verstehen. Sie meinen sowieso immer, sie möchten hier endlich einmal etwas erleben, um die Langeweile zu unterbrechen. Und kaum steht ein Abenteuer bevor, schicke ich sie weg.«
»So ist es, Monsieur.« Der alte Mann nickte.
Julie trat ins Haus und ging, während er weitersprach, in den linken Flügel, Maurice folgte ihm.
»Monsieur, ich habe alles für Sie bereitgelegt.«
»Gut, danke. Bitte sagen Sie einem der Stallknechte, er soll Titus satteln und die Gewehrtasche und ein Lasso einpacken. Und stellen Sie sicher, dass die Notfallausrüstung in die Satteltaschen gepackt wird. Verladen werde ich den Hengst selbst, sonst dreht er noch durch, und die Abfahrt verzögert sich unnötig.«
»Jawohl, Monsieur.«
Julien lief als Erstes ins Ankleidezimmer und zog sich um. Anschließend überprüfte er schnell die zahlreichen Taschen seiner Barbourweste, in denen er einige Notfallutensilien aufbewahrte: Kompass, Handy, Feuerzeuge, Taschenlampe, Messer und Hufkratzer, kleine Verbandspäckchen und andere Hilfsmittel, die man brauchte, wenn man in der Wildnis unterwegs war. Dann ging er ins Arbeitszimmer, holte Munition aus dem Waffenschrank, griff sich ein Gewehr, das Fernglas und die Leuchtspurpistole und lief zurück auf den Hof, wo Jacques ihn bereits erwartete.
Trotz der bedrohlichen Situation und der Sorge, die ihm zu schaffen machte, fühlte Julien sich gut. Er liebte das Landleben und seine Tiere. Saloppe Arbeitskleidung, eine herbe Brise vom Meer, den Pferderücken zwischen den Schenkeln und das weite Land um sich herum, das war es, was er wie die Luft zum Atmen brauchte. Nadelstreifenanzüge und exquisite Restaurants, Partys und teure Autos, Luxus und Weltreisen, darauf konnte er verzichten. Er war ein Mann, dem körperliche Arbeit und das Gefühl, an seine körperlichen Grenzen zu gehen, guttat. Das Leben in der Natur mit den Pferden schenkte ihm Erfüllung.
Am liebsten ritt Julien mit den Hirten und Treibern bei Sonnenaufgang los, um erst spätabends müde, hungrig, durstig, erschöpft und so wunderbar zufrieden wieder heimzukommen.
Doch an diesem Tag würde er kaum ein Hochgefühl empfinden, diesmal ging es ums blanke Überleben der Tiere. Er war sich darüber im Klaren, in welche große Gefahr er sich und Titus brachte.
Als sie die Stallungen des Gutes erreichten, ging der Knecht bereits mit dem gesattelten Pferd vor dem Gebäude auf und ab. Beglückt betrachtete Julien Titus. Der Hengst, den er selbst gezüchtet hatte, war ein eigenwilliges, etwas schwieriges Tier, aber das beste, das er je besessen hatte: absolut zuverlässig und mutig, und auf den Mut kam es bei Camargue-Pferden vor allem an, da sie im Sumpfland kaum festen Tritt hatten. Diese wilden Kreaturen konnte man nicht unbedingt als Schönheiten bezeichnen, sie waren nur mittelgroß, kompakt gebaut, mit großem Kopf und breiten Hufen, die sie auf dem weichen Boden sicher trugen. Aber Titus, der aus einer Kreuzung mit einem edlen Araber entstanden war, hatte sich zu einem eleganten, kräftigen und großen Pferd entwickelt und versprach, beste Erbanlagen weiterzugeben.
Langsam ging Julien auf den Hengst zu und sprach leise auf ihn ein. Obwohl die Zeit drängte, musste er dem Tier mit Ruhe begegnen, denn das Tier hatte ein feines Gespür für die Menschen, die sich ihm näherten. Juliens Nervosität würde sich auf den Hengst übertragen. Und ein nervöses Pferd war das Letzte, was Julien jetzt brauchen konnte, das Verladen war an sich schon eine schwierige Angelegenheit. Er nahm dem Knecht die Zügel ab, rieb Titus liebevoll über die Nüstern, kraulte seine Stirn und strich ihm über die Ohren, bevor er ihn erst langsam einmal im Kreis und dann auf die Verladerampe und in den Transporter führte. Der Hengst folgte ihm willig. Kein Kopfhochwerfen, kein Zurückzucken, kein seitliches Ausbrechen – treu lief er die Rampe hinauf. Während der Knecht die Hecktür des Transporters schloss, band Julien den Hengst vorne fest und schlüpfte durch eine kleine Seitentür nach draußen. Danach setzte er sich ans Steuer und fuhr, nachdem auch Jacques eingestiegen war, langsam an.
Kurz darauf rollte der Transporter die Asphaltstraße am Weideland entlang in Richtung Süden und Meer. Während nördlich vom Gut Landwirtschaft betrieben wurde, begrenzten in den südlicheren Gebieten saubere, weißgestrichene Koppelzäune die Straße. Auf diesen Weiden lebten in den Wintermonaten die Stuten mit den Fohlen, die Junghengste und die Kühe mit ihren Kälbern. Wacholdergebüsch und kleine Gruppen verkrüppelter Pinien, vom Mistral gepeitschte Miniatureichen und Ginster, an dem die ersten Schoten reiften, grenzten den Blick auf die ungeheure Weite der Seenlandschaft noch ein, aber nur wenige Kilometer weiter gingen Land und Wasser uferlos ineinander über.
»Jacques, wenn die Flut für zehn Uhr erwartet wird, dann müssen sich die Männer ab neun Uhr ins Trockene bringen und zum Mas des Iscles kommen. Sorgen Sie dafür, dass alle diesen Befehl erhalten und befolgen. Ich wünsche keine riskanten Unternehmungen und keine Beweise von besonderem Mut. Ich möchte Sicherheit für alle. Werden Sie das schaffen?«
»Ja, Monsieur, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht.«
»Die Transporter sollen um neun am Mas des Iscles bereitstehen und die Männer mit ihren Pferden zurückbringen.«
»Jawohl, Monsieur Montellet. Und Sie selbst, wo soll man auf Sie warten?«
»Das weiß ich noch nicht. Aber machen Sie sich um mich keine Gedanken, ich kenne das Land wie meine Westentasche. Im Notfall fordere ich ein Boot an, das mich rausholt. Aber so weit wird es nicht kommen. Hauptsache, ich werde ständig darüber unterrichtet, welche Richtung der Sturm nimmt.«
»Selbstverständlich, Monsieur.«
Sie hatten das Ende der Asphaltstraße erreicht. Julien fuhr noch ein Stück auf einem Schotterweg weiter, der auf einmal eine scharfe Biegung nach Osten machte. Dort hielt er an.
»So, hier trennen wir uns, ich muss nach Süden, und Sie fahren zurück.«
Nachdem Jacques die Hecktür geöffnet und die Verladerampe angebracht hatte, drückte Julien den Hengst Schritt für Schritt rückwärts nach draußen. Dann zog er den Sattelgurt straff, saß auf, tippte an seinen breitkrempigen Hut und sagte: »Bis später, Jacques. Ich verlasse mich auf Sie.«
Der Chauffeur setzte sich in den Transporter und fuhr los. Einen Augenblick lang sah Julien dem Wagen noch nach, dann wendete er das Pferd mit leichtem Schenkeldruck zum Etang de Montellet. Während Titus die ersten Schritte in das knöcheltiefe Wasser des flachen Sees machte, kontrollierte Julien mit dem Feldstecher den Horizont. Einige Kilometer südlich von ihm schwebten Flamingos auf und ab. Besorgt beobachtete er die Vögel: Kreisten sie, um sich niederzulassen oder um davonzufliegen? Flucht deutete auf Gefahr hin. Es bedeutete meist nichts Gutes, wenn diese Vögel wie eine rosarote Wolke am Himmel entlangzogen. Aber er konnte nicht erkennen, was die Vögel umtrieb. Sie waren zu unruhig. Sein Blick schweifte weiter, bis er sich in einer grauen Fläche verlor. Ruhig setzte der Hengst einen Schritt vor den anderen, während Julien gebannt den Himmel absuchte. Da vorn, diese graue Mauer, war das eine riesige Wolke, die auf ihn zukam, oder eine Wasserwand? Er ließ den Feldstecher sinken und nahm die Zügel fester in die Hand. Aufmerksam sah er sich um. Er musste darauf achten, nicht jenen Moment zu verpassen, nach dem die Rückkehr selbst bei gutem Wetter und bester Sicht unmöglich wurde. Die Stille und die Sehnsucht nach Unendlichkeit, die sich in dieser Landschaft widerspiegelten, übten eine magische Anziehungskraft aus, die einen, wenn man zu weit vorgedrungen war, nicht mehr losließ. Julien kannte diesen Magnetismus nur zu gut und wusste, dass er Kraft brauchte, um ihm zu widerstehen. Doch diesmal hatte er keine Zeit für Risiken, ein Irrtum konnte bei Sturm tödlich sein. War er erst einmal zu weit geritten, konnte selbst die kleinste Flut zur Todesfalle werden, denn die Differenz der Gezeiten im Delta war groß genug, um darin zu sterben. Die Tiere der Wildnis hatten einen Instinkt für diese Gefahr, und selbst Titus, in Ställen und auf Koppeln groß geworden, lag dieses Gespür im Blut. Aber allein dem Instinkt seines Pferdes wollte Julien sein Leben nicht anvertrauen.
Mutig setzte der Hengst einen Huf nach dem anderen ins Wasser, das langsam tiefer wurde. Julien strich ihm über den Hals, sprach immer sanft auf ihn ein und lobte ihn mit leiser Stimme. Um schneller vorwärtszukommen, machte er sich daran, die Schilfinseln, die aus dem seichten Wasser herausragten, zu umreiten. Die Pferde, aber auch die Rinder liebten es, sich bei großer Hitze zwischen Binsen und Gras niederzulegen und zu dösen. Auf den kleinen Erhebungen wehte immer ein schwacher Wind und brachte eine angenehme Kühlung. Julien wollte bis zu den südlichsten Inseln reiten, um sie dann auf dem Rückweg systematisch nach Jungtieren abzusuchen. Die Fohlen wie die Kälber fürchteten das Wasser und den Sumpf, weil sie mit ihren kleinen Hufen keinen Halt fanden und der Herde nur schwer folgen konnten. Im Gegensatz zu den besonders breiten Hufen der ausgewachsenen Tiere waren ihre schmalen Hufe nicht ausreichend trittfest, weshalb sie oft bis zur Erschöpfung kämpfen mussten, um die Muttertiere nicht zu verlieren. Erreichten sie einen trockenen Platz, legen sie sich meist erst einmal nieder, um auszuruhen.
Julien legte einen Stopp ein und nahm den Feldstecher, um den Horizont zu kontrollieren. Die undefinierbare graue Masse aus Wolken oder Wasser war näher gekommen, aber immer noch in ausreichender Entfernung. Dann fischte er sein Handy aus der Tasche und rief Jacques an.
»Gut Montellet, Jacques am Apparat«, meldete sich der Chauffeur.
»Montellet hier, was gibt es Neues?«
»Der Wind hat etwas gedreht, er kommt nun stärker aus östlicher Richtung, Monsieur.«
»Das könnte uns helfen, dann drückt die Flut nicht direkt ins Delta. Was machen die anderen?«
»Ich habe Ihren Befehl für die Rückkehr an alle weitergegeben. Sie haben bereits eine Menge Vieh zum Mas des Iscles getrieben. Claude meint, dass die Tiere dort sicher sind. Aber einige Gruppen sind noch unterwegs. Die Tiere sind anscheinend sehr störrisch, so dass die Männer Mühe haben, sie zusammenzutreiben.«
»Sie spüren die Gefahr und wollen nicht den Menschen, sondern ihrem Instinkt folgen. Im Wasser fühlen sie sich sicher, aber sie ahnen nichts von der Flut.«
»Das sagt der Vorarbeiter auch.«
»Trotzdem, sie müssen zum Mas gebracht werden, sagen Sie das den Männern. Ich achte den Instinkt der Tiere, aber wir müssen die Sturmwarnung ernst nehmen. Danke, Jacques.«
Julien beendete das Gespräch und steckte das Handy ein. Dann zog er die Weste aus und kontrollierte die Verschlüsse der einzelnen Taschen. Es war drückend heiß. Der Schweiß lief ihm am Rücken und an den Armen herunter. Das Hemd klebte ihm am Körper, deshalb krempelte er trotz des Risikos, von Insekten zerstochen zu werden, die Ärmel hoch. Als er die Weste am Sattel festgeschnallt hatte, ritt er weiter. Er trieb den Hengst zu einem schnelleren Schritt an und steuerte auf die Schilfinsel zu, die am weitesten entfernt war und wo er zur Rückkehr wenden wollte.
Immer öfter schüttelte der Hengst unwillig den Kopf und peitschte mit dem Schweif, ein Zeichen dafür, dass ihm die Bremsen zu schaffen machten. Auf seinen Flanken und am Hals bildeten sich schweißfeuchte Stellen und zogen die hartnäckigen Blutsauger an, die man nur durch einen Renngalopp loswerden konnte. Aber der war im Wasser unmöglich. Langsam näherten sie sich der südlichsten Insel. Julien dachte an all die Ausritte, bei denen ihn Titus weit durchs Schwemmland getragen hatte. Wie sehr hatte er das Land, seine Einsamkeit und Schönheit genossen. Für zahlreiche Vogelarten waren diese Sumpfgebiete ein Paradies: vom Purpur- bis zum Rallenreiher, über Kormorane und Säbelschnäbler, Austernfischer bis hin zu den Enten. Im Laufe der Jahre war er auf viele verschiedene Raubvögel gestoßen, er hatte Fischotter, Dachse, Wildschweine und Füchse beobachtet und sogar Schlangen gesehen, darunter auch sehr gefährliche. Julien liebte dieses Land, aber er brachte ihm auch gehörigen Respekt entgegen. Vorsichtig ritt er weiter und sah zum Meer hin. Bei gutem Wetter war der Horizont eine durchgehende und vollendete Gerade, die Himmel und Wasser in einer scharfen Linie trennte. An manchen Tagen hingegen gingen Himmel und Wasser fließend ineinander über und verschmolzen, das waren die gefährlichen Tage, weil man keine Entfernung mehr abschätzen konnte.
Konzentriert ritt er weiter nach Süden und schaute nur ab und zu auf den Kompass, um die Richtung zu kontrollieren. Denn es konnte sehr wohl geschehen, dass man im Kreis ritt, wenn Land und Wasser solch eine dunstige Einheit bildeten.
Seit Jahrhunderten vermengten sich hier Süßwasser, Salzwasser und Erde zu einem einzigartigen Gebiet, weil der Fluss, das Meer und der Mistral, der immer wieder Dünen aufwarf und abtrug, ständig ihre Struktur veränderten. Selbst jemandem, der schon viele Jahre in dieser Region lebte, fiel es schwer, sich nach einem Sturm, nach einem Hochwasser oder einer Flut zurechtzufinden. Obwohl Julien die Gegend so gut kannte, behielt sie auf diese Weise immer etwas Geheimnisvolles für ihn.
Als Julien die südlichste Schilfinsel erreicht hatte, schaute er zum Festland zurück. Fern am trüben Horizont konnte er die kleinen, fast undurchdringlichen Wäldchen aus buschigen Wacholderbäumen sehen, die festen Boden ankündigten und den wenigen Raubkatzen, die hier lebten, als Versteck dienten. Die Luft vibrierte in der Hitze, die Distanz zu jenen Gehölzen war nicht mehr abzuschätzen. Es wurde Zeit, umzudrehen. Vorsichtig ritt er auf den noch nicht überspülten Sand. Bei Gefahr flüchteten oft Nattern auf die Inselchen, und er wollte vermeiden, dass sein Pferd scheute oder gar gebissen wurde.
Der Himmel wurde dunkler, es kam Wind auf, und erste dicke Regentropfen fielen vom Himmel. Julien nahm den Feldstecher und suchte auf den Sandbänken nach den Flamingos. Zu seiner Bestürzung konnte er nicht einen einzigen Vogel entdecken. Er schaute erneut zum Meer hinüber. Die Wellen hatten eine schmutzig graue Farbe angenommen und schoben weiße Schaumkronen vor sich her. Mit Schrecken stellte er fest, dass die bedrohliche Wolken- oder Regenwand beängstigend nah gekommen war und gewaltige Regengüsse vor sich herpeitschte. Er ließ das Pferd sofort wenden und ritt zurück ins Wasser, das dem Hengst mittlerweile fast bis zum Bauch reichte und jede schnelle Gangart verhinderte.
Nach ein paar Minuten erreichte er die nächste Insel. Er überquerte sie langsam, um nach zurückgebliebenen Tieren zu suchen, fand aber keine und ritt so schnell wie möglich weiter.
Auf der vierten Insel lag, tief im Schilf verborgen, ein Fohlen. Es war noch feucht von der Geburt und höchstens ein, zwei Stunden alt. Teile seines Fells waren noch in Eihaut gehüllt, ein Zeichen, dass die Stute ihr Fohlen fluchtartig verlassen hatte, bestimmt hatten seine Hirten die Herde weggetrieben. Dabei konnten sie weder Rücksicht auf Jungtiere nehmen, noch hatten sie die Zeit, nach Fohlen zu suchen, wenn sie alle Herden retten wollten. Genau aus diesem Grund war er hier. Julien hoffte, allein gelassenen Tieren zu helfen. Er sprang ab, befreite das wild um sich schlagende kleine Hengstfohlen von dem restlichen Eisack und fesselte ihm die Vorder- und Hinterbeine. Dann nahm er es auf, legte es über den Hals seines Pferdes, schlang das Seil um seinen kleinen Körper und befestigte es am Sattelknopf. Als er fertig war, zog er seine Weste wieder an, saß auf und trieb Titus zurück in die Wassermassen, die sich bereits leicht an der Oberfläche kräuselten.
Der schwache Wind war mittlerweile zu heftigen Böen angeschwollen. Julien drehte sich um. In der finsteren Wand hinter ihm zuckten Blitze, und fernes Donnergrollen mahnten zur Eile.
Mittlerweile regnete es in Strömen, und auch der Wind wurde immer heftiger, er peitschte bereits durch das Schilf der nächsten Insel. Schnell ritt Julien darüber hinweg, und während er nach der nächsten Erhebung Ausschau hielt, holte er das Handy aus der Tasche und rief Jacques an, der sich sofort meldete.
»Hier Montellet. Ich bin ungefähr auf der Höhe des Etang de Tourmente. Ich habe ein Fohlen gefunden und suche noch weiter, aber ich habe ein Unwetter mit Blitz und Donner im Nacken. Das Wasser läuft ziemlich schnell auf, und ich weiß nicht, ob ich Le Mas erreiche. Sagen Sie dem Vorarbeiter, er soll mir zwei Leute schicken. Ich schieße alle halbe Stunde eine Leuchtpatrone ab, es wird hier draußen bereits dunkel.«
»Sollten wir nicht die Küstenwache mit dem Hubschrauber alarmieren, Monsieur?«
»Vorläufig nicht. Ich werde mein Pferd nicht im Stich lassen und möchte noch weitersuchen.«
»Jawohl, Monsieur, aber bitte melden Sie sich, wenn Sie Hilfe brauchen.«
»Auf jeden Fall.«
Julien steckte das Handy ein, zog die Weste zu, um sich wenigstens etwas vor dem Regen und dem kälter werdenden Wind zu schützen, und ritt weiter. Zehn Minuten später entdeckte er ein Stierkälbchen, das zitternd im Schilf lag, ein Bein völlig verdreht von sich gestreckt. Er stieg ab und untersuchte das Tier. Das Bein war nur verrenkt. Wäre es gebrochen gewesen, hätte er das Kleine erschießen müssen. So aber hob er es hoch, legte es Titus auf den Rücken und band es hinten am Sattel fest. Während das Fohlen immer noch strampelte und versuchte, sich loszureißen, blieb das Kalb apathisch und ruhig liegen, als sie sich in Bewegung setzten.
Julien wusste, dass er seinen Hengst nicht noch mehr belasten konnte. Da das Wasser Titus mittlerweile bis zu den Flanken reichte, stieg Julien ab, als sie die nächste Erhebung passierten, und führte seinen Hengst, um ihn nicht noch mehr zu belasten. Dann schoss er die erste Leuchtpatrone ab. Inzwischen war es acht Uhr und fast dunkel. Sie kamen nur noch langsam vorwärts. Das Wasser reichte Julien nun bis zur Hüfte. Je näher sie dem Festland kamen, desto geringfügiger stieg das Wasser, da das Delta hier noch einmal sehr breit wurde und die Flut sich über viele Kilometer hin verteilen konnte, bevor die Küste das Schwemmland wieder einengte und der Wasserpegel schneller hochging. Bald haben wir es geschafft, sagte er immer wieder, um die Tiere zu beruhigen.
Der Wind brachte die Kälte der aufgewühlten See mit. Doch trotz der rasch fallenden Lufttemperatur und des Regens schwitzte Julien. Im diffusen Licht sah er weiße Schaumkronen auf dem sonst so ruhigen Brackwasser. Sie kündigten noch stärkeren Wind an. Niedrige Wolkenfetzen trieben wie schwarze Girlanden über ihn hinweg. Er war nass bis auf die Haut und hatte das Gefühl, nie wieder trocken zu werden. Obwohl er schon manchen Sturm hier draußen erlebt hatte, war er beinahe entsetzt über die Gewalt, die sich hinter ihm aufbaute. Julien redete seinem Pferd gut zu, trieb es zu einer schnelleren Gangart an, musste jedoch einsehen, dass weder der Hengst noch er selber zügiger vorankamen. Um halb neun schoss er die zweite Leuchtpatrone ab. Das Wasser reichte dem Pferd bis an die Satteltaschen und ihm selbst fast bis zur Brust. Noch einmal fingerte er das Handy aus der obersten wasserdichten Tasche seiner Weste und rief Jacques an.
»Es wird eng! Die Männer müssen mich sofort hier rausholen. Ich schieße ab jetzt alle fünf Minuten Patronen ab, damit sie mich orten können. Wenn der Sturm die Wellen heranpeitscht, überrollen sie uns. Versuchen Sie, ein Boot loszuschicken, ich will unbedingt die Tiere …«
Die Verbindung war abgebrochen.
Und während Julien versuchte, mit Taschenlampe und Kompass den Weg in Richtung Le Mas beizubehalten, wurde auf dem Gut die Rettungsaktion gestartet. Die wenigen noch verfügbaren Männer wurden zusammengerufen, man verlud das Schlauchboot mit dem starken Außenbordmotor auf einen Anhänger, und ein paar Minuten nach dem Hilferuf fuhr der Traktor mit dem Rettungstrupp und dem Hänger los, um vom nahe gelegenen Kanal aus in die Wasserwüste zu starten.
Von der nächsten Schilfinsel aus konnte Julien die landnahen Sträucher und Ginsterbüsche erkennen. Gerade als er weiter in Richtung Festland vordringen wollte, entdeckte er ein kleines Stutenfohlen, das unbeholfen versuchte, davonzulaufen, aber aus Furcht vor dem Wasser immer wieder zurückwich. Es schien panische Angst vor dem Menschen mit dem Licht zu haben. Nach ein paar Minuten gelang es Julien, das Tier mit dem Lasso einzufangen und ihm die Beine zu fesseln, damit es nicht doch noch ins Wasser stürmte und ertrank.
Er klopfte seinem unruhiger werdenden Hengst den Hals und sprach beruhigend auf ihn ein: »Keine Angst, mein Junge, sie kommen und holen uns hier raus. Du hast deine Sache ganz großartig gemacht.«
Doch ohne Hilfe waren sie verloren, sie konnten hier nicht mehr fort. Die Insel wurde zwar schon von kleinen Wellen überspült, war aber sicherer als das aufgepeitschte Wasser rundherum. Als ein Wirbel ihm Sprühwasser ins Gesicht peitschte, leckte sich Julien die Lippen und schmeckte das Salz. Das Meer hat uns also erreicht, dachte er und wischte mit der Hand das Wasser aus den Augen, weil das Salz brannte.
Titus wurde immer unruhiger. Er stampfte mit den Hufen und schüttelte sich. Er wollte die Last auf seinem Rücken loswerden. Der Geruch des neugeborenen Fohlens und des Rinderkälbchens behagten ihm sicher nicht. Julien klopfte ihm den Hals und wiederholte dabei immer wieder: »Ruhig, Titus, wir haben es gleich geschafft.«
Aber der Hengst mit seinem feinen Instinkt spürte die Gefahr, wieherte mehrmals, stieß ihn mit dem Kopf weg und versuchte, sich loszureißen.
»Sei brav, mein Junge, ich helfe dir.«
Vorsichtig band Julien die beiden Jungtiere los und legte sie, die Beine weiter gefesselt, etwas abseits auf den Boden. Dann nahm er seinem Pferd den schweren, mit Wasser vollgesogenen Sattel ab und hängte die Satteltaschen an einen Wacholderstrauch, den das Wasser noch nicht erreicht hatte. Während er den Hengst festhielt, beobachtete er die Jungtiere am Boden, die immer wieder von kleinen Wellen überrollt wurden. Sie lagen still im seichten Wasser und schüttelten sich, so gut es ging, sobald eine Welle abgeebbt war.
Wenn man uns nicht bald abholt, sind wir alle verloren, dachte Julien und lauschte in die Dunkelheit. Dann schoss er die nächste Patrone ab, deren rote Leuchtspur in den tiefhängenden Wolken jedoch binnen weniger Sekunden verschwunden war. Der Hengst, zwischenzeitlich übernervös, versuchte, sich loszureißen. Das zischende, grellrote Licht versetzte ihn in Panik. Er schnaubte heftig, schlug mit den Vorderbeinen nach Julien und versuchte, sich durch Beißen vom Zügel zu befreien, der ihn an der Flucht hinderte. Seine Muskeln spannten sich, und er warf sich mit aller Macht nach hinten. Julien brauchte seine ganze Kraft, um das Pferd zu halten und den Vorderhufen auszuweichen. Er wollte das Tier auf keinen Fall verlieren. Es hatte Jahre gedauert, bis sein Zuchtversuch diesen Erfolg gebracht hatte. Außerdem hing er an dem Tier. Wenn er den Hengst jetzt laufenließ, war es fraglich, ob er sich aufs Festland retten konnte oder ob ihn die fehlende Orientierung zum Meer hinaustreiben würde. Titus war im Stall und nicht in den Sümpfen aufgewachsen, ihm fehlten die Urinstinkte der Wildpferde.
Plötzlich hielt der Hengst mitten in einer Bewegung inne und spitzte die Ohren. Julien sprach noch immer beruhigend auf ihn ein. Dann hörte auch er das ferne Geräusch eines Motors. Noch einmal schoss er eine Leuchtpatrone ab. Kurz darauf sah er in der Ferne das grüne Signal, ein Zeichen dafür, dass man ihn geortet hatte.
Wenig später rauschte das Boot heran. Julien sah erst die weiße Bugwelle, die das aufschäumende Wasser durchschnitt, dann hörte er die Rufe seiner Männer. Sie stellten den Motor ab, und das Boot glitt lautlos an den Rand der kleinen Insel. Zwei Männer sprangen heraus und wateten an Land. Der Hengst verspannte sich wieder, aber es gelang Julien, ihn zu beruhigen. Dann rief er den Männern zu: »Da drüben liegen drei Jungtiere, die müssen zuerst an Bord. Vorsicht mit dem Kalb, es hat sich ein Bein verrenkt.«
Als die Tiere verladen waren, zeigte er auf den Sattel und die Taschen und sagte: »Bringen Sie das alles an Bord, und steigen Sie wieder ein.«
»Und Sie, Monsieur?«, fragte einer der Männer.
»Ich führe den Hengst seitlich an das Boot und steige dort ein, um dem Motor auszuweichen. Dann halte ich Titus am Zügel fest, während er neben uns herschwimmt. Wir müssen ganz langsam fahren, damit er es schafft.«
Julien ging ins Wasser, das ihm nach wenigen Schritten bis zur Schulter reichte. Titus war auf einmal erstaunlich ruhig. Als er mit dem Hengst die Außenseite des Schlauchbootes erreicht hatte, zogen ihn die Männer über die dicke Gummiwulst ins Boot. Er befahl, den Motor so leise wie möglich zu starten und ganz langsam anzufahren, um das Pferd nicht zu erschrecken. Als sie sich in Bewegung setzten, schwamm der Hengst sofort nebenher. Immer wieder sprach Julien auf das Tier ein, ermunterte es, beruhigte es und zog es behutsam mit. Nach etwa zehn Minuten wurde das Wasser flacher. Titus schien Boden unter den Hufen zu spüren. Bald lief er neben dem Boot her und schüttelte sich. Wenig später hatten sie den Kanal erreicht, der in weitem Bogen bis in die Nähe des Gutes führte. Orkanartige Böen trieben Wolken und Wasser nach Norden. Die ersten Wellen waren bereits über die Weiden geschwappt und hatten große Wiesenflächen überspült.
Erleichtert rief er Jacques an.
»Wir sind im Kanal und in Sicherheit. Was sagt der Wetterbericht?«
»Gott sei Dank, Monsieur, dass es Ihnen gutgeht. Wir waren in großer Sorge. Der Wind hat erneut gedreht. Der Sturm kommt jetzt direkt aus Osten, die Hochflut wird uns also nicht voll treffen. Allerdings wird das Wasser wahrscheinlich noch um einen Meter steigen, sagt das Seewetteramt. Wir haben wohl noch einmal Glück gehabt.«
»Danke, Jacques. Das sind gute Nachrichten. Ich bin in dreißig Minuten da. Holen Sie mich bitte am Landesteg ab.«
Er steckte das Handy weg und strich seinem Pferd, das im mittlerweile flacheren Wasser neben dem Boot herlief, über die Flanke.
»Noch einen Meter, mein Junge, und wir hätten es nicht geschafft.« Erst jetzt spürte er, wie angespannt er war. Er gab einem der Männer die Zügel, um sich ein bisschen zu strecken. Nass bis auf die Haut, durchgefroren bis auf die Knochen, erschöpft und ausgelaugt – dennoch fühlte er sich so glücklich wie selten. Trotz seiner beinahe fünfzig Jahre hatte er bravourös einen großen Kampf gewonnen: Er hatte drei Jungtieren das Leben gerettet, seinem Hengst gezeigt, wer der Herr war, dem Unwetter ein Schnippchen geschlagen und die verdammte eigene Angst besiegt. Und das alles in einer Nacht.
Jacques erreichte gerade mit dem Jeep den Landesteg, als das Boot mit den Männern und Jungtieren sowie Titus, der nebenherlief, anlegte.
Montellet, eine Decke um die Schultern gelegt, kümmerte sich persönlich um das Verladen der Jungtiere. Er hielt das verletzte Bein des Kälbchens, während die Männer den Körper in den Jeep hoben, mit dem die Tiere, zu ihrer Sicherheit immer noch gefesselt, abtransportiert werden sollten. Es goss nach wie vor in Strömen, aber ungeachtet seines persönlichen Zustandes, packte Montellet mit an, bis die Tiere gesichert im Wagen lagen. Dann führte er Titus in den Transporter, der dem Jeep angehängt war. Der Hengst zitterte am ganzen Körper. Er war über einen Kilometer geschwommen, bevor er Boden unter die Hufe bekommen hatte, und das Wasser war ihm bis über den Körper gegangen. Montellet sprach beruhigend auf das Tier ein, nahm die Decke von seinen Schultern und legte sie dem Titus über den Rücken, bevor er den Transporter verließ und in den Jeep einstieg.
»Wir können fahren, Jacques. Was ist mit den Hirten? Sind sie in Sicherheit?«
»Soweit ich das verfolgen konnte, Monsieur Montellet, haben alle Männer die Wagen erreicht, die sie zurückbringen sollten.«
»Und die Herden?«
»Darüber weiß ich nichts, aber der Vorarbeiter wird inzwischen auf dem Gut sein, um Sie zu informieren.«
»Und der Wetterbericht?«
»Das Wasser steigt noch bis etwa elf Uhr, dann tritt Ebbe ein, und es wird langsam fallen.«
»Mit der Ebbe ist das keine großartige Sache hier am Mittelmeer. Wie entwickelt sich der Sturm?«
»Der Wind ist ganz nach Osten abgebogen, der Orkan trifft weiter westlich auf die Küste. Es sieht so aus, als ob die Camargue vom Schlimmsten verschont bleibt.«
»Sagen Sie bitte Maurice, er soll Claude in einer Viertelstunde in mein Arbeitszimmer rufen, damit wir die nächsten Schritte planen können.«
Unvermindert ergoss sich der Regen auf das Land. Die Scheinwerfer kamen kaum gegen die graue Wand an, und über große Strecken hinweg war die Straße vom Wasser überspült.
Jacques musste sich ganz auf die Fahrt konzentrieren, um nicht vom Weg abzukommen. Nach einer Weile erreichten sie endlich etwas höher liegendes Gelände, und die Fahrt wurde einfacher.
»Darf ich fragen, Monsieur, wie es da draußen aussah?«
»Ich habe nicht viel erkennen können, der Dunst war zu dicht. Einmal sah ich in der Ferne eine riesige graue Wand auf mich zukommen, wusste aber nicht, ob es eine haushohe Flutwelle oder eine Wolkenbank war, die da herangepeitscht wurde. Nun ja, eine Flutwelle war es nicht, sonst wäre ich jetzt nicht hier, aber die Regenmassen hätten auch gereicht.«
Auf dem Gut angekommen, ging Julien ins Bad. Er legte die nassen Sachen auf den Fliesenboden und stellte sich unter die Dusche. Der heiße Wasserstrahl löste die Verspannungen und weckte seine Lebensgeister. Er spürte, wie sich sein Körper langsam aus der Starre von Kälte und Erschöpfung befreite. Das Badetuch um die Hüften geschlungen, ging er in sein Schlafzimmer, wo Maurice bereits wie immer frische Kleidung zurechtgelegt hatte. Während er sich anzog, sah er sich in dem großen, ungemütlichen Raum um. Seit das Bett seiner Frau nach ihrem Tode entfernt worden war, wirkte das Zimmer ungemütlich und unpersönlich. Es gab nichts, was hier eine wohnliche Atmosphäre verbreitet hätte. Als Corinne noch lebte, war dieser Raum stets von Lebendigkeit erfüllt, hier und da lagen Kissen, Bilder, Blumen, Flakons und Döschen schmückten das Zimmer. All das fehlte nun. Selbst die bunten Bettbezüge waren steifem, weißem Leinenzeug gewichen. Julien fröstelte, er war müde. Weshalb Zeit und Gedanken an einen Raum verschwenden, in dem man lediglich schlief?
Etwas wehmütig dachte er an Corinne zurück, die nun schon seit vier Jahren tot war. Ihr Sterben hatte zwei Jahre gedauert. Es war furchtbar gewesen, sie leiden zu sehen, zuletzt war ihr Tod ihm beinahe wie eine Erlösung erschienen. In Gedanken sah Julien das Bild seiner Frau vor sich – Corinne war eine liebevolle Mutter gewesen. Sie hatten eine gute Ehe geführt, jedenfalls war das seine Meinung, eine nüchterne, emotionslose, aber gute Ehe, der zwei herrliche Töchter entstammten. Wie gern hätte er auch noch einen Sohn gehabt …
Früher war das Haus voller Leben gewesen. Corinne lud häufig irgendwelche Freunde ein, die Kinder hatten immer andere Kinder zu Besuch, Juliens Brüder und Corinnes Verwandte verbrachten regelmäßig die Ferien auf dem Gut. Es war keineswegs der ständige Trubel, den er jetzt vermisste, im Gegenteil, damals waren ihm die vielen Leute im Haus oft zu viel. Was ihm fehlte, war die Unbeschwertheit, die Lebenslust und die Fröhlichkeit jener Tage, die ihn vom Ernst der Arbeit, den Aufgaben, Pflichten und der Verantwortung ablenkten. Das hatte ihm gutgetan. Er brauchte die Ausflüge, die Picknicks, die mit Musik erfüllten Abende und die wöchentlichen Feste nicht unbedingt zum Leben, aber er vermisste ein Haus voller Lebensfreude. Etwas musste sich ändern, Julien wollte nicht zum menschenfeindlichen Einsiedler in diesem großen, leeren Haus werden. Er musste auch an seine Töchter denken. Gleich morgen früh rufe ich sie an, nahm er sich vor.