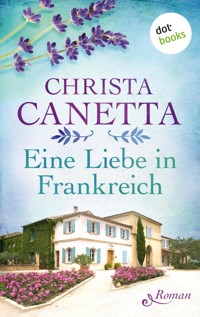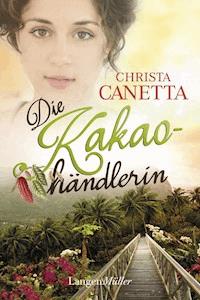Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn das Schicksal Amor spielt: Der Romantik-Sammelband »Eine Landärztin zum Verlieben« von Bestseller-Autorin Christa Canetta als eBook bei dotbooks. »Frau Doktor, wir haben ein Problem!« Die junge Ärztin Sabine Büttner fällt aus allen Wolken, als sie ihren Verlobten in flagranti erwischt. Oder ist das vielleicht genau der Schubs, den sie gebraucht hat, um sich endlich vom hektischen Großstadtleben verabschieden zu können? Voller Hoffnung im Herzen übernimmt Sabine eine Landarztpraxis in der Lüneburger Heide – doch so friedlich, wie es die malerische Natur verspricht, geht es hier nicht zu. Das liegt auch an Paul, dem Sabine immer wieder über den Weg läuft: Der attraktive Förster ist zwar ein Experte für die Hege und Pflege von Mufflon-Lämmer … aber deutlich weniger geschickt im Umgang mit Frauen! Wird Sabine ihr Glück auf dem Land finden – oder sich schon nach kurzer Zeit Hals über Kopf in das Abenteuer eines Auslandseinsatzes stürzen? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Im romantischen Sammelband »Eine Landärztin zum Verlieben« von Bestseller-Autorin Christa Canetta genießen Sie die beiden Liebesromane »Die Heideärztin« und »Die Heideärztin unter dem Kreuz des Südens«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 802
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
»Frau Doktor, wir haben ein Problem!« Die junge Ärztin Sabine Büttner fällt aus allen Wolken, als sie ihren Verlobten in flagranti erwischt. Oder ist das vielleicht genau der Schubs, den sie gebraucht hat, um sich endlich vom hektischen Großstadtleben verabschieden zu können? Voller Hoffnung im Herzen übernimmt Sabine eine Landarztpraxis in der Lüneburger Heide – doch so friedlich, wie es die malerische Natur verspricht, geht es hier nicht zu. Das liegt auch an Paul, dem Sabine immer wieder über den Weg läuft: Der attraktive Förster ist zwar ein Experte für die Hege und Pflege von Mufflon-Lämmer … aber deutlich weniger geschickt im Umgang mit Frauen! Wird Sabine ihr Glück auf dem Land finden – oder sich schon nach kurzer Zeit Hals über Kopf in das Abenteuer eines Auslandseinsatzes stürzen?
Über die Autorin:
Christa Canetta ist das Pseudonym der deutschen Journalistin und Autorin Christa Kanitz (1928–2015). Sie studierte Psychologie und lebte in der Schweiz und Italien, bis sie sich in Hamburg niederließ. Sie arbeitete für den Südwestfunk und bei den Lübecker Nachrichten; 2001 begann sie in einem Alter, in dem die meisten Menschen über den Ruhestand nachdenken, mit großem Erfolg, Liebesromane und historische Romane zu schreiben.
Von Christa Kanitz erschien bei dotbooks der Roman »Die Liebe der Kaffeehändlerin«.
Unter ihrem Pseudonym Christa Canetta veröffentlichte sie bei dotbooks »Eine Liebe in Frankreich«, »Das Leuchten der schottischen Wälder«, »Schottische Engel« und »Schottische Disteln«.
Ebenfalls bei dotbooks erschienen die Romane »Jenseits der Grillenbäume«, »Im Land der roten Erde« und »Sommerwind über der Heide« aus dem Nachlass von Christa Kanitz: Drei zuvor unvollendete Romane, denen ihre Töchter – darunter die erfolgreiche Autorin Brigitte D’Orazio – gemeinsam den letzten Schliff verliehen und die nun unter dem Namen von Christa Kanitz‘ Enkeltochter Virginia veröffentlicht wurden.
***
Sammelband-Originalausgabe August 2021
Copyright © der Originalausgabe »Die Heideärztin« 2006 by Moments in der area verlag GmbH, Erftstadt; Copyright © der Neuausgabe 2013, 2021 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe »Die Heideärztin unter dem Kreuz des Südens« – ursprünglich veröffentlicht unter dem Titel »Der Ruf des Leoparden« – 2008 area verlag GmbH, Erftstadt; Copyright © der Neuausgabe 2014, 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Nomad_Soul / aprilante / 2seven9 / Ingo Bartussek / Gayvoronskaya_Yana sowie © pixabay / buntysmum
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-681-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Eine Landärztin zum Verlieben« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Christa Canetta
Eine Landärztin zum Verlieben
Zwei Romane in einem eBook
dotbooks.
DIE HEIDEÄRZTIN
Für Thorsten
Kapitel 1
Der schrille Schrei des Telefons riss Sabine aus dem ersten Tiefschlaf dieser Nacht. Erschrocken und verwirrt setzte sie sich auf und griff zum Hörer. Die Leuchtziffern des Weckers zeigten genau zwei Uhr an.
»Büttner«, murmelte sie verschlafen
»Schnell, Doktor Büttner, Sie werden in der Notaufnahme gebraucht.«
»Aber ich habe doch heute keinen Bereitschaftsdienst«, protestierte Sabine, weil sie wusste, dass solche Versehen in der Zentrale durchaus passierten.
»Sie werden gebraucht, bitte beeilen Sie sich«, mahnte die ungeduldige Frauenstimme am anderen Ende der Telefonleitung.
»Bin schon unterwegs«, rief Sabine und sprang aus dem Bett. Nach der Betätigung eines kleinen Schalters auf dem Nachttisch ging in der ganzen Wohnung das Licht und in der Küche die Kaffeemaschine an. Diese Installation hatte sie ein kleines Vermögen gekostet, aber sie half ihr bei plötzlichen Einsätzen, schnell ganz wach zu werden und sich in Windeseile fertig zu machen. Mit dem gleichen Knopfdruck eines Schalters neben der Eingangstür konnte sie alle elektrischen Geräte und Lampen wieder ausschalten.
Es war nur ein kleines Appartement im Ärztehaus, das Sabine bewohnte – Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Bad –, aber sie liebte ihr Domizil, und es genügte ihr, weil sie die Räume im Laufe der Jahre sehr persönlich eingerichtet hatte.
Sabine lief ins Bad, spritzte sich Wasser ins Gesicht und Zahncreme in den Mund – fürs Zähneputzen blieb bei einem solchen Anruf keine Zeit –, streifte die weiße Kleidung über, die immer bereitlag, trank etwas von dem brühheißen Kaffee und schlüpfte in Arztkittel und Schuhe. Dann griff sie nach der Notarzttasche, die ihren Platz neben der Wohnungstür hatte, warf das dunkelblaue Lodencape über die Schultern, löschte das Licht und zog die Tür ins Schloss. Sie lief den Flur entlang zum Treppenhaus. Auf den Lift verzichtete sie nachts, der hatte nämlich so seine Tücken. Sie war aus der zweiten Etage schneller unten, wenn sie lief, als wenn sie irgendwo im Lift stecken blieb.
Draußen empfing sie eine bitterkalte Nacht. Obwohl der Kalender Mitte März anzeigte, verbiss sich ein eisiger Nordostwind in ihrer Haut. Ein paar vereinzelte Laternen zeigten ihr den Weg durch den Park zum Krankenhaus. Rechts und links auf dem Rasen, wo das Licht hinfiel, spiegelte sich glitzernder Raureif in hundertfachen Farben. Aber für die Schönheit der Natur hatte Sabine Büttner in dieser Nacht keine Zeit. Sie versuchte, auf dem frostigen Boden die Balance zu halten und so schnell wie möglich das Haupthaus zu erreichen.
Vor dem Eingang zur Notaufnahme herrschte Hochbetrieb: Krankenwagen mit Blaulicht, aber ohne Martinshorn fuhren vor und wieder fort, Schwestern, Ärzte und Sanitäter eilten hin und her. Leise Kommandos und hundert Fragen füllten die hektische Atmosphäre.
Sabine blieb einen Augenblick neben der Außentür stehen. Ihr Herz jagte, und sie musste tief durchatmen, um dieses Herzrasen zu bekämpfen. Sie lehnte sich gegen die Wand, weil ein leichter Schwindel festen Halt forderte. ›Jochen Bellmann muss mich durchchecken‹, dachte sie erschrocken, ›diese Herzattacken nehmen zu. Ist ja auch kein Wunder bei diesem Stress. Da hat man nach sechsunddreißig Stunden Bereitschaftsdienst endlich eine Nacht lang Ruhe, und dann wird man doch aus tiefstem Schlaf gerissen. Eigentlich habe ich nichts gegen die Hektik, aber vielleicht sollte ich doch ab und zu auf meinen Körper hören.‹
Sabine griff in die Tasche und zog die Briefchen mit den Tenormin-Tabletten heraus. ›Zur Not muss es eben ohne Wasser gehen‹, dachte sie und zerkaute das bittere Medikament. Seit drei Monaten hatte sie diese Tabletten immer griffbereit. Sie war Ärztin genug, um zu wissen, was Herzrhythmusstörungen bedeuteten. ›Aber mit dreiunddreißig ist es einfach zu früh für solche Medikamente‹, schalt sie sich. ›Ich sollte mir endlich die ruhige Landarztpraxis suchen, von der ich während des Studiums geträumt habe. Wenn da nicht Axel wäre ...‹ Und dann dachte sie für einen Augenblick an den Chirurgen Axel Bentrop. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht, als sie ihren Verlobten in Gedanken vor sich sah. Seinetwegen blieb sie im Unfallklinikum Großbresenbek. Er war der stellvertretende Chefarzt und würde die Klinik nie verlassen. Für einen flüchtigen Moment dachte sie sogar an ihre Hochzeit, die für Ostern geplant war. ›Vielleicht gelingt es mir dann, als seine Frau, ihn von dieser Hektik zu lösen und einen ruhigeren Lebensrhythmus für uns beide zu finden.‹
Sabine atmete noch einmal tief ein. Das Herz hatte sich beruhigt.
Sie ging in die Notaufnahme und erkundigte sich am Zentralverteiler: »Doktor Büttner, wo werde ich gebraucht?«
Eine Mitarbeiterin suchte im Computer. »Drittes Obergeschoss, Station vier. Man wartet auf Sie.«
»Was ist da los? Wer erwartet mich?«
»Weiß ich nicht«, erklärte die Schwester. »Ist heute Nacht sehr turbulent. Es gab einen Unfall am Rangierbahnhof. Wir sind überfüllt. Man wird Sie oben einteilen, Doktor.«
Sabine eilte zur Treppe, da die Aufzüge mit Krankentragen besetzt waren. Atemlos nahm sie immer zwei Stufen auf einmal. ›Komisch‹, dachte sie, ›auf der Drei und Vier gibt's doch gar keinen akuten Unfalldienst. Da liegen Rekonvaleszenten.‹
Endlich war sie oben. Sie wartete einen Augenblick, um ihren keuchenden Atem zu beruhigen, dann öffnete sie die Glastür. Außer einigen Notleuchten war der Flur dunkel.
›Seltsam‹, dachte Sabine, ›hier schlafen doch alle. Außerdem ist das die Station von Jochen Bellmann, der würde mich nie aus dem Schlaf reißen.‹ Leise ging sie den Flur entlang. Hinter der Tür mit der Aufschrift »Stationsschwester« brannte Licht. Sie klopfte leise und trat ein. Am Schreibtisch saß keine Nachtschwester, sondern der Arzt persönlich.
»Hallo«, sagte sie leise, »was ist denn los, Jochen?«
Der Arzt stand auf, reichte ihr die Hand und bat sie: »Komm mit, ich muss dir etwas zeigen.«
Sprachlos sah sie ihn an. »Nur um mir etwas zu zeigen, holst du mich mitten in der Nacht aus dem Bett?«
»Warte es ab.«
Sabine schüttelte den Kopf, folgte ihm aber über den langen Flur. Jochen Bellmann war der rücksichtsvollste Mann, den sie kannte, und seit vielen Jahren ein guter Freund. Als sie in der Klinik anfing, damals, als Assistenzärztin, hatte er sie unter seine Fittiche genommen und ihr den Einstieg auf jede erdenkliche Art leicht gemacht. Als Oberarzt hatte er sie vor eifersüchtigen Schwestern geschützt, die der jungen, gut aussehenden Ärztin das Leben zur Hölle machen wollten. Er hatte sie in Schutz genommen, wenn bei der Arbeit Schwierigkeiten aufgetaucht sind, hatte für genügend Freizeit gesorgt, in der sie sich vom Stress der Unfallklinik hatte erholen können, und hatte ihr geholfen, sich in der fremden Großstadt zurechtzufinden. Er hatte sie auf ihrem Weg die Karriereleiter hinauf unterstützt und zu dem gemacht, was sie heute war: eine kompetente, energische, von allen geachtete Medizinerin, der die Klinikleitung großes Vertrauen entgegenbrachte.
Und dann hatte sie Axel Bentrop kennen gelernt und sich sofort in den neuen stellvertretenden Chefarzt verliebt. Er war charmant, umwarb sie mit Zärtlichkeiten, mit Blumen und kleinen Präsenten, führte sie zum Essen aus und fuhr sie in seinem schnittigen Porsche durch die Gegend, wenn es die Zeit erlaubte. Er verkörperte alles, was sie sich von einem Mann erträumt hatte – obwohl, viel Erfahrung mit Männern hatte sie nicht.
Jochen Bellmann, der diese Entwicklung mit Sorge, Wut und Traurigkeit beobachtet hatte, zog sich aus ihrem Leben zurück. Er blieb ihr Freund, wenn sie Hilfe brauchte, aber er ließ sie nun allein auf ihrem Weg die Karriereleiter hinauf und in die Arme von Axel Bentrop.
Sie gingen bis ans Ende des langen Flurs. Die dicken Gummisohlen der Ärzteschuhe, die jeder auf der Station trug, machten keinerlei Geräusch. Als Bellmann vor einer der letzten Türen stehen blieb, legte er seinen Zeigefinger auf die Lippen. Dann stieß er ganz plötzlich die Tür auf, bediente gleichzeitig den Lichtschalter und trat zur Seite. Geblendet starrte Sabine in den Raum. Was sie sah, trieb ihr Herz zur Raserei. Auf dem Krankenbett im leeren Privatzimmer lag ihr Verlobter, eng umschlungen von den Armen und Beinen einer Lernschwester, und befand sich im Endstadium sexueller Befriedigung. Hartes Keuchen und helle, schrille Schreie zeigten das nahende Ende der Vereinigung an. Die beiden Liebenden waren so vertieft, dass sie weder die aufschlagende Tür noch das blendende Licht, noch die Besucher im Türrahmen bemerkten. Versteinert von dem Anblick, blieb Sabine stehen, bis sich die Erregung auf dem Bett gelegt hatte und die Umschlungenen ihre Umwelt wieder wahrnahmen. Als die Augen ihres verblüfften Verlobten sich erschrocken auf sie richteten, drehte sie sich um und verließ das Zimmer. Sie hörte, wie er ihren Namen rief, aber sie ging mit erhobenem Kopf und ohne zu wanken den langen Flur zurück ins Zimmer der Stationsschwester. Erst als der Freund die Tür hinter ihr geschlossen hatte, brach sie schockiert zusammen. Bellmann versuchte, sie zu trösten und zu beruhigen.
Langsam drang das Erlebte in ihr Bewusstsein ein. Sie barg ihr Gesicht in den Händen und versuchte ganz ruhig zu atmen, doch es dauerte lange, bis sie sich so weit gefasst hatte, dass sie fragen konnte: »Warum? Warum hast du das gemacht?«
»Es war der eindrücklichste Weg, es dir zu sagen. Oder hättest du mir geglaubt, wenn ich es dir nur erzählt hätte?«
»Nein«, sagte sie mit heiserer Stimme. »Nein, ich hätte dir nicht geglaubt.« Hätte man sie in diesem Augenblick gefragt, was sie fühle, sie hätte es nicht beschreiben können. Ihre Empfindungen wirbelten in einem solchen Tempo durcheinander, dass sie keinen zusammenhängenden Gedanken fassen konnte. Dann sah sie die Sorge in den Augen des Freundes. »Du warst brutal, aber du hast richtig gehandelt.«
»Siehst du, das dachte ich mir.«
»Seit wann ...?«
»Seit Wochen. Mit wechselnden Personen.«
»Und heute? Warum heute?«
»Ich wusste, dass die Zeit in dieser Nacht reichen würde, um dich zu holen.« Er legte seinen Arm um ihre Schulter, aber alles, was Sabine sah und hörte, waren diese umschlungenen Körper und das Keuchen der Leidenschaft da hinten in dem dunklen Zimmer.
Sie löste sich aus dem Arm, der sie hielt. »Wusste er, dass du ...?«
»Nein. Ich weiß es selbst erst seit fünf Tagen, aber im Haus ist die Sache anscheinend seit langem bekannt. Ein paar Schwestern sind sehr eitel, die müssen einfach plaudern, wenn sie Erfolg bei ihm hatten.«
Sabine atmete tief ein. »Danke, dass du mich auf so drastische Weise gewarnt hast. Ich glaube, ich möchte jetzt gehen.« Sie wusste, wenn sie die nächsten Stunden überstehen wollte, musste sie jetzt allein sein. Und langsam, ganz langsam verwandelte sich die bittere Enttäuschung in einen gesunden Zorn.
»Ich begleite dich. Ich muss nur noch die Nachtschwester zurückbitten.« Er drückte auf einen Knopf auf einer Tafel an der Wand.
Kurz darauf betrat eine ältere Schwester den Bereitschaftsraum. »Alles erledigt?«
»Danke, ja.« Bellmann zog seinen Mantel an, reichte Sabine ihr Cape und führte sie durch die Station, die Treppe hinunter, durch die Notaufnahme und durch den Park. Vor der Tür zum Ärztehaus sah Sabine ihn an. »Ich möchte jetzt bitte allein sein.«
»Ich verstehe. Aber ruf mich an, wenn du mich brauchst. Meine Handynummer hast du ja, ich bin Tag und Nacht für dich da, das weißt du.«
»Ja, danke.« Sabine ging ins Haus, stieg die Treppen hinauf und öffnete ihre Wohnungstür. Diesmal machte sie kein Licht mit dem exklusiven Schalter. Sie schleppte sich ins Wohnzimmer, dann ließ sie sich schluchzend auf die Couch sinken. Sie wusste, dass in diesen Minuten nicht nur ihre Lebensplanung erloschen war, sondern dass auch ihre Arbeit in dieser Klinik augenblicklich beendet war. Hinter ihrem Rücken würde geredet und mit dem Finger auf sie gezeigt werden, und schadenfrohes Grinsen würde ihre Arbeit begleiten. Sie weinte und spülte mit den Tränen ihre Träume und ihre Zukunft fort.
Jochen Bellmann zögerte im Park. Konnte er Sabine nach diesem Schock wirklich allein lassen? Wäre es nicht besser gewesen, bei ihr zu bleiben, sie zu trösten, ihr in seinen Armen Schutz und Geborgenheit zu bieten? Er schüttelte den Kopf. ›Nein‹, dachte er, ›sie ist jetzt erschüttert, schockiert und fassungslos, aber sie ist auch stark, sie wird damit fertig. Ich werde morgen nach ihr sehen. Wenn sie frei hat, gehe ich zu ihr, wenn sie Dienst hat, treffe ich sie auf der Station. Vielleicht ist sie wütend auf mich, weil ich sie praktisch in diese Ernüchterung hineingestoßen habe. Aber ich musste es tun. Bentrop ist ein schrecklicher Casanova, und ich konnte nicht zulassen, dass eine ehrliche und selbstlose Frau wie Sabine in solch eine Falle stolpert. Sie ist in intimen menschlichen Angelegenheiten einfach zu naiv. Sie ist eine wunderbare Ärztin, und ich würde mein Leben in ihre Hände geben, aber als Mensch ist sie zu arglos und zu leichtgläubig.‹
Langsam ging er zurück zur Notaufnahme. Er erinnerte sich, wie hinter Sabines Rücken über ihre Liebe und die bevorstehende Hochzeit getuschelt worden war. Lange Zeit wusste er nicht, weshalb man über sie redete, bis er per Zufall hörte, wie sich zwei junge Ärzte über Bentrop unterhielten: Sie achteten ihn als Mediziner, und sie bewunderten sein chirurgisches Können, aber sie bezeichneten ihn auch als Playboy und unersättlichen Schürzenjäger.
Als er heimlich nachforschte, war seine Bestürzung groß, und er wusste, dass er Sabine vor einem großen Fehler bewahren musste. Selbst auf die Gefahr hin, dass sie ihm das nie verzeihen würde, musste er sie mit der Wahrheit konfrontieren – und zwar auf diese grausame Weise. Hätte er sie mit Worten zu überzeugen versucht, hätte sie ihn ausgelacht und ihm kein Wort geglaubt, das hatte sie ihm eben selbst bestätigt. ›Sie tut mir Leid, aber ein heilsamer Schock ist besser als eine unglückliche Ehe‹, überlegte er und ging zum Eingang des Krankenhauses zurück.
Im Osten kündigte sich erstes Morgengrauen an. In der Notaufnahme herrschte noch immer Hochbetrieb. Der Unfall auf dem Rangierbahnhof hatte mehr Verletzte gefordert, als man zunächst angenommen hatte. Ein Kesselwagen mit Benzin war entgleist und in eine Baracke gerast, in der die Rangierarbeiter gerade eine Mitternachtspause eingelegt hatten.
Jochen Bellmann ging zu seiner Station. Auch hier würden in dieser Nacht alle Betten belegt werden. Aber noch war es ruhig. Er ging in sein Sprechzimmer, weil die Bettenbelegung neu eingeteilt werden musste. Immer wieder jedoch schweiften seine Gedanken hinüber zur anderen Seite des Parks. Was würde Sabine gerade machen? ›Weinen‹, dachte er, ›sie wird weinen.‹ Er sah sie vor sich, das hellblonde Haar zerdrückt und ungekämmt und den Kopf in einem Kissen vergraben. ›Sie ist so zart und so überaus sensibel‹, dachte er. Gleichzeitig wusste er aber auch, dass diese zierliche Frau eine unglaubliche Stärke und Ausdauer besaß. Ohne diese hätte sie die zehn Jahre im Klinikum Großbresenbek nicht durchgehalten.
Aber wie würde es nun weitergehen? Konnte er ihr helfen? Durfte er sich noch stärker einmischen? Damals, als sie in die Klinik gekommen war, um als Assistenzärztin zu arbeiten, hatte er ihr geholfen, weil er sich im allerersten Augenblick in das hübsche Mädchen verliebt hatte. Aber diese Liebe war von ihr nicht erwidert worden. Sie war dankbar, freundlich und lernbegierig gewesen, nicht mehr und nicht weniger. Nach dieser Einsicht hatte er seine Gefühle zuerst verheimlicht und schließlich begraben – aber er blieb stets ihr Freund. Und so hatte er sie als Freund beim gemeinsamen Nachtdienst am Patientensimulator gelehrt, Kranke umzubetten, er hatte ihr Handgriffe gezeigt, die die Schwestern perfekt beherrschten, von denen die junge Ärztin aber keine Ahnung hatte. In seinen Armbeugen hatte sie üben dürfen, Spritzen richtig zu setzen und die Venen auf Anhieb zu treffen ...
Und dann war der neue stellvertretende Chef gekommen, dieser Casanova Bentrop; mit dem er nicht Schritt halten konnte. Dieser Adonis von fast zwei Metern und einem draufgängerischen Charme hatte die Herzen aller Frauen im Sturm erobert. Da hatte er, der kleine Oberarzt, rundlich, unsportlich und mit schütterem Haar, nicht mithalten können. Aber sein Helfersyndrom war geblieben. Auch wenn die intimen Gefühle für Sabine scheinbar gestorben waren, sein Herz und sein Verstand gehörten ihr.
Ungeduldig erhob sich Jochen Bellmann von seinem Stuhl, ging ein paar Schritte, um sich gleich darauf wieder hinzusetzen. Sabine entsprach in allen Punkten dem, was er sich je von einer Frau erhofft hatte – sie war treu, sensibel und selbstlos, gleichzeitig besaß sie trotz ihrer inneren Stärke eine Aura der Verletzlichkeit, die seinen Beschützerinstinkt wachrief. Wie würde es nun weitergehen? Er merkte in diesem Moment, dass seine intimen Gefühle für sie damals wohl doch nicht gänzlich erloschen waren, denn er fühlte, wie sie in seinem Innern neu aufflammten. Sollte er es noch einmal wagen, sie für sich zu gewinnen? Konnte man eine verletzte Seele in solch einer Situation überhaupt durch neue Liebe retten? Wie würde sie reagieren, wenn er jetzt versuchte, erneut um sie zu werben? War sie überhaupt stark genug, sich dem Getuschel im Haus zu stellen, stand sie über diesen Dingen oder zerbrach sie daran – vielleicht in diesem Augenblick?
Bellmann spürte, wie ihm plötzlich der Schweiß ausbrach. War das Angst davor, Sabine nun ganz zu verlieren? Sollte er nicht doch zu ihr laufen, sie einfach in die Arme nehmen? Denn, sollte sie sich entscheiden, die Klinik zu verlassen, konnte er ihr auf keinen Fall folgen.
Seine Existenz und seine Zukunft waren mit der Arbeit hier so eng verbunden, dass eine Trennung ihn zerrissen hätte. Großbresenbek und die Patienten, das war ganz einfach sein Leben.
Und dann hörte er, wie draußen auf dem nächtlichen Flur das Leben Einzug hielt. Krankes, verletztes Leben, und hier war unmittelbare Hilfe gefragt. Seine Station wurde mit Männern belegt, die ganz andere Leiden erdulden mussten als er selbst, denn eine Trennung von Sabine würde Leid bedeuten, das wusste er genau.
Kapitel 2
Sabine weinte nicht lange. Zorn und Stolz besiegten die Tränen schneller, als sie selbst erwartet hatte. Sie knipste die Stehlampe an und ging in ihre winzige Küche, um sich den Kaffee zu holen, den sie vorhin nicht ausgetrunken hatte.
Sie starrte in die Tasse mit der kalten, schwarzen Flüssigkeit und dachte: ›Aus! Vorbei! Alles zu Ende! So schnell geht das also.‹ Dann sah sie sich in dem gemütlichen Zimmer um. Auch das würde bald der Vergangenheit angehören. ›Schade, aber es ist eben alles aus, ich werde rigoros alles aufgeben: die Wohnung, die Arbeit, die Freunde, die idiotische Hochzeit, die ich geplant, und die Familienidylle, von der ich geträumt habe.‹ Mit zwei kräftigen Schlucken leerte sie die Tasse und stellte sie ab. ›Keine Zeit mehr zum Träumen‹, überlegte sie wütend, ›ich muss und ich werde mich der Realität stellen. In der Klinik kann ich nicht bleiben. Ich würde zum Gespött der Mitarbeiter. Wer weiß, wie lange die schon hinter meinem Rücken gelacht und getuschelt haben. Sie wissen es alle, hat Jochen gesagt. Manche werden Schadenfreude spüren lassen, andere werden mich bemitleiden, und beides will ich nicht. Also muss ich gehen.‹ Sie fuhr sich mit den Fingern durch die blonden Locken und dachte an die Pläne, die sie früher einmal gehabt hatte.
›Früher? Mein Gott, wann war das? Es muss eine Ewigkeit her sein, dass ich von einer Praxis auf dem Land geträumt habe, von einem gemütlichen Strohdachhaus und von Menschen, die mit all ihren Sorgen zu mir kommen. Die mir ihr Leben anvertrauen und mich einbeziehen in ihre Familien und in eine wunderbare Gemeinschaft.‹ Aber Sabine wusste auch, dass derartige Träume blankes Wunschdenken waren. Diese heile Welt gab es schon lange nicht mehr, auch in der Abgeschiedenheit eines Dorfs nicht. ›Arbeitslosigkeit, Abwanderung, Existenzangst und Sorgen beherrschen die Dörfer heute‹, überlegte sie und dachte an verlassene Höfe, an brachliegende Felder und verwilderte Bauerngärten. ›Trotzdem‹, machte sie sich Mut, ›ich werde es versuchen. Ich werde die Ärmel hochkrempeln, in die Hände spucken und mich nicht unterkriegen lassen. Und ich werde sofort damit beginnen.‹ Sie zog die Gardine zurück und ließ die kühle Märzmorgensonne ins Zimmer. Dann holte sie ihren Laptop hervor, fuhr das Textverarbeitungsprogramm hoch und schrieb ihre Kündigung – kurz, stolz und selbstbewusst. Danach rechnete sie aus, wie viel Urlaub ihr noch zustand. ›Ich werde heute noch kündigen, sofort Urlaub nehmen und dann nicht mehr wiederkommen. Schade, ich war gern hier, die Patienten sind mir oft sehr ans Herz gewachsen, manche schreiben mir heute noch oder schicken mir Urlaubskarten, und sogar die kleinen oder größeren Intrigen eifersüchtiger Schwestern habe ich ertragen. Ich habe mich durchgesetzt, und man hat mich anerkannt Am Anfang war's eine schwere Zeit, aber da gab es Jochen Bellmann, und dann wurde es von Jahr zu Jahr besser, und zum Schluss war ich wirklich gut. Aus! Vorbei!‹
Sie ging in ihr Badezimmer, ließ Wasser in die Wanne laufen und legte die Arztkleidung ab. ›Fünf Uhr‹, überlegte sie, ›da kann ich ein heißes Bad nehmen und noch ein paar Stunden schlafen, und morgen habe ich frei. Dann werde ich mich um die Zukunft kümmern.‹ Sie glitt tief in das heiße Wasser und atmete den lieblichen Jasminduft des Badeöls ein, das sie schon ewig benutzte. Den Raum füllte dichter Badedampf und beschlug den Spiegel über dem Waschbecken. Die inneren Verspannungen lösten sich und wichen wohltuender Müdigkeit.
Und dann war an Schlaf doch nicht zu denken. Die unsichere Zukunft und viele Erinnerungen zogen durch ihre Gedanken. Und immer wieder sah sie das Paar auf dem Bett vor sich, die bestrumpften Beine der Lernschwester, die sich um den weißen Kittel des Mannes schlangen.
›Meines Mannes‹, dachte sie wütend, ›meines beinahe Mannes! Können diese Mädchen nicht die Finger von einem fast verheirateten Mann lassen? Musste dieser Casanova sich anderweitig bedienen? War ich ihm nicht gut genug? Hab' ich ihn zu lange warten lassen? Aber ich habe nun einmal meine Prinzipien, und ich habe nicht vor, davon auch nur einen Schritt abzuweichen. Erst die Ehe, dann das eheliche Vergnügen. Vielleicht bin ich zu altmodisch in dieser Beziehung, aber meine Achtung vor mir selbst ist mir wichtiger als die Lusterwartungen eines Mannes.‹ Sie strich über ihre Bettdecke und war überrascht von der sehr genauen Erinnerung an die vielen Gespräche, die sie und Axel geführt hatten, an Träume und an Liebesbeteuerungen, die sie sich gegenseitig gemacht, und die Zärtlichkeiten, die sie ausgetauscht hatten, die aber alle vor der Schlafzimmertür enden mussten. ›War das ein Fehler? Diese geschlossene Tür? Dieser Schurke, dieser Wüstling.‹
Sie stand wieder auf und ging ins Bad, um das Gesicht zu kühlen. Als der Spiegel ihr Portrait zurückgab, sah sie Augen voll wilder Wut und ein selbstbewusstes Lächeln. Eine Aussprache würde es nicht geben. Nein, was sie gesehen hatte, nachts auf Station vier, war an Klarheit nicht zu überbieten.
Zurück in ihrem Bett, zog sie Bilanz: ›Existenz, Liebe, Zufriedenheit und Wohnung – alles weg. Was bleibt? Ich bleibe‹, dachte sie trotzig. ›Ich bleibe und mein Stolz, meine Kraft, meine Energie, mein Selbstbewusstsein, mein Können, und finanziell bin ich zum Glück unabhängig.‹
Sabine dachte an ihre verstorbenen Eltern, die ihr ein Vermögen hinterlassen hatten. Unerwartet und viel zu früh waren sie während einer Expedition bei einem Flugzeugabsturz über dem peruanischen Urwald ums Leben gekommen. Ihr Vater, Hobbyarchäologe und besessen von der Erforschung der frühen Inkadynastien, hatte jede Minute freier Zeit in die Forschung gesteckt. Als er fünfzig wurde und die Silberhochzeit überstanden war, wie er liebevoll betonte, hatte er das familieneigene Stahlwerk in Essen verkauft, einen Teil des Vermögens seiner Tochter überschrieben und dann mit seiner Frau zusammen die abenteuerlichsten und gefährlichsten Reisen unternommen.
Sabine war gerade zwanzig Jahre alt, als das Unglück geschah. Zu dem Leid über den Verlust der geliebten Eltern kam die Angst vor der Zukunft. Geldsorgen hatte sie nicht, denn sie war Alleinerbin, aber das Alleinsein, das Fertigwerden mit dem Leben, das sie bisher in der Geborgenheit der elterlichen Liebe geführt hatte, machte ihr Angst. Aber diese Angst machte sie auch stark. Und bis heute hatte sie diese Stärke nie verlassen. ›Ich brauche nicht die Schulter eines Mannes, um mich daran auszuruhen, ich brauche nicht das Gehalt eines Klinikdirektors, um gut leben zu können. Ich werde mich vollständig neu orientieren, ich werde nur noch tun, wozu ich Lust habe, und mir eine Arbeit suchen, die mich erfüllt. Ich bin gern Ärztin, und jetzt werde ich die Praxis suchen, von der ich schon so lange träume. Keine Spezialpraxis für dies oder das, sondern eine Praxis für alle Leiden und für alle Menschen. Eine Praxis auf dem Land, die für alle offen ist: für die Großen und die Kleinen, für die Alten und die Jungen, für die Gutbetuchten und für die Armen – für alle eben.‹ Und mit dem Gedanken an ein gemütliches Heim mitten im blühenden Heidekraut schlief sie endlich ein.
Sabine hatte gerade ihr Frühstück beendet, als Jochen Bellmann an der Wohnungstür klingelte.
»Hallo, komm herein.«
»Guten Morgen, Sabine, du siehst gut aus. Ich habe mir Sorgen gemacht, wie geht es dir?«
Sabine lächelte. »Ich habe beschlossen, einem unwürdigen Wurm keine Träne nachzuweinen, es lohnt sich nicht. Möchtest du Kaffee, er ist fertig.«
»Danke, gern.«
»Komm, setz dich doch.«
»Wie kann ich dir helfen? Du weißt, ich liebe es, anderen zu helfen.«
Sie lächelte. »Ich weiß, und das ist nett, aber ich denke, ich komme allein zurecht. Meine Rettungsaktion habe ich heute Nacht gründlich geplant.«
»Willst du sie mir verraten?«
»Natürlich. Gern. Ich verlasse Großbresenbek noch heute. In meinem Kündigungsschreiben steht: ›Aus persönlichen Gründen, die ich vertraulich zu behandeln gedenke, sehe ich mich gezwungen, meine Arbeit im Unfallklinikum Großbresenbek mit sofortiger Wirkung zu beenden. Sollte das Direktorium meine Kündigung nicht anerkennen, sehe ich mich gezwungen, die Gründe offen zu legen.‹ Außerdem habe ich mitgeteilt, dass diese Wohnung in zwei Tagen besenrein zur Verfügung steht.«
Jochen sah sie besorgt an. »Du bist sehr konsequent. Weißt du, was du aufgibst?«
»Ja, ich gebe alles auf. Aber ich behalte die Hochachtung vor mir selbst. Die ist mir wichtiger als eine Existenz in diesem Klinikum.«
»Und die Menschen? Du hast hier viele Freunde.«
»Wirkliche Freunde verliert man nicht. Sie werden meinen Entschluss akzeptieren und mich auch weiterhin begleiten.«
Jochen seufzte. »Du wirst mir fehlen. Wir waren so ein gutes Team, wir zwei. Wir sind durch dick und dünn gegangen, jetzt lässt du mich einfach zurück.«
»Ich weiß. Und ich weiß auch, dass du mir nicht folgen kannst, denn deine Existenz ist mit diesem Haus verbunden, deine Familie hat es vor hundert Jahren gestiftet und erbaut. Ich dagegen bin frei. Ich will und werde mir eine Praxis aufbauen, die genau meinen Träumen entspricht.«
»Du meinst die finanzielle Freiheit?«
»Natürlich, ohne Geld wäre alles sehr viel schwerer. Aber ich habe hier zehn Jahre gearbeitet und nach der Ausbildung gutes Geld verdient. Ich hatte kaum Gelegenheit, es bei diesen Tag-und-Nacht-Diensten auszugeben. Ich habe fast alles gespart, jetzt kann ich davon profitieren.«
Sie sah ihr Gegenüber an und hoffte, dass sie glaubwürdig klang, denn von ihrem Privatvermögen wusste hier niemand etwas.
Jochen nickte. »Ich weiß, du hast sehr sparsam gelebt, aber wird es für eine eigene Praxis reichen?«
»Wenn man bescheiden anfängt, sicherlich.«
»Und an was für eine Praxis hast du gedacht? Vielleicht kann ich dir bei der Suche helfen?«
»Das wäre sehr nett, denn auf einen Fachmann wie dich möchte ich bei der Suche eigentlich nicht verzichten«, lächelte sie, denn sie wollte ihm die Trennung nicht unnötig schwer machen. Und dann erzählte sie ihm von ihrem Traum mit der strohgedeckten Kate mitten in der Heide. »Vor allem möchte ich eine Arbeit ohne Stress, eine Arbeit, bei der ich mich in Ruhe um meine Patienten kümmern kann und selbst zur Ruhe komme. Nachtdienst ist kein Problem, aber der Bereitschaftsdienst hat mich ausgelaugt, es wird Zeit, dass ich auch einmal an meine eigene Gesundheit denke.«
»Hast du Probleme? Ich hatte manchmal den Eindruck, dass ...«
»Schon gut, Jochen, ich brauche nur hin und wieder etwas Ruhe.«
Jochen Bellmann stand auf und ging zum Fenster, um sie nicht ansehen zu müssen. »Du wirst mir fehlen, Sabine, und nicht nur als Kollegin, das weißt du hoffentlich.«
Sabine stellte sich neben ihn und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Ich habe unsere Freundschaft sehr genossen, ohne dich hätte ich das alles nicht geschafft. Und ich hoffe sehr, dass sich an unserer Beziehung nichts ändert.«
»Alles wird sich ändern.« Es schmerzte Jochen, dass sich Sabine mit jedem Wort weiter von ihm entfernte. Diese winzige Hoffnung, dass sich aus der Freundschaft mehr entwickeln könnte, machte sie mit ihren Plänen und Träumen konsequent kaputt.
Sie stand so dicht neben ihm, dass er Angst hatte, sie versehentlich zu berühren. Und dabei wünschte er sich nichts mehr als eben diese Berührung. Er ging ein paar Schritte zurück ins Zimmer, um den drängenden Wunsch, seinen Arm um sie zu legen, zu unterbinden. Sein Gesicht verriet nichts von seinen Gefühlen, aber in seinem Körper machte sich eine fast schmerzhafte Sehnsucht breit. Ihre adrette, kühle und immer korrekte Art reizte ihn mehr als jedes Entgegenkommen. Das war schon immer so gewesen und würde auch immer so bleiben. Vielleicht war diese radikale, von ihren Plänen bestimmte Trennung wirklich das Beste. Vielleicht würde sich auf dieser Basis die Freundschaft erhalten lassen? »Und wie soll es nun weitergehen, Sabine?«
»Ich werde im Internet Stellenanzeigen studieren. Wenn ich etwas Interessantes gefunden habe, werde ich hinfahren, Einzelheiten prüfen und mich bewerben. Ich möchte aufs Land, das war schon immer mein Wunsch.«
»Davon hast du bisher nie etwas gesagt.«
»Ich habe mich hier wohl gefühlt. Die Hektik hat mich fasziniert, die schnellen Entscheidungen, die über Leben und Tod bestimmen, die Zusammenarbeit aller und das Gefühl unbändiger Freude und Dankbarkeit, wenn man schwerste Verletzungen trotz großer Angst behandeln und heilen konnte.«
Sabine dachte einen Augenblick nach. »Ich habe meine Träume einfach vergessen, wenn uns die Arbeit durcheinander wirbelte und man das erlösende Gefühl hatte, alles wird gut. Wir waren in dieser Klinik ein wunderbares, eingespieltes Team, in dem sich einer auf den anderen verlassen konnte. Aber nun hat es einen Vertrauensbruch gegeben, und da der Bruch mich betrifft, gehe ich. Mit Intrigen kann ich genauso wenig leben wie mit Mitleid, also habe ich heute Nacht den Schlussstrich gezogen.«
Sabine sah den Freund an, der so lange ein vertrauter Kollege war. »Ich möchte mich jetzt an den Computer setzen, weil ich neugierig bin, ob mein Laptop im Internet meine Träume verwirklichen kann. Sei nicht böse, wenn ich dich jetzt bitte zu gehen. Aber wenn später die konkrete Entscheidung ansteht, würde ich dich gern um Rat fragen.«
»Du weißt, wo du mich findest.«
»Ja, und danke für alles, Jochen. Ich verlasse heute Nachmittag das Gelände und ziehe in ein Hotel. Meine Wohnung wird geräumt, sobald ich eine Spedition mit einem guten Speicher für die Möbel gefunden habe.«
»Das dürfte in einer Stadt wie Bremen nicht schwer sein. Soll ich dich irgendwo hinbringen?«
»Danke, nein. Du weißt, ich habe meinen kleinen Smart in der Tiefgarage stehen. Die muss ja auch geräumt werden. Und außer Kleidung und Computer nehme ich nichts mit.«
Jochen reichte ihr die Hand. »Lass mich wissen, wo du bleibst.« Dann strich er mit einem Finger über ihre Wange. »Ich wünsche dir, dass deine Träume wahr werden.« Er wandte sich um und verließ die kleine Wohnung. Seine Enttäuschung war nicht mehr zu verbergen, er musste gehen.
Sabine sah ihm nachdenklich nach. Sie wusste, dass er für sie mehr empfand als nur Freundschaft. Sie hatte schon immer gespürt, dass er ihr intime Gefühle entgegenbrachte und auf deren Erwiderung hoffte. Aber sie konnte sich nicht entschließen, darauf einzugehen. Er war ein lieber Mensch, aber er war überhaupt nicht ihr Typ. Sie war eine Frau, die großen Wert auf Äußerlichkeiten legte. Nicht, dass sie oberflächlich war, aber die Harmonie musste stimmen, auch die äußere. Und ein Mann, der kleiner war als sie, der dick und unsportlich und beinahe kahlköpfig war, entsprach eben nicht ihrem Bild von einem Mann, den sie gern an ihrer Seite gesehen hätte.
Dann sah sie wieder ihren Verlobten vor sich, diesen Doktor Axel Bentrop, der so ganz ihren Wünschen entsprach. ›Himmel, war ich dumm‹, schalt sie sich nun. ›Ich bin ihm fast in die Arme geflogen, als er mit dem kleinen Finger winkte. Und was habe ich nun von meinem Idealtypen? Einen Reinfall habe ich erlitten, über den die ganze Klink lacht. Man soll eben doch nicht nur nach Äußerlichkeiten gehen, sondern die inneren Werte eines Menschen erkennen und schätzen. Trotzdem ...‹, sieschüttelte unwillig über sich selbst den Kopf, ›ich kann nun mal nicht anders, ich brauche die geistige und optische Harmonie. Ich wollte Jochen nicht wehtun, aber ich musste ihn auf Distanz halten. Vielleicht kommt die räumliche Trennung genau zur richtigen Zeit.‹
Sabine schaltete den Computer aus und begann zu packen. Ein Koffer muss reichen. Dazu Reisetasche und Laptop, und das Auto ist voll. Sie lächelte und nickte sich im Spiegel zu. ›Wenn's was wird mit dem Landleben, dann brauche ich einen Geländewagen mit Allradantrieb.‹ Und in Gedanken bedankte sie sich bei ihrem Smart, der sie drei Jahre lang zuverlässig von Bremen aus in die verschiedensten Gegenden Europas gebracht hatte. Auf dem Weg zur Straße gab sie ihren Brief in der Klinik ab. Sie hatte die Anschrift der Direktion auf den Umschlag geschrieben und den Vermerk ›Persönlich‹ dick unterstrichen.
Sabine suchte sich ein kleines Hotel am südlichen Stadtrand. Wollte sie in die Heide, war der Weg nicht weit, und zur Innenstadt gab es gute Verkehrsverbindungen. Sie hätte sich jedes Luxushotel im Zentrum leisten können, aber das entsprach nicht ihrem Stil. Sie war trotz des elterlichen Wohlstands bescheiden erzogen worden und war von dieser Bescheidenheit nie abgewichen. ›Hotelservice und Ambiente müssen stimmen, dann werde ich mich auch wohl fühlen‹, bestimmte sie sich selbst gegenüber. Dabei dachte sie einen kurzen Augenblick an die herrschaftliche Villa der Eltern in Essen, die ein Makler für sie verwaltete und möbliert an große Firmen vermietete, die für ihre Direktoren eine passende Wohnung brauchten.
Im »Posthof« angekommen, ließ sie sich allerdings das größte Zimmer mit dem schönsten Blick auf die Weser geben. »Ich brauche viel Ruhe und einen Internetanschluss für meinen Computer«, erklärte sie an der Rezeption und bezog dann ein gemütliches, im Landhausstil eingerichtetes Zimmer. Warme Farben in Braun und Beige vertrieben das kühle Wetter vor dem Fenster, ein Schafwollteppich bedeckte die Holzdielen, und ein winziger Strauß mit ersten Schneeglöckchen stand auf dem Tisch.
Dann erkundigte sie sich an der Rezeption nach einem verlässlichen Spediteur und verabredete mit ihm ein Treffen für den nächsten Morgen.
Kapitel 3
Sabines Eile, die Stadt und ihr bisheriges Arbeitsfeld zu verlassen, grenzte fast an eine Flucht. Flucht vor wem und weshalb? Sabine dachte darüber nach, als sie am nächsten Morgen aufstand und aus dem Fenster sah. Es wurde gerade erst hell. Die Wiesen rechts und links von der Weser glänzten in ihrem Kleid aus gefrorenem Tau, und vom Wasser stieg ein feiner Dunst auf. Sie öffnete das Fenster und atmete den Duft von Frische, von feuchter Erde und von nassem Gras tief ein. ›Ja‹, dachte sie, ›das ist es, ich fliehe nicht, mich drängt es fort, ich kann es plötzlich kaum erwarten, der Vergangenheit den Rücken zu kehren und in die Zukunft zu laufen. Ich möchte die Welt da draußen umarmen und alles andere hinter mir lassen. Nicht vergessen, nein, dazu waren die Jahre zu wertvoll, aber etwas Neues suchen, erwarten, annehmen, das ist es, was ich will, und zwar sofort.‹
Sie schloss das Fenster, duschte und zog sich an. Unten im Frühstücksraum, der, einem Wintergarten gleich, von der frühen Sonne durchflutet und angenehm warm war, bediente sie sich als erster Gast von dem hübsch dekorierten Büfett.
»Nehmen Sie Kaffee oder Tee?« Eine junge Frau stand lächelnd neben ihr und bot beides an.
»Ich hätte gern Kaffee, ohne den Muntermacher bin ich morgens nur ein halber Mensch.«
»Das kenne ich«, lachte die Frau. »In fünf Minuten ist er frisch auf Ihrem Tisch.«
Sabine bedankte sich, nahm zwei Mohnbrötchen, Butter, etwas Aufschnitt und ein Schälchen mit Marmelade. ›Das lass ich mir gefallen‹, sinnierte sie. ›Ein sonniger Morgen, ein genussvolles Frühstück und jede Menge Zeit. Kein Telefon, das schrillt, kein Alarm, der Stress verheißt, kein Fordern und Hetzen und Bangen und Trösten. So sollte jeder Tag beginnen.‹ Aber sie wusste auch, dass dies nur ein Traum war. Selbst als Landärztin musste sie mit Notrufen und Nachtdiensten, mit Ängsten und Sorgen rechnen. Sabine schüttelte den Kopf. ›Was sein muss, wird erledigt, aber ohne Stress und Hektik.‹ Sie sah nach draußen, es war eine frische, saubere, farbenfrohe Gegend, auf die ihr Blick fiel, und was sie sah, machte ihr das Herz leicht und schärfte ihre Sinne. ›Klare Umrisse und eine überschaubare Welt, das ist es, was ich brauche, und das werde ich finden.‹ Sie beendete ihr Frühstück, bedankte sich bei der Bedienung und ging hinauf in ihr Zimmer.
Sie hatte kaum die Tür geschlossen, als ihr Handy klingelte. Etwas unwirsch meldete sie sich. »Ja, bitte?«
»Bin ich zu früh?«, fragte Jochen Bellmann und bat um Entschuldigung.
»Nein, nein, tut mir Leid, aber ich hatte nicht mit einem Anruf gerechnet. Ich habe gerade gefrühstückt und dabei festgestellt, wie angenehm es ist, nicht von einem Telefon geweckt zu werden.«
»Das kannst du noch einmal, sagen. Hier herrscht seit Stunden Hochbetrieb, aber das kennst du ja.«
»Gibt es etwas Neues, hat man meine Kündigung akzeptiert?«
»Na ja, es gab ein ziemliches Hin und Her. Dann hat man mich als deinen engsten Kollegen gerufen und nach einem Gespräch eingesehen, dass deine Kündigung berechtigt ist. Du bekommst dein restliches Gehalt einschließlich Urlaubsgeld auf dein Konto überwiesen, und dann wollte man deine Anschrift wissen, um die Kündigung zu bestätigen. Deshalb rufe ich in erster Linie an. Aber es gibt noch einen anderen Grund.«
»Und der wäre?«
»Ich habe gestern Abend im Internet geblättert und ein paar interessante Annoncen gefunden. Such' mal mit Google in den Seiten ›Ärzte: Angebote und Nachfragen‹, da findest du zwei Landarztpraxen, die vielleicht deinen Vorstellungen entsprechen.«
»Danke, Jochen, du bist ein Schatz.«
»Wenn du willst, könnten wir am Wochenende zusammen hinfahren, falls dir ein Angebot zusagt.«
»Danke, Jochen, aber ich möchte nicht erst am Wochenende auf die Suche gehen. Ich kann es kaum erwarten.«
»Was kannst du nicht erwarten?«
»Mit der Zukunft anzufangen.« Sie lachte. »Vielleicht bin ich verrückt und sollte erst mal Urlaub machen, aber ich bin so begierig auf etwas Neues, ich kann hier nicht tatenlos herumsitzen und warten.«
»Ich verstehe dich. Aber du solltest nichts überstürzen. Vier Augen sehen mehr als zwei, und vier Ohren ...«
»Ich weiß, ich weiß, du hast ja Recht. Aber ich verspreche dir, ich höre auf deinen Rat, wenn es so weit ist.«
»Das beruhigt mich aber nur ein bisschen, einen Vorgeschmack deiner schnellen Entscheidungen habe ich gestern bekommen.«
»Versprochen ist versprochen, ich hoffe, du weißt auch, dass ich Versprechen einhalte.«
»Das tröstet mich. Nun gib mir deine Anschrift, damit die Direktion dir schreiben kann.«
Sabine gab ihm die Adresse des Hotels und verabschiedete sich. Als Nächstes rief sie die Spedition an, die das Hotel ihr empfohlen hatte, und vereinbarte einen Termin, um Einzelheiten zu besprechen und einen Blick in das Lager zu werfen, in dem ihre Möbel auf unbestimmte Zeit stehen würden. Sie schaltete ihren Laptop an und wählte Google an. ›Jochen hat Recht‹, dachte sie, ›es sieht gar nicht schlecht aus. Anscheinend will niemand auf dem Land arbeiten. Die alten Ärzte gehen in Rente oder sterben, und die jungen zieht es in die Städte.‹ Nachdenklich starrte sie auf den Bildschirm. Verwandelten sich da ihre Träume etwa in Albträume?
›Ist das Leben auf dem Land komplizierter, als ich erwarte?‹, überlegte sie und blätterte weiter in den Seiten. Und dabei stellte sie fest, dass es eigentlich nur ein Angebot gab, das ihr zusagte: Eine Samtgemeinde – ›komisches Wort‹, dachte sie, ›eigentlich muss es doch Gesamtgemeinde heißen, wenn sich mehrere Dörfer zusammenschließen‹ –, also eine Samtgemeinde in der Lüneburger Heide suchte einen Arzt oder eine Ärztin als Nachfolger(in) für den vor zwei Jahren in den Ruhestand getretenen Arzt. ›Eigenartig‹, überlegte sie. ›Seit zwei Jahren ist die Stelle vakant, gibt es da Probleme? Und wer hat in der Zeit die Kranken versorgt?‹ Aber die Annonce reizte sie. In der Gemeinde, zu der noch drei weitere Dörfer gehörten, gab es ein leer stehendes Arzthaus mit Wohn- und Praxisbereich, eine Garage, einen Garten und einen kleinen Stall für eventuelle Haustiere. ›Auch das noch‹, lachte sie. ›Dass das Haus, wie es heißt, renoviert werden muss, ist kein Problem, im Gegenteil, dann kann ich es so herrichten, wie es mir gefällt, und muss nicht zwischen alten Wänden leben und arbeiten. Wer weiß, wann da zuletzt etwas modernisiert worden ist. Ja, morgen fahre ich hin und schau mir alles an. Ganz inkognito, erst mal nur so zum Gucken. Und auf dem Weg zum Spediteur werde ich mir eine Straßenkarte von der Lüneburger Heide besorgen.‹
Den Abend verbrachte Sabine mit dem Studium der Landkarte Da die Samtgemeinde Auendorf am Rand des Naturschutzgebiets lag, musste sie davon ausgehen, dass nur wenige Straßen mit dem Auto befahren werden durften, dass man Umwege in Kauf nehmen und oft auf recht schlechten Wegen unterwegs sein würde. ›Ja‹, überlegte sie, ›dann brauche ich ein anderes Auto. Ich werde, wenn alles klappt, einen Geländewagen mieten und ausprobieren, wie ich damit zurechtkomme. Aber erst, wenn alles gut geht mit dem Fahren, mit der Praxis und mit den Verträgen, dann werde ich so einen Wagen kaufen. Vorher nicht. Morgen muss mein kleiner Smart Asphaltstraßen, Kopfsteinpflaster und Sandwege bewältigen.‹
Der kalte Ostwind fegte über die freie Kuppe des Hambergs, und die wenigen Wacholderbüsche an seinem Hang suchten Schutz im engen Nebeneinander. Es war ein klarer, sonniger Märztag, und Paul Albers genoss die weite Sicht über die hügelige Heide. Er beobachtete wie an jedem Tag an dieser Stelle ein Mufflonrudel, das seine ersten Lämmer mit sich führte. ›Sie nutzen die Frühlingssonne‹, überlegte er, ›aber abends werden sie sich in den schützenden Wald zurückziehen, sonst wird es zu kalt für die Jungen.‹ Er zählte die Tiere und freute sich über die kräftigen Böcke mit den kreisrunden Hörnern, die den Winter gut überstanden hatten und auch in Zukunft für Nachwuchs sorgen würden.
Als er vor fünf Jahren die ersten Paare wieder in der Heide angesiedelt hatte, waren viele seiner Kollegen skeptisch gewesen und hatten befürchtet, die Tiere, in Wildgehegen gezogen, würden die Auswilderung nicht überleben. Aber er war zuversichtlich gewesen, denn er hatte Beweise aus früheren Zeiten, wo große Rudel die Heide bevölkert hatten, bevor sie gejagt und, bis auf ganz wenige Tiere, die man dann einfing, um sie in schützenden Gehegen zu erhalten, ausgerottet worden waren.
Er nahm das Fernglas herunter und strich den Hunden zu seinen Füßen beruhigend über das Fell. Die beiden Pointer standen auf, sahen ihren Herrn erwartungsvoll an und folgten ihm, als er langsam den Hamberg verließ. Einer rechts neben ihm, der andere links neben ihm. Er liebte diese britischen Vorstehhunde, die er während seiner Ausbildung in England kennen und schätzen gelernt hatte. Und als er endlich seine erste Försterei bekam, reiste er sofort auf die Insel, um zwei Welpen zu kaufen. Die beiden, die ihm jetzt folgten, kamen aus seiner eigenen Zucht, auf die er sehr stolz war.
Unten im Tal war es wärmer. Der Wind zerrte hier nicht mehr an Sträuchern und Heidekraut, und der Förster knöpfte seine Lodenjacke auf. Er ging zum Wald hinüber, wo er seinen Wagen abgestellt hatte.
Paul Albers war Oberförster in dem großen und zum Landschaftsschutzgebiet erklärten Heideland. Er liebte seine Arbeit, den Frieden der Natur und die Tiere, die er hegte und pflegte. Er war ein ruhiger, harmoniebedürftiger Mann, und nach dem Abitur, als die Zukunft Entscheidungen forderte, hatte er sich entschlossen, Förster zu werden. Er hatte an der Höheren Bundeslehranstalt für Forstwirtschaft studiert, nach dem bestandenen Diplom eine zweijährige Betriebspraxis im Harz und in England absolviert und die Staatsprüfung für den Försterberuf abgelegt. Damals war er fünfundzwanzig gewesen. Nach fünf Jahren Dienst in der Rhön war er zum Forstmeister und danach zum Oberförster befördert worden. Und dann hatte er das Angebot aus Hannover bekommen, die Oberförsterei mit dem »Heidehaus« bei Moordorf zu übernehmen. Das war jetzt zwölf Jahre her. ›Zwölf wunderbare Jahre‹, dachte er dankbar und öffnete die Hecktür, damit die Hunde in den Land Rover springen konnten. Als er die Tür schließen wollte, merkte er, dass die Hunde unruhig wurden und leise knurrten. Er sah sich um und beobachtete den Waldrand. Und dann sah er sie.
Sie kam mitten aus dem Gebüsch, einen Schuh in der Hand, das Haar zerzaust und im Gesicht einen Kratzer. Sprachlos starrte er die fremde Frau an. Hier gab es weit und breit keinen Ort, keine Straße, wo kam die her?
»Mein Gott, ich dachte schon, ich müsste die Nacht im Wald verbringen.« Sie reichte ihm die Hand. »Ich bin Sabine Büttner, und ich habe mich total verfahren.«
Er nickte ihr nur zu und übersah die Hand. »Albers«, antwortete er zugeknöpft, denn Leute, die die Ruhe seines Waldes störten, hasste er. »Wie kommen Sie überhaupt in diese Gegend, hier ist weit und breit Fahrverbot.«
»Das ist ja das Problem. Ich habe mich nach einer Straßenkarte gerichtet und sorgfältig darauf geachtet, nur öffentliche Wege zu benutzen. Und auf einmal, mitten im Wald, war die Straße zu Ende, und ein Schild verbot die Weiterfahrt. Ich wollte auf dem schmalen Grasstreifen wenden, und dabei ist mein Wagen in einen Graben gerutscht. Es tut mir schrecklich Leid. Sie sind der Förster hier, nicht wahr?«
Er nickte. ›Dumme Person, das sieht man doch‹, dachte er, ›schließlich habe ich eine Uniform an. Und dann rutscht sie auch noch in einen Graben.‹ »Sie sollten erst mal fahren lernen, bevor Sie sich in so eine Wildnis begeben«, brummte er, und dann etwas lauter: »Wo genau ist das passiert?«
»Das wüsste ich selbst gern.« Sabine war nun auch verärgert. Statt seine Hilfe anzubieten, putzte er sie runter. Sie holte ihre Karte aus der Tasche und strich sich das Haar zurück. »Bis hierhin bin ich auf einer Asphaltstraße gefahren, dann ging sie in einen Sandweg über, und mitten im Wald war Schluss.«
»Und warum sind Sie nicht zur Straße zurückgelaufen statt mitten durch den Wald?« Er legte seine Büchse und das Fernglas auf den Rücksitz des Wagens, und danach erst sah er sich die Karte an, die sie ihm hinhielt.
»Ich bin auf der Straße nicht einem einzigen Menschen oder Auto begegnet. Da dachte ich, quer durch den Wald käme ich schneller zu einem Dorf.«
»So ein Unsinn. Steigen Sie ein, ich weiß, wo Ihr Wagen steht.«
»Warum sind Sie so unfreundlich?«
»Weil ich für solchen Unsinn kein Verständnis habe. Schauen Sie sich Ihre Karte mal genauer an, dann sehen Sie, dass sich dieses Waldgebiet kilometerweit erstreckt. Wie kann man denn da nach einem Dorf suchen?«
Sabine zuckte mit den Schultern. »Ich bin zum ersten Mal in dieser Gegend, und viel Übung im Landkartenlesen habe ich auch nicht. Ich bin, wenn Sie so wollen, eine Großstadtpflanze und kenne mich nur mit Busfahrplänen aus.« Sie ging um den Wagen herum und wollte schnell einsteigen. Es konnte ja sein, dass dieser Grobian ohne sie abfuhr. Mühsam kletterte sie mit dem engen Kostümrock auf den Sitz. ›Unhöflich ist er auch noch‹, dachte sie und zog die Tür ins Schloss.
»Und warum haben Sie Ihren Schuh in der Hand?«
»Die Verschlusslasche ist abgerissen, ich habe ihn dauernd verloren.«
Paul Albers beruhigte die Hunde, die wieder leise knurrten. Dann ließ er den Motor an und fuhr am Waldrand entlang bis zu einer kaum sichtbaren Spur, die von der Heide in den Wald führte.
»Was machen Sie eigentlich hier? Touristenattraktionen gibt's nicht.«
»Ich wollte Land und Leute kennen lernen«, erwiderte Sabine ebenso kurz angebunden. Warum sollte sie ihm auf die Nase binden, dass sie sich nach einer Landarztpraxis umsah und dass ihr die Gegend unglaublich gut gefiel? Womöglich verhinderte er ihre Pläne, je nachdem, wie viel er hier zu sagen hatte.
Wenig später hatten sie Sabines Wagen erreicht.
»Wie kann man denn mit so einem Stadtwägelchen in die Heide fahren?« Paul Albers war verblüfft, als er den Smart sah, der nur noch mit dem Verdeck aus dem trockenen Graben ragte.
»Ich bin durch halb Europa damit gefahren, aber so ein Gelände ist er nicht gewohnt.«
»Man sieht's. Steigen Sie ein und lösen Sie alle Bremsen.«
»Ich kann die Türen nicht öffnen, sie stecken in den Grabenrändern fest.«
»Und wie sind Sie rausgekommen?«
»Durchs Fenster.«
»Na bitte.«
Sabine war frustriert. Wollte der etwa zuschauen, wie sie sich durch das Fenster quälte? Vorhin hatte sie den Rock ausgezogen, um sich besser bewegen zu können. Sie konnte doch nicht im Beisein dieses fremden Mannes hier im Höschen herumklettern.
Unschlüssig sah sie auf das kleine Fenster.
»Na, was ist? In einer halben Stunde wird es dunkel.«
»Drehen Sie sich bitte um, ich muss meinen Rock ausziehen.«
»Ich weiß, wie Frauen ohne Rock aussehen«, erwiderte er brummig, drehte sich aber um. ›Dabei habe ich noch nie eine Frau ohne Rock gesehen‹, dachte er verblüfft, ›jedenfalls nicht in natura und nicht direkt neben mir.‹
Sabine zog den Rock aus und schob ihn mit dem Schuh zusammen durch das Fenster. Dann kletterte sie hinterher, löste die Handbremse und kontrollierte den Fußschalter. »Es ist alles gelöst«, rief sie ihm zu.
Der Förster hatte ein Abschleppseil aus seinem Wagen geholt, befestigte es vorn an der Abschlepphalterung des Smart, prüfte den Boden und ging ein Stück am Grabenrand entlang.
»Hier vorn wird der Graben flacher, ich ziehe Sie bis hierher und dann aus dem Graben raus. Lenken Sie geradeaus, bis ich seitwärts blinke, dann lenken Sie den Wagen nach links. Verstanden?«
»Ich bin nicht schwerhörig.«
»Aber eine Großstadtpflanze, wie Sie vorhin sagten.«
Sabine sparte sich die Antwort und konzentrierte sich auf den Wagen. Der Rover fuhr langsam, bis das Seil spannte. Dann zog er an, und der Smart kratzte durch den Graben. Wurzeln, Steine, Sand und heruntergebrochene Äste schrammten an den Seiten entlang. ›Du meine Güte‹, dachte Sabine entsetzt. ›Der Wagen ist Schrott, wenn ich hier jemals herauskomme. ‹ Dann wurde der Boden flacher, der Rover blinkte links, Sabine steuerte in die gleiche Richtung, und dann war sie draußen.
Befreit atmete sie auf. »Danke.«
»Fahren Sie hinter mir her, ich bringe Sie nach Auendorf, und dann haben Sie freie Fahrt in Ihre Großstadt.«
»Könnte ich mir erst noch meinen Rock anziehen? Ich möchte nicht auf der Dorfstraße damit anfangen.«
»Bitte.« Und nach einem Augenblick: » Hinter der Kirche biege ich ab, da brauchen Sie dann nicht mehr zu folgen. Die Hauptstraße geht geradeaus weiter. Ich wünsche Ihnen eine problemlose Heimfahrt.«
»Danke. Aber ich fahre nicht weiter, ich habe in Auendorf ein Zimmer für die kommende Nacht gemietet. Dürfte ich Sie als Dankeschön zu einem Abendessen oder zu einem Glas Wein einladen?«
»Keine Zeit«, murrte er, »ist spät genug geworden.«
Er stieg in seinen Wagen, wartete einen Augenblick, dann fuhr er los. Sabine streifte in aller Eile den Rock über, stieg ebenfalls ein und folgte ihm. Als sie den Wald verließen, war es dunkel. Eine halbe Stunde später erreichten sie Auendorf, der Förster bog nach der Kirche ab, und Sabine fuhr auf den Parkplatz vor dem »Auenkrug«, dem einzigen Gasthaus in der Gegend. ›Schade‹, dachte sie, ›so ein attraktiver Mann und so unhöflich, wer hat den bloß so verletzt?‹
Sie ahnte nicht, dass dieser attraktive, unhöfliche Mann gleich hinter der Kirche ausstieg und ihrem Wagen nachblickte. ›Dummes Ding‹, dachte der Oberförster, ›aber irgendwie bezaubernd. Schade, dass ich bei Frauen so schlecht aus meiner Haut herauskann. Die hätte mir gefallen, wenn Sie nur nicht so dumm gewesen wäre.‹
Der Zweiundvierzigjährige hatte keinerlei Erfahrung mit Frauen. Seine von den Eltern einst anerzogene Zurückhaltung duldete keine Gefühlsausbrüche vor anderen Menschen. Seine Schulkameraden und später die Studenten hatten ihn geneckt, ihn »gehemmt« und »introvertiert« genannt, und er hatte sich noch weiter zurückgezogen. Er suchte keine Gesellschaft, er zog das Alleinsein vor. Dabei fühlte er sich nicht einsam und ihm fehlte nichts, denn er hatte die Natur, die Tiere im Wald und im Haus, die seinen Lebensrhythmus bestimmten. Dabei war er ein mutiger Mann, einer, der keine Angst kannte, der beherzt zugreifen konnte, wenn Not am Mann war, und der vielen, die ihm begegneten, ein Vorbild wurde. Seinen Mitarbeitern, den Kollegen und den Waldarbeitern gegenüber war er ein aufgeschlossener und kompetenter Chef, der gerecht war und der von allen respektiert wurde.
Nachdenklich fuhr er heim in sein »Heidehaus«. Er freute sich auf den Kamin, in dem ein Feuer prasseln und wohlige Wärme verbreiten würde, und auf ein Glas Rotwein nach dem Abendessen, das fertig im Kühlschrank stand und nur noch aufgewärmt werden musste. Er freute sich auf Shaica, die Hündin, die zu Hause bleiben und sechs kleine Welpen versorgen musste. Und er freute sich auf das geruhsame Alleinsein mit einem guten Buch. ›Bezaubernd oder nicht‹, überlegte er und dachte kurz an die Fremde im Wald, ›nichts könnte diese Harmonie in meinem Leben ersetzen.‹ Aber ein Stachel war geblieben, und der störte ihn immer wieder, wenn er nicht damit rechnete, wenn er gar nicht daran dachte. Dann sah er sie wieder vor sich, wie sie aus dem Wald kam und wie sie sich im Höschen durch das Autofenster zwängte, schließlich hatte sein Rover einen Rückspiegel.
Kapitel 4
Sabine verbrachte eine unruhige Nacht. Die Begegnung mit dem Gemeinderat am nächsten Vormittag ging ihr nicht aus dem Kopf. ›Hundert Fragen habe ich‹, dachte sie, und nach einer Weile stand sie auf und machte sich Notizen. Wichtigster Punkt in ihrem Katalog war die Frage nach der Selbstständigkeit. Sie wollte freie Hand haben und nicht eine mehr oder weniger angestellte Ärztin sein. ›Wenn ich hier eine Praxis eröffne, ist das allein meine Privatangelegenheit.‹ Dann die Frage nach dem Haus. Gehörte es der Gemeinde, oder stand es zum Verkauf? Sie hatte es gestern gesehen, und es gefiel ihr. Es war ein Haus zum Wohlfühlen. Sie dachte an den Tag zurück:
Nachdem sie am späten Vormittag in Auendorf angekommen war und im Gasthaus das Zimmer bezogen hatte, ließ sie sich von der Wirtin den Ort erklären. Sie erfuhr, wie alt und einmalig die Fachwerkkirche war, wo der Pastor, der Bürgermeister und der Großbauer wohnten, wo die Mühle, das Rathaus und eben auch das leere Arzthaus zu finden waren.
Gemächlich war sie durch Auendorf geschlendert, und dann stand sie vor dem alten Haus am Ortsrand. Es gefiel ihr sofort, obwohl sie sah, dass es sich in einem trostlosen Zustand befand. Aber das alte Haus versprach Wärme und Geborgenheit. Und beides brauchte sie. Das Strohdach mit dem spitzen Giebel über der Haustür musste als Erstes erneuert werden. Die Mauern und der dicke Schornstein, aus alten Backsteinen in den verschiedensten Rottönen gemauert, sahen massiv und robust aus. Die vier kleinen Fenster, die sich rechts und links von der Haustür aneinander reihten, und alle Giebelfenster mussten ausgetauscht werden, aber sie deuteten auf große Räume im Inneren hin. Das Dachgeschoss war anscheinend ausgebaut, denn in den beiden Seitengiebeln gab es, ebenso wie im Mittelgiebel, je ein Fenster. Am meisten gefiel ihr die Symmetrie des Hauses, die durch klare Formen geprägt wurde.
Obwohl die Dorfstraße leer und die nächsten Häuser etwas entfernt waren, wagte Sabine nicht, den verwilderten Vorgarten zu betreten, um durch die Fenster ins Innere zu schauen. Sie wollte vermeiden, dass sich ihr Interesse an dem Haus herumsprach, bevor sie mit dem Gemeinderat die Einzelheiten geklärt hatte. Zur Straße hin wurde das Grundstück durch eine Mauer lose aufeinander geschichteter Feldsteine begrenzt, zwischen denen sich Unkraut breit gemacht hatte. Die kleine Gartentür hing schief in ihren Angeln, und die Farbe war kaum noch zu erkennen.
Sabine betrachtete noch einmal die Haustür, und im Geist sah sie daneben an der Mauer ein blank geputztes Messingschild mit der Aufschrift:
Dr.med. Sabine BüttnerÄrztin für Allgemeinmedizin
Da wusste sie, dass sie ihr Zuhause gefunden hatte.
Langsam schlenderte sie weiter, ging in einem großen Bogen um benachbarte Grundstücke herum und kam dann von hinten noch einmal zu dem Haus. Die Rückseite glich der Vorderseite vollkommen. Auch hier führte eine Tür unter einem Mittelgiebel ins Freie. Ein Schuppen, den man als Garage nutzen konnte, ein zweiter, der wohl den im Internet angegebenen Stall darstellte, und ein verwilderter Garten mit Obstbäumen, Beerensträuchern und wucherndem Unkraut vervollständigten das Anwesen. ›Der Zustand ist absolut desolat‹, dachte Sabine, ›aber man kann Haus und Garten mit Geld und Fantasie wunderbar herrichten.‹
Hinter dem Grundstück begann unmittelbar die Heide. Sie zog sich nach Norden hin einen Hügel hinauf, und dieser kleine Hügel versprach Schutz vor kalten, stürmischen Nordwinden.
Sabine sah gedankenverloren in die Nacht vor dem Fenster und dachte noch einen Augenblick an ihren Spaziergang. Dann setzte sie einen dicken Punkt hinter ihre Liste mit den Fragen und ging wieder ins Bett. Und nun kamen die Erinnerungen an die Irrfahrt des späten Nachmittags. ›Selten habe ich mich so blamiert‹, dachte sie, dann schlief sie ein. Aber erholsam war der Schlaf nicht, denn ein Albtraum plagte sie, und der kam immer wieder: Ein Ungeheuer in Uniform drohte, sie übers Knie zu legen und zu verhauen, und zwei Hunde, die eher Wölfen glichen, knurrten sie mit gefletschten Zähnen und blitzenden Augen groß wie Taschenlampen an.
›Das kann ja heiter werden‹, dachte sie, als sie in der Morgendämmerung schließlich aufstand und unter die Dusche ging, um den Albtraum abzuwaschen und wach zu werden.