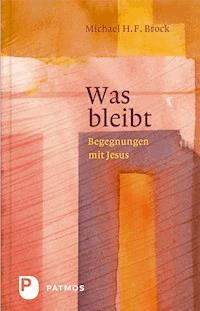Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Begegnungen mit Jesus
- Sprache: Deutsch
Die letzten Tage Jesu sind voller Dramatik. Bis zuletzt bleibt er seinem Weg mit den Menschen treu, der von so vielen nicht verstanden wird und ihm schließlich den Tod bringt. Der Autor beschreibt diese Ereignisse aus der Sicht der Freunde Jesu. Dabei spielt Maria von Magdala mit ihrer besonderen Nähe zu Jesus eine wichtige Rolle. Einfühlsam und bewegend schreibt der Autor in Anlehnung an die biblischen Erzählungen von der Botschaft Jesu, seiner Liebe und Freundschaft, seinem Ringen, seinen Tränen und seinem Weg zum Vater. Die Leserinnen und Leser werden zu Zeitzeugen und entdecken so in den scheinbar längst bekannten Geschichten überraschend Neues.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NAVIGATION
Buch lesen
Cover
Haupttitel
Inhalt
Über den Autor
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Michael H. F. Brock
Die letzten Tage
Begegnungen mit Jesus
Patmos Verlag
Inhalt
Ein Wort voraus
Das leere Grab
Lk 24,1–10
Ihr seid mehr wert als die Spatzen
Lk 12,1–12
Wo euer Schatz ist, da ist euer Herz
Lk 12,22–32
Lasst eure Lampen brennen
Lk 12,35–40
Von der Versöhnung
Lk 12,54–57; 13,18–21
Im Reich Gottes zu Tisch
Lk 13,22–30
Mahnung zur Bescheidenheit
Lk 14,7–11
Hilf mir, Lazarus
Lk 16,19–31
Warum so harte Worte
Lk 17,20–37
Darum wird es gehen
Lk 18,31–34
Der Einzug in Jerusalem
Lk 19,28–44
Die Tempelreinigung
Lk 19,45–46
Die Frage nach der Auferstehung der Toten
Lk 20,27–40
Das Opfer der Witwe
Lk 20,45–47; 21,1–4
Das Mahl
Lk 22,7–23
Die Stunde der Entscheidung
Lk 22,31–38
Das Gebet am Ölberg
Lk 22,39–46
Die Gefangennahme
Lk 22,47–53
Die Verleugnung
Lk 22,54–62
Der Prozess
Lk 22,66–71; 23,1–25
Die Kreuzigung
Lk 23,26–43
Der Tod
Lk 23,44–56
Die Botschaft der Engel
Lk 24,1–12
Auf dem Weg nach Emmaus
Lk 24,13–35
Der Abschied
Wofür hast du gelebt?
Am ersten Wochentag aber, noch tief im Morgengrauen, kamen sie zur Gruft und brachten die Duftkräuter, die sie bereitet hatten. Sie fanden den Stein vom Grab umgewälzt, gingen hinein, aber den Leib des Herrn fanden sie nicht. Und es geschah: Während sie darob verstört waren – da! Zwei Männer in blitzendem Kleid traten zu ihnen.
In Furcht gerieten sie und neigten das Gesicht zur Erde. Die aber sprachen sie an: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier – auferweckt ward er.
Erinnert euch, wie er, noch in Galiläa, zu euch redete und sagte: Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen.
Und sie erinnerten sich seiner Worte.
Und zurückgekehrt vom Grab meldeten sie das alles den Elf samt allen Übrigen.
Es waren das aus Magdala Maria, und Johanna, und Maria, die Mutter des Jakobus.
Lukas 24,1–10a – übersetzt von Fridolin Stier
Ein Wort voraus
Es ist eine Liebesgeschichte. Zuerst und vor allem eine Liebesgeschichte Gottes. Er schenkt in die Herzen eine Nähe zum Himmel, die Menschen befähigt, ihn zu spüren.
Ob sie sich so nahe waren, wie ich es hier beschreibe: Maria, die aus Magdala, und er, Jesus? Ich weiß es nicht. Mir hilft es, ihm nahe zu sein.
Und also schreibe ich Geschichten. Sie sind frei erfunden und viele Dialoge und Augenblicke beschreibt die Bibel nicht. Ich spüre sie in meinem Herzen.
Nachfolge geschieht immer biographisch. Da wir aber keine Biographie von Jesus besitzen, helfen mir die erfundenen Bilder und Begegnungen mit ihm, ihn heute neu zu verstehen.
Ich habe nicht den Anspruch, alles verstanden zu haben. Und ich möchte auch nicht jeder Theologie Rechenschaft geben.
Ich möchte, dass beim Lesen spürbar wird, wie er gelebt, gesprochen, gedacht, gebetet, gelitten hat. Ich möchte ihm zuhören und bei ihm sein. In diesem Buch sind es oft kleine Gedanken und ich beschreibe seine letzten Tage.
Ja, seine letzten Tage möchte ich ihn begleiten. Ich tue es in kleinen Augenblicken, die ich beobachtend beschreibe. Maria tut es für mich rückblickend und in seiner Nähe. Ich beschreibe diese Nähe sehr emotional, weil mich Emotion immer fesselnd am Leben hält.
Die Dialoge, auch seine, sind ebenfalls frei erfunden. Und ich möchte nicht den Eindruck erwecken, ich wüsste mehr als andere.
Aber es ist für mich ein möglicher Zugang, ihm nahe zu sein wie etwa bei einer Reise nach Galiläa und Jerusalem heute. Über die Steine ist Geschichte gegangen. Aber er ist dort zu spüren.
Meist folge ich dem Evangelium des Lukas in diesem Buch. Verlasse es aber auch dort, wo es mein Herz mir eingibt, ihn besser zu verstehen.
Ich folge den Begegnungen, die ich zwischen Maria und Jesus erahne, den Freunden Johannes, Petrus. Manchmal trete ich aus biblischer Betrachtung heraus und beschreibe eigene oder gefundene Gedanken aus heutiger Zeit. Perspektiven wechseln und kehren doch immer wieder zu den beiden zurück: Jesus und Maria.
Biblische Zitate stammen aus der Übersetzung von Fridolin Stier. Sie sind nicht eigens gekennzeichnet, sondern fügen sich ein in meine Beobachtungen.
Und darum geht es mir. Ich möchte ihn mehr und mehr verstehen. Ihn, der als Mensch unter uns gelebt hat. Er war einer von uns. Er hat geliebt und geweint, geglaubt und gezweifelt. Er war mit Gott versöhnt und gottverlassen. Er ist Menschen so unglaublich heilsam begegnet und wusste, wer sein Vater war: Gott des Himmels und der Erde.
Wenn ich mit diesen skizzenhaften Beschreibungen, die man gerne je für sich oder als Ganzes lesen kann, Menschen das Leben Jesu, sein Sterben und, wie ich glaube, seine Auferstehung so beschreiben kann, dass Menschen wieder Freude haben, ihm zu folgen, dann war die Zeit, sie zu schreiben, wertvoll.
Michael H. F. Brock
Das leere Grab
Lk 24,1–10
Als wollte die Nacht nicht enden, begann der Tag. Maria stand draußen. Unbeweglich stand sie da. Ihr Haar vom Wind zerzaust und vom Schmerz. In ihren Augen die Tränen der Nacht. Es war Johannes, der zu ihr ging. Sie sprachen kein Wort. Sie konnten nicht, wollten nicht sprechen. Still stand er neben ihr. Blickte wie sie hinüber zur Stadt. Alt gewordenes Jerusalem. Staubig, laut, verhurt, reich und erbärmlich. Stadt in Angst, johlend, zynisch erhaben. Noch leckten sie das Blut des Ermordeten, tanzten den Totentanz in Spott gekleideter Huren der Macht. Und sollte doch Zelt Gottes sein unter den Menschen, das Heilige.
Es war der dritte Tag. Der dritte Tag. Was für ein großes Wort. Es war der Tag seiner Auferstehung.
Maria stand schweigend, weinend, aufrecht. Versteinert sah sie hinüber und wusste: Er war gestorben. Für sie war er tot. Johannes spürte es und nahm sanft ihre Hand, und konnte ihr doch kein Leben mehr schenken. Sie blickte ihn nicht einmal an, als er ihre Hand nahm. So tief hatte der Tod sie getroffen.
Als die ersten Strahlen der Sonne ihr Gesicht streichelten, brach sie zusammen. Zusammengekauert im Schoß des Johannes lag sie selbst wie tot und weinte bitterlich. Sie war so kraftlos und doch schienen in ihrem Inneren Bilder aufzuflackern, die sie noch tiefer in ihrer Traurigkeit gefangen hielten.
Sie sah den Augenblick vor sich, der ihr ganzes Leben verändert hatte. Jenes Bild des ersten Augenblickes, der sie die ganze Nacht begleitet hatte. Es war damals in Galiläa am See, nicht weit von dem Ort, da sie geboren wurde, Magdala. Es war ein Augenblick, als er zum allerersten Mal ihre Hand berührte. Er tat es fast wie im Vorübergehen, als sie einander auf dem Markt begegneten. Ihr Haar war lang und der Wind fuhr ihr hindurch, als bliese das Leben Glück im Augenblick seiner Berührung. Und wie von ihm angezogen, folgte sie ihm zu jenem Berg. Als er sprach, spürte sie, wie ihr Herz so ruhig wurde und doch so aufgeregt, ihre Blicke scheu. Und doch konnte sie keinen Augenblick ihre Augen abwenden, als er sprach.
Er sprach von nichts anderem, als was sie schon kannte. Die alten Prophetenworte aus seinem Mund aber paarten sich mit seinen Händen, seinen Augen. Sie schienen so lebendig, die Worte, wie sie sie nie erlebt hatte. Alte Worte. Er sprach sie jung. Gewohnte Blicke blickte er tiefer. Ohne sie bloßzustellen, blickten sie in jene Verwundungen hinein, die sie so gern verborgen hätte. Ihn ließ sie blicken auch in die verlorenen Orte der Seele, die sie so schmerzlich bluten spürte, bis er ihre Seele heilte mit einer zarten Berührung seiner Worte. Die Hände folgten und sie fanden sich in einer Umarmung der Seele, die sie sanft nun auch auf ihrer Haut spürte, als sie ihn so nah und zart bei sich wusste, dass sie den Boden verlor unter ihren Füßen und sich ganz und gar getragen fühlte von seiner Nähe.
Der Tag der Ermordung hatte ihr diese Nähe geraubt, die sie seit jenem ersten Augenblick jeden Tag aufs Neue spüren durfte. Es war ihre Liebe, die ermordet wurde.
Sooft hatte sie ihn gebeten: Lass uns unsere Liebe halten, sie bewahren. So gern hätte sie ihn für sich behalten. Und doch: Er konnte nicht. So als wollte er sagen: Schaut auf unsere Liebe und tut es uns gleich. So als wollte er nicht aufhören, ihre geschundenen Seelen zu berühren, wurde er immer rastloser in seiner Liebe. Nur abends, wenn alle schliefen, lag auch er in ihrem Schoß, so als schöpfte er Kraft aus ihrer Liebe.
Immer neue Worte fand er zu beschreiben, Sehnsucht zu wecken bei den Geschundenen. Als er schließlich tote Seelen zu erwecken suchte und es ihm gelang, waren seine Feinde übermächtig geworden. Diese Welt erträgt die erweckende Liebe nicht. Sie fürchtet sich vor einer Sehnsucht, die zur Hoffnung werden könnte, diejenigen zu vertreiben, die den Tod bringen.
Am Ende war es seine Liebe, die ihn hat schwach erscheinen lassen. Was konnte die Liebe antworten auf den Vorwurf der Lästerung? Er habe sich zum Sohne Gottes gemacht, hieß es. Ja, was war er anderes als der Sohn der Liebe. Eine Lästerung? Nein, er sprach aus, was alle hätten sein können, Söhne und Töchter der Liebe. Nur weil der Hass größer, die Macht mächtiger, der Spott verführerischer war und der Ehrgeiz sie alle zerfraß, sollte er ermordet werden.
Als Maria spürte, wie Johannes ihre Hand hielt und sie in seinem Schoß erwachte, blickte sie auf. In den Gräbern liegen unsere Träume, sagte sie. Die Gräber sind angefüllt mit unserer Sehnsucht und unsere Tränen mischen sich mit der Angst, die sie begrub.
Sollte der Tod tatsächlich mächtiger sein als das Leben? Vieles spricht dafür. Ich habe so viele Gräber gesehen, angefüllt mit Zynismus und Hass, Gräber voller verlorener Seelen, die nie ein Mensch berührte. Ich habe Menschen ihre Träume beerdigen sehen und die zarte Berührung jenes Augenblicks, der stets am Anfang stand. Freiheit ging verloren und die Kraft zu gestalten. Spott sprach das Leben und die Zärtlichkeit verschwand ebenso in den Gräbern wie das Lächeln auf deinem Gesicht. Auch das wurde begraben, das Lachen deiner Seele, das ich so oft wie Lichterstrahlen sah in deinen Augen.
Am Ende schien es gar, als wären Güte, Verständnis und Menschlichkeit jedem Sterben ins Grab vorausgeeilt, so als wäre ihr Verlust der erste Vorbote des Todes.
Komm, Johannes, lass uns gehen. Wir wollen den Geschundenen salben wie einst, als er die Gebrochenen salbte mit seiner Nähe. Lass uns den Tod beweinen.
Als sie am Grabe stand, das nicht verschlossen war, wollte sie nicht weitergehen. Ich kann nicht hinein, sprach sie. Sie sprach nicht zu Johannes. Es war, als spräche sie mit ihrer Liebe. Ich kann nicht hinein. Ich kann den Tod nicht salben. So als wäre der Tod es wert, gesalbt zu werden. Den Geliebten zart berühren vielleicht, aber den Tod wollte sie nicht salben.
Und was würden sie finden dort in der kalten Gruft? Nein, sie würde nichts finden. Ihre Liebe nicht und nicht den Freund. Das Grab ist angefüllt und leer. Beides. Es ist angefüllt: Betrogene Freundschaft, ermordetes Leben, verspottete Liebe. All das würden sie finden. Aber kein Leben mehr. Das Leben ist von jenem Ort gewichen, der nur noch Tod heißt und Verzweiflung. Und leer ist es. Ich spüre deine Wärme nicht mehr an dem Ort des Todes. Nur Schweigen und keine Worte mehr. Nur Tränen bleiben, bleiben bis heute.
Vielleicht eines Tages, vielleicht in ferner Zeit, werde ich dem Engel glauben, der vom Leben spricht. Vielleicht, wenn die Sehnsucht neu in mir erwacht, vielleicht dann, werde ich ihm glauben. Heute noch nicht.
Ihr seid mehr wert als die Spatzen
Lk 12,1–12
Mehr wert als die Spatzen? Maria musste schmunzeln und überlegte: So komme ich mir aber nicht vor, mehr wert als die Spatzen. Wie erlebe ich sie denn? Ich erlebe sie lästig. Sie stören. Wagen sich bis auf meinen Teller, drehen leicht den Kopf, so als wollten sie mich verhöhnen. Und sie kommen in Massen, überfallartig. Dabei fliegen sie so unverschämt eng an meinem Kopf vorbei, dass ich zurückschrecke, meist in einer Bewegung, die weh tut. Irgendetwas verkrampft immer. Das Genick, der Hals, der Rücken. Jede ruckartige Bewegung, die keine Chance hat, koordiniert zu werden, verursacht in meinem Alter Schmerzen.
Manchmal beobachte ich sie und sie mich. Sie sind so menschlich in ihrer Aufdringlichkeit. Sie kennen kein Maß. Von Nähe und Distanz haben sie keine Ahnung. Sie haben nur ihr Fressen im Kopf und wie sie dran kommen können, ohne erwischt zu werden. Hastig picken sie auf Tellern, Tischen, vom Boden. Ihr Picken wirkt verzweifelt, ihr Flügelschlag kämpferisch, nur ihre Augen bleiben starr auf mich gerichtet, so als wollten sie sagen: Du magst groß sein und die großen Stücke schon gegessen haben, für mich fällt immer etwas ab. Und, ich behalte dich im Auge. Du magst dich aufregen über mich, aber ich bin schneller. Du magst nach mir schlagen, du weißt schon, ich bin schneller. Schnell da und schnell wieder weg. Und ich bekomme, was ich will. Was ich zum Leben brauche, nehme ich mir, stehle ich mir. Gestohlenes Leben, hastig, flügelschlagend, aufgeregt, schillernd. Immer im Rudel.
Mag sein, dass es beruhigt, dass die Gierigen immer zusammen auftreten. Sie haben nichts Edles, eigentlich sind sie klein und hässlich. Aber sie kriegen, was sie wollen. Mehr fällt mir zu den Spatzen nicht ein.
Aber warum vergleicht er uns eigentlich mit ihnen. Natürlich bin ich mehr wert als sie. Halt, ich wollte ehrlich sein, heute wenigstens. Ja, es stimmt. So komme ich mir vor, manchmal wenigstens. Und je länger ich überlege: Ja, wenn ich ehrlich bin, so komme ich mir oft vor, ich komme mir lästig vor und klein. Ich habe nicht die Größe der meisten Menschen, die erwachsen und bedeutend zu Tisch sitzen. Ich bin nicht in der Lage, mir ein ausgewähltes Mahl zu bestellen. Ich genieße nicht den Vorzug eines reich gedeckten Tisches, mit weißem Tischtuch, weißen Tellern, silbernem Besteck und einem Sonnenschirm.
Wir, die Spatzen, müssen uns die Brocken zum Leben allzu oft einfach klauen und sind froh, wenn ein Stück vom Leben für uns abfällt. Ja, ich Spatz, ich weiß: Ich störe, weil ich Hunger habe. Glaubt ihr Großen, ihr hättet allein das Recht auf ein üppiges Mahl? Ihr habt es verdient, sagt ihr. Ihr hättet von Natur aus das Anrecht. Es gäbe eben Unterschiede, sagt ihr. Und Begabungen, Vorrechte. Abstammung, Gattung, Vermögen. Ich kann es nicht mehr hören.
Ja, ich bin nur ein Spatz. Ich habe nichts gelernt, nichts empfangen, mir nichts verdient und erarbeitet. Ich bin, was ich bin: klein, unbedeutend, lästig.
Und ich trotze der Natur. Ja, ich fliege an deinen Ohren vorbei, damit du erschrickst und zusammenzuckst, und ich lande auf deinem Teller. Nur ein Brocken trockenes Brot. Aber ich ertrotze es mir. Ich behalte dich im Auge, du Auserwählter der Schöpfung. Du arroganter Mensch. Du mit deinem Sonnenschirm und deinem weißen Tischtuch.
Ich stehle mir das Leben. Ja, ich bin maßlos. Ich nehme mir, was ich kriegen kann. Was glaubst du eigentlich? So oft kommt es nicht vor, dass ein Brocken vom Leben übrig gelassen wird. Meist vernasche ich hastig, was du übrig gelassen hast.
Du Mensch, du wagst schon ein Urteil? Meinst du nicht, ich würde nicht gern genießen wie du? Meinst du wirklich, es sei erstrebenswert, so klein und schutzlos zu sein wie ich? Du meinst, ich sollte mich benehmen? Nun, sich zu benehmen, muss man sich leisten können. Bei mir geht es meist ums reine Überleben. Von der Hand in den Mund, würdet ihr sagen. Ich sage, vom Boden in den Schnabel, Hauptsache, es hält mich am Leben.
Du hast die Idee der Aufstände noch nicht verstanden. Je kleiner wir sind oder angesehen werden, desto frecher werden wir und rücksichtsloser. Und ja, wir treten im Rudel auf. Die einzige Chance, uns größer zu fühlen. Und wir behalten euch im Auge. Wir lassen uns unser kleines Leben nicht mehr nehmen. Und spürst du es? Wir sind schneller, wendiger und einfallsreich.
Wir sind die Überflüssigen. Und nur die Kinder freuen sich an unserer Gegenwart. Beobachten unsere Frechheiten mit eigenem Amüsement. Einmal frei sein wie sie, lese ich in ihren Gedanken. Nur einmal nicht einfach nur brav am Tisch sitzen müssen. Einmal fliegen wie die Spatzen, frei und ungezwungen vom Boden essen. Nur sich einmal nicht benehmen müssen. Statt mit Messer und Gabel nur einmal mit dem Mund vom Teller essen.
Einmal vermeintlich Verbotenes, Verpöntes tun, nur weil ich es zum Leben brauche, ohne Rücksicht auf Etikette und Stand. Das ist die Ironie. Die Großen hassen ihre Rolle allzumal und können sich doch von ihr nicht trennen.
Und darum hassen sie uns. Und je länger ich nachdenke: Vielleicht sind wir einfach nur ehrlich. Wir Spatzen sind Getriebene. Getrieben vom Hunger, getrieben von unserer Schwäche. Getrieben, weil wir so klein sind und hässlich. Getrieben, weil wir uns nehmen, was wir brauchen.
Ja, ich mag nicht mehr. Ich werde mich nicht mehr dafür entschuldigen, ein Spatz zu sein. Ja, ich habe Hunger und ich möchte es aussprechen dürfen. Ich habe Hunger nach Leben. Und ich möchte mich nicht mehr dafür entschuldigen und ich will es mir nicht mehr stehlen müssen. Ich bin mehr wert als die Spatzen.
Ja, es hat einen Wert, auch das kleine, unbedeutende, hässliche, nebensächliche Leben. Und ich werde dir um die Ohren fliegen. Deine Kinder haben es schon verstanden. Sie springen mit, lachen mit und werfen die kleinen Brotstücke uns entgegen wie das Leben selbst. Freuen sich, wenn wir ihnen aus den Händen picken, und kehren kleinlaut an den Tisch zurück, wenn ihnen bewusst wird, wie verärgert ihr reagiert.
Ja, es ist ein hingeworfenes Leben. Und jeder kämpft auf seine Weise, nur dass es bei uns offensichtlich ist. Den Mehrwert erlebe ich bei den Kindern und bei den Alten, wenn sie in der Nachmittagssonne auf der Parkbank sitzen und uns die Brosamen zu Füßen legen und sich daran freuen, wie wir Brotstücke aufsammeln. Sie bemerken, vielleicht sie allein, dass unsere Blicke auch Dankbarkeit ausstrahlen.
Was mich, Maria, unterscheiden könnte von den Spatzen: Auch ich bin eine Getriebene, aber ich weiß mich nicht verachtet, weil ich klein bin. Ich fühle mich nicht verfolgt, weil ich mir Leben stehle, und ich fühle mich nicht verspottet, weil ich hässlich bin.
Ich habe es erlebt. Ich lag in seinen Armen am Abend jenes Tages. Und ihr habt mich verachtet, weil ich ihm so nahe sein durfte wie ein Spatz. Was ihr nicht wisst: Ich stahl ihm nicht, was ich zum Leben brauchte, er schenkte es mir, ein Stück Leben, wie die Brosamen der Geschichte. Aber nicht weil sie weggeworfen wurden, weil sie auch für mich noch reichten. Mehr noch, weil auch sie mich noch erreichten.
Und ich blickte ihm in die Augen, aber nicht flüchtig, nicht furchtsam, sondern voller Aufmerksamkeit für den nächsten Augenblick.
In euren Augen war ich wertlos wie die Spatzen, für ihn war ich der Augenblick, da er wieder Kind sein durfte, und alt auf einer Parkbank sitzen, und ich spüre wie er es genoss, das Leben zu verschenken, mir, dem Spatzen in seiner Hand.
Und ihr: Ihr seid noch mehr.
Wo euer Schatz ist, da ist euer Herz
Lk 12,22–32
Für einen kurzen Moment verlasse ich biblische Zeit. Ich erzähle eine Geschichte von einem Menschen, der seinen Schatz verloren hat, wie es schien, und beinahe das Herz.
Ich war siebzehn Jahre alt, als er starb. Und er war doch erst sechzehn. Bis zu diesem Tag kannten wir noch keinen Schmerz. Jedenfalls keinen wirklichen.
Wir kannten die Tränen der Kindertage. Oh, auch die waren schon heftig. Tränen sind immer schrecklich. Aber wir weinten uns in die Nacht und wussten uns doch irgendwo geborgen. Es waren die Tränen, die sich noch abwischen ließen durch eine zarte Berührung.