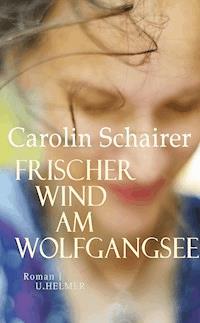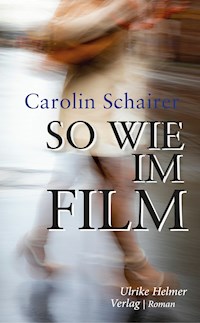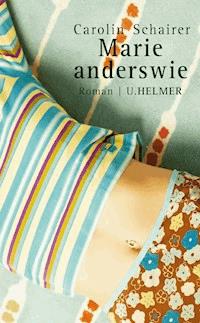16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ulrike Helmer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Katharina Hermann ist die erste Kanzlerkandidatin der Bundesrepublik. Sie ist attraktiv, charismatisch, und sie ist erpressbar ... Zufällig gerät der jungen Journalistin Theresa Lackner ein kompromittierendes Foto in die Hände, das die aufstrebende Politikerin Katharina Hermann mit einer anderen Frau zeigt: als nacktes Liebespaar. Sie erzwinkt von der Politikerin ein Abkommen: Katharina Hermann soll der Journalistin die Karriereleiter halten, die Journalistin wird dafür über die Politikerin berichten. Theresa schafft es mit Katharinas Hilfe zum Politikmagazin "Brennpunkt", für das sie die Kanzlerkandidatin exklusiv in der heißen Wahlkampfphase begleiten soll. Als sich Theresa jedoch in Katharina verliebt, überschlagen sich die Ereignisse. Raffiniert und fesselnd entwirft Carolin Schairer ein brisantes Politszenario und eine Geschichte über die erotische Anziehungskraft unter Frauen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 613
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Carolin Schairer
Die Spitzenkandidatin
Roman
eBook ISBN 978-3-89741-971-1
Print ISBN 978-3-89741-192-0
© eBook nach der Originalausgabe© 2005 Copyright Ulrike Helmer Verlag, Königstein/TaunusAlle Rechte vorbehaltenCovergestaltung: Atelier KatarinaS, NL
Ulrike Helmer VerlagNeugartenstr. 36c, D-65843 Sulzbach am TaunusE-Mail: [email protected]
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ulrike-helmer-verlag.de
Inhalt
Unverhofftes Wiedersehen
Am Anfang War der Trumpf
Ticket nach Berlin
Familienprobleme
Im Ministerium
Das Spiel beginnt
Der Wahlkampf
Ruhelos
Überraschungen
Tommi
Tod des Vaters
Am Ende der Straße
Mitternachtsgespräche
Oase des Friedens
Reise in die Vergangenheit
Weichenstellung
Liebesleiden
In der Hauptstadt
Ungewisse Aussichten
Schlussstrich
Geplantes Ende
Epilog
Über den Autor
Unverhofftes Wiedersehen
Ich hatte Gitta nicht gegrüßt. Das war ein Fehler. Denn sie nahm die Tatsache, dass ich sie auf dem Weg zum Kaffeeautomaten übersehen hatte, sogleich zum Anlass, mir den Gang entlang zu meinem Schreibtisch zu folgen.
»Schieß los, Babe, welche Laus ist dir heute über die Leber gelaufen?«
Ich beschloss, sie zu ignorieren, und schaltete meinen Computer ein.
Gitta ließ nicht locker. »Du machst ein Gesicht, als hättest du heute Morgen vor dem Spiegel die ersten grauen Haare entdeckt!«
Dass sie sich so leicht abschütteln lassen würde, hatte ich auch nicht erwartet. Gitta Grothe war Society-Reporterin, und das seit über zwanzig Jahren. Schnell aufzugeben war nicht nach der Art einer Journalistin ihres Kalibers. Ich nahm es ihr nicht übel, aber im Moment hatte ich einfach keine Lust zu sprechen. In der Hoffnung, sie längerfristig doch noch in die Flucht zu schlagen, kramte ich unter einem der zahlreichen Stapel, die sich auf meinem Schreibtisch türmten, eine bunt bedruckte Broschüre hervor und starrte konzentriert auf Seite zwei und drei des dünnen Heftchens.
Aus den Augenwinkeln beobachtete ich Gitta, die zunächst ein Weilchen wie angewurzelt vor mir stand. Dann ergriff sie rigoros die zwei letzten Nummern von Amiga, dem Trendmagazin für die Frau des 21. Jahrhunderts – so lautet tatsächlich die Eigenwerbung des Blatts, für das ich arbeite – und warf sie auf den Boden knapp neben den Mülleimer.
»Hej …«, protestierte ich schwach und umklammerte instinktiv mit beiden Händen meinen Plastikkaffeebecher. Ehe ich es verhindern konnte, hatte sie sich auf dem freien Platz niedergelassen, den sie sich auf meinem Schreibtisch verschafft hatte, und schlug nun schwungvoll die Beine übereinander. Aus ihrer erhöhten Position betrachtete sie mich mit prüfendem Blick.
»Bella Theresa. Du kannst mir vertrauen. Sprich mit Tante Gitti über dein Problem.«
»Habe kein Problem«, nuschelte ich in meinen Kaffeebecher hinein, ohne sie anzusehen. Zumindest hatte ich kein Problem, das ich mit der 20-köpfigen Redaktion von AMIGA nebst allen freien Mitarbeitern und Fotografen diskutieren wollte. Ich hatte Gitta in den fünf Jahren in dieser Redaktion gut genug kennen gelernt, um zu wissen, dass sie nichts für sich behalten konnte.
»Jetzt reicht’s!« Mit gespieltem Ärger riss sie mir, meinen erneuten Protest missachtend, die Broschüre aus der Hand und betrachtete stirnrunzelnd das Cover. »Boa Goa – die sanfte Pflege für Haut und Sinne«, las sie laut vor und ihre Stirnfalten vertieften sich, ehe sie die Broschüre mit einer verächtlichen Geste in den Papierkorb warf. »Eine Werbung für Seifenschaum. Erzähl mir bitte nicht, dass du so früh am Morgen solch bittere Lektüre verdauen willst.«
Mein Widerstand war schwach angesichts ihrer Hartnäckigkeit. Vielleicht war es auch der Kaffee, der allmählich meine Lebensgeister weckte und mich kommunikativer stimmte.
»Ist für die Pflege-und-Schönheits-Seite«, erklärte ich kurz angebunden, während ich den Werbefolder wieder aus dem Papierkorb fischte. »Ich muss dort ein paar kreative Zeilen über dieses innovative Produkt loswerden. Ist ein Werbekunde von uns. Anweisung von oben sozusagen.«
»Dir bleibt auch nichts erspart«, kommentierte Gitta meinen Sarkasmus mit einem Kopfschütteln. »Aber daher kommt deine schlechte Laune nicht. Das machst du ja quasi jeden Tag. Wundert mich ohnehin, wie du das aushältst, ohne ernsthafte psychische Probleme zu entwickeln.«
Zu entwickeln? Ich habe bereits ernsthafte psychische Probleme, Gitta!
Ich behielt meine Gedanken für mich und zuckte nur mit den Schultern. »Irgendwer muss es ja tun.«
»Ja, aber es müsste keine Redakteurin sein. Das ist ein Praktikanten-Job«, erwiderte Gitta energisch. »Und selbst für diese armen Zeilenschreiber ist es eigentlich eine Schmach und Schande, sich über Putzmittel, Haarshampoo, Festiger, Deosprays und alle Arten von Seifen den Kopf zerbrechen zu müssen!« Sie machte eine kleine Pause, fuhr sich durch ihr kurz geschnittenes, bordeauxrot gefärbtes Haar und ließ ihren Blick kurz durch die Räumlichkeiten schweifen. Es war erst neun Uhr morgens, früh für einen Arbeitsbeginn in der Redaktion einer Wochenzeitschrift, und daher waren außer Gitta und mir nur wenige Kolleginnen hier.
Gitta senkte die Stimme, als sie ihre Aufmerksamkeit erneut mir zu wandte. »Hast du diese eklig-blaustichige Strumpfhose von der Kesselflieger gesehen? Diese Frau wird nie Stil entwickeln, glaube mir! Aber sie ist mein Lieblingsstudienobjekt. Durch sie weiß ich immer, welche Geschmacklosigkeit in ein paar Wochen hip ist. Die Kesselflieger ist mein Frühindikator.«
Katja Kesselflieger war vor drei Jahren in die Amiga-Redaktion gekommen. Zuvor hatte sie für eine Flensburger Tageszeitung gearbeitet und anschließend als so genannte »feste Freie«, also als Journalistin mit Pauschalvertrag, aber ohne Sozialleistungen wie bezahltem Urlaub und Krankenversicherung, für zwei weitere Frauenmagazine geschrieben. Wie die meisten von uns hatte es Katja Kesselflieger nach Hamburg verschlagen; im Unterschied zu den anderen in dieser Redaktion sah man es ihr nicht nur an, sondern hörte es sofort, wenn sie den Mund auftat: Die Mittvierzigerin sprach breitesten Dialekt, was besonders für mich, die ich aus dem entgegengesetzten Teil Deutschlands stammte, des Öfteren zu Verständigungsschwierigkeiten führte. Außer ihrer Unfähigkeit, sich auf Hochdeutsch zu artikulieren, hatte Katja Kesselflieger eine Vorliebe für außergewöhnliche Farbkombinationen und eher unvorteilhafte Schnitte. Doch das sollte nicht mein Problem sein. Ich hatte – im Gegensatz zu Gitta, die bereits mehrmals berufliche Meinungsverschiedenheiten mit unserer Kollegin ausgetragen hatte – nichts gegen die Kesselflieger. Im Grunde tat sie mir nur Leid. Sie war eine von jenen, die sich selbst unheimlich wichtig nahmen, weil ihnen sonst niemand dieses Gefühl vermittelte. Von der Art gab es mehrere in dieser Redaktion. Vielleicht zählte ich sogar selbst dazu, ohne mir darüber bewusst zu sein.
Obwohl mir blaustichige Strumpfhosen egal waren, hatte ich bei Gittas Worten aber automatisch den Kopf gehoben und beobachtete nun ebenfalls die Kesselflieger, die mit besagter Strumpfhose und knallrotem Rock am Kopierer stand und mit unserem Praktikanten Henning die Wochenenderlebnisse austauschte. Ich musste unwillkürlich grinsen, als ich aus Katjas Mund das Wort »Inlineskaten« vernahm, denn sogleich stellte ich mir die rundliche Kesselfliegerin im grellbunten eng anliegenden Sportdress mit ihrer im Fahrtwind wehenden, blond gefärbten Löwenmähne vor. Gitta schien meine Gedanken lesen zu können. Unsere Blicke trafen sich, und ich musste noch mehr grinsen.
»Theresa, so gefällst du mir schon besser!«, erwiderte sie. »Aber jetzt sag schon, was los ist. Ich finde es sonst ohnehin selbst heraus.«
Auch wenn sich meine Stimmung durch das kleine Intermezzo gebessert hatte – mir war dennoch nicht danach, von meinem Wochenende zu erzählen. Doch Gittas stahlgraue Augen durchbohrten mich. Plötzlich schlug sie die Hände über dem Kopf zusammen, in einer Lautstärke, mit der sie die Aufmerksamkeit von Katja Kesselflieger, unserem Praktikanten Henning und zwei anderen anwesenden Kolleginnen unweigerlich auf uns lenkte.
»Heureka!«, rief sie aus. »Ich weiß, was es ist!« Sie starrte mich an und sagte in absolut sachlichem Tonfall: »Du hast Mr. Austria aus deiner Wohnung geschmissen. Hab ich Recht oder hab ich Recht?«
Ich sah zu ihr auf und mein Blick sprach Bände. Gitta hatte den Nagel auf den Kopf getroffen: Ich hatte mich gestern Abend endgültig von Mr. Austria verabschiedet. Mr. Austria hieß mit vollem Namen Jörg Mayringer, stammte aus dem Südburgenland und war mit einem adonisgleichen Körper ausgestattet. Dieser Körper verhalf ihm zunächst zum Titel »Mr. Austria«, anschließend zu einer Karriere als Männermodel in ganz Österreich und später auch in Deutschland. Die wirklich großen Auftritte bei Modeevents in Mailand, New York und anderen Mode-Metropolen blieben bisher aus. Aber das konnte sich ja noch ändern. Mr. Austria war schließlich erst knappe 23 Jahre jung.
»Er war doch sooooo schööööön!«, flötete Gitta nun in einer Lautstärke, die Henning und Katja Kesselflieger endgültig an meinen Schreibtisch lockte.
»Er war strohdumm«, konterte ich.
»Wat is’n los, Kleene?«, erkundigte sich Katja nun neugierig.
»Mr. Austria ist Vergangenheit«, setzte Gitta sie sogleich in Kenntnis und fügte – erklärend für Henning, der erst seit zwei Wochen in der Redaktion weilte und daher noch nicht umfassend über mein Privatleben informiert war, hinzu: »Theresas Freund, pardon, jetzt Ex-Freund.«
»Oh, das tut mir Leid.« Henning bedachte mich mit einem mitleidsvollen Blick. »Geht’s dir jetzt sehr schlecht?«
Außer der Tatsache, dass der Erholungswert meines Wochenendes geschmälert worden war und dass ich sämtliche Begleitumstände eines solchen Ereignisses verabscheute, fühlte ich angesichts der Umstände denkbar wenig. Meine schlechte Laune resultierte hauptsächlich aus dem Mangel an Schlaf und dem Ärgernis, 24 Stunden lang einer Non-Stop-Konfrontation ausgesetzt gewesen zu sein.
Ehe ich etwas sagen konnte, hatte Gitta schon wieder das Wort ergriffen, während Katja Kesselflieger bei Hennings gut gemeinten Worten einen Lachkrampf zu unterdrücken versuchte.
»Ach Unsinn, Henning. Unsere Theresa ist doch da schon erfahren. Da hat sie doch Routine, mit dem Schlussmachen und so. Wie lange warst du gleich wieder mit diesem Typen zusammen? Zwei Monate? Drei Monate?«
»Zwei Monate«, erwiderte ich gehorsam. So seltsam es für Außenstehende sein mochte: Was sich hier abspielte, erschütterte mich nicht im Geringsten. Ich fühlte, Mr. Austria betreffend, nämlich genau … nichts. Und auch Gittas Worte verletzten mich nicht. Was sie sagte, entsprach voll und ganz der Realität. Da unsere Redaktion relativ klein war, ein lockerer Umgangston herrschte und wir uns gegenseitig über unser Privatleben informierten, waren auch meine Männergeschichten nicht geheim, sondern sorgten hin und wieder für Unterhaltung. Ich war daran gewöhnt und empfand es nicht einmal als seltsam, was hier ablief. Im Gegenteil: Ich wurde allmählich wieder redseliger.
»Oh … ähhh.« Angesichts Gittas Erläuterung geriet Henning ins Stammeln. »Tschuldigung.«
»Kein Problem«, sagte ich und trank den letzten Schluck Kaffee aus. Mit Schwung ließ ich den Plastikbecher in den Papierkorb fallen. »Es ist so, wie es ist.«
»Die Weisheit der Theresa L.«, kommentierte Gitta trocken und ahmte mich nach: »Es ist so, wie es ist. – Wie ist es denn, liebe Theresa? Was hat der arme Kerl verbrochen? Hat er dich betrogen, hat er die Zahnpastatube offen gelassen wie dieser Bauchtänzer Marcel, mit dem du mal was hattest, wollte er den Müll nicht heruntertragen wie dieser Wein-Ausschenker, wie hieß er denn?«
»Ullrich«, schaltete sich Katja Kesselflieger ein. »Der hieß Ullrich. Und er war Sommelier im Le Meridien.«
Es war Zeit, mich aktiv ins Gespräch einzubringen.
»Nein«, sagte ich. »Ullrich war der Fitness-Trainer vom Holmes Place, und der Sommelier hieß Erik. Das war aber nicht der mit dem Müll. Der Haushaltsverweigerer hieß Daniel und war Sportstudent. So ein großer Blonder. Erinnert ihr euch? Den hatte ich doch auf dieser Verlagsjubiläumsfeier dabei. Du warst von ihm hin und weg, Katja!«
Vor meinem geistigen Auge tauchte Katja auf, in ein knallrotes eng anliegendes Latex-Kleid gepresst, wie sie am Buffet stand und besagtem Daniel hingebungsvoll den Teller mit Sushi und Dim Sum voll lud.
»Der Kleene war ja auch so ein Prachtexemplar, nee!« Die Kesselfliegerschen Augen glänzten.
»Theresa hat immer schöne Männer«, erwiderte Gitta sachlich. »Hab noch keinen getroffen, der nicht aussah wie ein junger griechischer Gott. Vielleicht solltest du es mal mit einem Quasimodo versuchen, Theresa? Wenn’s mit den Schönlingen immer nur so ein kurzes Intermezzo wird.«
»Es waren satte zwei Monate«, entgegnete ich ebenso sachlich. »Das ist kein kurzes Intermezzo. Es war eine sehr intensive Affäre!«
Dabei wünschte ich, ich könnte als Trennungsgrund nennen: Wir haben uns auseinander gelebt. Das klingt so harmonisch. So normal. So, dass es jeder versteht.
»Intensiv zweifelsohne«, bemerkte Gitta trocken und bohrte dann im Stil der erfahrenen Society-Reporterin, die sie nun mal war, hartnäckig weiter: »Also, was hat sich Mr. Austria geleistet?«
Ich seufzte. Offensichtlich kam ich um die Antwort nicht herum. Da meine Kreativität so früh am Morgen keine Purzelbäume schlug, blieb ich bei der Wahrheit: »Er wusste nicht, wer Nietzsche war!«
Es herrschte verblüfftes Schweigen. Drei Augenpaare starrten mich entsetzt an. Es wäre naiv gewesen zu glauben, sie seien über dieses Unwissen von Mr. Austria genauso schockiert, wie ich es gewesen war. Ich war nicht naiv.
Gitta war die erste, die sich von ihrem Schreck erholte. »Was bitte habt ihr für Gesprächsthemen? Oder besser gesagt: Was für Diskussionen führst du mit deinen Liebhabern? – Wenn du philosophieren willst, liebe Theresa, solltest du dich einer Gruppe von Alt-Philologen anschließen. Es gibt in dieser großen Stadt sicher was Passendes.«
Während ich über den Zusammenhang zwischen Alt-Philologen und Philosophie nachsann, schaltete sich nun wieder Katja ein. »Ach nee! Dat kann nich gut gehen! – Theresa, der Nietzsche, der ist doch schon tot! Dat is doch keen Thema zwischen einem Liebespaar!«
In meiner Erinnerung spulte sich die Szene ab: Mr. Austria und ich, Sonntagmittag beim Frühstück. Ich mit einem Croissant in der Hand, er mit einem Schinkenbrötchen. Wir sitzen uns schweigend gegenüber, weil wir uns nicht viel zu sagen haben. Plötzlich steht er auf, geht hinüber zur Couch und schaltet den Fernseher ein. Nuschelt irgendwas von Wettergebnissen und Pferderennen. Sportwetten waren seine Leidenschaft. Für mich nicht nachvollziehbar, aber gut. Es war sein Geld, sein Hobby, es ging mich nichts an. Während ich herzhaft in mein Croissant beiße, sehe ich aus den Augenwinkeln, wie er die Teletext-Seite eines Hamburger Stadtsenders aufgerufen hat. Ich höre ihn fluchen. Ich denke: Aha, wieder nichts, und liege damit auch richtig.
»Dieser Nietzsche hat meinen Domino wieder abgehängt! Es ist zum Auswachsen!«, murmelt er kopfschüttelnd vor sich hin.
»Nietzsche?«, wiederhole ich amüsiert, ohne mich wirklich für den Sport zu interessieren. »Wie kann jemand sein Pferd nur Nietzsche nennen?«
»Warum?« Er wendet sich kurz vom Bildschirm ab und starrt mich entgeistert an. »Was ist daran so komisch? Ist doch ein ganz normaler Name!«
»Nun ja«, nuschle ich mit vollem Mund und schlucke den letzten Bissen meines Croissants herunter. »Friedrich Nietzsche würde sich wahrscheinlich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, dass ein Rennpferd nach ihm benannt wurde!«
Dann kam es. Ich sah es noch jetzt wie in einer ZeitlupenRückblende vor mir: Die Entgeisterung in seinem Blick machte einem Zustand kompletter Verwirrung Platz. Er starrte mich weiterhin an und fragte dann mit tief gerunzelter Stirn: »Wer ist Friedrich Nietzsche?«
Es war für mich das i-Tüpfelchen in einer Reihe von Episoden wie dieser, die sich in den ersten und letzten Wochen unserer zwei Monate währenden Beziehung abgespielt hatten. Ich konnte ihn nicht länger ertragen. Ich ließ ihn noch den Frühstückstisch abräumen und erklärte ihm klipp und klar, er solle sofort seine Habseligkeiten zusammenpacken und meine Wohnung verlassen. Das Problem war: Er wollte nicht glauben, dass es mir ernst war. Dafür kannte er mich offensichtlich nicht gut genug. Es dauerte bis tief in die Nacht hinein, bis ich es ihm verdeutlicht hatte. Deshalb hatte ich zu wenig Schlaf. Ich musste ihm Dinge sagen, die ich nicht sagen wollte. Weil es mir unnötig schien, ihn zu verletzen. Er konnte schließlich nichts dafür, wie er war, und er konnte erst recht nichts dafür, wie ich war. Er sollte einfach nur verschwinden. Ich hatte ihn satt.
Da ich bei meinen Kolleginnen lieber als Intellektuelle galt denn als arrogante, beziehungsunfähige Geisteskranke, zog ich es vor, diese Details für mich zu behalten. »Ich möchte mich jetzt Boa Goa widmen, der sanften Pflege für Haut und Sinne«, erklärte ich mit einem liebenswürdigen Lächeln. »Ihr kennt nun die Geschichte meines bewegten Wochenendes; ich hoffe, ich konnte eure Neugierde befriedigen. Mr. Austria gibt es nicht mehr und ich bin wieder Single.«
Katja Kesselflieger gab sich zufrieden und bewegte sich wieder in Richtung Kopierer. Henning hatte sich schon längst heimlich zurückgezogen; ihm war diese Art von Frauengesprächen wohl doch zu viel geworden. Ich konnte es ihm nicht verübeln. Er hatte es ohnehin nicht leicht – als Mann in einer Frauenredaktion. Ich wusste, dass dieses Praktikum für ihn eine Art Notlösung war. Henning war Student einer Hamburger Journalistenschule, die unter anderem auch von unserem Verlag finanziert wurde. Amiga war das Frauenmagazin dieses Verlags, der allerdings hauptsächlich durch sein Nachrichtenmagazin Brennpunkt bekannt war. Brennpunkt war vor einigen Jahren als eine Art Konkurrenzprodukt zum bekannten Spiegel gegründet worden. Anders als Der Spiegel richtete sich Brennpunkt vorrangig an eine eher konservative Schicht von Lesern. Dem Brennpunkt war im Gründungsjahr von vielen Seiten ein schneller Untergang prophezeit worden. Es schien damals unvorstellbar, dass sich ein weiteres Nachrichtenmagazin in Deutschland etablieren würde. Der Brennpunkt sprang jedoch auf die Infotainmentwelle auf, ohne das Nachrichtengenre zu verlassen und Seriosität einzubüßen. Er lieferte fundierte Hintergrundberichte, schaffte es aber, diese in ein modernes und einprägsames Layout mit vielen guten Bildern und Graphiken zu packen.
Für den Brennpunkt zu schreiben genoss in der schreibenden Zunft heute den gleichen Stellenwert wie seine Artikel im Spiegel abgedruckt zu finden. Es war gigantisch. Der Traum jedes ehrgeizigen Journalisten. Beide Medien wurden von über einer Million Lesern gelesen.
Auch Henning träumte von einer Karriere beim Brennpunkt. Wir hatten nie darüber gesprochen, aber es war für mich offensichtlich. Denn Henning, dieser stets gut gelaunte junge Mann mit dem gewinnenden Lächeln und den blonden Locken, die ihm von Gitta den heimlichen Spitznamen »Engel« eingebracht hatten, besuchte nicht umsonst die Journalistenschule des Verlags. Leider dachten dort alle so wie er. Und das war genau das Problem: Denn der Brennpunkt selbst nahm nur ganz wenige Praktikanten auf. Meist ergatterten jene die wenigen Stellen, die entweder Beziehungen hatten oder sich bei ihren Dozenten besonders gut verkauften. Das einzige, was man ihm hier wohl angeboten hatte, war die Stelle bei Amiga. Und die nahm er an, was taktisch außerordentlich geschickt war. In seinen Lebenslauf würde er hineinschreiben: Praktika beim Brennpunkt-Verlag in Hamburg. Und viele Personalchefs und Chefredakteure würden nur den bekannten Namen Brennpunkt sehen und ihm zumindest die Chance geben sich vorzustellen. Und eine Chance brauchte jeder in diesem Job, der immer noch als Traumberuf galt und für den es nie an fähigen Arbeitskräften mangelte. In einer Branche, die sich von allen Seiten nährte, denn da der Beruf des Journalisten bekanntlich ein so genanntes »Jedermannsrecht« ist und damit keine besondere Ausbildung erfordert – zumindest in der Theorie –, waren gut bezahlte Redakteursstellen für junge Journalisten eher die Ausnahme.
Ich wusste, dass Henning so agieren würde, weil ich es damals auch getan hätte. Der Journalismus war keine besonders soziale Branche, wo edle, gute Menschen harmonisch im Team arbeiteten und miteinander im Einklang lebten. Diesen Anspruch zu erheben, wäre auch verfehlt. Schließlich war es die Aufgabe von Journalisten, investigativ zu agieren und Missstände aufzudecken. Und manchmal heiligt der Zweck bekanntlich alle Mittel.
So rechtfertigte ich nicht nur die teilweise umstrittenen Methoden meines Berufstands, sondern verteidigte mich auch vor meiner inneren Stimme, die sich Gewissen nannte und sich in schwachen Momenten hin und wieder zu Wort meldete.
»Lass den Kopf nicht hängen, Theresa.« Ich hatte ganz vergessen, dass Gitta immer noch auf meinem Schreibtisch saß. Sie lehnte sich zu mir vor und klopfte mir tröstend auf die Schulter. »Das wird schon mit den Männern. Du bist erst 32 – im besten Alter also. Aber such dir mal einen Typen, der dich intellektuell ein wenig herausfordert. Jemand mit Grips und Ehrgeiz. Du weißt ja: Schönheit ist vergänglich.«
»Okay, ich werde es versuchen«, antwortete ich ergeben und wusste trotzdem schon genau, dass ich Gittas Rat nicht befolgen konnte.
Es ist so, wie es ist. Ich bin so, wie ich bin.
Als hätte sie meine Gedanken lesen können, bedachte mich Gitta mit einem scharfen Blick. Einen Moment lang schien es, als wolle sie noch etwas hinzufügen, dann beließ sie es jedoch bei einem Seufzer und einem Kopfschütteln. Sie rutschte von meinem Schreibtisch herunter. »Dann schreib mal über dieses Duschbad, Herzchen. Ich muss mich ja auch meiner Arbeit zuwenden.«
Als sie von meiner Tischplatte glitt, fiel mir auf, dass sie heute für einen »Innendienst-Redaktionstag«, wie sie die Tage nach den Abenden nannte, die sie beruflich auf diversen Promi-Feten verbrachte, überdurchschnittlich fein gekleidet war – nämlich mit schickem schwarzem Rock und elegantem Blazer. Mir drängte sich spontan eine Frage auf. »Gitta, warum bist du eigentlich schon hier? So früh am Morgen – und dann in diesem Aufzug?«
Sie blieb stehen und wandte sich nochmals zu um. »Das weißt du nicht? Amiga bekommt ein Exklusivinterview mit der eventuell ersten deutschen Bundeskanzlerin. Und rate mal, wer dieses Interview heute Nachmittag führen wird!«
»Oh mein Gott! Oh mein Gott!«
Es war früher Nachmittag, und Gitta, meines Wissens Atheistin aus Überzeugung, rief mit verzweifelter Miene den Herrn im Himmel an. Vor knapp fünf Minuten hatte sie einen Anruf von der Ballettschule bekommen: Tatjana, ihre neunjährige Tochter, war in der wöchentlichen Trainingsstunde gestürzt und hatte sich offenbar verletzt. Jedenfalls hatte die Ballettlehrerin am Telefon von einem »kaputten Knöchel« gesprochen, was Gitta den ersten schweren Schock versetzt hatte. Den zweiten Schock hatte sie erlitten, als sie Tatjana im Hintergrund vor Schmerzen heulen hörte wie eine Hafensirene.
Jetzt raste sie mit vor Aufregung fleckigen Wangen um meinen Schreibtisch herum und war völlig aufgelöst. »Ich muss da sofort hin! Meine Kleine! Mein Gott, wenn das bloß nichts Bleibendes ist! Was, wenn sie nie mehr laufen kann? Um Himmels Willen! Ich muss sofort zu ihr!«
»Gitta, die Ballettlehrerin hat doch von einem kaputten Knöchel gesprochen, nicht von einem Wirbelsäulenschaden«, versuchte ich sie zu beruhigen. »Wahrscheinlich hat sie sich den Fuß verstaucht, oder allenfalls einen Bänderriss zugezogen.«
Ich erntete von Gitta prompt einen vernichtenden Blick. »Du hast ja keine Ahnung, wie ich mich fühle! Du hast ja keine Kinder! Du hättest sie im Hintergrund weinen hören sollen. Sie muss enorme Schmerzen haben. Normalerweise ist sie doch so tapfer!«
Ich kannte Tatjana von flüchtigen Begegnungen. Mit dem Prädikat »tapfer« hätte ich dieses feingliedrige Geschöpf, für das bestimmt selbst ein Windhauch zu viel Belastung bedeutet, allerdings nicht in Verbindung gebracht. Gitta als ihre Mutter sah das offensichtlich völlig anders.
Aber es war kein guter Zeitpunkt für Grundsatzdiskussionen. Denn Gitta war noch aus einem anderen Grund in arger Bedrängnis: Die Journalistin Brigitta Grohte sollte in rund einer Stunde die Justizministerin und Kanzlerkandidatin Katharina Hermann interviewen. Job und Privatleben prallten aufeinander. Die vor Sorge zerfließende Mutter und die karriereorientierte, professionelle Journalistin gerieten in heftigen Konflikt. Denn die Mutter Gitta wollte und musste sofort nach Beendigung des Telefonats ihre sieben Sachen packen, um nach Hamburg-Eppendorf zu rasen, in Tatjanas Ballettschule zu stürmen und sich höchstpersönlich um den kaputten Köchel zu kümmern.
Sie tat mir Leid. Ihre Selbstsicherheit und das professionelle Auftreten, für das ich sie insgeheim bewunderte, waren auf einmal wie weggeblasen. Sie, die bereits Interviews mit internationalen Stars wie Mariah Carey, Michel Douglas und sogar Madonna geführt und dafür von Kollegen bewundernde Worte geerntet hatte, wirkte in diesem Moment konfus und hilflos wie nie zuvor.
Ich wusste: Das Interview konnte weder kurzfristig abgesagt noch verschoben werden. Es war sicherlich ohnehin schwer genug gewesen, ein Gespräch mit der Kanzlerkandidatin zu organisieren. Daher war es jetzt unmöglich, den Termin nicht wahrzunehmen. Ich suchte nach einer anderen Lösung.
»Hat diese Ballettlehrerin nicht sowieso gesagt, sie hätte bereits einen Notarzt verständigt, der unterwegs sei zur Ballettschule?«
»Ja, ja.« Gitta wirkte keine Spur beruhigter als zuvor. »Aber was bringt das? Der kann auch nur eine Diagnose stellen und sie medizinisch versorgen, aber ihre Tränen trocknet er nicht! – Und außerdem: Die Zvarova hat schließlich gesagt, der Knöchel sei kaputt! Allein die Vorstellung, was sie damit meinen könnte, verursacht mir Schweißausbrüche!«
»Die Zvarova«, das wusste ich aus Gittas früheren Erzählungen über Tatjanas Aktivitäten, war die Ballettlehrerin. Ich versuchte Gittas Panik einzudämmen.
»Die Zvarova ist Slowakin und spricht schlecht Deutsch«, rief ich ihr in Erinnerung. »›Knöchel kaputt‹ kann also vieles heißen. Ihr fehlt einfach das nötige Vokabular.« Da Gittas Miene unschwer zu entnehmen war, dass sie weder Ruhe noch selbst eine Lösung aus ihrem Dilemma gefunden hatte, zerbrach ich mir weiterhin für sie den Kopf. Spontan fiel mir Gittas Ex-Ehemann ein.
»Was ist denn mit Ludger? Vielleicht könnte er nach Tatjana sehen und sie trösten …« Ich wählte meine Worte bewusst vorsichtig. Gitta war schon vor der Scheidung nicht gut auf ihren ExGatten zu sprechen gewesen und seit der offiziellen Trennung, die alles andere als harmonisch verlief, wusste sie überhaupt nichts Gutes mehr über ihn zu sagen. Aber er erschien mir als Notanker. Immerhin war Dr. Ludger Grothe Tatjanas Vater und für sie genauso verantwortlich wie Gitta. Da ich wusste, dass er als Chefarzt einer Hamburger Privatklinik für Schönheitschirurgie bezüglich seiner Arbeitszeiten sehr flexibel war, hielt ich es für unwahrscheinlich, dass er ausgerechnet jetzt zu unabkömmlich war, um sich um seine Tochter zu kümmern. Doch als ich seinen Namen ins Spiel brachte, wechselte Gittas Gesichtsfarbe von blass zu dunkelrot.
»Dieser Kotzbrocken! Den werde ich garantiert nicht anrufen! Wahrscheinlich ist er sowieso mal wieder beim Golfspielen! Der hat am Samstag schon so herumgezickt, als er abends auf sie aufpassen sollte, weil ich – wohlgemerkt! – arbeiten musste. Du treibst dich ständig auf diesen Partys herum, und ich muss zu Hause hocken mit dem Kind, hat er mir vorgeworfen! Dieser Idiot kapiert immer noch nicht, dass ich auf diesen Events nicht zum Vergnügen bin!«
Ich konnte Gittas Ärger teilweise verstehen. Jeder, der nur einmal ein derartiges Promi-Event journalistisch zu meistern hatte, konnte nachvollziehen, weshalb sich eine Reporterin gekränkt fühlte, wenn ihr vorgeworfen wurde, sich auf Promi-Parties zu vergnügen. In einem Getümmel von Leuten, die tatsächlich wichtig waren oder sich wichtig fühlten, nach herausragenden Persönlichkeiten zu suchen, die sich zwar in Feierstimmung, aber auch in Interviewlaune befanden, war ein Knochenjob. Besonders, da diese Veranstaltungen meist am späteren Abend begannen und erst weit nach Mitternacht endeten. Andererseits – hier handelte es sich schließlich um eine Art Notfall. Aber Katharina Hermann war Gitta Grothe offenbar nicht wichtig genug, um ihren Stolz zu überwinden und ihren Ex-Mann um etwas zu bitten, was ihn als Vater meiner Meinung nach genauso viel anging wie sie.
»Es muss eine andere Möglichkeit geben!«, brach es aus Gitta hervor. »Ich habe sowieso keine ruhige Minute, wenn ich nicht selbst zu Tatjana fahre! Nicht auszudenken, wenn die Kleine ganz alleine mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert wird!«
Da ich mit meinen freundschaftlichen Ratschlägen am Ende war, schwieg ich.
Gitta zog sich vom Nachbarschreibtisch den verwaisten Drehstuhl zu mir heran und ließ sich darauf niedersinken. Sie raufte sich das kurze Haar und legte ihre Stirne in Denkerfalten.
»Herr im Himmel, Theresa, was soll ich denn jetzt tun? Um halb vier ist das Interview. Ich schaffe es nie und nimmer, Tatjana ins Krankenhaus zu begleiten … Und überhaupt, ich muss dann bei ihr bleiben, ich kann sie doch nicht alleine lassen mit dem Gips. Also kann ich absolut nicht ins Park Hyatt und dieses Interview führen!« Sie machte eine kurze Pause und setzte dann hinzu: »Und schließlich ist diese Hermann ja nun wirklich nicht Madonna. Oder Michel Douglas. Aber Termin ist Termin. Die Chefredaktion wird mir verständlicherweise die fristlose Kündigung hinterherwerfen, wenn ich jetzt einfach meinem Mutterinstinkt nachgebe und hier abzische!«
Damit hatte sie ohne jeden Zweifel Recht.
Plötzlich kam mir eine Idee.
»Und wenn dieses Interview einfach jemand anderer führt?«, schlug ich vor. »Das wird dann vielleicht nicht so gut wie bei dir, aber immerhin, es wird erledigt! Und wenn du die Chefredaktion vom Unfall deiner Tochter in Kenntnis setzt, werden die den Grund deiner Verhinderung sicherlich als triftig genug ansehen, um dich vertreten zu lassen!«
Gittas Gesicht erhellte sich schlagartig. Sie sprang so schnell und enthusiastisch auf, dass sie dabei fast den Drehstuhl umstieß. »Das ist die Idee!«, rief sie aus. »Theresa, du bist ein Genie! Ich werde das gleich klären.«
Schon war sie aus dem Büro. Mit der Genugtuung, dass ich letztendlich doch einen passenden Ausweg aus Gittas innerem Konflikt gefunden hatte, widmete ich mich wieder meinen Schönheitsprodukten – bis plötzlich ein Schatten auf meinen Schreibtisch fiel. Ich sah auf. Gitta war zurück. Die Sorge um Tatjana stand ihr zwar immer noch ins Gesicht geschrieben, doch sie wirkte wesentlich entspannter als zuvor.
»Alles geregelt«, setzte sie mich in Kenntnis. »Ich bin dir wirklich dankbar, Theresa. Du bist eine wahre Freundin.«
Während ich gerade anmerken wollte, dass so viele Dankesworte für einen simplen Vorschlag gar nicht nötig waren, rannte sie zu ihrem Schreibtisch und kam mit einem Stapel Unterlagen wieder zurück.
»Hier. Da steht alles drin, was du wissen musst. Und du hast auch noch rund eine Stunde Zeit, dich vorzubereiten. Viel ist ohnehin nicht zu tun. Kannst dich ja ein wenig einlesen in ihren Werdegang. Die Fragen habe ich schon alle vorbereitet. Stehen hier auf diesem Zettel.«
Sie fischte aus dem Papierstapel ein beidseitig beschriebenes Din-A-5-Blatt heraus und legte es vor mich hin. »Die Fragen sind alle mit Katharina Hermanns Presseattaché abgesprochen. Mehr, als hier steht, darfst du sowieso nicht fragen.«
»Bitte, was?« Ich begriff gar nichts. Perplex starrte ich sie an. Was wollte Gitta von mir?
»Na, du wirst dieses Interview mit Katharina Hermann führen!«
In der Annahme, es sei ein Scherz, lachte ich jetzt herzhaft. Als ich jedoch ihren entschlossenen Gesichtsausdruck sah, begriff ich den Ernst der Lage. Gitta meinte es offensichtlich ernst.
»Nein, Gitta, ich …«
Sie schnitt mir das Wort ab. »Theresa, das war doch dein Vorschlag! Warum zierst du dich denn jetzt? – Unsere Chefredaktion war sofort damit einverstanden, dass du diesen Termin übernimmst. Abgesehen davon: Ansonsten sind sowieso alle mit Terminen verplant. Alternativen gibt es keine. Henning, unseren Praktikanten, können wir ja keinesfalls dorthin schicken.«
»Ich … ich hab das anders gemeint …«, stotterte ich nervös.
Auf keinen Fall würde ich dieses Interview führen!
Sie sah meine entsetzten Gesichtszüge und interpretierte sie auf ihre Weise. »Theresa, das ist ganz easy! Mach dir nicht in die Hose! Du gehst da hin, ziehst das Interview durch, kommst wieder zurück, und wir besprechen das.«
Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht!
»Gitta, darum geht es nicht«, erwiderte ich und schob den Zettel mit den Fragen wieder in ihre Richtung. »Ich bin auf ein Interview mit einer Politikerin, die vielleicht mal unsere Kanzlerin wird, absolut nicht vorbereitet. Schon rein optisch. Sieh mich doch nur an. Sieh, wie ich gekleidet bin! Ich trage nicht mal ein Jackett!«
Sie musterte kurz meine weite Khakihose mit den aufgenähten Außentaschen, meine dunklen Turnschuhe und meine Leinenbluse mit dreiviertellangem Arm.
»Das geht schon«, beschloss sie mit unbewegter Miene. »Aber vielleicht wäre eine andere Frisur empfehlenswert. Mit den Zöpfen links und rechts siehst du aus wie eine Indianersquaw. Oder ein Schulmädchen.«
»Ich bin keine Society-Reporterin«, erwiderte ich in der Hoffnung, an ihre Vernunft zu appellieren. »Ich hab überhaupt keine Erfahrung im Umgang mit Promis.«
»Du hast Politik studiert«, kommentierte Gitta. »Also komm mir nicht mit Qualifikations-Argumenten.« Sie schob mir den Zettel mit den Interviewfragen wieder zurück. »Hier, bereite dich vor. Ich werde inzwischen diesem Pressefuzzi Bescheid geben, dass Theresa Lackner kommt, nicht Brigitta Grothe. Die wollen ja alles so genau wissen!«
Sie stand auf und ließ mich mit meiner Verzweiflung allein. In meinem Kopf ging es drunter und drüber. Bruchstücke von Erinnerungen tauchten auf, von denen ich geglaubt hatte, sie erfolgreich verdrängt zu haben. Anscheinend ein Irrtum. Ich sah die Kanzlerkandidatin vor mir, die gegenwärtig noch Bundesjustizministerin war, und Unbehagen breitete sich in meiner Magengegend aus.
Ich will sie nicht sehen.
Vielleicht würde sie mir ohnehin kein Interview geben. Vielleicht würde sie aufstehen und mich zur Tür hinauskomplimentieren.
Ich verwarf diesen Gedanken jedoch sogleich wieder, da er abwegig war. Sie war schon immer professionell gewesen; nie würde sie sich derart auffallend verhalten. Sie war aalglatt, und genau deshalb hasste ich sie.
Gitta kam zurück. Sie hatte bereits ihre Handtasche über die Schulter geworfen und war offensichtlich auf dem Weg in Richtung Ballettschule.
»So, alles erledigt. Der Presseattaché weiß Bescheid. Wenn du um halb vier im Park Hyatt angekommen bist, frag nach Dr. Wieland. – Im Übrigen, Theresa, ich habe bemerkt, unsere Justizministerin kommt aus der gleichen Ecke von Bayern wie du. Das ist ja die beste Basis für ein trautes Zwiegespräch – mit Aufzeichnungsgerät, versteht sich.«
Beste Basis? Das muss ich leider entschieden bezweifeln.
War es ein fast unmerkliches Zucken meiner Lippen? Wechselte meine Gesichtsfarbe von einer frischen Sonnenbräune in ein fahles Blass? Gitta jedenfalls betrachtete mich prüfend.
»Theresa, seid ihr euch schon mal über den Weg gelaufen, du und unsere Kanzlerkandidatin?« »Nein!«, entfuhr es mir, während ich an meinen Armen sich ausbreitende Gänsehaut fühlte. »Ich kenne sie nur vom Fernsehen.« Ich schickte meinen Worten ein selbstsicheres Lächeln hinterher, um meine Lüge zu bekräftigen.
Es war zwanzig nach drei Uhr nachmittags, und ich saß in einem Taxi Richtung Hyatt Park. Die Strecke vom Redaktionsbüro bis zum Hotel war nicht lang; es war schönes Maiwetter, ich hätte auch zu Fuß gehen können. Doch meine Knie fühlten sich an, als beständen sie aus Gummi. Meine Hände waren schweißnass und hinterließen verräterische feuchte Flecken auf dem Papier mit den Interviewfragen, das ich umklammerte.
Mir war übel, ich wäre am liebsten davongelaufen. Gleichzeitig kam ich mir lächerlich vor. Was sollte schon passieren? Sie war immerhin ein Profi.
Ich las mir zum hundertsten Mal die Interviewfragen durch und konnte noch immer nicht glauben, was ich Katharina Hermann, eine Frau mit zwei hart erarbeiteten Studien, zwei Doktoraten und einem durchweg brillanten Verstand da fragen sollte: Welchen Lippenstift sie trug und ob sie für Gäste selbst koche oder kochen ließe. Im Moment konnte ich mir noch nicht vorstellen, dass mir diese Fragen tatsächlich über die Lippen kommen würden.
Es war mir auch peinlich, vor ihr in Khakihose und Leinenbluse zu erscheinen. In Turnschuhen! Sie kannte mich so nicht und sollte mich auch nicht so kennen lernen. Doch es blieb keine Zeit, nach Hause zu fahren und mich umzuziehen. Meine geflochtenen Zöpfe hatte ich aufgelöst und mit ein paar Haarnadeln zurückgesteckt. Als Schulmädchen wollte ich ihr nun wirklich nicht gegenübertreten.
Wenn ich doch nur auf den Termin vorbereitet gewesen wäre!
Kaum war mir dieser Wunsch durch den Kopf geschossen, wurde mir klar, dass es kein Wenn gab. Jedenfalls keines, das ein Dann nach sich zog, für das Vorbereitungen notwendig gewesen wären. Hätte ich gewusst, dass ich heute Katharina Hermann träfe, die lange Jahre meinen Heimatwahlkreis als Mitglied des Bundestags in Bonn und später dann Berlin vertrat, dann wäre ich nämlich erst gar nicht im Büro erschienen. Ich hätte mich krank gemeldet.
Katharina Hermann war nicht die Person, die ständig irgendwelchen Frauenzeitschriften Rede und Antwort stand. In den letzten Jahren hatte ich Interviews mit ihr nur noch in Magazinen wie Spiegel und Brennpunkt und in Tageszeitungen wie der Süddeutschen, der Welt und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesehen. Und das, ohne ihnen größere Beachtung zu schenken. Katharina Hermann spielte schon seit Jahren keine Rolle mehr in meinem Leben, und auch wenn ich Politik studiert hatte: Die Bundespolitik der Konservativen interessierte mich spätestens seit meinem Umzug nach Hamburg nicht mehr.
In diesem Herbst war Bundestagswahl. Die Konservativen wollten das Zepter der Macht keinesfalls an die Sozialdemokraten verlieren. Justizministerin Katharina Hermann war im Falle eines tatsächlichen Wahlsiegs als Bundeskanzlerin im Gespräch – die erste Frau in der Geschichte der Bundesrepublik, die für diesen Posten nominiert wurde.
Aus diesem Grund wurden nun sämtliche Register gezogen, um Katharina Hermanns Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad zu steigern. Eine Medienschlacht zwischen Udo Körnigge, dem Kandidaten der Sozialdemokraten, und ihr hatte begonnen. Eine Medienschlacht, die sich in den kommenden Monaten mit Sicherheit noch verstärken würde.
Unter den vielen auflagenstarken Frauenzeitschriften, die es auf dem deutschen Zeitungsmarkt gab, hatte sich der Beraterstab von Katharina Hermann für Amiga entschieden. Warum das so war, hatte ich inzwischen von Katja Kesselflieger erfahren, die diesmal offensichtlich besser informiert war als ich selbst: Amiga-Chefredakteurin Isolde Heinemann war eine ehemalige Studienkollegin von Hermanns Presseattaché Dr. Jan Wieland.
Das Taxi hielt vor dem pompösen Gebäude des Park Hyatt Hotel, das einst ein Kontorhaus gewesen war und meiner Ansicht nach äußerlich wenig Schönes an sich hatte. Ich zahlte, ließ mir eine Quittung geben und stand Augenblicke später in der modern gestalteten, hellen Lobby. Das freundliche Ambiente im Inneren des Hotels entschädigte für das wenig einladende Äußere. Es war mein erster Besuch im Park Hyatt, doch mir blieb keine Zeit für genauere Betrachtungen des Interieurs. Ich nannte an der Rezeption meinen Namen, den Grund meines Erscheinens und verlangte, wie aufgetragen, nach Dr. Wieland.
Es wird ihr unangenehm sein, dass ich hier erscheine. Es wird kein gutes Gespräch werden. Wie soll es das auch? Es steht so viel zwischen uns.
»Wieland. Ich grüße Sie.«
Ein hoch gewachsener Herr um die fünfzig, im Anzug und mit Krawatte, stand vor mir und streckte mir steif die Hand entgegen. Seine Statur war sehr schmal, fast schlaksig, und seine Halbglatze glänzte, als hätte er sie kurz zuvor mit Hautöl poliert. Er strahlte kein bisschen Freundlichkeit aus, sondern eine Mischung aus Professionalität, Kälte und einer nicht geringen Prise Überheblichkeit. Bekanntlich entscheidet ein Mensch innerhalb von drei Sekunden, ob ihm sein Gegenüber sympathisch ist oder nicht. Wieland war mir auf Anhieb unsympathisch, und ich fühlte instinktiv, dass es ihm mit mir ebenso ging.
»Bitte folgen Sie mir.«
Wir wollten uns gerade in Bewegung setzen, als hastige Schritte auf hochhackigen Pumps, deren Echo in der großzügig gestalteten Hotellobby widerhallte, eine mir nur allzu vertraute Person ankündigten. Sekunden später stand Gitta neben mir. Sie war völlig außer Atem, ergriff aber dennoch gleich das Wort.
»Brigitta Grothe, Society-Redakteurin von Amiga.« Sie reichte Wieland, der über ihr Erscheinen offensichtlich so überrascht war wie ich, die Hand. »Entschuldigen Sie bitte die Verspätung. Es ließ sich terminlich nun doch realisieren, dass meine Kollegin Frau Lackner und ich gemeinsam kommen.«
Wieland begrüßte sie genauso kühl wie mich und führte uns zum Lift. Wir fuhren in die oberen Etagen und fanden uns Augenblicke später in der so genannten Präsidentensuite wieder. Hier sollte das Interview stattfinden. Man hatte vorgesorgt: Kaffeegedecke und Mineralwasser standen auf dem Tisch, an dem wir Platz nehmen durften.
»Ich werde Frau Ministerin Hermann nun holen«, sagte Wieland mit unbewegter Miene und verschwand durch eine Seitentür.
»Gitta, was machst du hier?«
»Tatjana ist umgeknickt und der Knöchel ist etwas geschwollen. Der Arzt hat gesagt, es sei eine Verstauchung, weiter nichts. Die Tränen waren schon getrocknet, als ich ankam. Sie wollte nicht mal nach Hause fahren, sondern noch bis zum Rest der Stunde zuschauen. Und dann wird sie sowieso von der Mutter ihrer Ballettfreundin abgeholt. Hast du den Zettel mit den Fragen dabei?«
Ich schob ihr das inzwischen leicht zerknitterte Blatt zu.
Eigentlich konnte ich jetzt gehen. Wenn Gitta ohnehin hier war …
Es war zu spät. Die Seitentüre öffnete sich wieder und Katharina Hermann, gefolgt von Wieland, trat ins Zimmer. Wir erhoben uns, als sie sogleich mit gewinnendem Lächeln auf den Lippen auf uns zukam.
Seit unserem letzten Zusammentreffen hatte sie sich kaum verändert. Sie trug ihr blondes Haar immer noch schulterlang, akkurat auf eine Länge geschnitten und ohne Pony. Der Seitenscheitel war sorgfältig nach links frisiert. Ihre graugrünen Augen blickten uns freundlich an, doch ich wusste aus Erfahrung, dass es jene aufgesetzte und zweckdienliche Freundlichkeit war, die rein darauf abzielte, Sympathien zu gewinnen. Sie trug dezentes Make-up, von dem ich vermutete, dass es mit mindestens vier Profi-Visagistinnen exakt auf ihren Typ abgestimmt worden war. Neu waren lediglich die kleinen Falten, die sich um ihre Augen gebildet hatten, aber für eine Frau ihres Alters – Katharina Hermann war in diesem Jahr 39 geworden – durchaus nicht ungewöhnlich waren. Sie trug ein elegantes Kostüm in pastellblau mit tailliertem Blazer und ich stellte innerhalb weniger Bruchteile von Sekunden fest, dass sie zwar immer noch schlank war, aber im Vergleich zu früher doch einige Kilos mehr auf den Rippen hatte. Lag es an den vielen Buffets und Dinners, an denen sie teilnehmen musste?
»Es freut mich, dass Sie gleich zu zweit kommen«, sagte sie und reichte uns beiden die Hand. »Bitte, setzen Sie sich doch wieder.«
Erkennt sie mich nicht?
»Der Terminplan von Ministerin Hermann ist sehr gedrängt. Sie haben 45 Minuten Zeit, das ist das Maximum«, informierte uns Wieland, der offensichtlich während des gesamten Interviews zugegen sein würde.
Gitta reichte sowohl Wieland als auch Katharina Hermann ein Visitenkärtchen. »Brigitta Grothe. Hier finden Sie meine Kontaktdaten. – Und das ist meine Kollegin Theresa Lackner.«
Bitte nicht nochmal meinen Namen sagen. Ich schrumpfte regelrecht auf dem weinroten Ledersofa, auf dem wir platziert worden waren.
»Angenehm«, sagte Katharina Hermann, und nichts an ihrem Verhalten deutete darauf hin, dass sie mit meinem Namen irgendetwas verband.
Sie erkennt mich nicht. Die Erkenntnis traf mich wie ein Faustschlag in die Magengrube. Mit allem hatte ich gerechnet, mir darüber den Kopf zerbrochen – aber nicht damit, dass sie mich tatsächlich nicht erkannte. Während ich diesen Schock erst einmal verdaute, ging Gitta in die nächste Runde.
»Frau Lackner stammt zufällig aus derselben Gegend wie Sie, Frau Ministerin, und hat auch bei der dortigen Regionalzeitung gearbeitet. Eventuell sind Sie sich ohnehin schon einmal über den Weg gelaufen.«
Herzstillstand. Gitta, wie kannst du nur? Warum habe ich dir nur jemals etwas von mir erzählt?
Da war es: Ein verräterisches Flackern in Katharina Hermanns Augen, als sich unsere Blicke trafen. Sie wusste also doch, wer da vor ihr saß. Seltsamerweise wurde mir bei diesem Gedanken nicht besser, im Gegenteil: Ich fühlte, wie ich wieder zu schwitzen begann.
Die Justizministerin runzelte die Stirn und schien angestrengt nachzudenken.
»Ich kann mich im Moment nicht erinnern, natürlich ist das möglich, aber …« Eine Sekunde lang schien sie mit sich zu ringen, ob sie unsere Bekanntschaft verleugnen sollte oder nicht. Dann entschied sie sich, dass es doch besser war, mich zu kennen. Angesichts der zahlreichen Artikel, die mit meinem Namen versehen und mit Zitaten aus ihrem Munde gespickt im Regional- und später auch Bundesteil unserer Regionalzeitung erschienen waren, war dies eindeutig die klügere Entscheidung.
»Aber natürlich!« Ihr Gesicht hellte sich auf, als hätte die plötzliche Erleuchtung sie überkommen. »Sie haben diese BorkenkäferPlage journalistisch begleitet, nicht wahr? Da hatten wir des Öfteren miteinander zu tun.«
Gittas Mundwinkel zuckten, und ich wusste, dass es der Borkenkäfer war, der sie belustigte. Als gebürtige Hamburgerin hatte sie zu den Problemen der ostbayerischen Forstwirtschaft wenig Bezug.
Ich nickte ergeben und hielt dabei die Augen gesenkt. Glücklicherweise legte Gitta nun das Aufnahmegerät auf den Tisch und schritt nach ein paar einleitenden Worten, in denen sie kurz und knapp das Amiga-Konzept vorstellte, zur ersten Frage. Ich versank in meinen Gedanken, kämpfte gegen die Schweißausbrüche und das dumpfe Gefühl in meinem Magen, gegen sämtliche Erinnerungen und gegen die Gespenster der Vergangenheit, die mich noch immer verfolgten.
Ich hätte das nie tun dürfen!
Aber du hast es getan, Theresa, weil du ein kleines egoistisches karrieregeiles Biest warst! Und jetzt musst du mit diesem deinem schlechten Gewissen leben und die Konsequenzen tragen.
Eine Unzahl von belanglosen Fragen und aalglatten Antworten später gab ich mich der trügerischen Hoffnung hin, das unverhoffte Wiedersehen mit Katharina Hermann sei bald beendet. Ich irrte mich. Was jetzt schon schlimm genug war für mich, hatte durchaus Steigerungspotenzial.
Katharina Hermann hatte gerade die letzte Frage – nämlich die nach ihrem Lippenstift – souverän und mit galantem Lächeln beantwortet und damit unfreiwillig Produktwerbung für Chanel Aqualumière in einer Farbkreation namens »Key Largo« gemacht, als sich Gitta auch schon herzlich für das Interview bedankte und sich nach Farbfotos von der Ministerin erkundigte, die ihr Wieland am Telefon zugesichert hatte. Wie viele hochrangige Persönlichkeiten zog die Ministerin die Weitergabe vorbereiteter Pressefotos einem Fototermin mit einem – meist durchschnittlichen – Pressefotografen vor.
»Aber sicher«, sagte Katharina Hermann, ohne ihr freundliches Lächeln dabei zu verlieren. »Am besten wählen Sie sich gleich selbst aus, was Sie zur Illustration benötigen. Herr Dr. Wieland hat das Bildmaterial in unserem mobilen Press-Office, gleich ein paar Zimmer weiter. Herr Dr. Wieland, wären Sie wohl so freundlich und versorgen Frau Grothe gleich mit den passenden Fotos?«
Wieland machte ein Gesicht, als hätte sie ihm Unmögliches abverlangt. »Frau Ministerin, es gäbe die Möglichkeit, die Fotos digital – «, begann er, wurde jedoch von der Angesprochenen freundlich, aber bestimmt unterbrochen.
»Wenn Frau Grothe schon hier ist, treffen Sie doch gleich gemeinsam mit ihr eine Vorauswahl und geben Sie ihr die Fotos mit. Warum so umständlich?«
Hoppla. Offenbar war das nicht abgesprochen.
Wieland blieb nichts anderes übrig, als den Brocken zu schlucken und ihre Anweisung zu befolgen. Er erhob sich, und auch Gitta und ich standen auf.
Nur weg hier.
»Ich denke, Frau Grothe schafft die Fotoauswahl mit Herrn Dr. Wieland ganz gut alleine, nicht wahr? Da können Sie doch in Ruhe Ihren Kaffee austrinken, Frau Lackner.«
Oh nein. Bitte, Gitta, sag, dass mein fotografisches Auge für die Auswahl unverzichtbar ist.
Gitta tat mir den Gefallen nicht. »Aber natürlich. Wir besprechen das dann ohnehin später in der Redaktion«, flötete sie, bedachte mich mit einem kurzen fragenden Blick und verschwand mit Wieland durch die Türe.
Wir waren alleine.
Eine Weile sagte niemand etwas. Ich fühlte, dass ihr Blick auf mir ruhte, und zwar lange und gründlich. Ich konzentrierte mich auf meine Kaffeetasse, die ich nun genauso umklammert hielt wie den Plastikbecher heute Morgen in der Redaktion. Es war wie ein Schutzschild vor den Verbalattacken, die ich befürchtete.
»Theresa, Sie haben sich verändert.«
Ihr Satz war eine einfache Feststellung. Sie hatte Recht. Es gab nichts darauf zu sagen, also schwieg ich.
»Warum schreiben Sie für dieses Blatt?«
Warum siezt du mich, Katharina? Waren wir nicht schon mal beim Du?
»Es ist okay«, sagte ich schulterzuckend und vermied es dabei sie anzusehen.
»Nein, zum Teufel, das ist es nicht!« Ihre Stimme war leise, schneidend, und hatte die Freundlichkeit, die während des gesamten Interviews mitgeschwungen war, verloren. »Sie hatten eine Redakteursstelle beim Tagesspiegel, Theresa! Warum sind Sie da nicht mehr? Oder besser: Warum sind Sie nicht inzwischen beim Brennpunkt oder beim Spiegel? Das ist die Etage, in der ich Sie erwartet habe. Nicht das hier.«
Die Verächtlichkeit in ihrer Stimme verletzte mich mehr, als sie vielleicht ahnte. Oder wusste sie es und rächte sich nun an mir für die Sünden aus meiner Vergangenheit?
Ich stellte die Kaffeetasse ab, hob den Kopf, reckte ihr entschlossen mein Kinn entgegen und bemühte mich um einen möglichst selbstsicheren und gelassenen Tonfall, als ich entgegnete: »Die Dinge haben sich eben geändert. Manchmal wechseln die Prioritäten, die man früher hatte, im Laufe der Zeit. Das ist völlig normal.«
Ehe ich es verhindern konnte, fasste sie nach meiner rechten Hand und betrachtete sie kurz.
»Kein Ehering, Theresa. Kinder?« Sie gab sich selbst die Antwort. »Nein, wohl kaum. – Was hat sich dann verändert, Theresa? Und was ist mit Ihrem damaligen Verlobten geschehen, diesem Medizinstudenten? Standen Sie nicht kurz vor der Hochzeit? Und war Ihnen Ihre Karriere nicht damals so wichtig, dass Sie über Leichen gingen?«
Ihre Fragen klangen wie eine einzige Anklage. Ich fühlte mich attackiert von einem Messer, dessen Spitze sich wieder und wieder in meine Bauchdecke bohrte und kleine, blutende Wunden hinterließ. Der Schmerz überraschte mich selbst, hatte ich doch lange genug geglaubt, ich sei nicht mehr fähig, welchen zu empfinden. Gleichzeitig spürte ich, wie Wut in mir aufstieg. Sie braute sich zusammen wie ein Gewitter und brach aus, als ich Katharina Hermanns selbstgefällige Miene sah. Sie schien ihren Triumph über mich genauso zu genießen wie ich damals meine Übermacht über sie.
Ich konnte mich nicht länger zusammennehmen. Mit einem wütenden Zischen sprang ich auf und funkelte sie, die noch saß, von oben herab an.
»Martin ist tot!«, brach es aus mir heraus. »Ich konnte ihn nicht heiraten, weil er vorher mit dem BMW seines Vaters gegen einen Baum fuhr!«
Das saß.
»Oh, mein Gott.« Die Ministerin hielt sich bestürzt die Hand vor den Mund. »Ist … ist das wahr?«
Ich antwortete nicht. Ich kämpfte mit den Tränen, und diese Tatsache beschämte mich.
Nicht vor ihr weinen.
»Theresa …« Sie reichte mir ein Taschentuch, und ich wischte mit vor Scham und Wut aufeinander gepressten Lippen die verräterischen Tränen aus meinen Augen. Dieses Zusammentreffen entwickelte sich noch schlimmer, als ich befürchtet hatte.
»Theresa, ich hatte keine Ahnung, ich …« Was auch immer sie noch sagen wollte, sie kam nicht dazu. Wieland und Gitta traten wieder ins Zimmer. Ich kehrte den beiden den Rücken zu und versuchte, mich zu beruhigen.
Sie hatte sich sofort im Griff.
Es fand eine kurze, professionelle Verabschiedung statt, dann geleitete uns Wieland nach unten in die Lobby.
»Na, Erinnerungen ausgetauscht?«, erkundigte sich Gitta, als wir uns zu Fuß auf den Rückweg zur Redaktion machten. Die gewisse Bissigkeit in ihrer Stimme konnte ich ihr nicht verübeln. »Warum hast du mich heute morgen belogen, Theresa? Hast du ein Problem mit ihr?«
»Nein!« Ebenso wie in der Früh kam meine Antwort auf ihre Frage auch diesmal etwas zu schnell.
»Auf den Arm nehmen kann ich mich selbst«, erwiderte Gitta. Sie war beleidigt. Schweigend gingen wir zurück ins Büro.
Am Anfang War der Trumpf
Der Borkenkäfer, lateinisch Scolytus oder – bei Vorkommen in Fichten und Tannen – Pityogenes chalcographus, ist ein heimtückisches Tier: Zusammen mit seinen Artgenossen nistet er sich in einen Baum ein. Nicht in irgendeinen, nein. Der Borkenkäfer ist schlau und sucht sich in einem Wald genau jenen aus, der am schwächsten ist. Denn ein gesunder Baum kann ihm und seiner Sippschaft in der Regel Widerstand leisten. Gibt es jedoch eine Schwachstelle, frisst er sich Gänge unter der Rinde und gibt ihm somit nach und nach den Rest. Wird ein Baum auf diese Weise befallen, ist sein Tod nahezu unabwendbar. Derart gut genährt, vermehrt sich das hässliche braune Ungetüm innerhalb kürzester Zeit immens und ist somit ein echtes Problem für die Forstwirtschaft und einer der Gründe für das zunehmende Waldsterben.
In einem heißen, trockenen Sommer saß eine junge Journalistikstudentin in einer ostbayerischen Kleinstadt am Rande von Nirgendwo in einem engen kleinen Dreierbüro am Schreibtisch und versuchte trotz glühender Hitze, fehlender Klimaanlage, dem Zigarettenrauch ihrer stetig qualmenden Kollegen, dem ständigen Bimmeln des Telefons im Sekretariatszimmer nebenan und dem Rattern des Redaktiondruckers hinter ihr einen klaren Gedanken zu fassen.
Es war erst halb drei Uhr nachmittags, doch Theresa hatte schon einen anstrengenden Tag hinter sich: Um sechs war sie aufgestanden und in die Kreisstadt gefahren, hatte dort am Bahnhof einen Kollegen aufgesammelt und war mit ihm zusammen eineinhalb Stunden durch den Bayerischen Wald gefahren. An einem Grenzort zu Tschechien trafen sich zwei Minister und einige Politiker der Region, um über den Borkenkäfer zu diskutieren.
Es gab viel Gerede und eine Waldführung, die Theresa tapfer mitmachte, obwohl sie dafür mit ihrem dunkelblauen Kostüm und der weißen Sommerbluse denkbar ungünstig gekleidet war. Theresas Chef, der Bezirksressortleiter der Regionalzeitung, hatte sie auf diesen Termin geschickt, ihr aber nur die erste Hälfte des Programms mitgeteilt. So hatte sie sich auf eine Reihe von Vorträgen und Reden eingestellt, nicht aber auf eine Wanderung über Stock und Stein. Es gab Kollegen, die diesen Programmpunkt ausließen. Theresa gehörte nicht dazu. Sie hatte Angst, es könne etwas Wichtiges während dieser Wanderung geschehen oder gesagt werden, etwas, das für die Berichterstattung von Bedeutung war. Am Schluss stellte sich jedoch heraus, dass sie sich in ihren schmal geschnittenen Absatzschuhen ganz umsonst Blasen gelaufen hatte, denn das einzige, was es zu sehen gab, war ein kaputter Baum, aus dem tausende Borkenkäfer krabbelten.
Die anwesenden Fotografen schossen ein paar Aufnahmen, und auch Theresa machte anstandshalber ein paar Fotos mit der Redaktionskamera, ahnte jedoch schon, dass wahrscheinlich ohnehin ein dpa-Bild zur Illustration des Artikels genommen würde. Im Gegensatz zu namhafteren Gazetten gönnte sich die Regionalzeitung nicht den Luxus professioneller Fotografen. Auf Pressekonferenzen wunderten sich die Redakteure anderer Medien längst nicht mehr, dass ihre Kollegen aus der Region den Vortragenden nicht nur zuhörten und sich Notizen machten, sondern nebenbei noch ganze Fotoserien verschossen.
Der Kollege, den Theresa in ihrem Auto an die tschechische Grenze mitgenommen hatte, hieß Paul Schwenker. Er war für ein anderes Regionalblatt tätig; die Wahl, ihn mitzunehmen oder nicht, existierte in der Realität nicht. Die stellvertretende Ressortleiterin hatte ihr gesagt, es sei immer so, dass Paul Schwenker auf Termine, die weiter entfernt lagen, mitgenommen würde, und sie habe doch nichts dagegen? Was sie nicht sagte, war, dass Paul Schwenker vor Jahren einen Unfall aufgrund von Trunkenheit am Steuer verursacht hatte, aufgrund dessen ihm der Führerschein entzogen wurde.
Also hörte sich Theresa während der eineinhalb Stunden Autofahrt die Lebensgeschichte eines 43-jährigen Redakteurs an, der in drei verschiedenen Lokalredaktionen eines größeren ostbayerischen Verlagshauses zwanzig Jahre lang die Meldungen selbst ernannter Dorfjournalisten redigierte und in ein teilweise vorgegebenes Seitenlayout presste. Sie ließ sich die großen schauspielerischen Erfolge des Laiendarstellers Schwenker erzählen, die sich auf fünf Auftritte bei einem größeren historischen Festival beschränkten, an dem rund 1000 weitere Leute aus der gesamten Region mitgewirkt hatten. Sie nahm zur Kenntnis, dass Paul Schwenker nach seiner Karriere in den diversen Lokalredaktionen tatsächlich für zwei Jahre die Seiten gewechselt und in der Pressestelle eines großen Automobilkonzerns gearbeitet hatte, und zwar in »leitender Position«, wie er ihr erklärte. Sie ließ seinen Vortrag über den aus Mangel an talentiertem Nachwuchs bedingten Niedergang des Journalismus ebenso über sich ergehen wie seine stetig wiederkehrenden Anmerkungen, dass eineinhalb Stunden Fahrt für die Strecke bis zu besagtem Grenzort doch wohl ein bisschen großzügig kalkuliert worden seien, und dachte sich die ganze Zeit über: Was für ein Schwätzer. Lieber Gott, lass mich nie so enden wie er!
Theresa glaubte in Wahrheit weder an die Macht des Schicksals noch an Gott. Sie war katholisch getauft, was zweifelsohne daran lag, dass in ihrer Gegend fast alle katholisch waren, doch Religion spielte in ihrem Leben keine Rolle. Selbst den Religionsunterricht hatte sie geschickt umgangen, indem sie in der Kollegstufe auf Ethik wechselte. Sie hatte früh begriffen, dass ihr das Beten zu Gott nichts brachte: Nichts änderte sich in ihrem Leben dadurch, dass sie abends ein paar stille Worte an jemanden richtete, von dessen Existenz sie nicht überzeugt war. Sie fühlte sich nicht einmal besser. Es schien ihr Zeitverschwendung, also ließ sie es schließlich ganz sein.
Woran Theresa glaubte, war persönlicher Erfolg aufgrund von Fleiß, Ehrgeiz, geschickter Kalkulation und intelligentem Taktieren. Sie war bereit, Chancen zu nutzen, die sich ihr boten.
Seit Beginn dieses Sommers sah sich Theresa jeden Tag aufs Neue mit einer Vielzahl von Chancen konfrontiert. Sie hatte sich zum Ziel gesetzt, so viele wie möglich zu nutzen, um das zu erreichen, was sie sich schon immer gewünscht hatte: Ein Maximum an beruflichem Erfolg. Sie war sich im Klaren darüber, dass sich ihre Träume nicht von heute auf morgen erfüllen ließen und dass es bis in die Chefredaktion eines renommierten landesweit verbreiteten Mediums ein harter, steiniger Weg war. Doch sie war sich sicher, dass sie bereits die ersten Schritte in die richtige Richtung getan hatte.
Als sie zehn Minuten vor neun Uhr am Ort der BorkenkäferPressekonferenz eintrafen, hatte ihr Paul Schwenker bereits das Du angeboten. Seinen Kollegen von der Süddeutschen Zeitung, dem Korrespondenten der Deutschen Presseagentur und der Redakteurin vom Bayerischen Rundfunk stellte er Theresa als »Frau Kollegin« vor. Das schmeichelte ihr. Schließlich hatte sie erst vor zwei Wochen ihr Praktikum bei der Regionalzeitung begonnen. Noch mehr schmeichelte ihr, dass der Kollege von der Süddeutschen, der während des Vortrags ohne Angabe von Gründen für eine drei viertel Stunde nach draußen verschwand, anschließend auf ihre Notizen zurückgriff. Wäre es ein Redakteur von einer anderen Regionalzeitung gewesen, hätte sie ihre Aufzeichnungen selbstverständlich für sich behalten. Doch die Tatsache, dass ein altgedienter Redakteur einer der größten Tageszeitungen Deutschlands Interesse an ihren Notizen hatte, gefiel ihr. Außerdem behielt sie im Hinterkopf, dass ein guter Draht zu einem SZ-Redakteur nie schaden konnte – besonders später, wenn das Studium zu Ende war und die Suche nach einer Stelle anstand.
Jetzt saß Theresa wieder im Redaktionsbüro und suchte nach einer Lösung für ein Problem: Der Ressortleiter hatte ihr eröffnet, im Landkreis-Teil sei Platz für einen Vierspalter frei geworden. Ob sie nicht die Ergebnisse der Borkenkäfer-Konferenz auch auf Landkreisebene abhandeln könne?
Wie jede Tageszeitung, so setzte sich auch die Regionalzeitung aus mehreren so genannten »Büchern« zusammen: Da gab es den überregionalen Mantelteil, der die internationalen Nachrichten, Wirtschafts- und Politikmeldungen aus ganz Deutschland, den Sport und die Berichterstattung aus der Region Ostbayern umfasste, und zum anderen den Landkreis- und Lokalteil. Im Landkreisteil wurde über die Getreidepreise, die jüngste Feiertagsprozession in den Ortschaften, den 100. Geburtstag eines ehemaligen Landrats oder die Aktivitäten des Vogelschutzvereins berichtet. Im Lokalteil fanden sich Artikel über die silberne Hochzeit eines Stadtratehepaars, die Neugründung eines Jugendzentrums, die Erweiterung des Tiergartens und das Fazit aus dem Rechenschaftsbericht des Stadthaushalts. Die Regionalzeitung erschien in insgesamt zwölf verschiedenen Ausgaben, jeweils zugeschnitten auf einen bestimmten Teil des Verbreitungsgebiets. Während der Mantelteil in allen Ausgaben der gleiche war, wechselten – je nach Ausgabe – Landkreis- oder Lokalteil oder auch beides.
Im ganzen Verbreitungsgebiet, das einen Großteil Ostbayerns umfasste und dem Blatt in manchen Regionen die absolute Marktmacht bot, gab es zehn verschiedene Lokalredaktionen. In ihnen saßen eine Hand voll Leute mit Redakteursstatus. Manchmal wurden sie von Volontären oder auch Praktikanten unterstützt. Theresa war froh, dass sie als Praktikantin der Zentrale in der Kreisstadt zugeteilt worden war und nicht einer Lokalredaktion. Sie hatte schnell herausgefunden, dass die Kompetenz der Redakteure proportional zur Entfernung von der Verlagshaus-Zentrale sank. Es schien ihr nicht sinnvoll, wieder in einem Umfeld zu arbeiten, das sie nicht vorwärts brachte. Theresa hatte bereits vor dem Studium und in den vorangegangenen Semesterferien bei zwei Lokalradios der Umgebung sowie einem neu gegründeten lokalen Privatfernsehsender gearbeitet und dabei zumindest eines gelernt: Dass sie niemals, niemals in solch einer Sackgasse enden wollte. Die Kollegen dort waren entweder blutjung, schlecht ausgebildet und unterbezahlt oder aber abgebrüht, frustriert und ebenfalls unterbezahlt. Theresa hatte im Fall der erstgenannten Gruppe oft den Eindruck, dass sie als Praktikantin diesen jungen Volontären und Redakteuren noch einiges über korrekte Recherche und Konzeption von Beiträgen beibringen konnte. Das gefiel ihr nicht. Schließlich war sie hier um zu lernen.
Auch hier in der Zentrale gab es junge Volontäre, die auf ein Studium verzichtet und sich gleich nach dem Abitur für ein Volontariat entschieden hatten. Sie waren etwas jünger als Theresa. Sie, die Journalistikstudentin, war zunächst überrascht über die Tatsache, dass die Regionalzeitung noch Leute ohne Studium einstellte. Von ihren Kommilitonen wusste sie, dass die meisten anderen deutschen Regionalzeitungen von ihren Volontären ein Studium als Mindestvoraussetzung verlangten. Noch bessere Chancen hatten diejenigen, die zusätzlich langjährige Praxiserfahrung als freie Mitarbeiter aufwiesen. Später hörte Theresa den Verleger einmal selbstherrlich sagen, er bevorzuge Leute ohne Studium, da diese »leichter zu lenken und zu leiten« seien. Was er damit meinte, begriff sie, als er einer Volontärin zur Pressekonferenz über den Donauausbau die Worte »Sie kennen ja unsere Blattlinie: Wir sind für den Kanal!« mit auf den Weg gab. Für die junge Frau war das Wort des Verlegers Gesetz, und frei nach dem Motto »Der Wille des Chefs ist auch mein Wille« kamen in ihrem Artikel der Bund Naturschutz und die Grünen erst gar nicht zu Wort. Zu der Zeit, es war gegen Ende dieses Sommerpraktikums, träumte Theresa bereits jede Nacht vom Theodor-Wolff-Preis, einem der bedeutendsten deutschen Journalistenpreise.
Theresa seufzte. Ihr Problem mit dem Borkenkäfer-Artikel für den Landkreis-Teil war, dass sie bereits alle aussagekräftigen Zitate in dem Artikel für den Mantelteil verarbeitet hatte. Und nicht nur das: Ein Infokasten über den Borkenkäfer ergänzte den Bericht, für den man ihr großzügig Platz eingeräumt hatte. Was blieb also für den Landkreis-Teil an Neuem?
Theresas Seufzer ließ Hans aufblicken. Ihr Bürogenosse war um die 40, ledig wie die meisten in dieser Redaktion und hatte ein Auge auf die hübsche, schwarz gelockte Journalistikstudentin geworfen. Sie hatte das frühzeitig bemerkt und in seiner Anwesenheit beiläufig ihren Freund erwähnt. So konnte sie verhindern, dass er sich in die Idee verrannte, mit ihr ausgehen zu wollen. Sein Wille, sie zu unterstützen und ihr das Praktikum in der Redaktion möglichst angenehm zu gestalten, blieb dennoch erhalten. Jetzt war die Unterstützung mehr väterlich als zielgerichtet, und das war in Theresas Sinne. Hans gab ihr den heißen Tipp, sich einen Landkreis-Politiker zu suchen, der ein Statement über die Bedrohung der Forstbestände im unmittelbaren Umland loswerden wollte. Ein paar Minuten später hatte Theresa mit fünf verschiedenen Mitarbeitern des Landratsamts telefoniert und vom kurz angebundenen Pressesprecher erfahren, dass der Herr Landrat in Sachen Borkenkäfer nicht zu sprechen sei, da er auf einer wichtigen Besprechung für die Festspiele – und zwar auf der Festwiese – weile.