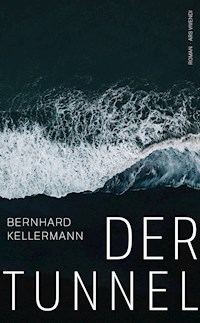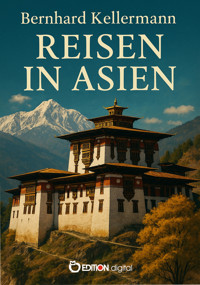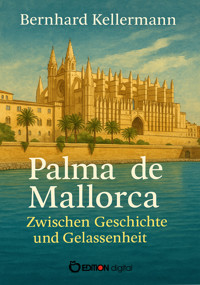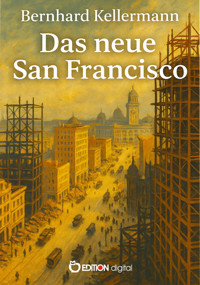10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Stadt, die im Schlaf auf einem Meer aus Öl liegt – bis ein junger Ingenieur sie weckt. Als Jacques Gregor in seine Heimat Anatol zurückkehrt, entdeckt er zufällig Spuren von Naphtha, die sich als gewaltige Erdöllager erweisen. Was als unscheinbare Probe beginnt, löst einen unerbittlichen Ölboom aus: Bohrtürme schießen aus den Böden, alte Häuser fallen, Grundstückspreise explodieren, Abenteurer und Hochstapler strömen in die Stadt, und über allem hängt der schwere Geruch von Petroleum. Jacques wird – ob er will oder nicht – zum Motor dieser gewaltigen Umwälzung. Sein Triumph, als das Öl „herausschoss, als habe man der Erde eine Schlagader geöffnet“, macht ihn über Nacht zu einer der einflussreichsten Figuren der Region. Doch je höher er steigt, desto dichter werden die Intrigen, die Abhängigkeiten und die menschlichen Tragödien um ihn herum. Während Anatol vor Arbeit fiebert und sich in ein chaotisches, lärmendes Ölimperium verwandelt, kämpfen die Menschen mit Gier, Hoffnungen, Verzweiflung – und den Folgen eines Reichtums, der tiefer geht als jeder Brunnen. Bernhard Kellermann entwirft ein grandioses, spannendes Gesellschaftspanorama, das zeigt, wie ein einziger Fund das Schicksal einer ganzen Stadt verändern kann. Das 1932 entstandene Buch wurde auch verfilmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 632
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Bernhard Kellermann
Die Stadt Anatol
ISBN 978-3-68912-611-7 (E-Book)
Aus: Ausgewählte Werke in Einzelausgaben, Verlag Volk und Welt, Berlin 1962 (2. Auflage). Herausgegeben im Auftrag der Deutschen Akademie der Künste von Ellen Kellermann und Ulrich Dietzel. Erstmals erschienen 1932, auch verfilmt.
© 2025 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Godern
Tel.: 03860-505 788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
ERSTES BUCH
I
Als der junge Ingenieur Jacques Gregor, von dem heute ganz Anatol spricht, vor einigen Monaten aus dem Auslande zurückkehrte, wurde seine Ankunft in der Stadt überhaupt nicht beachtet. Er kam an einem heißen Nachmittag in einer verstaubten Kalesche von der Station Kömbös herüber, und die Leute von Anatol schliefen wie gewöhnlich noch hinter den geschlossenen Fensterläden. Selbst der Kutscher schlief auf seinem Bock, aber die Pferde fuhren ganz von selbst schnurstracks vor das „Trajan“. Sie hätten ebenso gut zum „Russie“ fahren können, auf der anderen Seite des Platzes, einem Haus dritter Klasse, voller Wanzen, aber sie kannten die Passagiere am Geruch und zweifelten nicht eine Sekunde, dass dieser elegante Reisende nur im „Trajan“ absteigen konnte.
Man hat später erzählt, dass Koroscheck, der Wirt des „Trajan“, Jacques überhaupt nicht aufnehmen wollte, ganz einfach, weil der junge Herr Gregor das letzte Mal ganz vergessen hatte, die Zeche zu bezahlen. Koroscheck also, sagte man, bekam seinen bekannten Koller und schrie: „Ich verzichte, ich verzichte!“ Ja, was erzählt man heute nicht alles! Jedenfalls ist die Geschichte mit dem Koller nichts als eine böswillige Übertreibung. Jacques musste lediglich einige Minuten im Entree warten, das war alles. Er hörte hinter der Milchglasscheibe des Kontors Keuchen und Flüstern – es war Koroscheck, der keuchte, es war Xaver, der Ober, der flüsterte –, aber als er sich ungeduldig räusperte, trat auch schon Xaver diensteifrig ins Entree: „Herr Koroscheck wird sofort kommen.“
„Da sind wir also wieder, Xaver!“, rief Jacques dem Ober lachend entgegen, und seine helle, herausfordernde Stimme traf Xaver wie eine Fanfare, so dass er wahrhaftig zusammenschrak. Diese Stimme weckt ja das ganze schlafende „Trajan“, die ganze Stadt weckt sie auf. „Ca va, mon vieux? Still going strong, old boy?“
Xaver errötete. Der Atem der großen Welt da draußen schlug ihm aus der wachen, kecken Stimme Jacques’ entgegen. Er streifte Jacques’ eleganten Anzug (ein Taubenblau, das förmlich rauchte!) mit einem bewundernden Blick, und genauso, weiß Gott, wie Jacques auf dem abgeschabten Ledersofa des Entrees saß, so leger und selbstbewusst saßen die Reisenden in den großen Hotels von Wien und Budapest. Wer würde es wagen, an ihrer Zahlungsfähigkeit zu zweifeln?
„Gib mir Nummer vier, wie das letzte Mal, Xaver!“, rief Jacques, indem er sich den Schweiß vom Gesicht wischte. – „Besetzt. Leider. Eine Dame aus Bukarest.“ – „Eine Dame? Alt, jung, hässlich, hübsch?“ – „Ziemlich jung, weder hässlich noch hübsch.“
Auf der Treppe begann Jacques plötzlich belustigt zu lachen. „Was hatte denn unser guter Koroscheck, Xaver?“, fragte er, indem er stehenblieb und Xaver zublinzelte. „Er schien schlechter Laune zu sein, wie?“ – „Es ist wegen des letzten Mals“, raunte Xaver. „Sie wissen doch, diese Bauern liefen damals gleich zur Polizei.“ Wieder lachte Jacques. Ja, eine lustige Abschiedsfeier, einundzwanzig Flaschen Wein hatten sie getrunken. „Und dann höre, Xaver, ist Baron Janko Stirbey zurzeit in der Stadt?“ – „Ja, in der Stadt. Es ist ein Brief von ihm da für Sie. Ich werde ihn sofort bringen. Bitte, hier, Nummer drei. Ich hoffe, Sie sind zufrieden, Herr Gregor. Das Gepäck werde ich sofort heraufschicken.“ Xaver verbeugte sich, und sein Kellnerblick glitt rasch über Jacques’ Lackschuhe. Und solch einen Gast hätte der Chef um ein Haar abgewiesen! Er wird sich mit seinem Koller noch ums ganze Geschäft bringen, als ob wir jeden Tag solche Gäste hier hätten!
Xaver hatte kaum die Tür hinter sich geschlossen, als es schon zu klingeln anfing, dass das ganze Hotel rebellisch wurde. Der Hausdiener, verstaubt wie nach einem Sandsturm, erschien mit dem Gepäck. Wieder klingelte es schrill. Der Hausdiener fuhr mit dem Kopf nochmals in Nummer drei zurück. Das Mädchen soll sofort noch zwei Kannen Wasser bringen. Ja, nun begann das „Trajan“ wahrhaftig aufzuwachen.
Jacques begann vergnügt in der Waschschüssel zu planschen. Das war noch einmal gut abgegangen, alle Wetter! Stelle dir vor, dieser Koroscheck, dieser verrückte Knabe! Ja, was dachte er sich denn eigentlich? „Russie?“ Nein, ganz unmöglich, das wäre ein schlechter Start gewesen. Wenn er im „Russie“ abstieg – nicht eine Krone Kredit würde man ihm geben. Er kannte doch dieses Nest! Und Jacques stülpte sich ein grünes Flakon über den Kopf und massierte sich eifrig die braunen Locken. „Herein!“
An der Tür schnaufte es, und herein schob sich Koroscheck und machte etwas verlegen seine Verbeugung. „Willkommen im Lande, Herr Gregor!“
Jacques wandte ihm sein lachendes Gesicht zu. „Sie haben mich ja recht liebenswürdig empfangen, Herr Koroscheck“, rief er aus, strahlend vor Vergnügen und großmütiger Nachsicht. „Alle Wetter, wenn ich in Berlin ins ,Bristol‘ gehe, so reißt der Portier, zwei Meter hoch, die Türe auf: Habe die Ehre, Herr Gregor!“
„Berlin!“, stammelte Koroscheck beschämt, „Berlin, ja, ja.“ Er stammelte es in den Ausschnitt seiner Weste und schnaufte vor Verlegenheit asthmatisch. Er wagte sich kaum von der Tür fort und legte zwei Briefe, die für Jacques gekommen waren, auf die Kante des Tisches. Koroscheck war untersetzt und dickbäuchig, stak in viel zu weiten Kleidern und hatte einen blonden, merkwürdig hohen, eiförmigen, semmelblonden Kopf. Wenn jemand schlecht sah, konnte er glauben, Koroscheck trage eine reife, schon gelb gewordene Melone auf den Schultern. „Ja, ja!“ Koroscheck bereute und sah bekümmert aus, er legte die Melone vor Reue schief. Der Geruch der scharfen Essenz, der den ganzen Raum erfüllte, flößte ihm Hochachtung für seinen Gast ein. Wir wollen hoffen, dass der junge Herr Gregor nicht gehört hatte, was er im Kontor zu Xaver sagte, das wäre noch schöner. Es war sein Herz, nichts anderes, das Blut staute sich ganz einfach. Und hübscher war der junge Herr Gregor noch geworden, Tatsache! Ein junger Mann wie er sein soll, nicht wahr, frisch und gesund, etwas keck und leichtsinnig vielleicht, der alte Herr Gregor, Christian Alexander, würde jetzt seine Freude an ihm haben. Schon hat Koroscheck, der sehr empfindsam ist, Tränen in den Augen. „Bitte um Entschuldigung, Herr Gregor“, stammelte er mit rasselnder Stimme. „Wir hatten das letzte Mal Schwierigkeiten mit der Polizei, wegen ihres Abschiedsfestes. Die jungen Herren haben die Flaschen einfach auf den Platz geworfen, und da haben sich die Kühe die Scherben in die Klauen getreten. Da liefen die Bauern gleich zur Polizei –“, und Koroscheck musste nun husten und spuckte in sein blaues Taschentuch.
Jacques lachte laut heraus: „Welch ein elendes Nest!“, rief er verächtlich aus und schielte dabei über die Briefe, die Koroscheck auf den Tisch gelegt hatte. Ah, Berlin, Alvensleben & Co.! Alvensleben wunderten sich wohl, weshalb sie so lange nichts von ihm hörten? Ja, die Rätsel des Lebens, meine Herren, sie sind unergründlich. Und das ist ja Janko! „Nun hören Sie mal, Herr Koroscheck, Kühe, Kühe in einer Stadt? Was haben Kühe in einer Stadt zu suchen, frage ich Sie? Natürlich wunderten sich Alvensleben wie er es vermutet hatte, und sie wunderten sich nicht wenig. Wir sind bereits drei Wochen ohne Nachricht von Ihnen und geben der Hoffnung Ausdruck … Ja, wie sollten Alvensleben auch wissen, dass er über Paris nach Hause gefahren war und erst heute hier ankam! Und in Paris, da war Yvonne, Ihr Spesenvorschuss, meine Herren Alvensleben, ist weg, bis auf wenige Kronen, fragen Sie die Vorsehung, sie wird Ihnen Auskunft geben. Und Alvensleben erbitten sofort Nachricht, sie sollen sie haben. „Wissen Sie, mein verehrter Herr Koroscheck, was man in Berlin oder Paris mit diesen Bauern tun würde, wenn sie mit ihren Kühen in die Stadt kämen, wissen Sie das? Nun?“
Koroscheck wusste es nicht. Er starrte Jacques mit seinen vorquellenden veilchenblauen Augen hilflos an. – „Man würde sie einfach verhaften!“ – Koroscheck staunte. Er bat, Platz nehmen zu dürfen – diese Treppe –, und dann fragte er: „Gibt es denn dort keine Kühe? Trinken die Leute dort keine Milch?“
Jacques rieb eifrig Seifenschaum in der Rasierschale. „Natürlich trinken sie dort auch Milch“, erwiderte er zerstreut. „Aber die Kühe sieht man nicht mehr. Es gibt sicherlich viele Leute in den Großstädten, die ganz vergessen haben, dass die Milch aus dem Euter der Kuh stammt. Sie würden vielleicht gar keine Milch mehr trinken, wenn sie sich daran erinnerten, dass es sich um ein tierisches Produkt handelt. Ein Tier ist ein Tier, Ausschwitzungen, und das Stallpersonal ist ja auch nicht chemisch gereinigt. Übrigens stellt man jetzt Milch aus einer Bohne her, aus der Sojabohne, ja, mein verehrtester Herr Koroscheck.“ – Es klopfte, und das Zimmermädchen brachte eine Kanne Wasser. Es war ein junges, kaum sechzehn Jahre altes Bauernmädchen mit den glänzenden, sanften Augen eines Kalbes. Sie bebte vor Angst, als Jacques seinen Blick auf sie richtete.
„Zwei Kannen Wasser braucht der Herr stets, hast du verstanden?“, wiederholte Koroscheck Jacques’ Auftrag. „Nun, es war eine recht ärgerliche Sache, Herr Gregor, die Sache mit diesen Kühen damals. Die Bauern stellten hohe Forderungen, diese unverschämten Lümmel, sie drohten mit einem Prozess. Sie werden also verstehen, Herr Gregor, ein Mensch ist nur ein Mensch. Und da war auch noch“ – Koroscheck sagte es fast demütig – „eine kleine Schuld von Kronen hundertachtzig.“
Jacques begann sich einzuseifen. „Ich hatte Sie doch gebeten, sich mit meinen Brüdern in Verbindung zu setzen. Haben sie denn nicht bezahlt?“ Jacques schien mehr als verwundert zu sein.
Koroscheck wiegte den Kopf hin und her: „Nein, Herr Raoul war sehr ungehalten. Er sagte, er zahle Ihnen die monatliche Rente und sonst habe er gar nichts mit Ihren geschäftlichen Angelegenheiten zu tun. Und Herr Felix hat, wie er selbst sagte, sein ganzes Geld verbaut. Er hat selbst Schulden.“
Jacques kräuselte die Stirn. „Wie ärgerlich!“, sagte er, während er rasch Jankos Brief überflog. Janko erwartete ihn heute Abend im Hotel, das war alles, was Janko schrieb. Ja, das Leben war schön. Abschied, Ankunft, Wiedersehen mit Freunden, Erregungen, Spannungen. Da war Yvonne in der verräucherten Bahnhofshalle von Paris, Tränen in den Augen, trotzdem sie lachte, und im Schlafwagen Wien-Budapest diese etwas üppige Rothaarige. Schade, dass er kein Geld hatte, sonst hätte er in Budapest Station gemacht. Prachtvoll, dass Janko hier war! Der erste Abend in diesem Nest war immer geradezu fürchterlich, schlimmer konnte die erste Nacht im Gefängnis nicht sein. Jacques warf Koroscheck einen Blick durch den Spiegel zu, während er eine neue Rasierklinge einsetzte. „Das ist wirklich ärgerlich“, wiederholte er, als bedaure er Koroscheck aufrichtig. „Wie konnte ich das ahnen? Meine Herren Brüder, seht an, ich werde ihnen meine Meinung sagen. Wir können übrigens diese Lappalie ja gleich ausgleichen“, setzte er hinzu und fuhr mit den Fingern in die Westentasche.
Nun aber war das Erstaunen an Koroscheck. Er legte sich im Sessel zurück und hob beschwörend beide Hände hoch, seine Augen quollen noch mehr aus dem Gesicht: „Nein, nein, so war es nicht gemeint. Bitte herzlich! Ich muss Sie um Entschuldigung bitten, dass ich nicht sofort an den Wagen kam, um Sie zu begrüßen. Man ist aber hier nicht immer in der besten Laune. Die Zeiten sind schlecht. Der Weinhandel geht von Jahr zu Jahr zurück, und die Rosinen gehen noch schlechter. Wir können nicht mit der Türkei und Griechenland konkurrieren. Das einzige, was noch geht, ist das Rosenöl. Aber die Unkosten, stellen Sie sich diese Spesen vor, es bleibt fast nichts. Sie kommen direkt aus Berlin, Herr Gregor?“
Jacques rasierte sich, während sie plauderten. „Ich komme diesmal aus Paris, Herr Koroschek“, erwiderte er, ohne sich umzublicken. – „Aus Paris?“ Koroschecks Hochachtung wuchs ins Unendliche. Hier stand also ein Mann vor ihm, der direkt, ohne viele Umstände zu machen, aus Paris kam! „Und wie ist es denn in Paris?“, fragte er mit ehrfurchtsvoll gesenkter Stimme. Seine Augen hingen mit einer wahren Inbrunst an Jacques’ Lippen im Spiegel. – „In Paris?“ Jacques lachte leise. „Es ist unmöglich, Ihnen das auch nur anzudeuten, Herr Koroscheck. Es gibt keine Nacht, Tag und Nacht sind einander gleich, das Geld rollt durch die Straßen, Luxus, Frauen und Musik. Der Umsatz ist in einer Sekunde – hören Sie, was ich sage, Herr Koroscheck –, in einer Sekunde größer als in Anatol das ganze Jahr.“
„Gerechter Himmel“, seufzte Herr Koroscheck. Da sich jetzt Jacques die Lippe rasierte – nur das kleine, kaum sichtbare Schnurrbärtchen blieb stehen –, so gab er auf Koroschecks neugierige Fragen über Paris und Berlin keine rechten Antworten mehr, und der Wirt erhob sich. „Fast hätte ich vergessen“, sagte er unter der Tür, „Herr Baron Stirbey lässt Herrn Gregor bitten, heute Abend um einhalb acht Uhr, im roten Zimmer.“
Jacques stülpte sich ein helles Flakon in die Hand und wusch sich mit einer scharfen Essenz das Gesicht.
„Xaver soll mir sofort ein Telegrammformular bringen!“, schrie er aus einer Wolke von Wohlgeruch Koroscheck zu.
„Sehr wohl, Herr Gregor!“
Xaver brachte ein Formular, und Jacques schrieb sofort ein Telegramm an Alvensleben, Berlin. „Bin mitten in Arbeit und Verhandlungen, Bericht folgt.“ Das Telegramm gab er Xaver offen in die Hand. „Schicke das Telegramm sofort zur Post, aber sofort, am besten, du gehst selbst. Euer Hausdiener scheint ja ein richtiger Idiot zu sein.“
„Ich gehe selbst!“ Man hörte Xaver über den Korridor eilen. Ja, nun war das „Trajan“ wahrhaftig in Schwung gekommen.
So und nicht anders hatte sich Jacques’Ankunft abgespielt. Mögen die Leute heute erzählen, was sie wollen.
II
Pünktlich um einhalb acht Uhr stieg Jacques die Treppe hinab zum Speisezimmer. Erfrischt und ausgeruht, war er jetzt in geradezu vorzüglicher Laune. Auch hier im Stiegenhaus herrschte, genau wie in den Zimmern, der gleiche fade Lysolgeruch! Jahraus, jahrein kämpften Koroscheck und seine Alte gegen das Ungeziefer. Eine süße kleine Wanze ging am Abend aus zum Tanze, trällerte Jacques vergnügt vor sich hin. Was macht meine kleine Wanze denn beim Tanze? Dass der alte Esel Koroscheck ihm nicht einmal erlaubt hatte, seine Schulden zu bezahlen, nicht erlaubt, man höre, das war mehr, als er erwarten konnte!
Xaver, der Ober, verbarg seine Verblüffung, als er Jacques erblickte, hinter einem tiefen Bückling. Koroscheck aber, der neugierig die gelbe Melone zur Glastür herausstreckte, brachte vor Erstaunen nicht einmal einen Gruß heraus. Jacques hatte sich fein gemacht und, um Koroscheck, Xaver, Janko, ganz Anatol zu imponieren, einen Smoking angezogen. Im „Trajan“ einen Smoking zu einem gewöhnlichen Abendessen, so etwas war überhaupt noch nicht dagewesen! Und ich hätte mich fast von meiner Wut fortreißen lassen, ihn abzuweisen, heiliger Joseph, wenn mich nun Xaver nicht besänftigt hätte! Zur Reklame muss man einen solchen Gast hier aufnehmen, zur Reklame, auch wenn er nicht einen Heller bezahlt.
Um ins rote Zimmer, das Heiligtum des „Trajan“ zu gelangen, musste man das Café und den Speisesaal durchschreiten. Das kleine Café mit seinem Dutzend Marmortischchen war leer, in dem muffig riechenden kleinen Speisesaal aber saß in der Ecke, über den Suppenteller gebeugt, eine untersetzte, mittelgroße Dame mit dunklen, etwas wirren Haaren, die neugierig den Kopf hob, als Jacques hereinkam. Jacques musterte sie mit der ganzen Ungeniertheit eines jungen Mannes, der soeben aus Paris eingetroffen ist. Die dunkelhaarige Dame hielt den Löffel bewegungslos in der Hand, und es schien, als lache sie ihn aus ihren dunklen, glänzenden Augen an, etwas spöttisch, es sah fast aus, als mache sie sich über ihn lustig, offen gestanden. Als er sich an der Tür zum roten Zimmer zu ihr zurückwandte, schien es ihm, als verschwände soeben die Spitze ihrer Zunge, die sie nach ihm ausgestreckt hatte, wieder rasch zwischen den Lippen. Nun, er konnte sich auch getäuscht haben.
Sieh mal an! dachte Jacques. Was war das? Schade, dass sie nicht ein bisschen hübscher ist, die Kleine. Ist es nicht sonderbar, ja höchst eigentümlich? Man kommt aus Berlin oder Paris in irgendein Nest an der Peripherie der Zivilisation, und schon lockt das Leben wieder, rätselhaftes, ewig sprungbereites Leben! Und die kleine, süße Yvonne, sie ist fern, hol mich der Teufel, und das ist gut so. Und laut und freudig rief er aus: „Da bist du ja, Janko!“
Janko Stirbey lag, die Füße in der Luft, faul auf dem roten Plüschsofa des Salons ausgestreckt, sprang aber augenblicklich auf, als Jacques eintrat. Mit einem einzigen Sprung war er bei Jacques. Alle seine Bewegungen waren heftig und rasch: „Endlich wieder ein Mensch!“, schrie er. Immer war er laut, etwas zu laut, gleichsam ein wenig angeheitert. Er umarmte Jacques und küsste ihn auf beide Wangen. Wahrhaftig, seine Augen waren feucht. „Da bist du also endlich wieder! Gott sei Dank! Lass dich anschauen, Jacques, gut siehst du aus, braun wie ein Zigeuner.“ Mit wahrhaft zärtlichen Blicken musterte er den Freund.
Ganz im Gegensatz zu Jacques hatte Janko von Jugend an eine fahle, grünliche Gesichtsfarbe, selbst die heiße Sonne von Anatol konnte seine Haut nicht bräunen. Wie immer sah er ein wenig übernächtig aus, sogar etwas hohlwangig. Aber er war von einer unfassbar zähen Natur, die auch die größten Ausschweifungen nicht erschüttern konnten. Er vermochte tagelang ohne Schlaf auszukommen, und in der Tat, er schlief im Allgemeinen sehr wenig, kaum einige Stunden. Er hatte keine Zeit! Das Leben war zu interessant, um zu schlafen. Gewiss bummelt er wieder, dachte Jacques, als er ihn wiedersah, er kann es nicht lassen.
Janko Stirbey gehörte zu den ersten Familien des Landes. Sein Vater, Baron Michael Georg Stirbey, war jahrelang Minister gewesen, intimer Freund des verstorbenen Königs, sein älterer Bruder, Boris, war Gesandtschaftssekretär in London, seine Verwandten waren Generale, Präsidenten, Landräte, Staatsanwälte. Janko selbst war nichts als ein simpler Leutnant ohne den geringsten Ehrgeiz, wie er selbst zugab, und in Anatol unter der Bezeichnung „Der größte Lump der Stadt“ bekannt. Hatte er Geld, so warf er es mit beiden Händen zum Fenster hinaus – sein Vater hatte ihn schon einige Male saniert –, hatte er kein Geld, so machte er Schulden, ohne sich weiter den Kopf darüber zu zerbrechen. Janko war Spieler, Trinker und ein großer Verehrer des schönen Geschlechts. Die Geschichten über ihn nahmen kein Ende. Einige Male hatte es schon ordentliche Skandale gegeben. Nur mit Rücksicht auf seinen leidenden Vater hatte man ihn noch nicht aus der Armee gejagt.
„He, Xaver“, schrie Janko mit seiner etwas gemachten, forschen Art dem Kellner zu, „wir fangen an, bringe den Cocktail!“
„Cocktail, was ist das Neues?“
„Jawohl, Cocktail! Auch wir am Rande der Erdscheibe bleiben nicht völlig stehen. Erfunden zu deinen Ehren, Jacques! Du wirst staunen! Süßer Anatolwein, Gin, eine Spur Rosenessenz, des Raffinements halber, und eine Olive. Ich hoffe, du hast guten Appetit mitgebracht! Seit vielen Tagen schon habe ich mir den Kopf zerbrochen. Die Heimat soll dich begrüßen: das Schwein, das Lamm, das Huhn. Natürlich müsste ich dir auch eine Jungfrau vorsetzen, doch dazu bin ich heute nicht in der Lage. Doch warte – vielleicht morgen, wer weiß es? Jedenfalls aber wirst du hier ebenso gut speisen wie in Berlin oder Paris. Ich war vorhin bei Frau Koroscheck in der Küche, es duftete wie im Himmel. He, Xaver, spute dich!“
Jacques und Janko waren sozusagen Brüder. Sie hatten jahrelang die gleiche Schule besucht und waren von allen knabenhaften Leidenschaften und Lastern gleichzeitig besessen gewesen. Tausend jugendliche Tollheiten verbanden sie für das Leben, und in endlosen Gesprächen hatten sie ihre Meinungen ausgetauscht. Schließlich kam Janko auf die Kriegsakademie, während Jacques in Wien studierte. Nach einer Trennung von einigen Jahren fanden sie sich wieder im Hause einer Verwandten Jankos, der Gerichtsrätin Frau von Ypsilanti, und hier führte sie die gleiche Leidenschaft wieder zusammen. Sie verliebten sich gleichzeitig und gleich leidenschaftlich in die Tochter der Gerichtsrätin, Sonja, und sie verliebten sich, dies muss gesagt werden, gleich unglücklich in die schöne junge Dame, die sie beide auslachte.
Als Jacques zum ersten Mal aus Wien in die Ferien zurückkam, begann er Janko mit kritischen Blicken zu betrachten. In der gleichen Zeit fing Janko an, die geistige Überlegenheit Jacques’ zu fühlen, er ahnte seine überlegene Disziplin und verborgene Spannkraft und begann den Freund zu bewundern.
Der Cocktail, Jankos Erfindung, war ausgezeichnet, das Diner selbst ein kleines Kunstwerk. Als Jacques das erste fette Bratwürstchen in den Mund steckte, erwachte in ihm ein nahezu heimatliches Gefühl, das er verachtete. Diese Frau Koroscheck war eine Kochkünstlerin ersten Ranges, wahrhaftig: Wurzel aus Budapest plus Konstantinopel. Diese Formulierung stammt von Jacques. Dann die gebackenen Hähnchen! Dazu Anatols berühmter Hellroter, leicht moussierend wie Sekt. Ja, plötzlich fühlte Jacques sich zu Hause, als sei er niemals unter den Lichtfontänen von Berlin und Paris gewandelt. Xaver, auf seinen empfindlichen Füßen, schleppte Platten, Teller, Flaschen. Der Schweiß rann ihm über sein sommersprossiges Gesicht, er hatte seinen großen Tag. „Garcon, Waiter, Ober!“ Jacques brachte ihn in allen Sprachen in Trab, und Janko schrie unaufhörlich: Bring dies, bring jenes. Koroscheck stahl sich herein, um seine Reverenz zu machen. Er hatte einen neuen, dunkelgrauen Rock angezogen, Jacques’ Smoking ließ ihm keine Ruhe.
III
Mit einem fast verliebten Ausdruck hing Janko an Jacques’ Lippen. Berlin! Paris! Natürlich hatte auch er, Janko, eine Menge zu erzählen, das versteht sich von selbst. So war er vor kurzem auf zwei Monate nach der Hafenstadt Stanza strafversetzt worden. Stanza? Nun, eine Stadt wie Anatol, noch langweiliger wenn möglich. Ein paar Holzschiffe wöchentlich und ein paar Fischereidampfer, eine Batterie liegt dort, nichts sonst. Aber Gott ist gnädig! Dieser gnädige Gott hatte ihn bei einer Frau Gabriele Gilkas einlogiert. Gabriele, dreißig Jahre alt, Herr Gilkas, Fischhändler, sechzig. Gabriele – „eine wahre Juno, sage ich dir, Jacques, bei der größten Hitze blieb ihr Körper kühl wie Marmor, einfach herrlich!“
Ja, so war es ihm, Janko, also in Stanza ergangen, gar nicht schlecht eigentlich. Die Sache mit der Strafversetzung aber war kurz so gekommen: Er hatte Jaskulski verhaften lassen, ganz einfach verhaften.
„Welchen Jaskulski?“
Noch jetzt konnte Janko Tränen lachen, wenn er an diese Geschichte dachte.
„Nun, diesen Holzhändler Jaskulski, er ist fast zwei Meter groß, du erinnerst dich doch? Der einzige Mann in Anatol, der ein Radio besitzt, deshalb heißt er auch der Radio-Jaskulski. Ein Bauer ist er, nichts sonst, wenn ihm auch die halbe Stadt gehört.“
Nun schön, sie hatten getrunken, mehr als gewöhnlich. Was sollte der Mensch hier auch tun? Sie hatten gespielt, Jaskulski gewann und gewann, und Janko ist noch heute der Überzeugung, dass Jaskulski ihn betrog. Das ärgerte ihn. Zu allem Unglück begann der Holzhändler nun über die Armee zu räsonieren. Du kennst ihn ja, Jacques! Ja, wozu brauchen wir eine Armee? Gibt es Krieg, so seid ihr geschlagen, in einer halben Stunde – weniger, in zehn Minuten! Zehn Minuten, das war etwas stark! Aber eine Armee ohne Krieg ist wiederum Unsinn. „Eine Schlacht müsst ihr schlagen. Geht einfach über die Grenze und besetzt ein Stück Land.“ So schwätzte dieser alte Bauer daher. „Aber vielleicht nehmt ihr Reißaus, sobald sie nur eine Kanone auffahren, wie?“ Das war Janko zu viel. Er ließ den Holzhändler einfach verhaften. Und Janko erzählte unter lautem Gelächter, wie unsagbar drollig es war, als Jaskulski in seinem Arrest wie verrückt brüllte: „Ich schlage dich tot, Janko, wenn ich herauskomme!“ Am nächsten Morgen aber wachte Janko auf, und plötzlich fiel es ihm ein: Bei Gott, du hast diesen verfluchten Jaskulski verhaften lassen! Natürlich gab es einen mächtigen Skandal. Der Kommandeur rauchte! Auf diese Weise kam Janko nach Stanza. Es war nur einer der vielen Streiche Jankos, er konnte stundenlang erzählen. Zuweilen, das muss zugegeben werden, ließ er sich von seiner Fantasie etwas hinreißen, natürlich, so genau konnte man es bei ihm nicht nehmen. In seinen Erzählungen erschien er witziger, frecher, schlagfertiger, als er in Wirklichkeit war. Er selbst gestand, dass er häufig etwas dazulügen müsse.
„Aber bist du nicht auch der Meinung, dass Xaver noch einmal von diesen Hähnchen servieren sollte? Xaver!“
Nun, und zurzeit versuchte er also wieder, sich in diesem Nest hier einzurichten, so gut es eben ging. Ja, der Himmel meinte es nicht schlecht mit Janko. Er hatte zurzeit eine ganz reizende Geliebte! Süß, verliebt, leidenschaftlich. Kam er da kürzlich, ohne sich etwas zu denken, in einen kleinen Laden, um ein Stückchen Seife zu kaufen: Da stand sie, schmal, zierlich, hübsch, etwas beschränkt vielleicht, aber Augen, Jacques, Augen! Wie eine Gazelle, wahrhaftig! „Eine Spitzbübin, steigt nachts aus dem Fenster, um mich zu besuchen, und ist noch nicht siebzehn Jahre alt. Ich werde sie dir zeigen, du sollst sie sehen. Meinetwegen kannst du sie auch haben, wenn du willst, du weißt, ich liebe dich. Ja, mein Gott, was habe ich dir alles zu erzählen. Wie gut ist es doch, dass du wieder hier bist, Jacques!“, rief Janko mit glücklicher Miene aus. „Ein Mensch! Kennst du denn die Leute hier, das sind ja keine Menschen, das sind Läuse. Weißt du, wie mich oft die Sehnsucht verzehrt, verbrennt, mit einem wirklichen Menschen zu sprechen? Ich hoffe nur, du wirst diesmal etwas länger bei uns bleiben, wie?“
Jacques zögerte mit der Antwort. „Es ist noch nicht bestimmt“, erwiderte er dann nachdenklich. „Vielleicht bleibe ich diesmal einige Monate hier.“ Janko hielt im Kauen inne und sah ihn ungläubig an. „Vielleicht sogar länger. Ich habe diesmal Geschäfte in der Stadt, aber alles ist noch in der Schwebe.“
„Geschäfte in Anatol?“ Janko saß mit offenem Munde. Er sah fast erschrocken aus. „Du bist wohl von Sinnen?“
„Ja, Geschäfte“, wiederholte Jacques lächelnd und dämpfte dabei etwas wichtigtuerisch seine Stimme, „möglicherweise sogar sehr bedeutende und nicht ungewöhnliche Geschäfte. Dir kann ich es ja sagen, Janko, aber sprich vorläufig nicht darüber, die Sache ist die, ganz unter uns: Ich habe eine Erfindung gemacht, oder besser, eine Entdeckung.“
Janko lauschte mit aufgerissenen Augen, und wieder sah er Jacques voll zärtlicher Bewunderung an: „Eine Erfindung, seht an! Ich wusste es ja, dass du die Welt einmal in Erstaunen setzen würdest, Jacques, die ganze Welt! Was für eine Erfindung ist es, darf ich es wissen?“
Jacques aber schüttelte den Kopf und blies den Rauch in die Luft. Darüber wollte er noch nicht sprechen, auch zu ihm, Janko, nicht. Es sei noch zu verfrüht. Wie gesagt, alles sei noch in der Schwebe. „Es sind noch gewisse Untersuchungen nötig, Janko, obschon ich selbst – höre, was ich sage – meiner Sache völlig sicher bin!“ Das hörte sich sehr geheimnisvoll an. Jacques’ Stimme klang ruhig und bestimmt, er schien Janko plötzlich um einige Jahre älter geworden zu sein. Diese Stimme hatte einen völlig neuen, sicheren Klang. Vielleicht sprach er so mit den Leuten in Berlin oder Paris, wenn er ihnen seine Ideen vortrug? Dann versank Jacques in Nachdenken.
„Eine Frage“, wandte er sich nach einer Weile mit einer raschen Bewegung an Janko, „da wir gerade dieses Thema berühren. Wie steht es mit dir? Hast du zurzeit Geld, Janko?“ – „Geld?“ Janko blickte förmlich entgeistert auf Jacques.
„Ich meine, ob du zurzeit bei Kasse bist? Ich brauche Geld für die Geschäfte, die ich eben andeutete. Einige zwanzigtausend Kronen wären mir sehr willkommen.
„Einige zwanzigtausend Kronen!“ Janko warf beide Hände in die Luft und brach in ein so lautes und schallendes Gelächter aus, dass Xaver den roten Schädel neugierig zur Tür hereinstreckte. Sofort stand Jacques auf und ging gemessenen Schrittes zur Tür. „Er wird doch nicht etwa lauschen, dieser Halunke?“ Jacques warf einen Blich in das Speisezimmer. Immer noch saß die kleine schwarze Dame da, und wieder schien es Jacques, als ob sie ihn mit ihren schwarzen Augen spöttisch anlache. Als er etwas später wieder in den Speisesaal blickte, um Xaver zu rufen, war der Platz verlassen.
Das war wirklich eine drollige Sache! Janko konnte sich noch immer nicht beruhigen. „Einige zwanzigtausend Kronen“, rief er aus, „du bist köstlich! Wenn du wüsstest, was ich selbst für ein paar hundert Kronen geben würde, und er spricht gleich von zwanzigtausend.“ Nein, zurzeit hatte er, Baron Johann Stirbey, genannt Janko, keine drei Kronen in der Tasche, auf Ehre! Er war vollständig, aber vollständig abgebrannt. Vorgestern hatte er beim Spiel im Casino seine letzten hundert Kronen verloren. Er wollte heute für die Kleine, von der er vorhin sprach, ein kleines Geschenk kaufen, morgen hat sie Geburtstag, morgen wird sie siebzehn Jahre alt! Eine Aufmerksamkeit, eine Tasche, einen kleinen Ring – er kramte alle Anzüge durch, alle Schubfächer, nichts, nicht einmal ein rostiger Heller. Nein, zurzeit war seine Finanzlage geradezu hoffnungslos. Janko war unglücklich, Jacques enttäuschen zu müssen, und er fügte hinzu: „Du weißt, Jacques, mein Vater ist schwer leidend. Er kann jederzeit das Zeitliche segnen, dann sollst du Tausende haben, so viele Tausende du nur immer brauchst und wünschst.“
„Kannst du nicht Geld aufnehmen, Janko?“, fragte Jacques beharrlich. „Wir könnten, wie die Dinge liegen, eine Menge Geld verdienen, ganz nebenher, verstehst du, ohne jede Mühe. Ich würde dich natürlich mit der Hälfte am Gewinn beteiligen.“ – „Gewinn? Soll auch ein Gewinn dabei herauskommen?“ – Jacques lächelte nachsichtig. „Ich bin ein Mensch von heute“, sagte er mit nachdrücklichem, etwas komischem Ernst. „Geschäfte ohne Gewinn? Mühe ohne Genuss? Was wäre das? Ich bin kein – ich sage es offen –, ich bin kein Idealist! Ja, Janko, in welcher Welt lebst du eigentlich?“ Jacques lachte laut und belustigt.
„Wir werden darüber nachdenken“, versicherte Janko eifrig und blickte nach der Uhr. „Es ist noch nicht zehn, wir haben ja noch ungeheuer viel Zeit. Das ist der einzige Vorzug dieser Stadt, dass man immer Zeit hat. Aber Xaver soll jetzt den Kaffee und die Schnäpse bringen.“
IV
„Und Sonja? Ist sie hier?“, fragte Jacques unmittelbar aus der Ecke des roten Plüschsofas heraus. Augenblicklich traf ihn Jankos rascher, heller Blick, er stellte das Glas, das er erhoben hatte, wieder auf den Tisch zurück. Die plötzliche Frage verwirrte ihn, sein Lächeln wurde verlegen. Genauso lächelte er als Knabe, wenn man ihn bei irgendeiner nicht ganz korrekten Handlung ertappt hatte. Er errötete flüchtig und stand auf, so stark war seine Erregung.
„Du hast meine Gedanken erraten, Jacques“, erwiderte er mit einem noch immer etwas verwirrten Lächeln und begann im Zimmer auf und ab zu gehen. „Ich dachte soeben an Sonja! Den ganzen Abend dachte ich an sie, bei Gott, während ich albernes Zeug schwätzte. Hundertmal wollte ich schon von ihr zu sprechen beginnen, immer wieder schien es mir nicht der rechte Augenblick. Was kümmert mich schließlich die Kleine da, diese Rosa, mit ihren großen Augen? Nichts, gar nichts. Im Vergleich zu Sonja – nein, wen könnte man mit ihr vergleichen? Ich möchte auch beide nicht in einem Atem nennen.“ Seine Stimme klang weicher, sie hatte den etwas forschen, burschikosen Ton verloren. Er blieb bei Jacques stehen und nickte. „Ja, sie ist hier, Jacques! Seit einigen Wochen ist sie zurück!“ – Er kräuselte flüchtig die Brauen und begann wieder hin und her zu gehen. „Sie ist ernster geworden, noch ernster. Und noch schöner!“ Er schwieg eine Weile, während er auf und ab ging, dann blieb er wieder bei Jacques stehen. „Ja, noch schöner!“, wiederholte er mit schwärmerischer Stimme. „Du wirst sie ja morgen sehen. Sie ist jetzt völlig erblüht. Sie ist – nun, stelle dir eine märchenhaft schöne weiße Rose vor, eine Rose in ihrer schönsten und vollsten Blüte – so ist sie.“
Jacques lächelte im Schatten, so dass Janko seine weißen Zähne glänzen sah. „Du lächelst, Jacques?“, sagte er. „Nun gut.“ Er lachte kurz auf, sein altes, keckes Lachen, und goss sich ein Glas Kognak ein. „Du wirst sie sehen, Jacques, und ich sage es dir schon heute, du wirst dich ebenfalls und ebenso heftig in sie verlieben, wie ich, ganz genauso, ich kenne dich ja!“
Wieder ging Janko auf und ab. Er war sehr nachdenklich. Vielleicht war Sonja etwas zu ernst geworden, wie? Weshalb hatte die Baronin sie nach Südfrankreich in ein katholisches Institut mit stark religiösen Tendenzen gegeben? Wäre es nicht für Sonja bei ihrer Neigung zu Grübeleien und ähnlichem Firlefanz besser gewesen, wenn die Mutter sie in ein modernes Schweizer Pensionat, wo man tanzte und Sport trieb und sich amüsierte, geschickt hätte? „Aber herrlich war sie, unsagbar herrlich –!“
Janko schwärmte. Jacques aber wurde plötzlich müde, Eisenbahnräder rollten unter seinen Füßen. Er schlief etwas ein, während Janko redete, aber Gott sei Dank bemerkte es Janko gar nicht.
Als Jacques in später Stunde sein Zimmer betrat, blieb er überrascht und fast erschrocken auf der Schwelle stehen. Das Mondlicht flutete herein – die Stadt sah aus wie beschneit, und hinter ihr erhoben sich die Berge wie Silberblöcke in Rohguss. Unter dem Gefeil von Myriaden von Grillen schien ununterbrochen silberner Staub aus dem hohen, hellen Himmel herabzurieseln. Von den Bergen kam ein lauer Windhauch und trug den warmen, süßen Geruch der Rosenkulturen mit sich, die Anatols berühmte Rosenessenz lieferten. Sie begannen eben jetzt zu blühen, und die schlafende kleine Stadt war in einen Duft von Rosen gebettet.
In Paris brüllten jetzt die Autos, es stank bis in den fünften Stock nach Benzin, die Freunde spielten Billard im Café Versailles, und die kleine Yvonne saß geduldig an ihrem Marmortischchen und plapperte kleine mokante Albernheiten. Wie eine Brandung von Licht rollten die Boulevards dahin. Nun warte – auch du – er würde zurückkehren eines Tages, die Taschen gepolstert mit Banknoten, und sich hundert Yvonnes kaufen! O nein, vielen Dank, er hatte gar keine Lust, in einem Büro zu sitzen und ihnen die Stiefel zu putzen für vierhundert Kronen im Monat. Er war kein Narr. Und nicht feige, so ist es.
Schade, schade um diesen Janko! Er lebt in den Tag hinein, verliebt sich, weiß noch nicht, dass, ganz wie ein Gebäude, auch das Leben eines jeden Menschen einen Grundriss haben muss und der kleinste Fehler in der Anlage sich ein Leben lang rächen kann. Nun, er, Jacques, würde hübsch vorsichtig auf seinen Grundriss achten. Janko, du Narr, kehre um.
Es zeigte sich, dass man recht gut beim Brüllen der Automobile schlafen kann, dass aber das feine Feilen der Grillen das Einschlafen unmöglich macht. Jacques schloss das Fenster. Nun aber begann die Wand an seinem Ohr zu atmen. Weinte hier jemand, lachte, kicherte hier jemand? Nebenan schnäuzte sich jemand die Nase. Das „Trajan“ trug jeden Laut durch alle Stockwerke. Vielleicht war es die kleine Schwarze, die ihn auslachte? Schielte sie nicht ein wenig? War sie nur dunkel gekleidet oder in Trauer? Vielleicht schlief sie tatsächlich nur durch eine dünne Wand von ihm getrennt, sollte er klopfen? Vorgestern noch in Paris, Blick in Blick, pausenloses Gefecht der Geschlechter, gestern die Rothaarige im Zug nach Budapest. Auf eine Sandbank geworfen bei einem Schiffbruch, würde er wühlen nach einer Frau, und er würde sie finden! Ja, das glaubte er, Gott mache ihn selig. Es ist schön, jung zu sein.
Votre serviteur, messieurs, dames, seid gegrüßt, Yvonne, liebliche Gazelle. Leise und ferne spielte die Niggerjazzband der Tanzdiele auf der Place Clichy, das Saxofon kollerte und lachte drollig in seinem linken Ohr, und schon schlief er den gesegneten Schlaf eines jungen Mannes.
V
Früh am Morgen wurde Jacques durch das mörderische Schreien eines Esels geweckt, und augenblicklich war ihm bewusst, dass er wieder in der Heimat war. Schweine quiekten, Bauernweiber schnatterten, es war Markt.
Sofort sprang Jacques aus dem Bett und machte so hastig Toilette, als hätte er nunmehr auch nicht eine Sekunde Zeit zu verlieren. Eine Weile später verließ er geschniegelt und gebügelt, ganz feucht von Essenzen, das Hotel. Mit dem nachsichtigen Lächeln des Großstädters betrachtete er das Gewimmel des Marktes, den jungen Mädchen sah er ohne viele Umstände ins Gesicht. Wie reizend du bist, ja, sie wachsen heran. Eine zierliche dunkeläugige Dame stand auf dem Balkon von Rothkehl & Wiener, Konfektion, und lächelte ihm kokett zu. Er machte ihr seine Verbeugung. War es Gisela oder Antonia Rothkehl, er hätte es nicht sagen können, so ähnlich sahen sich die Schwestern. Eine von ihnen hatte er einmal nach der Tanzstunde geküsst. Mein Gott, in diesem Nest hatte sich auch nicht das Geringste geändert. Da saß wahrhaftig der weiße Spitz des Juweliers Roca vor der Ladentür, wie seit Jahren.
Jacques grüßte, lächelte, zeigte kokett seine weißen, hübschen Zähne, nun wusste ganz Anatol, dass der „junge Herr Gregor“ wieder eingetroffen war. Er bog in die Rathausgasse ein und trat in das Tor eines Hauses, dessen Kellern ein betäubender Geruch von Wein entströmte. Hier wohnte sein Bruder Raoul, Rechtsanwalt und Notar, und ihm galt stets sein erster Besuch. Jacques pfiff leise vor sich hin, um sich Mut zu machen. Die Antrittsvisite bei Raoul fiel ihm immer ziemlich sauer. Natürlich hatte er wieder zu viel Geld ausgegeben, er hatte zu selten geschrieben, und es wurde allmählich wahrhaftig Zeit, dass er sich nach einer soliden bürgerlichen Beschäftigung umsah. Raoul war ein Pedant, mit einem Wort ein Nörgler. Um viele Jahre älter, war er Jacques’ Vormund gewesen, und er begriff es einfach nicht, dass sein Mündel längst erwachsen war. Sein mild väterlicher, mahnender Ton aber wuchs Jacques nachgerade zum Halse heraus.
Diesmal aber hatte Jacques Glück. Sein Bruder war schon auf dem Gericht, sagte das Mädchen, und Olga, seine Schwägerin, war noch bei der Toilette und konnte ihn nicht empfangen. Nein, wie herrlich das war! Er hatte, offen gestanden, nicht das geringste Bedürfnis, seine Schwägerin Olga wiederzusehen. Er vermied es stets, mit ihr allein zu sein, ja, er fürchtete es in Wahrheit, denn er hatte ihr gar nichts zu sagen. Er verstand sie nicht und gab sich auch keine Mühe, sie zu verstehen, sie schien ihm eine eitle, oberflächliche Schwätzerin, die darauf wartete, dass man ihr Schmeicheleien sagte – nun, mochte sie warten. Die beiden hatten sich ein für alle Mal auf einen kühlen, höflichen, zuweilen etwas spöttischen Ton geeinigt.
Olga begrüßte ihn durch den Spalt der Tür ihres Schlafzimmers. Sie streckte ihr weiches Patschhändchen heraus und den vollen Arm, auf dem goldene Härchen schimmerten. Ihre blonden Locken waren zu Korkziehern gewickelt und standen komisch um ihr hübsches, leeres Puppengesicht.
„Wir wohnen natürlich wieder im ‚Trajan’?“, fragte sie. Sie sprach ihn fast immer mit „wir“ an.
„Aber selbstverständlich, soll ich etwa im ‚Russie’ wohnen?“
Olga lächelte kokett, und ihre hellblauen Augen schimmerten in aufrichtiger Herzlichkeit. „Natürlich, natürlich! Jeder nach seinen Mitteln“, erwiderte sie und verzog spöttisch das kleine Mündchen.
Jacques lachte gut gelaunt. „Ich lebe von den Zinsen der Millionen, die ich verdienen werde, Olga!“, entgegnete er etwas großspurig. Darauf wusste Olga nichts mehr zu erwidern, sie lud ihn zum Abendessen ein, und Jacques wollte nun nicht länger aufhalten. Nein, die beiden hatten sich wirklich nichts zu sagen.
Das ist ja diesmal prachtvoll gegangen, dachte Jacques, als er mit vergnügter Miene wieder die Straße betrat. Er durchquerte die Stadt und stieg eilig zwischen den Mauern der Weinberge in die Höhe. Bei einem abseits gelegenen, unscheinbaren Haus, das hinter einer verwilderten Hecke von Agaven und Kaktuspflanzen lag, pochte er gegen die Gartentür. Hier wohnte sein Bruder Felix, den er liebte.
VI
„Herr Felix ist in der Bibliothek“, sagte die Bäuerin, die ihm öffnete, und schon hörte er die tiefe Stimme des Bruders im Kellergeschoss des Hauses. Wo sollte Felix Gregor sich auch anders aufhalten als in seiner Bibliothek? Hier saß er mit breitem, gewölbtem Rücken an einem großen Schreibtisch, wie immer in einem hellen, sehr weiten Leinenanzug, der den Eindruck seiner Beleibtheit noch verstärkte. Das Hemd war an der Brust geöffnet, er war barfüßig und trug Bastschuhe wie ein Bauer.
In diesem angenehm kühlen Kellergewölbe verbrachte Felix die größte Zeit seines Tages. Zuweilen nur stieg er in den Garten hinauf, um sich etwas Bewegung zu machen, in die Stadt kam er fast nie. Alle Welt aber wusste recht wohl, wer Felix Gregor war, der Nimbus eines Gelehrten und Philosophen umgab ihn. Vor Jahren hatte eine Wiener Zeitung ein Feuilleton aus seiner Feder gebracht, und Felix war dadurch zu einer Art Berühmtheit geworden. Er hatte seit dieser Zeit nichts mehr veröffentlicht, aber es war stadtbekannt, dass er an einem großen historischen Werk arbeitete.
„Willkommen, willkommen!“, rief Felix freudig aus und küsste Jacques schmatzend auf beide Wangen. „Ich habe natürlich schon gehört, dass du angekommen bist“, fuhr er fröhlich fort, „die ganze Stadt weiß es schon. Gestern Abend soupierten wir zusammen mit dem jungen Baron Stirbey, wir wohnen im ,Trajan’ und haben, wie schon früher, die Gastfreundschaft unserer Brüder nicht in Anspruch genommen. Ja, siehst du, mein Lieber, ich weiß alles, ich weiß sogar noch mehr.“ Felix hatte ein gutmütiges, etwas rasselndes Lachen, das seinen massigen Körper erschütterte. Er kämmte sich belustigt mit den Fingern den Bart und blinzelte listig. „Hier in dieser Stadt gibt es keine Geheimnisse, auch du bist längst durchschaut! Heute Morgen wurde mir berichtet, dass du hierher gekommen bist, um die Bahn von Kömbös nach Anatol zu bauen.“
Jacques fuhr erschrocken zurück. „Aber wie in aller Welt –?“, stammelte er verwirrt, während Felix laut auflachte.
„Da staunst du doch ein wenig, mein Sohn, nicht wahr? So ist diese Stadt! Heute morgen, als ich die meteorologischen Instrumente ablese, da kommt dieser Gerschun, der dich gestern von der Station herüberfuhr, mit seinem Mistwagen vorbei, und sofort fängt er an, seine Neuigkeiten auszupacken. Du lässt ein dutzendmal anhalten, betreibst unterwegs geologische Studien, was ich sehr lobenswert finde, machst deine Scherze mit diesem Gerschun, und schon nimmt dieser Bauer alles für bare Münze und erzählt es in der ganzen Stadt.“ Und abermals schüttelte sich Felix vor Lachen.
Jacques hatte tatsächlich mit diesem Gerschun über das und jenes geschwätzt, ohne sich viel dabei zu denken. Er war noch immer etwas verwirrt und errötete einige Mal hintereinander. Eine Warnung! dachte er. Man kann hier nicht vorsichtig genug sein!
Die Bäuerin tischte eine kleine Erfrischung auf, kleine Pilze in Essig und Öl. Felix schmatzte mit Genuss, und während er schmatzte, sprach er von den Ruinen der sagenhaften, ja geradezu unbegreiflichen Stadt Simbabwe in Südostafrika, deren Ruinen zwischen den Flüssen Sambesi und Lompopo entdeckt wurden, und von dem widderköpfigen Sonnengott Amon. In wenigen Sekunden war er über Jahrtausende zurückgegangen. Die Gegenwart interessierte Felix nicht in dem Maße wie die Vergangenheit. Jacques zum Beispiel interessierte sich für die Passstraße von Kömbös nach Anatol, aber was kümmerte Felix diese elende Straße, ganze zwölf Kilometer lang? Nicht das Geringste. Er dachte an die Handelswege in der Zeit vor Christi Geburt, fünftausend Kilometer lang und noch länger führten sie quer durch ganz Asien. Das war wenigstens der Rede wert, wie meinst du? Trotz allem war Felix über die letzten Errungenschaften auf wissenschaftlichem und technischem Gebiet überraschend gut unterrichtet. In der Ecke der Bibliothek lag ein ganzer Berg von französischen, deutschen und englischen Zeitungen und Zeitschriften, und das ungeheure Gedächtnis des Bruders verblüffte Jacques immer wieder von neuem.
Voller Genuss zerdrückte Felix den letzten Pilz auf der fleischigen Zunge und wischte sich behaglich den Mund. Er lachte gutmütig, die Hände über dem Bauch gefaltet. Mochten sie seinetwegen die Atome zertrümmern, wenn es ihnen Vergnügen machte! Warum nicht? Mochten sie Töne in Licht und Licht in Töne verwandeln, er hatte nichts dagegen. Aber er war weit davon entfernt, der Technik jene Bedeutung zuzuschreiben, die ihr die Welt beimaß – weit davon entfernt. Es kam ihm so vor, als ob sie einen Motor in eine Orgel einbauten, die Orgel fliegt sogar, zugegeben, aber sie vergaßen ganz, die Musik zu verbessern. Das Wesentliche vernachlässigten sie, die Musik – das Göttliche!
Hier wird Jacques’ Gesicht glatt und kühl. Er lächelt höflich. „Das Göttliche?“, sagt er. „Verzeihe mir, Felix. Das sind Worte!“ (Worte? Des Bruders dunkles Auge glüht auf.) „Das sind Phrasen. Europa jedenfalls diskutiert diese Begriffe nicht mehr.“
Felix wiegte bestürzt den massigen Schädel hin und her. „Europa diskutiert diese Begriffe nicht mehr? Aber es sind die wichtigsten, die allerwichtigsten Dinge.“
Jacques stand auf. „Und dein Werk, wie geht es damit?“, fragte er in verändertem Ton.
Felix pumpte sich die Brust voller Luft, und seine Schultern wurden noch breiter. „Geduld, Geduld“, erwiderte er mit einem Seufzer. „Ein Gelehrter muss Geduld haben. Die Quellenstudien sind zeitraubend, und diese ewigen Korrespondenzen, die täglich Stunden verschlingen!“ Felix kritzelte Tag für Tag lange Briefe an Gelehrte, Akademien, Bibliotheken, Archive.
Er begleitete Jacques durch den Garten – eine hohe Auszeichnung. „Hast du bestimmte Pläne?“, fragte er ihn an der Tür. Jacques blieb stehen und wurde nachdenklich. Dann aber schüttelte er den Kopf und sagte: „Ich werde gelegentlich mit dir darüber sprechen.“
Felix blickte Jacques zärtlich an. „Du weißt, was du willst!“, nickte er lächelnd. „Lebe wohl! Komme zu mir zum Essen, wann immer du willst.“
Das Göttliche vergessen wir, dachte Jacques, als er die Tür hinter sich schloss, vielleicht hat er recht, wie? Zum Teufel, nein, er hat unrecht, es sind nichts als Phrasen.
VII
Vor der Gartentür blieb Jacques unentschlossen stehen. Soll ich jetzt Frau von Ypsilanti aufsuchen? Das Haus der Baronin lag kaum zehn Minuten von hier entfernt. Janko hatte ihm gestern geraten, der Baronin gehörig den Hof zu machen, sie hatte Geld, vielleicht würde sie ihm ein Darlehen gewähren: zwanzigtausend, fünfzigtausend, niemand konnte es wissen. Aber plötzlich schlug Jacques die entgegengesetzte Richtung ein. Trotz der großen Hitze schritt er eilig dahin. Der Weg stieg zwischen den Steinwällen der Weinberge in die Höhe, dann führte er durch ausgedehnte Rosenpflanzungen, die einen betäubenden Duft ausströmten. Aber Jacques warf kaum einen Blick auf die Rosenfelder, er überquerte ungeduldig eine öde, riesige Viehweide, die sich bis zu dem Wald auf der Anhöhe erstreckte. Erst als er den Rand des Waldes erreicht hatte, blieb er aufatmend stehen und wischte sich den Schweiß vom Gesicht.
Langsam, mit einer gewissen Feierlichkeit, ja mit einer Art von Andacht, schritt Jacques in den Wald hinein. Dieser Wald – nur er allein, Jacques Gregor, kannte sein Geheimnis, niemand sonst! Der Wald hieß allgemein der „Eichenwald“, obschon hier ebenso viele Buchen und Birken wie Eichen standen. An einzelnen Stellen waren die Wipfel der Bäume so dicht, dass die Sonne nicht durchdringen konnte. Es war ungewöhnlich still hier. Zuweilen nur hörte man den Ruf eines Vogels, aber auch die Stimmen der Vögel schienen merkwürdig fein und fern zu klingen, als ertönten sie in verdünnter Luft. Als er noch ein Knabe war, kam ihm der Wald verzaubert von, und es schien, als riefen die Vögel ihm merkwürdige Worte zu, die er nicht verstand. Oft hatte er ganz plötzlich Furcht empfunden, so dass er in panischem Schrecken zu laufen begann.
Langsam schlendert Jacques zwischen den Bäumen dahin. Seine Augen forschen am Boden, als suche er etwas. Er bleibt stehen, hebt einen Stein auf, mustert ihn und steckt ihn in die Tasche. Dann blickt er sich argwöhnisch um. Hat er Angst wie damals? Er kennt hier jeden Fels, jeden Pfad. Hier liegen die riesigen Felstrümmer, von wilden Rosen überwuchert, der eingestürzte Grat eines Gebirges. Und hier war es, wo er vor Jahren den größten Schrecken seines Lebens ausgestanden hatte.
Felix hatte dem Fünfzehnjährigen erzählt, dass Anatol, wie aus Chroniken hervorgehe, seinen Ursprung „Feueranbetern“ verdanke, einer religiösen Sekte, die wahrscheinlich über das Schwarze Meer gekommen war. „Feueranbeter?“ Das Wort erfüllte die Seele des Knaben mit glühenden Fantasien, und da Felix es nicht für unmöglich hält, dass man einmal die Ruinen ihrer Tempel auffinden werde, so wird der Knabe von dem Fieber des Archäologen erfasst. Ruinen, Grundmauern, überall forscht und sucht er, monatelang. Gerade, als er eines Tages fieberhaft damit beschäftigt ist, diese riesigen Felstrümmer hier zu untersuchen, schmettert ihn eine Stimme zu Boden. Diese Stimme kam aus den Baumwipfeln, aus den Felsen, aus der Erde. Sie war plötzlich da, der Schall einer Posaune, der ihn erstarren ließ.
Ein Mann stand zwischen den Felsen, nicht ein menschliches Wesen, ein Waldgeist. Er hatte einen wirren, aschgrauen Bart und wirres, graues Kopfhaar. Sein Gesicht war schwarz gebrannt, und darin waren helle Flecken, das waren die Augen. Der Waldgeist aber, der das entsetzte Knabengesicht sah, lachte plötzlich laut heraus, um den Erschrockenen zu beruhigen, und in diesem Augenblick erkannte ihn Jacques: Es war Maniu, der Besitzer des Eichenwaldes.
Maniu erfreute sich keines besonders guten Rufes. (Und das war noch vor dem großen Prozess, der Maniu ins Zuchthaus brachte!) Die Erwachsenen wichen ihm aus, die Kinder fürchteten ihn. Jacques hatte ihn zuweilen von weitem gesehen und war ganz einfach entflohen.
Nun aber plauderte dieser Maniu mit dem Knaben, beruhigte ihn und lauschte, den Kopf geneigt, seiner Erzählung von den Feueranbetern.
„Hier im Walde gibt es keine Ruinen“, sagte er, und Jacques hört noch heute seine tiefe, etwas mürrische Stimme. „Mauern? Wenn du dicke Mauern sehen willst, so musst du in meinen Hof kommen. Die Grundmauern dort sind zwei Meter dick. Vielleicht ist es das, was du suchst? Besuche mich einmal!“ Sein Bart weht, und fort ist er.
Jacques wagte sich in den nächsten Tagen tatsächlich zu Maniu, und sie wurden Freunde. Er versäumte es nie, ihn in den Ferien aufzusuchen. Maniu war ein verbitterter, alter Mann, der ihn vor den Menschen warnte, diesen bösartigen Bestien, der Gott leugnete und an den Teufel glaubte. Dabei war er gutmütig und fast kindlich naiv.
Er wird schon auf mich warten, dachte Jacques, als er den ausgefahrenen Fahrweg erreicht hatte, und schritt wieder rascher aus. Ich hätte ihm auf seinen letzten Brief antworten sollen, natürlich, oh, diese entsetzliche Faulheit!
Da lag der Hof, düster wie ein Gefängnis. Er trug den Namen „Türkenhof“, aber die Türken hatten nicht das mindeste damit zu tun, er hieß ganz einfach so, weil er ein Jahrhundert einer Familie Türk gehört hatte. Das Gehöft war von einer hohen, verwahrlosten Mauer umgeben, das Hoftor geschlossen. Völlig ausgestorben lag der Hof da, wie an einem Sonntag, wenn Knechte und Mägde in der Kirche sind. Er hörte die Ketten der Kühe klirren und die Pferde in den Ställen stampfen.
„Ist niemand hier?“, schrie er und polterte gegen das Tor. Eine Tür knarrte, Tritte schlurften, Jacques erkannte den Knecht Mischa, der sich auf seinen gichtigen Beinen ohne Eile dem Tor näherte. Mischa hatte einen Kopf wie eine Distel, so struppig standen ihm die weißen Haare vom Schädel. Argwöhnisch lugte er durch das Tor. „Ach, der junge Herr Gregor!“, brummte er und versuchte zu lächeln, zwei gelbe Zahnstumpen erschienen in seinem Mund.
„Ist Maniu zu Hause, Mischa?“
Mischa senkte nach seiner Gewohnheit den Kopf, als denke er tief nach, dann erwiderte er: „Nein, Maniu ist nicht zu Hause.“ – „Er ist wohl ausgegangen?“ – Diese Frage schien Mischa zu verwirren. Er blickte Jacques wieder mit seinen entzündeten Augen an, senkte den Kopf und schwieg. – „Wann kommt er denn wieder zurück?“ – Nun dachte Mischa lange und qualvoll nach. Sein Gesicht legte sich in Falten: „Sie wissen es also noch nicht?“, fragte er, und der Ausdruck seiner Stimme war nicht misszuverstehen.
Jacques trat einen Schritt zurück. „Was willst du damit sagen?“, fragte er mit bestürzter Miene. Nun, Mischa wollte damit nur sagen, dass Maniu diese Welt verlassen hatte, er war ja auch nur ein Mensch, und vor drei Tagen war er beerdigt worden. Jacques verschlug es den Atem. Maniu? Unmöglich, ganz unmöglich! „Aber Mischa, Maniu war doch ein Riese, dem der Tod nichts anhaben konnte?“ – Nun, nun, es war ja auch keine gewöhnliche Krankheit. Es war der Brunnen dort in der Ecke, der Brunnen hatte Maniu ganz einfach erschlagen, so war es gekommen. Der junge Herr Gregor kannte ja den Brunnen, er ist ja im Herbst selbst aus Neugierde die Leiter hinabgestiegen. Damals war der Brunnen acht Meter tief. Dann kam der Winter, und Maniu konnte nicht weiter graben. Sobald aber die Sonne wieder schien, da probierte Maniu auch schon, ob der Frost noch im Boden saß. Sobald es warm wurde, begann er wieder zu graben. Zuletzt war er schon so tief, dass von der Leiter nur noch drei Sprossen heraussahen. Und immer kam noch kein Wasser. Dann regnete es ein paar Tage, und das ist wohl der Grund, weshalb der Brunnen über ihm zusammenstürzte.
„Hat er den Brunnen denn nicht abgesteift?“ – „Jawohl, abgesteift, aber trotzdem stürzte der Brunnen ein. So schnell hat es ihn gepackt, und diesen Brunnen haben wir sofort zugeschüttet, damit nicht noch jemand verunglückt.“ – „Sofort zugeschüttet“, wiederholt Jacques geistesabwesend. „Das war gut, dass ihr das getan habt, Mischa, sehr gut.“ – Sie schweigen beide. Dann sagt der alte Knecht: „Er hat in den letzten Tagen noch öfter von Ihnen gesprochen, Herr Gregor.“
Sofort wurde Jacques’ Miene wach und argwöhnisch. Er prüfte das Gesicht des Knechtes und fragte: „Von mir hat er gesprochen? Was konnte er denn von mir sprechen?“ – „Er sagte, dieser junge Herr Gregor lässt auch nichts mehr von sich hören. Das sagte er öfter.“ – „Sonst sagte er nichts?“ – „Nein, sonst hat er nichts gesagt. Und am vergangenen Freitag ist er verunglückt.“
Jacques geht tief in Gedanken versunken durch den Wald. Seine glatte Stirn ist gekräuselt, er sieht wahrhaftig niedergeschlagen aus. Der Tod Manius ging ihm nahe. Dass er gerade jetzt sterben musste, wie fatal!
Plötzlich blendete ihn die Sonne ins Gesicht. In der Tat, da war der Wald schon zu Ende. Aber nun hat er sich schon wieder einigermaßen gefasst. Vielleicht ist es sogar besser so, denkt er, wer weiß es? In Geschäften war der Alte sehr schwierig. Er zog die Uhr. Wenn er Frau von Ypsilanti noch besuchen wollte, so musste er sich beeilen. Sonst kam er mitten in die Tischzeit.
VIII
Maniu beschäftigte ihn, während er eilig zur Stadt zurückging.
Der Alte war früher ziemlich wohlhabend gewesen, hatte aber zuletzt wohl nicht mehr sehr viel besessen. Er war ein Bauer aus dem Gebirge, der viel in der Welt herumgekommen war, ein Abenteurer. Anfangs hielt Jacques seine Erzählungen für Aufschneidereien, aber in einer mitteilsamen Stunde kramte Maniu für ihn eine Menge vergilbter Photographien aus der Lade, die bewiesen, dass Maniu nicht log. Maniu war in Alaska gewesen, in Kalifornien, in China und hatte schließlich in irgendeinem Winkel Mexikos einen Haufen Geld zusammengerafft. Mit diesem Geld war er vor etwa zwölf Jahren in seine Heimat zurückgekehrt und hatte den Türkenhof gekauft, der schon seit Jahren unbewohnt war, denn niemand wollte dieses düstere Gehöft mitten im Walde haben. Maniu aber hatte genug von der Welt und den Menschen und wollte völlig abgeschlossen leben. Er betrieb hier eine kleine Ackerwirtschaft, schlug Holz – fast die ganze Stadt wurde von ihm beliefert – und verkaufte Eichenrinde für die Gerbereien.
Fast niemand hatte Maniu je richtig zu Gesicht bekommen, niemand wusste etwas von ihm – doch kam er bald in den Geruch eines gewalttätigen Mannes, den die Leute fürchteten. Die Wilddiebe jedenfalls wagten sich nicht mehr in den Wald, er hatte förmliche Feuergefechte mit ihnen, und einige Bauern, die Holz stahlen, prügelte er beinahe zu Tode.
Auf dem Hof lebte außer Maniu nur ein einziges männliches Wesen, Mischa, der schon bei dem alten Türk gedient hatte. Sonst hausten dort gewöhnlich drei bis vier junge Mägde, die sich Maniu aus entfernten Gebirgsdörfern holte. Zu dieser Familie – denn sie lebten wie eine Familie auf dem Hof, aßen an einem Tisch – kam noch die blutjunge Tochter Manius, Franziska, die später durch den Prozess so sehr bekannt wurde. Aber fast niemand in der Stadt erinnerte sich, sie je gesehen zu haben. Sie wuchs ganz wie ein Bauernmädchen auf und ging wie sie mit nackten Füßen durch die Jauche der Ställe. Eine Frau hatte Maniu nicht, er war Witwer, seine Frau war auf dem Dampfer zwischen Mexiko und Europa gestorben.
Das also war der Hof. Maniu hatte die Abgeschiedenheit, die er wollte, und in der Stadt sprach man sehr selten über den Hof im Walde. Man munkelte nur dies und jenes: Wozu brauchte Maniu stets drei bis vier Mägde, die Wirtschaft war doch klein? Und die Mägde wechselten häufig. Maniu verheiratete sie an Waldarbeiter und Tagelöhner, gab ihnen eine kleine Aussteuer, Wäsche und Geld. Einzelne sollten den Hof schwanger verlassen haben, aber Genaues wusste man nicht. Nun, schließlich war dieser Maniu und sein Hof ja gar nicht so wichtig.
Plötzlich aber lag der einsame Hof im Mittelpunkt des Klatsches und der wildesten Fantasien. Das war vor etwa fünf Jahren, als der berühmte „Prozess gegen Maniu“ begann. Dieser Prozess erregte damals ungeheures Aufsehen, Berichterstatter erschienen aus der Hauptstadt, Pressefotografen, die ganze Stadt war in Aufruhr, und die Damen der Stadt rauften sich um die Plätze im Verhandlungssaal. Jacques erinnerte sich noch heute an alle Einzelheiten des Prozesses, denn sein Bruder Raoul verteidigte Maniu – es war der berühmteste Prozess seines Lebens, auf den er noch heute stolz ist. Raoul setzte seine ganze Kraft ein, und es gelang ihm ja schließlich auch, Maniu wieder freizubekommen.
Den Stein ins Rollen brachte Manius junge Tochter Franziska, damals siebzehn Jahre alt. Sie kam eines Tages in großer Erregung in die Stadt, und am nächsten Tage erschienen die Landjäger im Türkenhof, um Maniu zu verhaften. Aber Maniu warf sie buchstäblich zur Tür hinaus und drohte, jedermann niederzuschießen, der es wagen sollte, sich ihm zu nähern. Schon begann es zu knallen.
Die Landjäger schickten nach Verstärkung, und es begann die Belagerung des Türkenhofes, die drei Tage währte. Maniu schoss wie ein Wilder, und die ganze Stadt zitterte vor Erregung und Schrecken, Man hielt diesen Maniu für einen wirklichen Räuberhauptmann, der nunmehr seine Maske abgeworfen hatte. Endlich wagte es eine der Mägde, und zwar die jüngste, sie hieß Lisa Jellinek – selbst an diesen Namen erinnerte sich Jacques noch ganz genau –, zu dem Rasenden zu gehen und ihn zu überreden, sich zu ergeben. Gefesselt wie ein Raubmörder wurde Maniu in das Gefängnis abgeführt. Er war angeklagt, zu seiner Tochter unerlaubte Beziehungen unterhalten zu haben, Franziska selbst hatte ihn, da sie dieses Leben nicht mehr ertrug, denunziert.
Die Stadt sprach Tag und Nacht von nichts anderem als von diesem Prozess. Man holte die früheren Mägde aus ihren Dörfern, wollte wissen, ob sie wirklich von ihrem Brotherrn schwanger gewesen waren. Oh, mein Gott, was für ein Skandal! Das kleine Café des „Trajan“ war jeden Nachmittag voll von schwatzenden Damen.
Der Prozess wurde größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt, trotzdem drang Licht in das Dunkel des Türkenhofes. Die Aussagen der Mägde waren zurückhaltend und voller Widersprüche. Eine Magd sagte aus, dass Maniu seines Reißens wegen kochend heiße Bäder nahm und sie ihn nach dem Bade abreiben musste. Was sagt man dazu? Und weiter? Sonst nichts. Die Zeugin schweigt und brummt dann etwas, sie tat ihre Pflicht und damit fertig, übrigens ist es viele Jahre her. Kein böses Wort gegen Maniu, im Gegenteil, Dankbarkeit und Achtung. Seht an! Diese kleine, tapfere Lisa Jellinek aber schwört ganz offen, dass sie nie das Geringste mit Maniu zu tun hatte. Ein Verfahren wird gegen sie eingeleitet, und später wird sie wegen Meineids zu einem Jahr Gefängnis verurteilt.
Der Zeuge Mischa aber, mit dem Distelkopf und den Eisnadeln im Gesicht, er hat, so wahr Gott im Himmel ist, nichts gesehen, gehört, beobachtet. Nichts, niemals. Er ist Raouls festes Bollwerk, nichts kann es erschüttern. Er tut fast, als habe er Maniu kaum gekannt! Der Richter fragt, fragt, aber frage du nur, Mischa weiß nichts, schweigt, schweigt. Er ist wie Eisen: Auch wenn man es weißglüht, gibt es kein Wort von sich.
Franziska aber, nein, nein, ist es möglich? Ein Unhold, ein wahrer Unhold!
Die Stadt teilt sich in zwei Lager: Die Majorität war von Manius Schuld überzeugt, eine verschwindende Minorität glaubte an seine Unschuld. Sagte nicht dieser schweigsame Knecht Mischa, der die Worte abwog, als seien sie Goldstücke, als der Richter ihn über Franziska befragte: „Sie lügt, sie lügt immer, sie ist in den Jahren und muss lügen.“
Nun, ein Heiliger war dieser Maniu, der immerfort beteuerte, unschuldig zu sein, keineswegs, das wollen wir nicht behaupten. Raoul glaubte felsenfest an die Unschuld seines Klienten. Er hatte Tränen in den Augen, als er die letzte Mahnung an die Geschworenen richtete, vorurteilslos zu urteilen. Maniu wurde zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt.
Auch die Helden der berühmtesten Prozesse sind nach drei Tagen vollkommen vergessen. Jeden Tag bringen die Zeitungen etwas Neues. Oh, du mein Gott, was für eine Welt!
Zur allgemeinen Überraschung aber wurde nach einem Jahr der Prozess Maniu wiederaufgenommen. Franziska war nach dem ersten Prozess ihres Vaters in eine Nervenheilanstalt gekommen. Nach einem halben Jahr galt sie für genesen, und sie erklärte, dass sie krank gewesen sei und unter einem Wahn, wie sie es nannte, ihren Vater fälschlich beschuldigt habe. Maniu wurde freigesprochen. Seitdem lebte er einsam im Walde, man sah ihn gar nicht mehr. Er wurde noch menschenscheuer, trank noch stärker und litt unter allen möglichen Wahnideen. Mitten in der Nacht fing er plötzlich zu schießen an. Erst waren es Räuber, die ihn bedrohten, dann waren es die Soldaten einer fremden Regierung, die seine Auslieferung verlangten, schließlich aber sah Maniu direkt Gespenster.
„Wach auf, Mischa“, schrie er mitten in der Nacht, „sieh mal hinaus in den Hof, der ganze Hof steht voller roter Teufel. Nimm einen Prügel, Mischa, wir schlagen die ganze Bande in die Flucht.“ Das alles hat Mischa Jacques erzählt. Eines Tages aber, als es dämmerte, kam ein furchtbares Ungeheuer geradeswegs auf den Türkenhof zu. Halb war es ein Drache und halb ein Teufel mit zehn Köpfen und zwanzig Hörnern. Jedenfalls ein furchtbares Ungeheuer, es war dreimal so groß wie der Türkenhof selbst, und die Hörner ragten noch über den Wald hinaus. „Was will er, siehst du ihn, Mischa? Gegen ihn kann ich nicht ankommen.“ Es war das erste Mal, dass Maniu den Mut verlor. Er wurde ohnmächtig. Die Mägde rieten, nach einem Priester zu schicken, aber Maniu wollte nichts mit den Pfaffen zu tun haben.
Und nun ist er tot, dachte Jacques, er ist viel herumgewandert auf dieser Erde, endlich hat er seine Ruhe. Da aber war er vor dem Hause der Frau von Ypsilanti angekommen.
IX
Durch das Gitter erblickte Jacques, in der Sonne leuchtend, die im ganzen Lande berühmten Blumenrabatten der Baronin. Aus ihnen erhob sich das Haus – ein kleines Schlösschen –, eingehüllt von einer Atmosphäre von Reichtum und Gediegenheit.
Als er die Klingel zog, kamen, wie gewöhnlich, die Hunde der Baronin angestürzt, ein ganzes Dutzend, sie rasten gegen das Tor, sprangen in die Höhe, als wollten sie ihn in Stücke reißen. Der Diener jagte die Hunde in den Zwinger zurück, öffnete, und schon erschien die Hausherrin selbst auf der Terrasse.
Frau von Ypsilanti wirkte aus einiger Entfernung wie ein junges Mädchen von zwanzig Jahren. Sie war schmal und zart, ihre dunklen Augen glänzten – wenn man näher kam, dann sah man allerdings –, aber auch dann sah sie aus wie ein junges Mädchen, nur dass dieses junge Mädchen etwas zu kühn gefärbte Wangen und einen herausfordernd gemalten Mund hatte. Die Augen glänzten in der Nähe noch stärker als von fern, ihr Glanz schien völlig unnatürlich.
„Ja, das ist ja reizend“, rief sie Jacques lebhaft und erfreut entgegen. „Sind Sie wieder im Lande?“ Jacques aber eilte mit den raschen Schritten eines Liebhabers die Treppe empor – er sprang förmlich – und drückte einen herzhaften, etwas zu langen Kuss auf die weiche, duftende Kinderhand der Baronin. Er erinnerte sich an Jankos Rat, der Baronin „gehörig den Hof zu machen, geniere dich ja nicht“.
„Oh, Sie Schlingel, was tun Sie da?“, wehrte die Baronin lachend ab. „Küsst man so einer Dame die Hand? Ich sehe wohl, dieses Berlin hat Sie nun gänzlich verdorben.“
Frau von Ypsilanti – ihre Mutter war Französin, ihr Vater Österreicher – war von einer ewig gleichen Lebhaftigkeit und Heiterkeit. Sie war immer bei guter Laune und geneigt zu lachen, es war schließlich einerlei, wovon man mit ihr sprach, über eine Skandalgeschichte oder einen Todesfall in der Stadt. Selbst das tragische Schicksal ihres Gatten, der seit einigen Jahren gelähmt im Hause lag, hatte ihre Lebensfreudigkeit nicht zu trüben vermocht.
„Kommen Sie herein“, rief sie, „erzählen Sie mir das Neueste aus Berlin und Paris. Oh, ihr Unartigen“, herrschte sie die Hunde an, die nach der Begrüßung wieder aus dem Zwinger herausgelassen wurden, „wollt ihr artig sein! Peppi, Lola! Mathilde, nehmen Sie die Hunde weg. Oh, bei Gott, sehen Sie, dieser Peppi ist mit Ihrem Hut durchgegangen! Ach, Jacques, ich sehe es ja, Sie sind noch immer der gleiche Heuchler, derselbe Jesuit – ja, das sind Sie, ein Jesuit! Sie wissen so gut wie ich, dass Sie nur Sonjas wegen kommen und nicht wegen einer alten Frau. Nein, nein, sagen Sie mir nichts, kein Wort.“
„Aber es ist mir wirklich eine reine Freude, Baronin!“, versicherte Jacques. „Sie sehen entzückend aus, wie ein junges Mädchen.“
„Nun, Sonja wird in ein paar Minuten erscheinen. Sie hat im Garten gearbeitet und macht sich zurecht. Sie freut sich sehr, Sie wiederzusehen, sie hatte ja immer ein Faible für Sie. Sonja, was soll ich Ihnen sagen, das liebe Kind macht sich das Leben zu schwer.
Sie grübelt den ganzen Tag, und Bücher hat sie mitgebracht, Jacques, zwei große Koffer voll! Heute fragte sie mich: Mama, was würdest du tun, wenn du einen Dieb in deinem Hause ertapptest? Würdest du ihn der Polizei übergeben? Auch Janko setzt sie zu, sooft er kommt, er weiß nicht mehr ein noch aus. Der arme Janko, er ist verliebt in Sonja bis über die Ohren. Er ist mir ja keineswegs unsympathisch, unser Janko, im Gegenteil, aber manches ist mir doch unklar bei ihm. Sagen Sie mir – aber ich vergesse ja, dass Sie mit Janko eng befreundet sind, und ihr beiden seid ja die größten Spitzbuben der Stadt. Jacques, mon cher, Sie sind mir nicht böse, nicht wahr? Aber ich wollte Sie etwas fragen – eine Sache, die ich heute in einem Wiener Magazin gelesen habe. Ja, das ist es! Es soll in Berlin Tanzlokale geben, wo auf jedem Tisch ein Telefon steht, und die Gäste können sich untereinander anrufen. Ist es wahr? Und dann war von einem Tanz die Rede, wie hieß er doch? Die Tänzer schütteln sich, als hätten sie den Veitstanz. Ach, Jacques, ich glaube, ich fände mich nicht mehr zurecht in dieser Welt da draußen.“
Die Welt da draußen, denkt Jacques, ja wahrhaftig, wie muss sie von hier aus erscheinen? Nur als ein ganz schwaches Echo dringt ihr Lärm nach Anatol. Die Züge unter der Erde, die dreimotorigen Flugzeuge in der Luft, Europa wird zur Legende. Welch einen Tanz kann sie wohl meinen, vielleicht meint sie den Jimmy? – „Ja, Jimmy heißt dieser Tanz, können Sie ihn tanzen?“ – „Ja, warum denn nicht?“ –