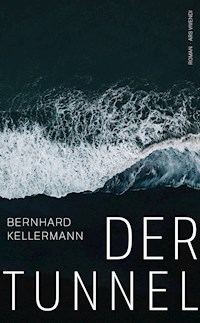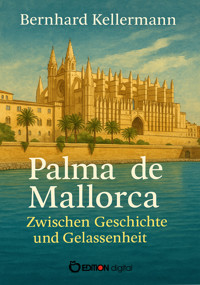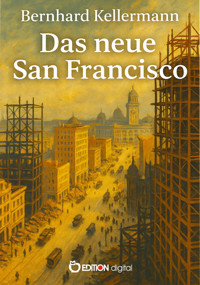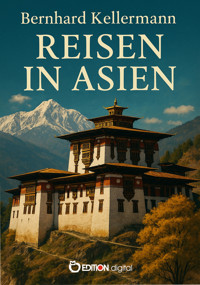
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Buch entführt den Leser auf eine faszinierende Reise durch die Länder des alten Orients – von Japan über Persien und Indien bis nach Kambodscha. Mit der scharfen Beobachtungsgabe eines Reporters und der poetischen Sprache eines Romanciers beschreibt Kellermann Landschaften, Menschen und Kulturen, die zwischen Tradition und Aufbruch stehen. Er begegnet Mönchen in Tibet, Geishas in Japan, Händlern in Persien und politischen Rednern im kolonialen Indien. Das Ergebnis ist ein vielstimmiges Panorama Asiens in den 1920er Jahren – eine Hommage an Schönheit, Glauben, Stolz und Wandel, aber auch ein kritischer Blick auf die westliche Überheblichkeit. Ein literarisches Reiseerlebnis von zeitloser Eindringlichkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Bernhard Kellermann
Reisen in Asien
ISBN 978-3-68912-609-4 (E-Book)
Aus: Ausgewählte Werke in Einzelausgaben, 2. erweiterte Auflage, Verlag Volk und Welt, Berlin 1975 (Erstausgabe 1940)
© 2025 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Godern
Tel.: 03860-505 788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
ERSTER TEIL: Das alte Japan
Eine kleine japanische Stadt
Ich habe hier die schönste Zeit meines Aufenthalts in Japan verlebt, und ich will von ihr erzählen wie von einem Freund …
Die Stadt ist alt, und Japans alter herrlicher Geist lebt noch in ihr. Die Leute werden dich hier von oben bis unten betrachten und deine Kleider und Schuhe betasten; wenn es regnet, so wird einer aus dem Hause eilen und mit zwei Händen einen großen Papierschirm über dich halten; wenn du aus dem Bade kommst, und ein Fischer steht am Strand, so wird er rasch die Sandalen von den Füßen streifen, sich verbeugen und sie vor dich in den Sand stellen, damit du nicht barfüßig über die Straße zu gehen brauchst. Pilger ziehen hier durch, die auf der Wanderung zu den hundert Tempeln unterwegs sind. Die alten Götter haben es gut hier. Zur Zeit des Totenfestes im Herbst brennen Feuer am Strande; mit einer Fackel weist man dem geliebten Toten den Weg zu seiner Hütte; er wird hier weilen und mit den Lebenden das Mahl einnehmen, am dritten Tage aber lässt man ein Miniaturboot mit einem Licht darin ins Meer gleiten, und die Seele wird den Weg in ihr unterirdisches Reich zurückfinden. Wenn die Fischer hier durch Zufall eine Schildkröte mit dem Netz ans Land ziehen, so geben sie ihr Sake zu trinken und senden sie, indem sie um ihre Gunst flehen, ins Meer zurück.
So ist diese Stadt.
Sie ist grau und, wenn man vom Meere her kommt, kaum zu sehen. Alle japanischen Ansiedlungen sind so. Ich habe mich in dieser Beziehung oft getäuscht und Felsen für Ansiedlungen, Häuser für graue Felsen angesehen. Die Häuser sind alle niedrig, zumeist bestehen sie nur aus einem Erdgeschoss, die Gassen sind krumm und eng. Die Stadt erscheint klein, aber je öfter man sie durchstreift, desto mehr Straßen und Gassen entdeckt man, und noch nach Wochen habe ich neue Straßen gefunden. Von den Hügeln und Bergen aus gesehen erscheint Miyazu mit den vielen grauen, schindelgedeckten Dächern schuppig wie eine große Schildkröte, die sich am Strande sonnt.
Ich liebte es, im Gewimmel und Geklapper der Straßen umherzuwandern und in die Häuser hineinzusehen, wo die Leute saßen und rauchten und geschäftig waren. Denn die Häuser waren ja offen, am Tage wurden die Holzwände zur Straße weggeschoben. Alle diese Laternen mit schwarzen Hieroglyphen, dachte ich jedes Mal, diese Haustüren, durch die nur ein Kind schlüpfen kann, diese Lattenverschläge und die Dachrinnen sind aus Bambusrohr, siehst du! Es gab ruhige Straßen, wo die Leute faulenzten, aber in den Geschäftsstraßen waren sie vom Morgen bis zum Abend fieberhaft tätig. Sie schnitzelten und klebten und kneteten den ganzen Tag. Die Kuchenbäcker gossen den Teig über das erhitzte Backblech, zerschnitten ihn, formten, rösteten und stapelten ganze Haufen der braunen würfelförmigen Kuchen auf. In vielen Häusern bewegten sich die Leute in Rauch und Qualm, sie rösteten Fische, Sardinen, Mägde knieten am Boden und schleißten kurz geschnittene Bambusrohre in dünne Stäbchen. Hier waren Weiber beschäftigt, kleine Fische zu häuten und auszugräten. Andere zerstampften sie, und andere kneteten sie mit Reismehl in einem großen runden Steintrog mit einem dicken Holzklöpfel, der an der Decke befestigt war und im Kreise gedreht wurde. Dann saßen Männer da, die den zähen grauen Teig zu Kuchen formten, mit einer Art Maurerkelle. Diese Kuchen waren etwa so groß wie eine Hand, länglich, trogförmig und wurden hübsch gelb und rötlich gebacken. Aber sie waren entsetzlich zu essen. Noch eine andere Art von Kuchen wurde hier fabriziert. Aus einem ähnlichen, mit Fisch vermengten Teig wurden sie an Bambusstäben in Röhrenform geröstet. Ich habe es nie versucht, sie zu genießen. All diese Kuchen wurden in großen Mengen hergestellt, denn wir exportierten sie. Sie sind berühmt in ganz Japan. Ein anderer wichtiger Exportartikel waren unsere getrockneten Sardinen und Tintenfische. Fische, nichts als Fische, ja, in unserer Hauptstraße roch es immerzu wie in einer Heringsbraterei.
Man ging und sah! Hier wurden kleine Körbe für die getrockneten Fische geflochten, dort war ein Lampionbauer am Werke. Er konstruierte das Gerippe einer Papierlaterne aus dünnen Bambusstreifen, die er zu Kreisen bog. Dann überklebte er das Gerüst mit Papier. Oder er ölte fertige Laternen, oder ich sah ihm zu, wie er getrocknete Lampen geschickt mit Schriftzeichen versah. Wir hatten viele Lampionbauer in der Stadt, aber noch mehr Schirmmacher. Solch ein japanischer Schirm ist ein vollkommenes Bauwerk, eine Art Karussell aus Papier, Bambus, Leim und etwas Draht, aber von einer unfassbaren Widerstandsfähigkeit. Zu den Stäbchen werden schmale Bambusstreifen benutzt, die durchlocht werden, wo der Knoten des Rohres das festeste Holz bietet. Die ganze Werkstatt ist voll von langen Bambusstangen, von ausgewählten Rohren für die Schirmstöcke, von halb fertigen und fertigen Schirmen, die von der Decke herabhängen. Armdicke kurze Rohrstangen, die als Behälter und Vasen gebraucht werden, sind angefüllt mit Büscheln von Schirmstäben, langen und kurzen. Die Schirmmacher hocken auf der Matte, setzen Schirme zusammen und bekleben die Gestelle, die schräg in einen Pfosten gesteckt sind und sich drehen lassen, so dass sie der Arbeiter bequem bepflastern kann, ohne je den Platz verlassen zu müssen. Erst werden mehrere Streifen von Papier auf das Gestell geklebt, ringsherum, oben und in der Mitte. Dann wird das Gestell mit Papier überzogen. Wenn der Leim trocken ist, wird der Schirm geölt, und nach einigen Tagen wird der Name des Bestellers und seine Wohnung mit großen Zeichen daraufgemalt, ein reizendes Ornament. Es gibt auch viele Schirme, die dazu noch schwarze oder rote Kreise haben. Im Allgemeinen sind die Schirme gelb und farblos, nur die kleinen anmutigen Sonnenschirme der Damen werden mit buntem Papier bespannt. Sie werden nicht geölt. Die fertigen Schirme bekommen aber noch eine Kappe aus Papier oder Leder und eine Schlinge zum Tragen. Ein Schirm kostet fix und fertig eine Mark, und wenn er ganz außerordentlich ausgestattet ist, fünfzig Pfennig mehr. Die Arbeit erfordert eine große Geschicklichkeit, aber in den Händen der Japaner erscheint sie wie ein Spiel.
Es gab Mattenflechter in der kleinen Stadt und Zimmerleute. Sie wirtschafteten mit blitzblanken Werkzeugen, barfüßig, halb nackt, lachten und zeigten die weißen Zähne, wenn ich ihnen zusah. Sie führten die Streiche nicht auswärts wie unsere Zimmerleute, sondern in der Richtung auf den Körper zu. Dabei hielten sie noch die Bohle, die sie mit der Axt bearbeiteten, mit dem nackten Fuße fest.
Die Kaufleute hockten ruhig auf ihren mattenbespannten Tritten und warteten auf Kunden. Sie hatten den unvermeidlichen Feuertopf vor sich stehen, ein Schälchen Tee, die Pfeife in der Hand. Trat man in ihren Laden, so regten sie sich nicht. Man konnte herumgehen, alles betrachten, betasten, sie rührten sich nicht. Man ging wieder hinaus, und sie bewegten keine Miene. Ballen von Stoffen, Seide, Spezereien, getrockneter Seetang und getrocknete Fische in allen Größen, vom Tintenfisch bis herab zu winzigen Sardellen, die wie Holzwolle aussahen. Schuhe, Sandalen und Stelzenschuhe. Es gab auch Basare mit europäischen Waren, und wenn ich vor einem derselben stehenblieb, so beobachteten mich alle Leute, und das Herz der Straße schlug stolzer. Haben wir nicht alles wie ihr? Ja, sie hatten, weiß Gott, allen europäischen Trödel, Schuhe, Hüte, Schirme, deutsche Nähmaschinen, französische Uhren, amerikanische Fahrräder.
Ich konnte nie die Stadt betreten, ohne von einer Menge Leute angestarrt und angesprochen zu werden. Scharen von Kindern folgten mir, aber sie liefen weg, sobald ich mich umdrehte, sie fielen vor Schrecken um, und die kleinsten heulten. Es gab ungeheuer viele Kinder in dieser kleinen Stadt, und in jedem Hause wurde gesäugt. Die Hunde kläfften und fuhren auf meine Schuhe los, die sie verdutzt anglotzten. Ich traf Bekannte, eine Magd, den „washman“, eine kleine Tänzerin. Ich hatte keine Langeweile.
Und immer mehr und mehr entdeckte ich die kleine Stadt. Wunderhübsche Gärtchen, Badehäuser, Brückchen, Durchgänge, Brunnen, unzählige kleine Schreine mit dem verwitterten Bildnis des lizo, des Gottes der Kinder, die große Bronzestatue Buddhas, der mit geschlossenen Augen auf der Lotosblüte saß und in der Sonne schlummerte; Friedhöfe, Bambushaine und Tempel, Tempel.
Zuerst waren es nur drei, aber dann wurden es zwanzig, und gewiss hatte ich sie noch nicht alle gefunden. Sie lagen versteckt in den Hainen und Wäldern der Berge, die unmittelbar hinter der Stadt steil anstiegen. Die Götter lieben es, einsam und idyllisch zu wohnen, und der Andächtige soll ungestört sein, fern von den Wohnstätten der Menschen und dem Alltag. Schmale Wege und Steige führten zu ihnen zwischen Bambushainen empor, eine Flucht eingesunkener, bemooster Stufen, auf denen sich Eidechsen und Schlangen sonnten. Kein Laut störte den heiligen Ort, nur die uralten hohen Zedern rauschten, und eine kleine Quelle gluckste. Gleich in der Nähe meines Gasthofes entdeckte ich eine Gruppe von Tempeln, zu welchen sich ein schmaler Pfad durch Gebüsch emporwand. Ich musste durch eine Anzahl von kleinen roten Torii schlüpfen; auf einem dieser Tore lag der Kopf eines Hahnes, die fromme Gabe eines Gläubigen. Vielleicht eine Reminiszenz an die ursprüngliche Bedeutung dieser Shintotore, die, aus zwei senkrechten und einem waagrechten Pfosten gebildet, dem Hühnervolk als Sitzstange dienten. Das Federvieh hatte die Pflicht, den Göttern den Tagesanbruch zu verkündigen. Ich aber sah keine Hühner mehr, nur Raben, die frech und räuberisch dasaßen und die verödeten Tempel mit Krächzen umflatterten. Hinter den Torii lag ein kleiner Schrein, und als ich durch das Holzgitter hineinsah, starrten mir zwei schlanke gipsweiße Füchse mit spitzen Schnauzen und dünnen schwarzen Schnurrbärten entgegen. Demnach war der kleine Schrein ein Tempel der Inari, der Reisgöttin, deren Diener die Füchse sind. Ganz in seiner Nachbarschaft lag ein vollkommener Tempelkomplex im Halbdämmer riesiger Zedern und Fichten. Hier war es kühl und still. Eine Quelle rieselte irgendwo. Die Tempel waren klein und sahen winzig in dieser Schlucht von Bäumen aus. Der Haupttempel zeigte Spuren eines Schnitzwerkes, Fische, die einen Wasserfall hinaufspringen. Daneben lag ein bedachter Brunnentrog und ein kleiner Pavillon, in dem die große tonnenförmige Trommel aufbewahrt war, rechts eine kleine Bühne für den Kagura-Tanz, halb verfallen, aber merkwürdigerweise mit einer Drehbühne versehen, die kaum größer als ein Wagenrad war. Auch ein Stall stand da, aber das heilige Pferd war verschwunden. Ein paar Stufen führten zu den Torii herab. Sie waren bewacht von Ama-inu und Koma-inu, den beiden Steinlöwen, die an keinem Shintotempel fehlen, dicken, drolligen Tieren, die ihre viereckigen Kinnladen mit den goldenen Zähnen fletschten und mit den goldenen runden Augen funkelten. Einer hatte eine Steinkugel im Maul, die man drehen konnte. Ich verfolgte den Pfad und kam an kleinen Friedhöfen vorüber; die schlichten, schmalen Steine mit den rätselhaften Inschriften waren von Blumen und Kräutern überwuchert. Wieder und wieder traf ich auf das Bildnis lizos, verwittert und zuweilen formlos, halb in die Erde gesunken, aber Nacken und Hände geschmückt mit Ketten farbiger Perlen, Kinderlätzchen auf der Brust und Häufchen von Steinen auf dem Schoß. Weihgeschenke von frommen Müttern und Geschwistern an den gütigen Kindergott, damit die Mühsal der dahingeschiedenen Kleinen erleichtert werde, die, von der Hexe Shozuka-no-Baba ihrer Kleider beraubt, an den Ufern des buddhistischen Styx, Sai-no-Kawara, unaufhörlich Steinhäufchen aufschichten müssen.
Der Pfad führte mich durch Bambushaine, tief unten lagen die grauen Dächer der Stadt und die leuchtende Bai; ich sah in Höfe gepflegter Tempel hinein, aus denen der monotone Gesang der Priester hallte und der gedämpfte Ton der Trommel. Der Haupttempel war von majestätischen Zedern umstanden. Im Hof stand ein halbverfallener Baumstrunk, durch Bastseile gekennzeichnet als die Wohnung eines Gottes. Wehe dem, der sich an dem Baumstrunk vergreift. Der beleidigte Gott wird ihn vernichten.
Ich stieg einige Stufen hinab und schlug einen schmalen Weg durch Gebüsch ein. Plötzlich stand ich auf Schutt und Geröll in einer halbzerstörten Anlage eines alten Tempels, den ein Bergbach verwüstete. Nur einige Seitentempel, eine Halle und das Haupttor hatte die Flut verschont. In einem kleinen Stall stand ein hölzerner steifer Schimmel mit rotem Maul, ein Gespenst von einem Pferde. Im Haupttor wachten noch die beiden erschreckenden Gestalten, die Ni-o.
Sie waren halb zerfallen, geschändete Götter, dem einen fehlte eine Hand, dem andern die Unterschenkel, ihre Augen waren herausgefallen, und die Löcher gähnten, aber sie standen noch mit wilder und furchterweckender Gebärde, die Dämonen zu verjagen. Sie waren Prachtwerke japanischer Skulptur, grandios in der Bewegung, mit wunderbar geformten Brustkörben und Gliedmaßen, die Muskeln von Kraft und Zorn geschwellt. Schreckliche Ruinen und Symbole einer untergehenden Kunst und ersterbenden Religion.
Die Hallen waren voller Sand und Staub. Unter dem Dache hingen halbvermoderte Bilder. Zwei kämpfende Samurai, ein wildes Pferd, das von einem Ritter gebändigt wird, die Darstellung eines Tempelfestes mit hundert kleinen Figuren und ein prächtiges Bild: ein Gott mit langem Barte, der auf Bergen lagert. Welche Unmenge von Kunstwerken vermodert in Japan! Auch die beiden prächtigen Ni-o werden verfaulen, sie werden umfallen, und man wird sie wieder aufrichten, aber ein Tag wird kommen, und niemand wird sich mehr um sie bekümmern. Viele gestürzte Bildnisse habe ich in Japan gesehen. Ich näherte mich einem abseits stehenden kleinen Tempel und lugte durch das Holzgitter in das dunkle Gehäuse: Eine wunderliebliche goldbraune Kwannon blickte mit schmalen weißen Augen auf mich heraus und lächelte.
Ich stieg hinunter in die Stadt, und auch hier entdeckte ich einen neuen Tempel, und zu meiner Überraschung in einer Straße, die ich schon hundertmal passiert hatte. Er war klein und befand sich in einem gewöhnlichen Wohnhause. Ein Priester in weißem Gewande kniete auf der Matte und verrichtete die Gebete, wobei er von Zeit zu Zeit in die Hände klatschte.
Die schönste Straße in unserer Stadt war die Straße der Teehäuser. Die Chayas sahen im Vergleich zu den gewöhnlichen Wohnhäusern wie Villen aus, sie waren einstöckig, mit Galerien, Gärtchen, hübschen Eingängen versehen. Im Vorbeigehen sah man stets etwas von der Vornehmheit und dem Reichtum der Häuser, einen alten prächtigen Wandschirm, Rehe darauf, Fische, Vögel oder einen hübschen Lackkasten, der auf den Matten eines leeren Zimmers stand, die in der Dunkelheit golden erschienen. Eine Samisen klimperte, man hörte die Trommel oder fremdartig klingenden Gesang. Eine kleine Tänzerin trippelte die Straße entlang, gepudert, mit gemalten Lippen, die schwarzen Augen der Mägde lugten durch eine Spalte heraus.
Aber sobald es dunkel wurde, wimmelte die Straße von hellen Laternen und erwachte zu einem fantastischen bunten Leben wie die Städte in den Märchen von Tausendundeiner Nacht.
Am besten aber gefiel mir die kleine Stadt bei Regenwetter. Alles war dann grau. Die flachen Häuser, das Meer, die Boote und der Wald von Stangen, an denen die Netze hingen, die Berge, die halb im Nebel verschwanden. Und Leute mit großen Papierschirmen wanderten in den grauen schmalen Gassen.
Gasthof in der Provinz
Araki-ya hieß das Gasthaus, in dem ich lebte. Es lag außerhalb der Stadt, am Meer.
Es war ein einstöckiges Gebäude, zierlich trotz seiner Größe, ein Kunstwerk aus dünnen Brettchen und Papier, mit Galerien, einer Brücke und weit ausladenden, chinesisch geschwungenen Dächern, die viel zu schwer für das dünne Balkenwerk erschienen. Dicht hinter dem Hause stieg der Berg an, so hoch und so nahe, dass man glauben konnte, die Bäume wüchsen auf dem Dache.
Ein schmaler krummer Weg führte von der Straße aus durch ein Gärtchen zum Haupteingang. Vor den Stufen stand immer eine Reihe von Stelzenschuhen, zierliche kleine Dinger, die gewöhnlichen Getas der Mägde, die feineren der Gäste, die Strohsandalen eines Kulis, und auch meine Schuhe standen hier, jeden Tag, ob ich ausging oder nicht, als eine Art Reklame. Das Entree war ein großer luftiger, mattenbelegter Raum mit einem hohen Wandschirm, auf den spielende Fische getuscht waren. Eine schmale, steile Treppe führte zum oberen Stockwerk empor; hier war ein breiter mattenbelegter Gang, der an allen Räumen vorbeiführte, und an seinem einen Ende leitete eine hölzerne Brücke zum höher gelegenen Flügel des Gasthofes.
Ich bewohnte zwei Zimmer im Erdgeschoss, und anfangs befand sich absolut nichts darin. Ich saß auf meinem Kissen in der Gesellschaft meiner kleinen Kohlenurne und hatte Zeit, alles genau zu betrachten. Die Matten gefielen mir außerordentlich. Sie waren gerahmt, sorgfältig ineinander gefügt, und sechs solche Matten bildeten den Boden meines Zimmers. (Man gibt die Größe eines Raumes durch die Anzahl der Matten an. Dies war also ein Sechs-Matten-Zimmer.) Sie waren aus gelben Halmen geflochten, dünnen Streifen von spanischem Rohr ähnlich, nicht zu weich und nicht zu hart, und es war ein Vergnügen, darauf zu gehen. Meine Wände bestanden aus Papierfenstern, die sich verschieben ließen. Es stellte sich heraus, dass ich alle Wände wegschieben und ganz in freier Luft sitzen konnte. Die Rückwand dagegen bestand aus vier Papierschiebetüren, die undurchsichtig waren, weiß, in schwarzen Lackrahmen. Ich konnte an jeder beliebigen Stelle eintreten. Im Anfang gelang es mir selten, diese Türen richtig zu schließen. Ich schob sie in der Mitte zusammen und dachte: nun gut, jetzt bist du zu Hause; aber wenn ich mich zufällig umwandte, sah ich, dass an der Seite eine breite Spalte klaffte. Oder ich schloss die Türen an den Seiten, dann standen sie in der Mitte offen. Ich bewunderte das Holz der Pfosten. Es war Zedernholz, glatt geschliffen, ungebeizt und ungestrichen. Die Japaner benutzen es als das kostbare Material, das es ist, wie wir den Marmor verwenden. Um mein Zimmer lief eine glatte hölzerne Galerie ohne Brüstung, auf der es sich angenehm wandelte.
Wenn ich sagte, mein Zimmer sei vollkommen leer gewesen, so ist das eine Lüge. Denn in einer kleinen Nische, einem winzigen Alkoven, saß auf einem Lackschemel eine kleine Statuette, das Bildnis einer schönen schlanken Kwannon. Zu ihren Häupten hing ein Kakemono, einen Wasserfall, der über Felsen stürzt, darstellend. Zu ihren Füßen aber stand eine Fichte, eine vollkommene Fichte mit Wurzeln, einem Stamme, Ästen und Nadeln, allein nur einige Zoll hoch. Diese Zwergfichte wuchs übrigens nicht so ohne weiteres, es wäre ein Irrtum, das anzunehmen. Sie stand auf vielen dünnen Wurzeln, die höher waren als die Krone, der Stamm nämlich krümmte sich tief herab, bevor er die Äste aussandte.
Über den Schiebetüren hing ein schmales gerahmtes Manuskript, ein Gedicht in schwarzen, kunstvoll gezeichneten chinesischen Charakteren.
Das alles gefiel mir sehr gut. Die Reinheit, die Glätte, die Genauigkeit der Kanten und Fugen, meine elastischen Matten, meine verschiebbaren Wände und Türen, die glatte Galerie. Ich beschloss, Wochen, ja Monate hier zu bleiben.
Glücklicherweise ließ sich jener hübsche junge Mann wieder sehen, der die Freundlichkeit hatte, mich am Kai zu empfangen, und Englisch sprach. Ich äußerte ihm mein Entzücken über das Haus, meine Zimmer, die Landschaft, und dass ich mich noch auf keinem Flecke der Erde so wohl gefühlt hätte wie hier.
Er lächelte und verbeugte sich leicht.
Nur möchte ich gerne dem Wirt dies oder jenes auseinandersetzen, ob er vielleicht den Dolmetscher machen wolle?
„Ich bin ja selber der Wirt!“, sagte der junge Mann und lächelte.
Das traf sich gut. Im Augenblick hatte ich ihm meine Wünsche offenbart, und er versprach sie sofort zu erfüllen.
„Vielleicht sitzen Sie nicht gut auf dem Kissen?“, fragte er.
„Oh, danke, vorzüglich. Aber vielleicht –?“
Ja, er versprach, augenblicklich einen Stuhl zu bringen.
Da saß ich dann und wartete und träumte von einem hübschen Stuhl, denn meine Beine wurden so steif, dass ich weder sitzen noch stehen konnte. Schon am anderen Nachmittage traf der Stuhl ein, und nun saß ich auf dem Stuhle, und meine Möbelstücke, mein Feuertopf, mein kleines Lacktischchen, mein Kissen lagen tief unter mir auf den Matten.
Der Wirt hatte mir auch einen Tisch versprochen. Ich hatte mir vorgenommen, wie ein Japaner zu leben, auf den Matten, aber es ging nicht. Der Wirt verstand, dass ich einen Tisch brauchte, zum Arbeiten, zum Essen, er wollte den Tisch ebenfalls augenblicklich beschaffen. Ich sprach tagtäglich mit ihm darüber. Er sandte sofort die Dienstboten weg, die Dienstboten eilten – aber der Tisch kam nicht. Erst am vierten Tage traf er ein. Nun war ich betrübt, denn er verdarb mir das ganze Zimmer.
Es waren viele Tage nötig, bis ich mich mit dem Hause und der fremden Umgebung zurechtfand, und auch dann kam ich nicht ganz über die Verwunderung hinweg, die mich erfasst hatte, als ich hier eintrat.
Ich liebte es, im Hause umherzuwandern, in Strümpfen oder barfüßig, auf den weichen, reinen Matten, und in alle Räume hineinzublicken. In jedem Zimmer war etwas Hübsches zu sehen, die am Boden hockenden Gäste, schöne Japanerinnen, allerlei sonderbare Gerätschaften, kunstvolle Kakemonos, Wandschirme, Lackkästen, Ornamente an den Türen kleiner Wandschränke und Blumen. In allen Zimmern, auch den unbewohnten, standen fortwährend Blumen, Sträuße oder blühende Zweige, und diese stillen Blumen in den stillen Zimmern erweckten den Eindruck, als ob freundliche Geister darin hausten. Ich setzte mich oft lange in ein leeres Zimmer, und es kam mir vor, als sei ich in der besten Gesellschaft.
Ich fühlte mich wohl in all der Leere, Reinlichkeit, frischen Luft und Sonne.
Auf der kleinen Brücke, die zum höher gelegenen Flügel des Gasthofes führte, standen unsere Waschbecken, drei in einer Reihe. Dort hingen auch die vielen kleinen Handtücher, mit Schriftzeichen, Blumen, Schmetterlingen geschmückt. Ganz in der Nähe befand sich unser Badezimmer, das sehr rein und kühl war.
Das Hotel besaß drei Gärtchen. Eines vor dem Hause, eines im Hof, eines vor dem höher gelegenen Flügel. Das war das schönste. So klein es war, hatte es doch eine Menge gewundener Wege, die sauber gepflegt waren, sonderbar geformte Steine lagen da zum Schmuck. Es besaß einen winzigen See, der mit einer Leitung gespeist wurde, die in einem hohen Baumstrunk versteckt war. Eine Muschel hing daran, aus der Farnkräuter herabrieselten, kleine Fische tummelten sich im klaren Wasser. Die Gärtchen waren voll von hundert kleinen Spielereien, die man erst nach und nach entdeckte, denn der Blick wollte dafür erzogen sein. Das Gärtchen im Hof bestand eigentlich nur aus einem kleinen See von wohlberechneter romantischer Form mit Steinen, Felsen, Brücken. Zwei grüne Frösche hausten darin. Gleich hinter dem See führte ein winziger Tunnel durch den Berg.
Kehrte ich in mein Zimmer zurück, so wunderte ich mich wieder über die niedrigen Türen, durch die man gebückt gehen musste, über die feine Arbeit der Fensterrahmen, das delikate Papier, die akkuraten, scharfen Falze, in denen die Fenster liefen, das Holz. Ich schob meine Wände hin und her, um besonders hübsche Ausblicke auf die Bai, blühende Büsche, den Wald zu gewinnen. Schloss ich die Schiebefenster, so war mein Zimmer erfüllt von gelbem, mildem Licht, wie es in Räumen herrscht, die der Widerschein der Abendröte erhellt.
Am Abend wurden meine Bettpolster aus einem versteckten Wandschrank genommen und in der Mitte des Zimmers ausgebreitet. Draußen auf der Galerie wurden Holzverschläge vorgeschoben. Sie liefen in Falzen, aus einem schrankähnlichen Kasten, der an der Seite des Hauses angebracht war, heraus und hinein, sie liefen fast von selbst und polterten. Nun war es dunkel und dumpf, und ich fühlte mich, wie sich ein Käfer in einer Zigarrenkiste fühlen muss. Mein Zimmer war wie ein geräumiger bequemer Sarg.
In aller Frühe kamen die Mägde herein, schoben die Vorschläge fort, und nachdem man von allen Seiten hereinsehen konnte, kleidete ich mich an. Die Bettpolster verschwanden im Wandschranke.
Hanako, die Prinzessin
All die vielen Wochen lang, die ich in dem freundlichen japanischen Gasthof verlebte, bin ich nur wenige, seltene Stunden allein gewesen.
Die ganze Familie hockte bei mir im Zimmer. Der Großvater, die Großmutter, der Wirt, die Wirtin, die Kinder, der Koch, der Laufbursche und die vier Mägde. Gingen die einen, so kamen die anderen. Sie kamen zur Tür herein oder vom Garten her, über die Galerie. Sie brauchten ja nur aus den Getas zu schlüpfen, und schon waren sie da. Dazu kamen noch die Gäste, die im Hotel abstiegen, sie alle wollten den Fremden sehen und mit ihm ein Wort tauschen.
Schon am frühen Morgen machte der Großvater seine Aufwartung. Er war ein würdiger Alter mit kurz geschorenen grauen Haaren und hieß Kinbe Araki: „Wächter des Goldes im Walde“. Mit von der Morgenfrische gerötetem Gesicht kam er an die Galerie meines Zimmers, und wir begrüßten uns.
„O hayo!“
„O hayo de gozaimas!“, erwiderte er und schlürfte höflich.
„Konnichi wa yoi tenki de gozaimas.“
„Taiso yoi o tenki!“
Nachdem wir, wie gewöhnlich, hinzugefügt hatten, dass es schön sei oder warm oder kühl, kam er herein und brachte mir Blumen, die er geschickt in der Vase ordnete. Das nahm lange Zeit in Anspruch, und meistens war der Großvater nicht zufrieden. Er ging und kehrte nach einigen Minuten mit einem Zweig zurück. Ja gewiss, nun war der Strauß schön, dieser Blütenzweig, so und genau so gesteckt, vollendete die Wirkung!
„Arrigato, taiso arrigato!“
Der Großvater schlürfte. „Do itashimashte!“ Und mit einigen kleinen Schlürf– und Ächzlauten der Höflichkeit entfernte er sich. Aber er kam bald wieder, er hatte hundert kleine Geschäfte. Er trug meine Zwergfichte ins Freie und brachte dafür ein anderes Zwergbäumchen. Einmal brachte er mir sechs kleine Ahornbäumchen in einer Schale nicht größer als ein Teller. Sie stellten eine Allee vor, und gewiss war das eine vollkommene Allee in Taschenformat, grüne Wipfel, Schatten.
Oder er wechselte das Kakemono, denn dieser Schmuck des Hauses lag in seinen Händen. In einem japanischen Zimmer darf nur ein Kakemono hängen oder ein Paar, was seltener ist, und der Platz des Kakemonos ist die kleine Nische. Damit ist das Zimmer vollkommen geschmückt. Der Großvater wechselte das Kakemono einmal in der Woche; er kam mit einer Rolle und einem Stäbchen herein, mit dem er das Kakemono vom Nagel nahm. Alles hat seine genauen Regeln. Er rollte das Bild zusammen und verschnürte es kunstgerecht, denn so muss es gemacht werden. Er war in überraschendem Maße kunstverständig, er verstand sich auf Holzschnitte und Zeichnungen und verblüffte mich stets durch die Feinheit und Sicherheit seines Geschmacks. Dabei war er absolut kein Museumsdirektor, sondern ein Wirt in einer kleinen Stadt.
Ich habe den „Wächter des Goldes im Walde“ beobachtet und bin vollkommen über seine Tätigkeit unterrichtet. Stundenlang saß er auf meiner Galerie, ohne sich zu regen, und betrachtete unseren herrlichen roten Busch, der über und über mit Blüten bedeckt war und den prächtige samtschwarze Falter umgaukelten. Er stand auf, besah sich eine Stelle im Garten und begann mit dem Spaten zu wirtschaften. Er hatte herausgefunden, dass gerade an dieser Stelle eine kleine Pflanze sich herrlich ausnehmen müsse. Er verschwand, kam mit einer Schere zurück und stutzte einen Busch zurecht, indem er zwei, drei winzige Zweigchen abschnitt. Er entdeckte ein Stückchen Papier, hob es auf und trug es fort. Er stellte meine Schuhe hübsch in Ordnung auf der Stufe, die von der Galerie in den Garten führte.
In den Mittagsstunden sah ich ihn in seinem Zimmer schlafen. Am Nachmittag nahm er aber wieder seine aufreibende Tätigkeit auf.
Sooft er an meinem Zimmer vorbeikam, verbeugte er sich und grüßte. Ob ich hinsah oder nicht. Ach, schon wieder waren die Schuhe verrückt, und ein Streichholz lag im Garten! Dann wechselten wir auch einige Worte. Er sagte mir die Namen der Blumen und Sträucher, die er alle kannte. Das ist diese Hana, das ist jene Hana. Er brachte mir eine Blüte, damit ich daran röche. Wie?
Nachdem Kinbe am frühen Morgen seine Aufwartung gemacht hatte, kam Mine, der „Berggipfel“, die Großmutter, mit dem dreijährigen Enkel, Kindaro, der „Sardine“, auf dem Rücken vorüber.
„Warum haben Sie doch Ihrem Jungen einen so sonderbaren Namen gegeben?“, fragte ich Nao-san, den Wirt, den „starken, aufrichtigen Mann“.
Er lächelte und erwiderte: „Kindaro ist eine Sardine, die in unserer Bai gefangen wird. Sie ist berühmt in ganz Japan, und deshalb gab ich dem Knaben diesen Namen. Er soll so berühmt werden wie diese Sardine.“
Kindaro hockte wie ein Frosch auf dem geduldigen Rücken der Großmutter; er war ein kleines hübsches Bürschchen mit braunen Schlitzaugen und kreisrund geschnittenen Haaren; er trug einen drolligen kleinen Kimono mit einem winzigen Gürtel und war immer barfüßig. Ging er aber aus, so schlüpfte er gewandt in kleine Getas, die kaum größer als eine Streichholzschachtel waren. Er bewegte sich schon wie ein Erwachsener, und ich habe ihn oft beobachtet, wie er stundenlang auf einem Kissen hockte oder geschickt mit den Holzstäbchen aß. Er konnte niederkauern und sich verbeugen wie ein echter Japaner. Gewöhnlich stapfte er mit einem kleinen Schwert im Gürtel auf den Galerien hin und her.
Jetzt aber ist Kindaro gekommen, um mir guten Morgen zu sagen. Er plaudert mit mir, aber es wird mir schwer, selbst die mir geläufigen Ausdrücke zu erfassen; denn diese Sprache, die an und für sich schon an eine Reihe unartikulierter Laute erinnert, ist in seiner kleinen Kehle nichts als ein drolliges Geräusch. Die Großmutter, deren Zähne alter Sitte gemäß schwarz gebeizt sind, lacht und macht ihn verständlich.
Kindaro hatte zuerst Angst vor mir und verkroch sich. Später durfte ich ihn aber anfassen, wenn jemand dabei war; ja, er ließ sich aufs Knie setzen, aber da hielt er es nur einen Augenblick aus, dann kehrte sein Unbehagen zurück. Einmal kam er sogar in mein Zimmer; die Schiebetür öffnete sich lautlos, und Kindaro kam herein, ganz allein, um mir sein Schwert zu zeigen. Als ich ihn aber anfassen wollte, retirierte er ängstlich, wenn auch mit Würde, und brachte in seiner Kehle eine ganze Menge von Geräuschen hervor. Sobald er jedoch draußen war, kehrte sein Mut zurück, er zeigte sein Schwert und plapperte.
Jeden Tag kommen auch Kindaros Tante und Onkel zu mir, zwei Kinder von etwa zwölf Jahren – die Großeltern sind ja noch rüstige, tatkräftige Leute –, sanfte, stille Kinder, die ich sehr liebte. Fukiko, die „Gesunde“, in ihrem bunten sauberen Kleid, anmutig und schüchtern, und Sue-o, der „letzte Held“, in seinem blauen Kattunkimono und der weißen Schülermütze. Er bringt mir Blumen, Steine, Muscheln, Frösche, Krabben, Fische und Schildkröten, Schlangen, lauter interessante Dinge, ich bin ihm sehr verpflichtet. Oft sitzt er lange still im Zimmer und besieht sich meine Sammlung von Fotografien und Holzschnitten, er hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, meinen Tisch in Ordnung zu bringen und meine Blumen mit frischem Wasser zu versorgen. Sue-o ist sehr zärtlich mit mir, er schlingt den Arm um mich, wenn wir zusammen ausgehen, und sieht mich mit schwärmerischen Blicken an.
Die Frau des Wirtes habe ich seltener bei mir gesehen, zuerst war sie schwanger, und dann hatte sie mit dem Säugling zu tun. Dagegen besuchte mich Nao-san häufig. Er erzählte mir, ich erzählte ihm von Europa, er zeigte mir seine Reichtümer an Kasten, Sakeschalen, Lackarbeiten, Kakemonos und Kleidern. Begreifst du, nun bin ich derjenige, der die Stoffe betastet! Er hatte einen Festtagskimono, eine Art Überrock aus feinster dunkelgrauer Seide, innen am Rücken mit einer prachtvollen Stickerei versehen, Drachen, Fichtenzweige, Tod und Teufel. Wenn man in ein Haus tritt, sagte er, so legt man den Überrock ab – er zog ihn aus und hatte ihn im Nu so geschickt auf die Matte geworfen, dass die Stickerei meilenweit funkelte.
„O, look at that!“, rief ich verblüfft und hingerissen aus.
Das war die Familie, es waren aber noch etwa acht Dienstboten im Hause. Yoshiko, die Gute, Hanako, die Blume, und Kameko, die Schildkröte, bedienten mich. Kameko war ein plumpes Mädchen mit braunem, dickem, verschwollenem Gesicht, kleinen Schweinsäuglein und ungeheuren Backenknochen, die schon bei den Schläfen anfingen. Ich nannte sie deshalb Mommo, Kürbis, aber sie war nicht erzürnt darüber; denn ich hatte mich getäuscht, mommo hieß nicht Kürbis, sondern Pfirsich. Yoshiko, die Gute, war die einzig Fleißige, sie war ein gutmütiges Geschöpf mit den etwas derben Zügen der arbeitenden Klasse. Ich nannte sie Kawazu, denn sie erinnerte mich an einen Frosch, wenn sie am Boden kauerte und die Kohlen anblies. Der Name ist ihr geblieben.
Hanako dagegen war eine Prinzessin! Sie arbeitete nichts. Sie trug zuweilen wohl ein Kissen in eine Rikscha oder ein Boot, aber das geschah sehr selten. Sie arbeitete mit den Fingerspitzen und auf den Zehen, und wenn man ihr einen kleinen Auftrag erteilte, so kam sie sicher nicht zurück. Sie war schön, blass, ein hübsches Mongolenweibchen mit feinem ovalem Gesicht, schrägen glänzenden Augen und weißen Zähnen. Ich liebte es, sie zu sehen, weil sie so hübsch war, so sauber gekleidet, so kunstvoll frisiert. Sie ging nicht, sie trippelte, sie lachte nicht, sie lächelte, sie sprach nicht, sie sang ganz leise wie ein Vogel. Ihre Stimme war das schönste an ihr. Schon am ersten Tage machte ich ihre Bekanntschaft. Als ich verlassen auf meinem Kissen saß, glitt die eine meiner vier Türen zur Seite, und Hanako kniete auf der Schwelle und winkte mit dem kleinsten Finger, den ich je sah, das kleinste feinste Winken und sagte: „Come, come!“ Denn Hanako sprach Englisch. Sie konnte sagen come und all right. Für all right sagte sie nur zwei kleine allerliebste Laute o–ei! Da kniete sie und winkte, und ich dachte: Es beginnt schon, siehst du, die Abenteuer beginnen. Bei Gott, dieses ist das schönste Mädchen, das ich jemals erblickte.
So dachte ich und folgte ihr. Hanako trippelte vor mir her, wendete sich zuweilen um und piepte: „Come, come“, und endlich nahm sie mich bei der Hand. Wir gingen die Treppe hinauf, die Gänge entlang, über die Brücke, wiederum eine Treppe – je weiter, desto besser, denn das Mädchen gefiel mir mehr und mehr.
Endlich schob Hanako ein Fenster zur Seite, und wir traten in ein leeres Zimmer, in dem ein wunderbarer Blumenstrauß am Boden stand. Einige Blumen und Zweige lagen auf den Matten, gewiss hatte sie den Strauß eben erst fertiggestellt. Ich bewunderte den Strauß mit den verschwenderischsten Ausdrücken der Sprache und Miene. Hanako lächelte und sagte: „O–ei! o–ei!“ Dann nahm sie den Strauß auf den Arm, winkte wieder und sagte: „Come, come!“ und trug ihn hinab in mein Zimmer. Ich schenkte ihr für den Strauß ein kleines seidenes Tuch, und Hanako errötete vor Freude und steckte es in den Gürtel. „E–u“, sagte sie, „thank you.“
Ich hatte mir vorgenommen, die Liebe der schönen Hanako zu gewinnen, und die Aussichten schienen günstig zu sein. Sie kam oft zu mir, plauderte ein wenig, lächelte; wenn sie vom Garten aus kam, so musste ich sie in die Höhe heben, sie ließ die Getas einfach fallen. Aber sobald ich ihr auf Japanisch meine Liebe erklärte, lief sie hinaus und erzählte es allen, den Mägden, dem Wirt, dem Großvater. So schön und so dumm, sagte ich zu mir und nahm mich in Acht.
Ein anderes Hindernis aber war mein Nebenbuhler, der siebzehnjährige Hausbursche, der ebenfalls Hanako liebte. Sobald Hanakos feine Stimme in meinem Zimmer erklang, öffnete sich lautlos die Schiebetür, und ein Auge blickte herein. Ich ließ mich nicht beirren, und die Türe öffnete sich weiter, und der Hausbursche saß auf dem Boden. Nichts konnte ihn mehr bewegen, uns allein zu lassen. Nun aber kam der Koch, der den Gehilfen vermisste, er zog die Pfeife aus dem Gürtel und begann zu rauchen. Er lachte mit dem runden Gesicht, putzte seine Brille und ließ sich häuslich nieder. Die Mägde kamen, denn sie suchten den Koch. Endlich kam auch der Wirt, der seine Dienstboten nötig hatte. Wir plauderten, und er übersetzte ihnen höflich jedes Wort unseres Gespräches. Die Kinder vermissten den Wirt und kamen alle drei herein, „die Sardine“ auf dem „Berggipfel“. Der „Wächter des Goldes“ aber dachte, was gibt es hier zu sehen?, und kam ebenfalls.
Nun hatte ich sie alle wieder da und konnte warten, bis sie sich verliefen. Meine armen japanischen Sprachstudien! Wenn ich es nur so weit brächte, dass ich sie bitten könnte, mich ein wenig allein zu lassen; höflich, höflich, das war es, denn sie waren ja alle solch liebenswerte Leutchen.
Shibal. Das Theater
Viele Abende hindurch saß ich im Theater. Ich habe hier wunderbare Dinge gesehen
Unser Theater war ein langes einstöckiges Gebäude mit flachem Dach, und es lag in einer von jenen Straßen, die ich nie finden konnte. Eine Reihe von langen Fahnen an Bambusstangen stand davor, bedeckt mit rätselhaften Schriftzeichen. In den rechten Ecken, also da, wo die Inschrift beginnt, war eine Art magerer Bassschlüssel, der besagte, dass die Fahnen Geschenke waren, Geschenke von Gönnern der Truppe. Die Front war der ganzen Breite nach bis zum Giebel hinauf mit bunten Bildern bedeckt: Szenen aus berühmten Dramen, Gruppen von fechtenden Samurai in wilden Posen und bizarren Verrenkungen, alle übermäßig lang und mit schmalen Gesichtern, wie in einem Rundspiegel verzerrt. Pompöse Aufzüge, wirbelnde Geister, verzweifelte Frauen, immer Aktionen, Entscheidungsmomente; der heiße Atem der Tragödie fegte durch diese mit anscheinender Willkür durcheinandergemengten Figuren. Diese Bilder waren zum Teil überraschend gut und belebt von der alten zeichnerischen Tradition Japans, die heute nur noch auf wenigen Gebieten ein klägliches Dasein fristet.
Am Tage war das Theater verödet, aber sobald es dämmerte, brannte eine kleine Papierlaterne im Eingang über einem niedrigen Pult, vor dem ein alter Theaterdiener hockte. Es trippelte und klapperte in den Straßen, laute Begrüßungen, Verbeugungen, Gestalten schlüpften hinein, die prächtige Schleife und die schneeweißen Socken einer Tänzerin leuchteten im Scheine der kleinen Papierlaterne. Man streifte die Schuhe ab und erhielt eine Nummer auf einem Holztäfelchen dafür, ein ganzes Heer von Schuhen stand vor dem Theater. Man bezahlte den Eintrittspreis, sechs Sen per Kopf, etwa zwölf Pfennig, und trat unter dem Höflichkeitsschlürfen der Diener ein.
Durch ein ärmliches, schmales Foyer gelangte man in den Zuschauerraum. Ich habe oft, wenn ich in Strümpfen über die Matten ging und mich bücken musste bei den Durchgängen, an die Theater Europas gedacht, an ihren Pomp und luxuriösen Komfort, nein, all das hatten wir nicht. Unser Theater war von Luxus entblößt, dafür aber hatten wir etwas, was die europäischen Theater nicht alle hatten, nämlich das große Geheimnis. Unsere Beleuchtung war mangelhaft, zwei Reihen von Papierlaternen und ein paar rußende Petroleumlampen, die kein Licht verbreiteten. Alles war hier ärmlich und alt, unser Theater bestand in der Hauptsache aus dünnen Bretterwänden und Strohmatten, und die Schiebetüren der „Logen“ waren aus Papier und so mangelhaft gefügt, dass sie umfielen, wenn man sie ansah. Es gab hier keine Sessel, man saß auf dem Boden, und das ganze Publikum saß in einem Rost aus schmalen niedrigen Balken. Vier bis sechs Personen nahmen in einer solchen viereckigen Kassette Platz. Die meisten waren barfüßig und trugen billige Kimonos aus Kattun. Die Tänzerinnen dazwischen sahen aus wie einzelne leuchtende Blumen auf einem grauen Acker.
Der Zuschauerraum hatte auch eine von dünnen Pfosten getragene Galerie, die ringsherum lief. Darunter lagen die „Logen“. Im äußersten Winkel der Galerie, nahe der Bühne, befand sich ein Extrakabinett, in dem ein Polizist bei einem rot-weißen Lampion vor einem kleinen Tischchen saß. Was er zu tun hatte, ward mir nicht recht klar, aber sicher ist, dass es in seiner Macht lag, die Vorstellung um Mitternacht zu schließen, wenn er es für angebracht fand. Das aber tat er nie.
Es gab aber etwas, wodurch sich das japanische Theater von jedem europäischen schon in der Anlage unterschied: den Hanamichi oder Blumenweg.
Europa hat japanische Schauspieler und Dramen importiert. Aber das weiße Publikum, soweit es bei seiner Immunität gegen Schönheit und Kunst überhaupt in Frage kommt, konnte nur einen geschwächten und entstellten Eindruck vom japanischen Theater bekommen. Die Schauspieler agierten in einem schreienden falschen Rahmen; wo war der Chor, wo war der begleitende Sänger? Kein Impresario würde es wagen, ihn singen zu lassen, denn er fürchtet sein Publikum, das toll vor Lachen würde. Und wo – fragte ich –, wo um Gottes willen war der Hanamichi?
Ohne den Hanamichi aber kann kein japanischer Schauspieler spielen, ohne ihn gibt es kein japanisches Drama. Der Blumenweg ist ein Ausläufer der Bühne, eine Fortsetzung gleichsam, ein schmaler Steg, der an der rechten Seite von der Bühne aus der Länge nach durch das Parkett führt, über die Köpfe der sitzenden Zuschauer hinweg. Eine ungeheure Erfindung!
Er ist der Weg, auf dem das Leben des Dramas pulsiert, hinein, hinaus.
Es ist das Gesicht des Schicksals, das auf dem Blumenweg auftaucht, während die Personen auf der Bühne noch ahnungslos plaudern, das freundliche Antlitz des Glückes oder die starre, bleiche Maske des Verderbens. Es ist das Lauern des Geschicks, das Hinstarren auf die Opfer, das Näherschleichen, was der Blumenweg zeigt. Mit seiner Hilfe flicht sich Vorgang inniger in Vorgang, das Drama rollt. Und ebenso wie sich die Gestalt der eintretenden Person verkleinert, je näher sie der Bühne kommt, um zuletzt ein Teil der Szene zu werden, und sich ins scheinbar Überlebensgroße streckt, wenn sie, aus dem Bühnenbilde sich lösend, über den Blumenweg durch den Zuschauerraum schreitet, ebenso verkleinert und vergrößert sich der dramatische Eindruck; er schrumpft zusammen ins Harmlose, Alltägliche, er dehnt sich urplötzlich ins Große aus, ins Bedeutsame, Schreckliche, zu einer Vision, die alles erklärt, deutet. Das Drama atmet.
Ich habe in meiner Jugend Zaubervorstellungen gesehen, in denen jene armseligen europäischen Geister auftraten, alberne Skelette und ein trottelhafter Tod im Hemd, diese Geister erschienen harmlos auf der Bühne, aber sobald sie in den Zuschauerraum schwebten, verbreiteten sie rasenden Schrecken. Ähnlich sind die Wirkungen, die der Blumenweg hervorbringt. Wir sind gewöhnt, trotz all des atemlosen Anteils an den szenischen Vorgängen das Spiel als Spiel zu betrachten und die Personen auf der Bühne als gewissermaßen unwirklich. Wie aber gestaltet sich der Eindruck, wenn eine Person auf der Bühne gekränkt und beschimpft wird, und plötzlich erhebt sich diese unwirkliche Person und wird lebendig, denn sie geht so nahe an dir vorbei, dass du sie greifen könntest, grau im Gesicht vor Schmach, Schande im Gang, in den Augen?
Die europäische Bühne verfügt nur über eine Fläche, von der aus sie ihre Schauer über die Zuschauer ausstrahlen lässt, die japanische dagegen umzingelt den Zuschauer und zwingt ihn von allen Seiten unter ihren Bann. Denn während man gefesselt von den Vorgängen auf der Bühne dasitzt, sieht man plötzlich eine Gestalt auf dem Blumenweg: Wie aus der Erde tauchte sie, um in das Drama einzugreifen. Es gibt übrigens noch einen zweiten, schmaleren Blumenweg, der auf der entgegengesetzten Seite parallel zum eigentlichen Hanamichi läuft. Auch darauf bewegen sich zuweilen die Akteure. Sie können auch aus verschiedenen Versenkungen auftauchen oder an der Decke, mitten in der Luft erscheinen. Das ganze Theater ist eine einzige Batterie von Suggestion.
Zu all diesen inneren Wirkungen, die der Blumenweg ermöglicht, kommen rein bildliche, das Entfalten dekorativer und pantomimischer Mittel. Ein Samurai könnte ja unmöglich so stolz auf der kleinen Bühne wandeln, ein vor Schrecken toll gewordener hätte ja keinen Raum, seinen Entsetzenstanz auf der Bühne so großartig auszuführen. Ein Unglücklicher, der verfolgt wird, wie sollte er zeigen können, dass ihn die Angst jagt, seine Verfolger, wie die Rache sie antreibt?
Auch für das Ausklingen einer Szene ist der Hanamichi wunderbar geeignet. Bei der europäischen Bühne ist der Vorgang zu Ende, sobald der Darsteller durch die Türe verschwunden ist. Bei der japanischen dagegen verlässt der Schauspieler den Schauplatz nicht nach hinten, sondern nach vorn.
Nehmen wir an, es wird eine schmerzliche Trennung dargestellt; der Sohn verlässt die Mutter. Nachdem der Abschied auf der Bühne zu Ende ist, folgt der Abschied par distance, ein langsames Gehen, Stehenbleiben, Grüßen mit den Blicken, ein halbes Drehen, ein Zagen. Die Entfernung wird größer, der Vorhang schließt sich, aber immer noch steht der Sohn und blickt zurück.
Der Blumenweg ist zu einer zweiten Bühne geworden. Ein Vorhang fiel, ein anderer stieg, ein Drama ist zu Ende, ein neues hebt an: Der Sohn ist allein.
So häufig ich auch das Theater besuchte, immer ergriff mich eine merkwürdige Erregung, wenn ich meine Schuhe am Eingang auszog. Das Klappen der Stäbe, das als Signal dient, drang aus dem Theater, Worte, Beifall, Gelächter, und ich eilte, so rasch ich konnte, und es war für mich stets von größtem Reiz, mir auszudenken, welches Bühnenbild sich mir beim ersten Blick darbieten würde. Zumeist waren es Samurai, die auf der Bühne knieten und verhandelten, oder es war eine Frau, die in die Getas schlüpfte, um einem Gast das kleine Tor zu öffnen. Die Zuschauer aber saßen ruhig, die glattgeschorenen Köpfe dicht gedrängt.
Oder ich trat in einer Pause ein, und das Theater war voller Tumult, Kinder liefen umher, Ausrufer schrien, und das war für mich so viel wie eine Szene auf der Bühne.
Ich nahm gewöhnlich eine „Loge“, die mich etwa eine Mark kostete. Die Schreiber an der Kasse pinselten sonderbare Hieroglyphen, die sie mit großer Wichtigkeit im Plane einzeichneten, sie nickten, schlürften, lächelten, wiesen mir den Platz an. Dann wurden ein Feuertopf gebracht – selbst im heißesten Sommer – und zwei Kissen, für die ich eine Kleinigkeit bezahlen musste. Aber ich konnte die Beine stets nur kurze Zeit bequem ausstrecken. Nach einer Weile kam Freund Nao-san, der Wirt, die Mägde, der Koch, der Hausbursche oder Tänzerinnen, und endlich hatte ich weniger Platz, als zum Knien nötig ist, für mich übrig. Aber die Liebenswürdigkeit meiner Gäste, all die freundlichen Gesichter um mich her entschädigten mich reichlich für eine kleine Unbequemlichkeit. Und dann das – Spiel!
Die Katzen von Odasaki
Ich habe einige Stücke so oft gesehen, dass ich es wohl übernehmen kann, sie zu beschreiben.
Eines von ihnen hieß die „Katzen von Odasaki“. Es ist sehr merkwürdig.
In der ersten Szene erscheinen einige Samurai, die in einer Wegschenke Erfrischungen einnehmen. Sie treten kühn auf und verhehlen ihre Ungeduld nicht, wenn der Wirt nicht sofort das Schälchen dünnen Tee bringt; aber sie sind viel zu vornehm und edel, um zu bezahlen. Der Wirt dagegen muss seinen Unwillen hinunterschlucken, denn mit solchen Gästen ist nicht gut Kirschen essen.
Einer nach dem anderen kommt den Blumenweg entlang, die zwei Schwerter im Gürtel, kehrt in der Wegschenke ein und bezahlt mit einigen hochtrabenden Worten. Einer der Samurai trägt eine sonderbare Kopfbedeckung, offenbar ein altes Modell, einen runden flachen Korb mit einem eingeflochtenen Visier, ein vortrefflicher Schattenspender. Nimmt er den Hut ab, so erscheint ein kahler Schädel mit olivgrüner glänzender Glatze, die wenig Kühnheit verspricht. (Ich habe übrigens diese Kopfbedeckung später in Kioto gesehen, bei einem in weiße Gewänder gekleideten Pilger.)
Der Vorhang geht zur Seite, die Bank wird weggezogen, und man erblickt das Innere eines schlichten Tempels, einen erhöhten kleinen, mattenbelegten Raum, von dem zwei Stufen herab zur Erde führen.
Ein Theaterdiener schlüpft herein und stellt ein kleines Gittertor auf, da, wo der Blumenweg in die Bühne einmündet.
Aus den Schiebetüren des Tempels tritt eine Frau, kauert sich vor dem Aschenbecken nieder und raucht. Sie ist eine Priesterin, der Tempel also ein Tempel mit Frauenpriestern, Amadera.
Nach einer Weile nähert sich über den Blumenweg einer von jenen Samurai, die in der Wegschenke einkehrten, der kühnste von allen; er steht vor dem kleinen Gittertor und begehrt Einlass. Die Priesterin steigt die Stufen herab, schlüpft in die Schuhe und trippelt zum Tor. Es entspinnt sich ein kurzes Hin-und-her-reden; sie beherbergt nicht gern Gäste, es wäre besser, der Edelmann suche nach einem anderen Obdach. Es sei auch nicht ganz geheuer im Tempel. Manchem Gaste schon wurde nachts das Blut ausgesaugt, und man fand ihn tot am Morgen. Aber der Samurai entgegnet ihr, dass er den Weg verloren hat, er ist fremd in der Gegend, es ist Nacht. Endlich öffnet ihm die Priesterin das Tor, er tritt ein, schlüpft aus den Schuhen und nimmt auf einem Kissen an der Seite der Frau Platz. Sie plaudern. Der Edelmann nennt seinen Namen. Er sei der Sohn jenes Samurais aus Odasaki in der Nähe von Nagoya, der von einer Katze getötet wurde. Ja, sie kennt das Geschlecht. Er ist unterwegs, den Vater zu rächen.
Hierauf begibt sich der Edelmann zur Ruhe, die Priesterin geleitet ihn zu seinem Lager. Die Szene ist leer.
Aber plötzlich eilt eine Frau aus dem Hintergrunde hervor auf den Blumenweg, blitzartig rasch, und wie ein Blitz in der Erde, so steht sie festgewurzelt, schräg nach hinten geneigt, in einer unheilverkündenden Pose. Sie ist in glänzende schwarze Seide gehüllt mit roten, blutigen Blumen darauf, ihr Gesicht ist schneeweiß, unheimlich flackernde Augen glühen darin, das schwarze Haar ist in einen Knoten gedreht, von dem ein langer Büschel hinten herabhängt. Wild und schön und edel erscheint sie. Sie trägt ein Gefäß mit langstieligen Blumen, das sie vor sich hält. Und sie beginnt zu sprechen, in Lauten, jenen der wilden Tiere in schwarzen Urwäldern ähnlich, jedes Wort ist bedeutend und schreckenverheißend.
Da die Herrschaften aber keine Silbe verstehen, so steigert sich die Spannung umso mehr.
Die Priesterin kehrt zurück, kommt herab, wechselt einige Worte mit der sonderbaren Frau und gewährt ihr endlich, nicht ohne eine gewisse Betretenheit, Einlass. Wie der unheimliche Gast geht! Wie ein Tier, ein schwarzer Panther. Wie sie spricht, kalt, stolz, ohne menschliche Anteilnahme, in eine Atmosphäre von lauerndem Entsetzen gehüllt. Prachtvoll ist dieses pechschwarze Gewand mit den roten Blumen, die wilde Haartracht, das bleiche, steinerne Gesicht mit den gemalten Lustmörderlippen, den glühenden umringten Augen. Die Priesterin dankt für die Blumen, der Gast neigt sich mit eisiger Höflichkeit und erwidert einige Worte. Eine Dienerin schlüpft durch die Türe und bringt eine brennende Lampe: ein großer Würfel aus transparentem Papier, der auf vier dünnen Lackbeinen steht.
Der unheimliche Gast wird unruhig. Sie betrachtet die Lampe und lächelt, ein unmenschliches, gieriges Lächeln.
„Wie gut duftet das Öl!“, sagt sie. Aber wie sagt sie es doch! Es klingt wie das grollende Miauen einer Bestie.
Die Priesterin kann ihre Betretenheit nicht länger verbergen, sie schickt sich an, den Raum zu verlassen. In den Gewändern der unheimlichen Frau klirrt es (warum sah man denn ihre Hände nie?), einen Augenblick lang verzerrt sich das bleiche steinerne Gesicht zu einer Grimasse. Die Priesterin erschrickt. Was ist das –? Mit einem kleinen Schrei schlüpft sie hinaus.
Sofort schleicht die schöne wilde Frau an die Lampe, öffnet sie hinten und steckt den Kopf hinein: Man sieht den Schatten des Ölgefäßes – und plötzlich eine Zunge, die hineintaucht und das Öl schlürft – und die Silhouette eines Katzenkopfes.
Eine Katze ist die unheimliche Frau, eine Katze in einem Menschenkörper! Sie also ist jene Katze, die sich des Nachts in die Tempel schleicht und den Übernachtenden das Blut aussaugt.
Sie leckt und schlürft; sie erhebt sich, schon wilder, tierischer im Aussehen, ihre Hände tragen klirrende lange Krallen. Sie hechelt damit am Boden, sie reibt sich nach Katzenart an den Wänden, hackt mit den Krallen nach den Pfosten. Sie eilt wieder zur Lampe, um das Öl zu trinken.
Einige Tempeldiener kommen ahnungslos mit Papierlampen in der Hand daher, sie gewahren die erschreckende Silhouette, fallen vor Entsetzen zu Boden, stieben auseinander.
Die Katze aber erhebt sich, und nun sieht sie fürchterlich aus. Das Maul ist breit und schwarz, die Augen glühen in schwarzen Ringen, die Züge sind verzerrt, das Haar flattert wild um ihren Kopf. Sie spricht grollend und droht ihnen, dass sie nun sterben müssen, weil sie sie erblickt haben. Ein junger Diener liegt ohnmächtig am Boden, sie schleicht näher und spielt mit grausamer Katzenlust mit ihm. Sie springt, gleitet, rekelt sich, hechelt mit den klirrenden Klauen, und der Körper des Ohnmächtigen windet sich unter ihr wie unter magnetischen Strichen. (Man muss wissen, dass das Volk in Japan der Katze ungewöhnliche Kräfte zuschreibt, sie hat selbst Macht über die Seelen der Toten.)
Hier aber eilt der Samurai, aufgescheucht von den entsetzten Dienern, herbei. Die Katze entschlüpft gewandt seinem Schwerte. Der Samurai aber erkennt in ihr die Mörderin seines Vaters, an einer Narbe, die sie an der Stirn hat, und rückt ihr tollkühn auf den Leib. Ein anderer Edelmann eilt mit dem Schwert zu Hilfe. Sie drängen die Katze in einen Winkel des Tempels, sie scheint verloren. Aber plötzlich schreckt sie die Verfolger durch eine drohende Pose zurück und schleudert aus beiden Händen Papierschlangen über sie, ein Geriesel von tausend feinen Fäden, das über die Samurai sinkt und sie wie unter einem Netze begräbt.
Sie entflieht.
Die nächste Szene zeigt die Verfolgung. Von allen Seiten nähern sich die Samurai dem Katzenhaus. Drei, vier Katzen, jetzt in Pelzen, mit Schwänzen, erscheinen hechelnd, miauend, fauchend, es wimmelt von Katzen. Sie springen kopfüber durch Fenster und Büsche, bis sie endlich getötet werden. Zuvor aber kletterte eine Katze an einem schräg über den Zuschauerraum gespannten Seil bis an die Decke und hockte dort oben. Eine Katze muss als Katze dargestellt werden!
Diese Szene kann sich mit der vorhergehenden nicht an Schönheit und Großartigkeit messen. Aber sie ist interessant. Denn wie das Stück in die ersten Anfänge dramatischer Dichtung gehört, die ihre Stoffe den Mythen entnahm, so trägt diese Szene deutlich die Spuren des Beginns der Schauspielkunst, die aus Tanz und Akrobatik hervorging.
Ein Stück, diesem ähnlich und nicht weniger großartig, ist das des Miijamoto Samonosuke, in dem ein übernatürliches Wesen, eine Kreuzung von Gott und Affe, auftritt.
Miijamoto Samonosuke
Diesem Stück liegt die Fabel von einem Geist zugrunde, der jedes Jahr ein Mädchenopfer heischt, und die Errettung eines solchen Opfers durch einen kühnen Samurai.
Wenn sich der Vorhang hebt, so gewahrt man einen kleinen Tempel zwischen Gebüschen am Wegrande, einen armen Schrein mit Holzgittern, einer Steinlaterne zur Seite, in der Art, wie sie zu Tausenden über Japan ausgestreut sind. Ein paar Holzstufen führen zum Tempel empor, und neben diesen Stufen steht eine Kiste. Ferner gewahrt man zwei Balken, dick wie Bäume, die vor dem Tempel in der Erde stecken, etwas schräg, und sich oben hinter dem Vorhang verlieren; aber man beachtet sie kaum.
Von rechts treten Priester auf, plappern ihre Gebete, klappen in die Hände, schwingen die Gebetsstäbe mit den Papierschnitzeln am Ende und gehen hierauf über den Blumenweg ab.
Plötzlich beginnen sich die großen Balken, die man kaum beachtete, zu bewegen, der Vorhang steigt ganz in die Höhe, und man sieht den Geist auf hohen Stelzen stehen. Eine affenähnliche Erscheinung mit weißgrauen, wirren Haaren, die den dicken Schädel umflattern. Der Geist trägt ein langes graues Gewand und macht einen übernatürlichen, mächtigen und erschreckenden Eindruck. Er stampft mit den Stelzen drohend auf und setzt sich in Bewegung. So groß ist er, fünf bis sechs Meter hoch, dass sein Haupt in den Schnürboden hineinragt. Unerklärlich bleibt es, dass er auf diesen dicken, schweren Wagendeichseln gehen kann! Aber er geht ganz natürlich, er schwingt den Körper auf den riesigen Beinen hin und her, bewegt sich stampfend am Tempel vorbei und wieder zurück, und da er keinen Laut von sich gibt, so erscheint er doppelt unheimlich, und man glaubt ein Ungetüm, ein Fabelwesen, zu belauschen, das, ohne zu ahnen, dass es beobachtet wird, im Walde sein Wesen treibt.
„Saru, saru!“, (Affe) flüstern die Leute.
Der Geist schlüpft durch den Vorhang und betritt den Blumenweg. Er stampft durchs ganze Theater, vor und zurück, die Galerie überragend, um hierauf im Gebüsch hinter dem Tempel zu verschwinden.
Das Trüppchen der Priester kehrt über den Blumenweg zurück, hält vor dem Tempel an und plappert abermals Gebete – plötzlich ein verdächtiges Geräusch – ein rasches Klappen von Holzstäben –, und die Priester stieben entsetzt auseinander. Einige entfliehen in die Büsche, einer rennt über den Blumenweg. Aber seine Angst ist so groß, dass ihm die Beine nicht gehorchen, er macht riesige Schritte in der Luft, schwingt die Arme, ohne von der Stelle zu kommen. Er tanzt vor Schrecken. Er fällt auf das Gesäß, zappelt, während er sitzt, mit Armen und Beinen, das Gesicht verzerrt vor lächerlicher Angst. Das drohende Klappen der Holzstäbe treibt ihn in die Höhe, er tanzt in der Luft, fällt wieder zu Boden, wird abermals aufgescheucht, und immer rasender vor Schrecken tanzend, bald stehend, bald sitzend, erreicht er endlich den Ausgang.
Wunderbar überzeugend drückt sich in seinem Schreckenstanz das Entsetzen aus, das der unheimliche Geist in dem unter seiner Herrschaft zitternden Volk verbreitet, und um so begeisterter ist der Empfang, der Miijamoto Samonosuke, dem Befreier, dem Erlöser, zuteil wird.
Ja, sei gegrüßt, Miijamoto Samonosuke! Mutig und edel siehst du aus!
Mit fliegenden Schritten und verwegener Gebärde betritt Miijamoto Samonosuke den Blumenweg. Er stürmt dahin, eine lohende Fackel in der erhobenen Rechten. Es ist Nacht, in einem Urwald, in einer wilden finsteren Zeit, die von Gespenstern, Dämonen und Ungeheuern erfüllt ist. Eine unvergessliche Erscheinung! Er trägt ein schwarzsamtnes Wams mit weiten Ärmeln, eine Art goldfarbener gemusterter Pluderhosen, die an den Knöcheln eng zusammengeschnürt und an den Seiten der Schenkel geschlitzt sind, zwei Schwerter im Gürtel; er ist barfüßig, die Schädeldecke ist oval ausrasiert und blau gemalt, das pechschwarze Haar zu einem Knoten gerafft, von dem Büschel in den Nacken herabhängen. Sein Gesicht ist bleich im Scheine der Fackel, edel, mit besonders schrägen Brauen, schmal und jünglinghaft schön und voll kühner Entschlossenheit.
In der Mitte des Blumenwegs hält er inne und spricht ein paar harte Worte, eherne, pathetische Worte, seine Augen funkeln, die Fackel lodert, vorwärts!
Er nähert sich entschlossen dem Tempel, leuchtet ihn ab und entdeckt die Kiste bei den Stufen. Er pocht mit dem Schwertknauf darauf und öffnet sie: Ein Mädchen, ein süßes Geschöpf in bunten Kleidern, mit lieblichem Gesicht, stürzt heraus. Sie erklärt dem Retter, dass sie als Opfer für den Dämon bestimmt war, sie dankt dem Edlen. (Wie war es doch nur möglich, dass sie in der kleinen Kiste hocken konnte!) Aber Miijamoto Samonosuke hat keine Zeit zu verlieren. Er wehrt kurz ihren Dank ab und sendet das Mädchen mit der Fackel fort.
Das befreite Mädchen geht über den Blumenweg ab. Aber so einfach geschieht das nicht. Mit einer Fackel muss besonders gegangen werden, und dann muss sie ja auch ihre Freude über die Errettung ausdrücken. So also schwingt sie die Fackel um die Schulter, hält sie wie eine Lanze nach vorn und schwirrt mit kleinen raschen Schritten wie ein Pfeil davon.
Man hört den Dämon, Miijamoto Samonosuke tritt hinter den Tempel, und der Geist auf seinen riesigen Beinen kommt aus den Büschen. Er trägt diesmal einen langen Bambusstab in den Händen, und damit stampft er auf die Kiste, um sein Opfer in Besitz zu nehmen. Im gleichen Augenblick tritt Miijamoto Samonosuke hervor und hält den Stab fest. Fechterstellung, Schütteln des Kopfes, Verdrehen der Augen – das Publikum spendet Beifall.
Der Dämon selbst zeigt weder Überraschung noch Furcht noch Mut, er verharrt in tierischer Gleichmütigkeit, groß wie ein Turm gegen seinen Angreifer. Und der Kampf beginnt.
Armer Miijamoto Samonosuke! Du bist so winzig und er so groß. Wie wird es dir ergehen!
Der Geist drängt ihn zurück, Samonosuke stürzt sich zwischen seinen Beinen durch und greift von der anderen Seite an. Der Geist treibt ihn über den Blumenweg, und jetzt erscheint ein blödes Lächeln in dem grauen Paviangesicht des Dämons: er spielt mit dem kleinen Menschlein, das ihm um die Beine läuft. Wunderbare Posen und Fechterstellungen. Samonosuke gelingt es abermals, zwischen den Beinen des Feindes, die ihn zu zerstampfen drohen, durchzuschlüpfen und zur Bühne zurückzueilen. Es ist der Kampf zwischen einem übermenschlichen und zugleich untermenschlichen Wesen, zwischen einem Wesen halb Gott und halb Gorilla und einem gewöhnlichen Sterblichen, dem das Publikum atemlos folgt. Der Kampf ist ungleich und heiß. Miijamoto Samonosuke lässt das schwarzsamtne Wams herab, ein prächtiges, rotes, gesticktes Untergewand kommt zum Vorschein. Endlich rafft er alle Kraft zusammen und versetzt dem Dämon einen Hieb ins Bein. Hohoo! Ah–ah–ah! Der Dämon schwankt, dieser Turm neigt sich und stürzt langsam der Länge nach zu Boden. Während er hastig die Stelzen abschnallt, wird die Aufmerksamkeit des Publikums durch einen kleinen Dämon abgelenkt, der dem Samurai in den Rücken fällt und rasch besiegt wird.
Unterdessen hat sich der Dämon der Stelzen und seines Obergewandes entledigt, und nun entpuppt er sich als ein gewöhnlicher, grauhaariger, zottiger Affe, dem es Vergnügen macht, mit diesem hitzigen, ungeschickten Menschlein zu spielen. Er springt kopfüber durch die Büsche, ja sogar durch die Gitter des Tempels und die Laterne, er verschwindet plötzlich und taucht ebenso plötzlich kopfüber irgendwo auf, während Miijamoto Samonosuke mit dem Schwerte um sich schlägt. Es wird ihm heißer und heißer. Er lässt das rote Untergewand herab, und ein blaues erscheint, er lässt später auch, gänzlich erschöpft, das blaue herab, und abermals erscheint ein rotes. Der Affe klettert auf den Tempel, Samonosuke folgt ihm. Hier passiert ihm das Missgeschick, dass der Affe ihm das Schwert entreißt. Durch List gewinnt er es wieder zurück. Er macht dem Affen Bewegungen vor, die saru seiner Natur gemäß alle nachahmt. Schließlich macht er die Bewegung des Schneidens, und der Affengreis oben auf dem Tempel schneidet sich in die Pfote und lässt das Schwert fallen.
Durch eine List gelingt es Miijamoto Samonosuke, endlich auch den Feind zu fassen. Er stellt sich tot, und der Dämon kauert sich mit affenhafter Neugierde an seiner Seite nieder. Miijamoto Samonosuke erfasst und überwältigt ihn.
Über das Drama
Der Direktor unserer Truppe, ein ehemals berühmter Frauendarsteller und jetzt noch ausgezeichneter Schauspieler, erzählte mir, dass es etwa zweitausend Stücke gäbe! Also tausend Stücke! Aber auch das ist gewiss noch übertrieben, sicher ist jedoch, dass es eine Legion von Dramen gibt. Ich habe nie in all den verschiedenen Theatern ein Stück, das ich schon kannte, wiedergesehen. Die bedeutendsten sind gedruckt, von vielen aber existieren nur einzelne Abschriften, und die meisten erhalten sich durch mündliche Überlieferung. –
Der älteste Typus ist das No, ein Gemisch von Rezitation, Tanz, Chor und lyrischen Spielen, den Vornehmen des Landes reserviert. Daraus entwickelten sich die Jidai-mono, die historischen Dramen, und die Sewa-mono, die bürgerlichen und Sittenstücke, die in den Volkstheatern shibai, kabuki gespielt werden. Sie umfassen schlechterdings alles: das Drama des nackten Menschengeschlechts, das unter Göttern und Dämonen zittert, das Drama der Nation, der Stämme, der Familie, des Einzelnen.
Obwohl das Theater schon deutlich die Spuren des Verfalls trägt – besonders in den großen Städten —, ist es doch noch die einzige Stätte, die Teehäuser vielleicht ausgenommen, die, von alten künstlerischen Traditionen beseelt, Pracht und Größe des klassischen Japan widerspiegelt. Eine Abendröte, deren verlöschendes Feuer die rote Glut und blendende Schönheit eines Sonnentages zurückruft, während schon die graue Dämmerung herabsinkt.
Die vergangene Kultur eines genialen Volkes, unvergleichlich in ihrer Geschlossenheit und ihrem Reichtum, die Geschichte, Götter und Gespenster, Sitten und Kostüme leben auf den dürftigen Bühnen wie in einem Zauberspiegel vor dem Auge des Zuschauers wieder auf und erwachen durch die raffinierte Kunst der Darstellung zu einem erschütternd greifbaren Leben.
Es gibt Stücke, die im Düster vorgeschichtlicher Epochen spielen, wo bärtige, haarige Menschen auftreten, die ungeheure Keulen schwingen, halb nackt, in Felle oder Gewänder barbarischer Pracht gehüllt, mit wilden Raubtiergesichtern und Gorgonenhäuptern, deren Anblick Entsetzen einflößt, wie durch einen Zauber aus versunkenen unverständlichen Jahrhunderten gestiegen; Darstellungen von Kämpfen der eingewanderten Japaner mit den Ureinwohnern, den Ainu, Kämpfe, rasende Kämpfe, und kein Wort wird dabei gesprochen. Nur die Natur spricht, der Donner, oder ein Schneesturm hüllt die Kämpfenden in dichte, fast undurchsichtige Schleier.
Wie in dem Spiel von Miijamoto Samonosuke treten in einer Anzahl von Dramen Dämonen und Gespenster auf, und ich habe ein Stück gesehen, in welchem sogar ein Kami (Gott) über den Zuschauerraum hinwegsegelte, an einem Draht; wie eine explodierte Bombe sah er aus.
Am häufigsten aber sind die historischen Spiele, und täglich werden auf tausend kleinen Bühnen berühmte Helden, Schlachten, Szenen aus den endlosen Fehden der verschiedenen Stämme, die ganze Geschichte Japans lebendig.
Man betritt ein Theater, wo immer es sein mag, und man wird fast stets das gleiche sehen: ein Samurai, der über den Blumenweg eilt, ein Rat würdiger, steif dasitzender Edelleute, Fechterstellungen, geschwungene Schwerter, Verfolgungen, blutüberströmte Menschen, abgehauene Gliedmaßen. Aber man wird nie müde werden, das zu sehen, hingerissen von der Großartigkeit und Wucht der Darstellung.
Die Trachten sind verschieden, den betreffenden Zeitabschnitten entsprechend, besonders die Frisuren. In den ältesten Stücken tragen die Samurai die schwarzen Haare lang und offen, in Knoten, mit in den Nacken hängenden Büscheln, rasiert in der Mitte und in Strähnen an den Seiten herabfallend, oder nur ein dünner Haarschopf ist auf dem gänzlich rasierten Schädel stehengeblieben. Erst in den Stücken aus neueren Epochen bleibt die Frisur die gleiche; die Schädeldecke ist ovalförmig ausrasiert, blau bemalt, die Haare sind zu einem Knoten im Wirbel gebunden.