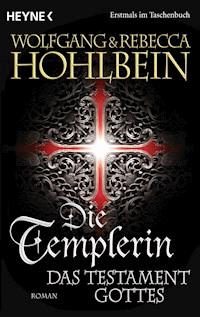
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Templerin-Serie
- Sprache: Deutsch
A. D. 1184: Die sagenumwobene Templerin Robin ist die Vertraute des todkranken Königs Balduin von Jerusalem. Um sein politisches Erbe zu regeln, begibt sie sich in Begleitung von Assassinen auf eine geheime Mission nach Deutschland. Dort enthüllt sich ihr das wahre Geheimnis des Templerordens. Das Wissen um das »Testament Gottes« droht den gesamten Erdenkreis ins Chaos zu stürzen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 656
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
WOLFGANG & REBECCA
HOHLBEIN
Die Templerin
DAS TESTAMENT GOTTES
Das Buch
Der leprakranke Balduin IV., König von Jerusalem, sieht sich dem Ende nahe. Einen direkten Erben hat er nicht, also wetzen schon viele – darunter auch seine intrigante Mutter Agnes – die Messer, um die Nachfolgefrage zu ihren Gunsten zu lösen. Balduin braucht Hilfe von außerhalb, und so schickt er eine Vertraute in geheimer Mission nach Deutschland: Robin, die legendäre Templerin, die ihm schon oft im Gewand eines Tempelritters als Mann verkleidet aus der Bredouille geholfen hat. Nach vielen Irrungen und Wirrungen stößt Robin im Norden ihres Heimatlandes schließlich auf ein Geheimnis von solcher Tragweite, dass sich die Sorgen Balduins dagegen fast schon als nichtig erweisen: Sollte die Welt von dem Geheimnis erfahren, würde nicht nur im christlichen Abendland ein Morden und Brandschatzen anheben …
Der Autor
Wolfgang Hohlbein wurde 1953 in Weimar geboren. Mit seinen in insgesamt 37 Sprachen übersetzten Romanen aus den verschiedensten Genres – Thriller, Horror, Science-Fiction und historischer Roman – ist er einer der erfolgreichsten deutschen Autoren überhaupt. Er lebt in der Nähe von Düsseldorf. Im Heyne Verlag erschein zuletzt: Wir sind die Nacht.
Rebecca Hohlbein, geboren 1977, führt das Erbe ihrer berühmten Familie weiter und hat bereits mehrere Jugendbücher geschrieben und sich einen Namen bei gemeinsamen Projekten mit ihrem Vater, Wolfgang Hohlbein, gemacht (u. a. Die Templerin – Das Wasser des Lebens).
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich daraufhin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Wilhelm Heyne Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © 2011 by Wolfgang & Rebecca Hohlbein
Copyright © 2016 dieses E-Books by Wilhelm Heyne Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
unter Verwendung eines Fotos von © shutterstock/Carlos Caetano
eISBN: 978-3-641-19813-8V001
Inhaltsverzeichnis
1. KAPITEL
Robin hatte mehr von der Welt gesehen als die meisten anderen Frauen ihres Alters. In den vergangenen Jahren hatten ihr zahlreiche Menschen nach dem Leben getrachtet. Das Schicksal hatte sie mehrfach auf hohe See geschickt, auf entbehrungsreiche Reisen durch die endlosen Wüsten des Heiligen Landes, in blutige Kämpfe und erbarmungslose Schlachten. Sie hatte die klaffenden und brandigen Wunden derer verbunden, die nur knapp mit dem Leben davongekommen waren, und mehr als einmal hatte es so ausgesehen, als käme für sie selbst jede Hilfe zu spät. Dennoch hatte sie einen Großteil aller Menschen überlebt, die ihr am Herzen lagen.
Sie war zweiundzwanzig Jahre alt, und doch hätte man meinen sollen, dass kein Grauen und kein Schrecken sie noch hätten erschüttern können, dass es nichts mehr gab, was sie sorgen, und niemanden, der sie noch hätte quälen können. Und im Großen und Ganzen war dem auch so: Was Gott ihr abverlangt hatte, hatte sie zu einem starken Menschen reifen lassen, der sich an den kleinen Freuden des Lebens erfrischen konnte und den großen, bedeutenden Dingen, wie zum Beispiel dem Krieg um das Heilige Land, der nach wie vor um Jerusalem herum tobte, mit einer beinahe kränkenden Gelassenheit entgegentrat. Nein – es gab wirklich nichts, was Robin noch aus der Ruhe bringen konnte.
Außer Leila.
Ihre Tochter, inzwischen fünf Jahre alt, war in diesen Stunden wieder einmal nicht daheim. Das allein war nicht ungewöhnlich: Zum Leidwesen ihrer Eltern neigte Leila seit annähernd einem Jahr dazu, sich mit einigen Jungen aus dem Viertel herumzutreiben, Orangen und andere exotische Früchte aus den Gärten der Nachbarschaft zu stehlen und die Ziege des alten Erdogan mit Lehmklumpen und Steinen zu bewerfen. Die Zeit, in der sie sich von ihrem Vater Salim mit liebevoll bestickten Kleidern hatte schmücken lassen und in der Saila und Nemeth ihr das Haar zu kleinen Kunstwerken voller goldener Nadeln und schillernder Perlen hatten aufstecken dürfen, war wie im Flug vergangen. Salim hatte seiner Tochter seit Monaten kein neues Kleid mehr anfertigen lassen – es war vergebene Liebesmüh. Die Lebensdauer jedweden Textils, mit dem sich nicht zumindest durch trockenes Gestrüpp tingeln ließ, betrug in etwa sechs Stunden; eher weniger. Saila beschränkte sich darauf, Leila am Morgen das widerspenstige schwarze Haar zu kämmen und es zu einem einfachen Zopf zusammenzubinden, und Robin kleidete sie in schlichte, aber robuste Leinenhemden, wie es in ihrer friesischen Heimat üblich war. Das Leinen kratzte auf der weichen Kinderhaut und machte nicht nur Leila, sondern auch ihre geplagten Eltern zum Gespött der Nachbarn und der gemeinhin eitlen und stolzen Mädchen Jerusalems. Leila schien es nicht zu stören. Mit den anderen Mädchen hatte sie sowieso nichts zu schaffen, wenn sie ihnen nicht gerade an den Haaren zog oder sie mit schmutzigem Wasser bespritzte. Und erwachsene Menschen nahm sie in aller Regel überhaupt nicht wahr.
Kurzum: Leila war eine Strafe, und Robin wusste nicht, wofür. Sie fragte sich, was sie getan hatte, dass der Herrgott ihr eine solche Prüfung auferlegte, und sie hatte nicht die geringste Ahnung, wie sie diese kaum hüfthohe Herausforderung jemals bewältigen sollte.
Sie hatte versucht, mit dem Mädchen zu reden, sie zu schelten und sie einzusperren. Aber Leila war komplett uneinsichtig, stur und außerdem recht klug. Wenn Robin mit ihr redete, fand Leila einfach die besseren Argumente, oder sie gab sich einsichtig, um möglichst schnell wieder in Ruhe gelassen zu werden. Schalt Robin sie, demonstrierte Leila ihr den unschuldigsten Augenaufschlag, der je unter dem Himmel des Orients getan worden war, sodass Robins Zorn jäh wieder verpuffte. Und wenn man sie einsperrte, fand Leila eben irgendwie nach draußen – meistens durch das Fenster. Dass dieses im ersten Stock ihres Stadthauses gelegen war, fand Leila nicht schlimm. Wahrscheinlich nur ein bisschen abenteuerlich.
Auch innerhalb der vergangenen Stunde musste das Mädchen das Fenster als Tor in ein neues Abenteuer gewählt haben. Und nun war es bereits die Stunde nach Mitternacht.
Robin verharrte vor dem Eingang ihres Zuhauses, unschlüssig, in welche Richtung sie sich wenden sollte, als Salim an ihr vorbeischoss. Mit einem unanständigen arabischen Fluch auf den Lippen verschwand er im Eilschritt nach rechts, ohne Robin eines Blickes gewürdigt, geschweige denn sich zu einer Erklärung herabgelassen zu haben.
»Salim!« Als er auf ihren Ruf nicht reagierte, eilte Robin ihm nach und griff ihn an der Schulter. »Wo willst du hin?« Sie kannte den Sarazenen nur zu gut und wusste, dass er gerade in einer Stimmung war, in der er unter Umständen Dinge tun würde, die ihm am kommenden Tag sehr leidtaten. Seiner Tochter den Hintern zu versohlen wie ein nordischer Waffenschmied, zum Beispiel. Durch den dünnen Stoff seines schwarzen Hemdes hindurch spürte Robin die Anspannung seiner Muskeln, und in seinen Augen loderte heiße Wut, als er innehielt und zu ihr herumwirbelte.
»Was glaubst du, wohin ich will, wenn meine Tochter sich des Nachts allein auf der Straße herumtreibt, Weib?«, fluchte er. »Selbstverständlich halte ich den Zeitpunkt für günstig, mich endlich einmal im Harem meines Vaters zu vergnügen – nun, da ich von meinen väterlichen Pflichten entbunden bin, bis diesem kleinen Wechselbalg einmal nach einem Kurzbesuch im elterlichen Haushalt zumute ist.«
»Wie redest du denn daher? Sie ist deine Tochter, und ich bin deine Ehefrau!«, schnappte Robin, besann sich dann aber eines Besseren. Sie würde die Ruhe bewahren und sich lieber darum bemühen, ihren zornigen Gatten zu besänftigen, statt eine Grundsatzdiskussion über zwischenmenschliche Werte und Umgangsformen vom Zaun zu brechen. »Ich komme mit«, entschied sie. »Wo wollen wir nach ihr suchen?«
»Wo auch immer es ein Tier zu quälen oder etwas zu zerstören gibt«, fauchte Salim. »Ich werde sie finden, verlass dich darauf. Du gehst zurück ins Haus und setzt Doran mit einem Tritt vor die Tür, der ihn von Jerusalem bis nach Mekka befördert. Und zwar mit seinem hohlen Kopf voran.«
»Das werde ich nicht tun!« Robin schüttelte entschieden den Kopf. Offiziell stand der junge Doran seit einigen Wochen in ihren Diensten, um ihre Tochter vor weltlichen Gefahren jeglicher Art zu schützen. Doch alle, besonders Doran selbst, wussten, dass es eigentlich die Welt war, die vor Leila geschützt werden musste.
Robin hatte nachdrücklich darauf bestanden, den jungen Assassinen zu engagieren, den sie während ihrer Suche nach dem legendären Wasser des Lebens kennengelernt hatte. Nicht weil sie große Hoffnungen hegte, dass er tatsächlich besser mit ihrer Tochter zurande käme als alle anderen, die bislang an ihrer Erziehung verzweifelt waren, sondern weil sie ihm vertraute. Sie wusste, dass er Leila niemals etwas zuleide tun würde. Nicht einmal, wenn das Mädchen Erdogans verdammte Ziege irgendwann vierteilen und über der Öllampe in ihrem Zimmer rösten würde.
»Dann werde ich Doran vor die Tür setzen! Sobald ich zurück bin und diese fleischgewordene Strafe Allahs in den Brunnen eingemauert habe. Dieser Hohlkopf ist der Aufgabe, auf ein fünfjähriges Mädchen achtzugeben, offenkundig nicht gewachsen!« Mit einem Schnauben wandte Salim sich ab und wollte davonstürmen, aber Robin bekam ihn am Unterarm zu fassen und riss ihn zurück.
»Ich komme mit, weil du sie sonst nur wieder schlägst!« Alle erzwungene Ruhe war von ihr abgefallen, und aus ihrer Stimme klang jetzt eine wütende Entschlossenheit, die der Salims in nichts nachstand. Sie hasste es, wenn ihr Mann ihre kleine Tochter schlug. Zwar schlug er stets bloß mit der flachen Hand, nicht etwa mit Gegenständen, wie es manch anderer Vater an seiner Stelle getan hätte. Doch kräftig und voller Energie, wie er nun einmal war, musste er nicht eigens mit einem Gürtel oder einem Stock auf Leilas Gesäß eindreschen, um dafür zu sorgen, dass sie im Anschluss nur noch auf dem Bauch in den Schlaf fand.
Hätte man Robin vor einigen Jahren erzählt, dass ihr geliebter Salim, dieser kluge, warmherzige Mensch und liebende Vater, jemals die Hand gegen sein eigenes Kind erheben würde, hätte sie ihn verlacht oder wäre beleidigt gewesen – je nach Gemütslage. Doch sie hätte auch nie geglaubt, dass es ein Kind – ein Mädchen zudem! – geben könnte, das sich so benahm wie ihre Tochter. Es war die berechtigte Sorge, die Salim in seine Wut und Gewaltausbrüche trieb, und vielleicht tat er sogar das einzig Richtige, weil Regeln und Grenzen aus Worten in Leilas Welt schlicht keine Akzeptanz fanden. Dennoch blutete Robin allein in Erwartung der Tränen und Schreie des Mädchens das Herz, und ihre eigene Hilflosigkeit entlud sich in Wut auf Salim: »Ich lasse nicht zu, dass du sie verprügelst!« Sie verstärkte ihren Griff um seinen Unterarm so sehr, dass es ihn schmerzen musste. »Ich kann es nicht ertragen, wenn du …«
»Ich habe sie noch nie verprügelt!«, fiel Salim ihr ins Wort, riss sich mit einem Ruck los, stürmte aber nicht sogleich weiter, sondern atmete hörbar tief durch. Dann mäßigte er endlich seinen Ton: »Hätte ich das getan, könnte sie das Haus nie wieder ohne fremde Hilfe verlassen, und das weißt du. Du weißt, dass ich ihr niemals irgendeinen echten Schaden zufügen könnte. Du weißt, dass ich sie nur vor sich selbst schützen möchte. Du weißt, dass ich sie vor sich selbst schützen muss, wenn sie ihre Kindheit überleben will.« Er griff nach Robins Kinn und zwang sie, seinem eindringlichen Blick im schwachen Licht, das durch die unteren Fenster auf die Straße fiel, zu begegnen. »Das weißt du doch, oder?«
Robin antwortete nicht. Selbstverständlich war sie sich all dessen bewusst. Doch sie wollte ihn spüren lassen, dass sie litt. Sie wollte, dass er sich einbildete, ganz allein schuld an ihrer Misere zu sein, damit er sich endlich etwas einfallen ließ, was ihnen wirklich half, weil sie selbst nämlich nicht mehr ein noch aus wusste. Fast wünschte sie, König Balduin käme in diesem Augenblick um die Ecke geritten, um ihr aufzutragen, die Gebeine der Heiligen Jungfrau auf einem Löwen nach Jerusalem zu holen und sie zu neuem Leben zu erwecken. Denn es erschien ihr, als wäre etwas Derartiges, verglichen mit der Erziehung eines jungen Menschen, noch die leichter zu bewältigende Herausforderung.
Doch König Balduin war dem Tod längst näher als dem Leben. Jüngst hatte er seinen Neffen Balduin V., den Sohn seiner Schwester Sibylle, zu seinem Nachfolger ernennen müssen, und weil dieser den Windeln gerade erst entwachsen war, führte nun Raimund III. von Tripolis die Regentschaft. Dieser aber, das wusste Robin, hätte sich selbst dann nicht an sie gewandt, wenn er tatsächlich einen solch absurden Wunsch verspürt hätte. Und so war Robin mit dem Rücktritt des hinfälligen Balduin IV. aus ihrer Pflicht als Erster Ritter des Jerusalemer Königshofes in ein fast normales Leben als fast normale junge Frau entlassen worden. Als junge Frau mit einem gigantischen, inzwischen fünfjährigen Problem und einem Ehemann, der ihr auch nicht helfen konnte.
»Ja«, antwortete sie schließlich widerwillig. »Ja. Das weiß ich alles. Aber …«
Erneut ließ Salim sie nicht ausreden. »Ich werde sie nicht schlagen«, versprach er beinahe sanft und küsste Robins Stirn. »Ich verspreche es dir. Es hat die letzten zehn Male nichts gebracht, und es würde auch dieses Mal nichts bringen. Ich werde …« Er zögerte.
»Du wirst was?« Robin zog misstrauisch die Brauen zusammen.
Salim zuckte die Schultern. »Mit ihr … reden. Von Mann zu Mann, sozusagen.« Er grinste gequält.
Robin maß ihn skeptisch. Sie war geneigt, ihm zu glauben, dass er Leila nicht wieder gewaltsam züchtigen wollte, aber das mit dem Reden glaubte sie ihm nicht. Sein Zögern war ihr ebenso wenig entgangen wie sein plötzlicher Stimmungswechsel, der ihr sehr verdächtig erschien. Als wäre ihm viel daran gelegen, dass sie sich vertrauensvoll und halbwegs beruhigt ins Haus zurückzog.
Robin suchte seinen Blick, und Salim hielt ihrem stand. Er war ein hervorragender Lügner. Sie wusste, dass er ihr nichts verraten wollte und würde – was auch immer er vor ihr verheimlichen mochte. Darum gab sie sich geschlagen. »Einverstanden«, stimmte sie beschwichtigt zu. »Ich warte zu Hause.«
Auch sie war eine gute Lügnerin.
Salim drückte ihr einen Kuss auf die Lippen. »Mach dir keine Sorgen, Christenweib. Ich habe mich schon weitaus größeren Gefahren gestellt.«
Und damit eilte er davon, nicht mehr stampfend, sondern leise wie eine Katze. Robin wandte sich ab und kehrte tatsächlich ins Haus zurück. Aber nur für einen kurzen Moment. Dann spitzte sie vorsichtig am Türrahmen vorbei, wartete ab, bis er um die nächste Ecke verschwunden war, und folgte ihm so leise und unauffällig, wie sie es von ihm und den anderen Schattenkriegern des Alten vom Berge gelernt hatte.
Zu dieser späten Stunde regte sich nicht mehr viel im muslimischen Viertel der Stadt. Doch Salim eilte zielsicher durch die Straßen, bis er einen düsteren kleinen Bezirk erreichte, in dem das Leben erst jetzt richtig erwachte. Robin begleitete ihn ungesehen in einem Abstand von rund fünfzig Schritt und bekam nicht nur zunehmende Schwierigkeiten, ihn im Auge zu behalten, sondern lief auch Gefahr, dabei entdeckt zu werden. Aus zahlreichen Teestuben und Gasthäusern, in denen der Alkohol, den der Koran so streng verbot, in Sturzbächen die Kehlen durstiger Männer hinabfloss, fiel helles Licht auf die ungepflasterten, engen Wege. Einige Soldaten des Jerusalemer Königs torkelten Fackeln schwenkend an ihr vorüber. Einer von ihnen hatte sich selbst eingenässt, was aber niemanden zu stören schien. Ihn selbst am allerwenigsten.
Salim überquerte einen kleinen Platz, auf dem auch weit nach Mitternacht noch reger Handel getrieben wurde. Eine Hure lockte einen Freier auf einen blickdicht verhangenen Wagen; drei Burschen, denen noch kein Haar aus den Achselhöhlen spross, schlugen zur Belustigung einiger anderer Betrunkener wild aufeinander ein. Eine Schar alter Männer lungerte um eine Kiste herum, die ihnen als Tisch für ein Geldspiel diente, und zwei Juden standen mit einem kleinen Karren am Rande, um die Gewinner anschließend um ihre Gewinne zu bringen und die Verlierer um ihr letztes Hemd.
Robin lebte nun seit annähernd sechs Jahren in der Heiligen Stadt, doch in diesem Teil war sie noch nie gewesen. Sie hatte davon gehört, aber keine Vorstellung vom Ausmaß der widerwärtigen, überaus vielseitigen Hemmungslosigkeit gehabt, die hier vorherrschte. Nun mit eigenen Augen zu sehen, wovon man sonst bloß hinter vorgehaltener Hand sprach, erschreckte sie sehr.
Was sie allerdings am allermeisten entsetzte, war der Umstand, dass dieses verkommene Gebiet so nah an dem lag, in dem sie lebte – und damit auch die Möglichkeit bestand, dass ihre kleine Tochter sich irgendwo hier herumtrieb. Dass sie irgendetwas stehlen und ohne jegliches richterliches Verfahren an Ort und Stelle enthauptet werden könnte. Dass man ihr die Zunge aus dem Rachen riss, weil sie sie nicht beherrschte. Oder dass einer dieser lüsternen alten Säcke, die hier in jedem Winkel lauerten, Leila in ein stinkendes Hinterzimmer lockte und ihr etwas unaussprechlich Schreckliches antat …
Robin zwang sich, nicht weiter darüber nachzudenken, und konzentrierte sich darauf, Salims Fährte nicht zu verlieren. Offenbar war er davon überzeugt, dass Leila hier irgendwo zu finden war. Oder er wusste sogar ganz genau, wo sie sich befand, jedenfalls machte er nicht den Eindruck, als ob er nach ihr suchte. Vielmehr bahnte er sich seinen Weg zielstrebig durch die Menge auf dem Platz, passierte eine schmale, unbeleuchtete Gasse und hämmerte an deren Ende an die Tür eines Hauses. Es erschien Robin eher wie ein heruntergekommener Verschlag, in dem sie halbwegs guten Gewissens bestenfalls ein lahmes Maultier untergestellt hätte. Und zwar das eines Menschen, den sie auf den Tod nicht ausstehen konnte.
»Tarek! Beweg deinen schrumpeligen Hintern aus dem schimmligen Stroh, sonst mache ich dir Beine!«, fluchte Salim, als niemand sofort auf sein Klopfen reagierte. »Ich bezahle dich nicht dafür, dass du deinen Rausch ausschläfst, wenn ich nach dir verlange!«
Robin duckte sich hinter einen morschen Karren, der nur noch ein einziges Rad hatte, und beobachtete ihren Mann mit zunehmender Verwunderung. Der Name Tarek war ihr fremd. Niemand dieses Namens stand in ihren Diensten. Zumindest nicht, soweit sie wusste. Außerdem hatte niemand, den Salim und sie beschäftigten, es nötig, in einer heruntergekommenen Hütte am Rande eines derart zwielichtigen Viertels zu hausen.
Ein weiterer Augenblick verging, in dem Salim abermals ungehalten gegen die hölzerne Tür hämmerte. Dann vernahm sie schlurfende Schritte, und schließlich öffnete sich die Tür einen Spaltbreit. Salim versetzte ihr einen Tritt, sodass sie zur Gänze aufschwang. Die Gestalt eines Mannes, den Robin in der Dunkelheit zunächst nicht deutlich erkennen konnte, stolperte mit einem leisen Fluch zurück, entzündete dann irgendwo im Inneren des Hauses eine Laterne und kehrte damit zum Eingang zurück.
»Oh, du Sohn eines verkrüppelten Esels, gezeugt in einem stinkenden Hühnerstall«, knurrte der Fremde, den Salim mit Tarek angesprochen hatte. Im Schein der kleinen Laterne in seiner Hand machte Robin ihn als Muselmanen von rund dreißig Jahren aus. Die Brauen waren über seiner Hakennase zusammengewachsen. Er war hager und trug ärmliche Kleidung. Was hatte Salim mit einem solchen Menschen zu schaffen? Und wenn er tatsächlich in seinen Diensten stand: Warum bezahlte er ihn nicht anständig, damit er sich wenigstens vernünftige Kleidung kaufen konnte?
»Hüte deine Zunge, Kerl!« Salim maß sein Gegenüber vom Kopf bis zu den Zehen, schien noch etwas hinzufügen zu wollen, winkte dann aber entnervt ab. »Hol das Pferd, und zieh dich um. Es ist so weit.«
»Schon wieder? Mir scheint, dein Töchterlein pflegt irgendwo in der Stadt eine kleine Affäre«, spöttelte Tarek und heimste sich damit prompt eine schallende Ohrfeige von Salim ein. Er schlug nur mit dem Handrücken zu und legte auch nicht sonderlich viel Kraft in den Hieb. Dennoch taumelte der fremde Muselman einen halben Schritt zurück. Er war ein Schwächling, registrierte Robin. Nicht besonders groß, krank von zu ausgelassenem Leben und außerdem recht dumm, dass er sich einen solchen Ton dem Sohn des Alten vom Berge gegenüber erlaubte. Wenn er denn wusste, mit wem er sprach.
»Sie ist fünf Jahre alt, du elender Hurensohn!«
Tarek hob die Linke, um sein Gesicht zu schützen, und nutzte sie dazu, sich die rot glühende Wange zu reiben, als er begriff, dass er zumindest für den nächsten Augenblick keinen weiteren Hieb zu befürchten hätte, sofern er Salim nicht erneut verhöhnte. »Schon gut, schon gut … Verzeih … Es tut mir leid. Es ist nur … Ich habe es bereits zweimal getan. Gestern und auch in der Nacht davor … So war es nicht abgesprochen. Ich kann nicht jede Nacht hinausreiten und darauf hoffen, dass ich sie noch erwische, ehe sie freiwillig heimkehrt.«
Gestern und in der Nacht davor? Robin stockte der Atem. Wollte er damit sagen, dass Leila auch in den beiden vergangenen Nächten fort gewesen war, ohne dass sie, ihre eigene Mutter, es bemerkt hatte? Das konnte nicht sein! Konnte ihr Versagen wirklich solche Ausmaße angenommen haben? Robin erwartete einen Widerspruch von Salim, aber der Sarazene ging nicht auf die Behauptung ein.
»Nicht?«, erwiderte er stattdessen verächtlich. »Welcherlei Pflichten binden dich denn an deine ärmliche Hütte? Für wen musst du da sein? Für die Huren, den Alkohol, das Glücksspiel oder das Spiel mit dir selbst?«
Tarek blieb eine Antwort schuldig und fühlte sich sichtlich unwohl in seiner Haut. Vielleicht wusste er doch in vollem Umfang um Salims Identität. Aber er gehorchte trotzdem nicht sofort. »Du wirst mir schon ein wenig entgegenkommen müssen«, beharrte er unbehaglich, aber entschieden.
»Elender Beutelschneider!«, schimpfte Salim. Aber aus seiner Stimme klang eine Ungeduld, die auch Tarek nicht entgehen konnte. Das brachte Salim einen Verhandlungsnachteil ein. Er wusste es selbst und schlug einen zusätzlichen Betrag vor fünf Dirham vor.
Tarek schüttelte den Kopf. »Zu wenig.«
Salim gab sich sichtlich Mühe, nicht aus der Haut zu fahren. »Was willst du noch, du Hund?«
»Das Pferd«, erklärte der Muselman.
»Es ist ein ausgebildetes Schlachtross! Ein Tier, das sogar meinem Vater gerecht würde!«
»Es ist ein Wallach.«
»Aber ein …«, begann Salim.
Tarek brachte ihn mit einer beschwichtigenden Geste zum Schweigen. »In Ordnung. Behalte den Gaul. Erhöhe um sieben Dirham, und wir sind uns einig.«
»Gut«, stimmte Salim widerwillig zu. »Und nun zieh dich endlich um.«
Tarek wandte sich ab, um – so vermutete Robin – Salims Bitte nachzukommen, hielt dann aber noch einmal inne: »Wenn ich morgen noch einmal losmuss, bekomme ich das Pferd.«
Salim beobachtete ihn durch die offene Tür. Wahrscheinlich wollte er das Haus nicht betreten. Wenn es dort roch, wie Robin es sich vorstellte, dann stank es gewiss erbärmlich. Viele der Menschen in den ärmeren Häusern lebten mit Ziegen, Hühnern und einer Unzahl von Ratten und Mäusen unter einem Dach. Salim jedenfalls drehte in regelmäßigen Abständen den Kopf zur Seite – vermutlich, um einen Hauch frischer Luft zu erhaschen. Im Inneren des Hauses raschelte, polterte und klimperte es.
»Andersherum, du Schwachkopf!«, schalt Salim Tarek nach einer Weile. »Du trägst den Waffenrock falsch herum … Und schnür die Stiefel anständig zu … Gut so. Der Helm … Warum ist er rostig? Du solltest darauf achtgeben, bis du ihn brauchst! Hast du ihn etwa in einem Trog aufbewahrt?!«
Robin begriff immer weniger von dem, was sie sah und hörte. Salim wollte seine Tochter suchen, keinen Verbrecher zum Ritter ausbilden, um ihn in die Schlacht gegen die Kleinnager in seinem Haus zu schicken! Was zum Teufel hatte der Sarazene nur vor?
»Klapp das Visier herunter, ehe du das Haus verlässt«, bestimmte Salim nach einem letzten prüfenden Blick. »Ich werde nun nach Hause zurückgehen und abwarten. Hol das Pferd, und beeil dich, damit du sie nicht wieder verpasst. Solltest du auch nur einen Lidschlag mehr Zeit vergeuden als zwingend nötig, frag mich später lieber nicht nach den sieben Dirham. Und nie wieder nach einem weiteren Auftrag.«
Sieben Dirham!, wiederholte Robin in Gedanken. Davon konnte eine Familie annähernd zwei Monate leben …
Salim machte auf dem Absatz kehrt, um den Weg zurückzugehen, den er gekommen war, und Robin duckte sich etwas tiefer hinter den morschen Karren, um nicht entdeckt zu werden. Als Salim außer Sichtweite war, richtete sie sich vorsichtig wieder auf und beobachtete die kleine, hagere Gestalt Tareks, der nun aus dem ärmlichen Eckhaus ins Freie trag.
Der Muselman trug einen Helm, dessen Visier nicht heruntergeklappt war, ein langes, rostiges Schwert und einen schmutzigen weißen Waffenrock, auf dem ein blutrotes Tatzenkreuz prangte.
Das Gewand eines Tempelritters!
Ihr Gewand?
Robin bewahrte es seit ihrer Rückkehr nach Leilas Geburt in einer Truhe unter ihrem Bett auf, die im Laufe der Jahre gelegentlich von Saila von Staub befreit, aber nicht ein einziges Mal geöffnet worden war. Hin und wieder hatte sie durchaus das Bedürfnis verspürt, den Waffenrock noch einmal hervorzuholen und überzustreifen; ein letztes Mal am Duft der reich verzweigten Wege zu schnuppern, die sie in ihr jetziges Leben geführt hatten – am Staub der Komturei, in die Bruder Abbé sie einst aufgenommen hatte, am Heu des Dachbodens, auf dem Salim und sie sich zum ersten Mal geliebt hatten, am Salz der Meere, die sie bereist (und um große Mengen halb verdauter Speisen bereichert) hatte, am Sand der Wüsten, in denen sie beinahe verdurstet wäre … All der Schweiß und das Blut längst vergangener Strapazen hafteten an ihrem Waffenrock, und ebenso verlangte es sie manchmal danach, den schweren Helm noch einmal über den Kopf zu stülpen und sich so stark zu fühlen wie in den zahlreichen Kämpfen, die sie überstanden hatte, und vor allem die Klinge des Schwertes noch einmal zu berühren, welches das einzige Erbe des Vaters war, den sie nie gekannt hatte. Aber nach ihrer Rückkehr nach Jerusalem hatte sie nichts von alledem jemals wieder getan. Ihr Herz mochte sich zeitweilig nach den Abenteuern ihrer Jugend sehnen. Doch mindestens genauso groß wie ihr Durst nach Freiheit und ihre Lust, immerfort mehr von der Welt zu entdecken, war der Schmerz, den sie empfand, wenn sie an den Preis für die Maskerade zurückdachte, der sie sich damals hatte unterwerfen müssen: an die stete Angst, enttarnt und getötet zu werden, die teils wortwörtlich schmerzhafte Unterdrückung ihrer Weiblichkeit und all das Elend, das sie durchgestanden und mit angesehen hatte. Als wäre sie kein junges Mädchen gewesen, sondern ein gestandener Krieger, den weder abgehackte Gliedmaßen noch die Schreie der Sterbenden im Geringsten erschütterten.
Robin hatte mit alledem abschließen wollen. Sie hatte ihre eigene Identität viel zu lange verleugnen müssen, als dass sie wirklich noch einmal Robin von Tronthoff, der Tempelritter, sein wollte. Auch nicht für die Dauer weniger Minuten, in denen ihr nicht einmal jemand zusah. Die Templerin war eine Legende, deren Reliquien in einer verschlossenen Truhe unter Robins Bett ruhten. Das Mädchen aus dem friesischen Fischerdorf hingegen war nun eine erwachsene Frau. Eine Mutter, die derzeit vor der Wahl stand, gleich an ihrem ersten Kind zu verzweifeln oder es als das größte Abenteuer ihres Lebens zu betrachten. Sich ihm zu stellen, um es zu einem guten Ende zu führen wie die zahlreichen anderen Herausforderungen, die sie in jungen Jahren gemeistert hatte. Zwar rückte die vollkommene Verzweiflung in diesen Tagen stetig näher, aber Robin war trotzdem noch lange nicht bereit aufzugeben. Offenbar ging es dem Wüstenprinzen ebenso. Was aber der Fremde in dem Gewand, das sie für das ihrige hielt, damit zu schaffen hatte und was Salim plante, verstand sie noch immer nicht.
Einen winzigen Moment lang spielte sie mit dem Gedanken, einfach aus ihrem Versteck zu treten und den Fremden zur Rede zu stellen. Was verheimlichte Salim? Was hatte er mit ihrer fürchterlichen, von Herzen geliebten Tochter vor? Handelte es sich tatsächlich um ihren Waffenrock und um ihren – in der Tat recht rostigen – Helm, in dem dieser stinkende, hässliche Mensch respektloserweise steckte? Falls ja, wollte sie, dass er beides schleunigst ablegte und zurückgab, damit sie es in ihre geheime Truhe zurückstecken konnte. Nachdem sie es Salim aus Wut über die heimliche Übereignung um die Ohren geschlagen hatte, natürlich.
Aber der Mann hatte seine Laterne bereits gelöscht und eilte nach rechts davon – wahrscheinlich um das Pferd zu holen, von dem Salim und er gesprochen hatten. Und selbst wenn Robin ihn eingeholt hätte, würde er gewiss den Teufel tun, seinen Auftraggeber an dessen Weib zu verraten. Schließlich erhoffte er sich zu der gestohlenen Ausrüstung offenbar auch noch ein Schlachtross.
Nein, was auch immer Salim im Schilde führte – sie tat gewiss besser daran, Leila zu suchen, ehe er sie fand. Auf ein Gespräch unter Männern, wie er es scherzhaft genannt hatte, lief das, was sie soeben mitbekommen hatte, auf jeden Fall nicht hinaus.
Ohne einen konkreten Anhaltspunkt, wo sie ihre Tochter hätte suchen können, drängte Robin sich durch das rundum verkommene Treiben auf dem Platz. Sie passierte die Spieler vor der Teestube und wollte gerade in eine vergleichsweise friedliche Gasse einbiegen, als sie die Stimme eines Kindes vernahm, das irgendwo hinter ihr vor Vergnügen quiekte. Sie verharrte mitten im Schritt und blickte alarmiert zurück.
»Fünf Dirham und eine Decke aus Lammfell!«, jubilierte die Kinderstimme. Leilas Stimme! Das Mädchen musste sich irgendwo unter dem Verdeck des Karrens verbergen, den die schlapphütigen Juden in diesem Moment von den Spielern vor der Teestube fortzogen. Robins Herz tat einen Sprung – ob vor Freude oder Entsetzen, hätte sie selbst nicht zu sagen vermocht. Was machten diese Heiden bloß mit ihrem Mädchen?!
»Was sagtet Ihr doch gleich, was der Kaufpreis gewesen ist?«, setzte Leilas Stimme nun freudig hinzu. »Zwei Dirham?«
Der älteste der Juden nickte. »In etwa. Ja.«
Robin unterdrückte den Impuls, auf dem Absatz kehrtzumachen, ihre Tochter unter dem Verdeck hervorzureißen und sie sich unter den Arm zu klemmen, um sie im Schnellschritt heimzutragen und ihr dort die Ohren lang zu ziehen. Die jüdischen Händler waren schließlich zu dritt, und sie trug keinerlei Waffen bei sich. Also wich sie zunächst bloß in die Nachtschatten zurück und beschränkte sich darauf, die Männer mit dem Karren zu beobachten und angestrengt nachzudenken, während sie ihnen auf leisen Sohlen folgte.
Zumindest in diesen Sekunden schwebte Leila offenbar nicht in Lebensgefahr. Wahrscheinlich hatten diese Dreckskerle sie mit irgendetwas gelockt und entführten sie gerade, ohne dass sie sich dessen bewusst war. Um sich an ihr zu vergehen oder um sie zu verkaufen. Oder sie wussten, dass Leila die Enkelin des Alten vom Berge war, und erhofften sich in ihrer grenzenlosen Dummheit ein stattliches Lösegeld, wo sie am Ende bloß der Tod erwarten würde.
Robin kannte keinen einzigen Juden persönlich, aber sie hatte viel von ihnen gehört und traute ihnen alles zu. Es ging ihr nicht darum, dass sie einem Volk angehörten, das keine Skrupel gehegt hatte, den Sohn Gottes zu verraten, sodass er grausam am Kreuze starb. Robin glaubte an Gott, war aber vernünftig genug, keinen Menschen bis ins zwanzigste Glied und länger für die Verbrechen seiner Ahnen verantwortlich zu machen. Darüber hinaus gestand sie jedem seinen eigenen Glauben zu, so wie sie erwartete, dass man ihr auch den ihrigen ließ. Aber die Juden mussten gute Gründe haben, weltweit das Leben in eigenen Siedlungen vorzuziehen, zu denen kein Andersgläubiger, ob Christ oder Moslem, je Zutritt hatte. Man sagte ihnen Lug und Trug nach, Diebstahl, Hehlerei, Hurerei und allerlei fürchterliche andere Schandtaten, für die sich nicht einmal in der überaus umfangreichen arabischen Sprache passende Worte fanden. Als die Kreuzzügler das jüdische Viertel der Stadt dem Erdboden gleichgemacht hatten, hatten sie nicht bloß aus ihrem eigenen Glauben in Paarung mit einem ordentlichen Maß an Intoleranz heraus gehandelt: Jene Juden, die sich als unbelehrbar erwiesen und sowohl an der Leugnung der Göttlichkeit Jesu festhielten als auch darauf bestanden, weiterhin in der Heiligen Stadt zu bleiben, wollte man vor allen Dingen nötigen, sich zu verstreuen. So hatten ihre neuen Nachbarn (zumeist waren es Muslime, denn kaum ein Christ duldete einen Juden in unmittelbarer Nachbarschaft) immerzu ein Auge auf sie, und es war wesentlich schwieriger, sich zu versammeln, um etwa ein Verbrechen zu planen oder einen Aufruhr anzuzetteln.
Das Misstrauen gegenüber den Juden saß jedenfalls tief, und – so fand Robin – es war gewiss nicht unbegründet. So erwischte auch sie sich gelegentlich dabei, einen misstrauischen Blick auf das bescheidene Haus der Familie ben Ephraim am Ende ihrer Straße zu werfen.
»Das ist großartig!« Nun schwang Leila die Beine über die offene Seite des Karrens und ließ sie entspannt baumeln. »Es ist wie Stehlen, ohne ein Dieb zu sein!«
»Nein.« Der älteste der Männer – er trug einen silberweißen Bart, der ihm fast bis zur Brust reichte, und die typisch jüdischen Ohrlocken wie seine beiden Gefährten – bremste den Wagen, drehte sich zu dem Mädchen um und blickte es ernst an. »Es ist einfach nur Handelsgeschick«, erklärte er. »Wir sind keine Diebe.«
»Ist mir egal«, winkte Leila ab und kicherte vergnügt. »Ich finde es toll! Wenn ich groß bin, will ich auch ein Jude werden und klauen, ohne ein Dieb zu sein.«
Die beiden jüngeren Männer tauschten Blicke, die Robin nicht zu deuten vermochte, und der Alte seufzte tief. »Du solltest nun nach Hause gehen«, sagte er zu Robins Überraschung. »Eines Tages werden deine Eltern dich erwischen, wenn du nachts auf unseren Karren springst. Und dann werden sie uns töten.«
Leila schüttelte den Kopf. »Meine Eltern könnten niemals einen Menschen töten. Dazu sind sie viel zu gutherzig«, plauderte sie drauflos. »Manchmal verhaut mein Vater mich. Aber er tut mir nie richtig weh. Er schlägt mich so, dass es laut klatscht, aber man merkt es kaum. Manchmal klatscht er sogar nur in die Hände und trifft mich überhaupt nicht. Immer dann, wenn meine Mutter in einem anderen Raum ist. Und wenn ich laut zu weinen anfange, dann hört er auch schnell wieder auf. So oder so.« Sie lachte.
»Deine Mutter«, erkundigte sich einer der jüngeren Juden. »Was tut sie, wenn dein Vater dich schlägt?«
Robin glaubte fast, eine Spur von Vorwurf aus seiner Stimme herauszuhören. Moralische Vorhaltungen aus dem Mund eines Juden! Aber vielleicht war es auch nur ihr schlechtes Gewissen, das seinen Worten diesen Beiklang verlieh.
»Sie tröstet mich«, erklärte Leila freimütig. »Dann weine ich noch mehr, und dann schickt sie mich in mein Zimmer und schimpft mit meinem Vater. Meistens kommt er dann irgendwann in der Nacht und bringt mir heimlich Zuckerwerk als Entschuldigung.«
Robin musste sich zusammenreißen, um die Luft nicht zischend zwischen den Zähnen hindurchzusaugen und sich dadurch womöglich zu verraten, denn die Juden waren nur wenige Schritte von ihr entfernt stehen geblieben.
Zuckerwerk! Als Entschuldigung dafür, dass Salim Leila überhaupt nicht wirklich schlug! Sie konnte kaum glauben, was ihre Tochter da erzählte, und dennoch erklärte dies natürlich einiges. Unter anderen Umständen wäre sie erleichtert gewesen zu erfahren, dass Salim ihrem Mädchen niemals so wehgetan hatte wie angenommen. Wahrscheinlich hätte sie sogar Dankbarkeit empfunden, denn es rückte den Sarazenen wieder in das Licht der Sanftmut, in dem sie ihn vor Leilas Geburt gesehen hatte. Aber die gespielten Schläge, die Salim so großzügig verteilt hatte, waren im Grunde das Einzige gewesen, was er bislang zu Leilas Erziehung beigetragen hatte! Und dann hatte er sie auch noch mit türkischem Honig und süßen Früchten für all ihre Vergehen und das gemeinsame Schauspiel im Anschluss entschädigt! Salim hatte Robin die ganze Zeit über vor ihrer Tochter zum Narren gemacht. Wen wunderte es da noch, dass sie weder ihn noch sie respektierte und ihnen immer mehr entglitt!
»Deine Eltern lieben dich, kleines Mädchen«, stellte der Alte nicht ohne Kummer fest. »Darum solltest du aufhören, uns nachzulaufen und nachzueifern. Es würde ihnen das Herz brechen, wenn sie davon erführen.«
Eine Annahme, die Robin sofort unterschreiben würde. Mit Blut anstelle von Tinte.
»Warum?«, erwiderte Leila verständnislos. »Ich habe so viel von euch gelernt. Ich kann bis einhundert zählen. Fast ohne Fehler. Ich weiß, wie man eine Muschel in drei Perlen verwandelt, und ich kann alle Münzen voneinander unterscheiden. Warum darf ich es nicht erzählen? Meine Mutter wäre stolz auf mich. Wir könnten uns tagsüber treffen, und damit wäre auch mein Vater einverstanden.«
»Du willst es nicht begreifen, du dummes Ding.« Der Jude, der bislang noch überhaupt nichts gesagt hatte, schüttelte den Kopf. Er war jünger, als Robin im schwachen Licht zunächst angenommen hatte. Er hatte den Stimmbruch hörbar noch vor sich. »Wir sind Juden! Kein Moslem lässt sein Kind bei einem Juden lernen. Ganz gleich, was es lernen will.«
»Meine Mutter ist eine Christin«, wandte Leila trotzig ein.
»Noch schlimmer«, sagte der Alte. »Und nun sieh zu, dass du heimkommst.«
Leila machte keine Anstalten, sich vom Karren zu bewegen. Robin konnte beinahe hören, wie sie ihr stures Näschen kräuselte und die Lippen zu einem Schippchen zog.
»Nun mach schon.« Der Alte trat an sie heran und hob sie mit einer sanften, aber bestimmten Bewegung vom Wagen. »Zwing mich nicht, ab morgen Abend einen anderen Weg zu gehen, damit du uns nicht mehr nachlaufen kannst. Deinethalben landen wir irgendwann noch vor einem Gericht.«
Worauf du Gift nehmen kannst, Elender!, grollte Robin im Stillen.
»Und mir persönlich ist es vollkommen gleich, ob das Beil, das mir den Kopf abtrennt, von einem muslimischen oder einem christlichen Henker geführt wird«, fügte der jüngste Jude hinzu.
Leila musterte die drei Männer missmutig, gab sich aber schließlich geschlagen. »In Ordnung«, sagte sie.
»Vergiss nicht die Aufgabe, die ich dir gestellt habe«, sagte der Alte und lächelte.
»Einen Dirham«, versprach Leila feierlich. »Einen halben für euch und einen halben für mich.«
»Das dürfte ein Leichtes für dich sein.« Der alte Jude versetzte dem Mädchen einen liebevollen Klaps auf den Po, und Leila machte kehrt und eilte leichtfüßig die Straße hinab, wobei sie fröhlich über die Schulter zu den Juden zurückwinkte.
Robin verharrte in ihrem Versteck, um sich die Gesichter der Juden, die ihr Kind ganz offensichtlich zu verderben suchten, bestmöglich einzuprägen. Ihre Erleichterung darüber, dass sie Leila zumindest keine Gewalt anzutun gedachten, hielt sich in Grenzen. Das würde ein Nachspiel haben, so viel stand fest. Und sie wollte nicht garantieren, dass an dessen Ende nicht tatsächlich die eine oder andere Ohrlocke an einem losen Kopf über blutiges Pflaster rollte.
Zunächst aber musste sie sich um Leila kümmern, und anschließend würde sie sich Salim vorknöpfen. Er schuldete ihr eine ganze Reihe von Erklärungen!
Robin eilte ihrem Kind nach, verzichtete aber darauf, dem Mädchen auf offener Straße die Leviten zu lesen. Stattdessen folgte sie Leila in einigen Dutzend Schritten Entfernung, die nun in ihr eigenes Viertel zurückkehrte und langsamer wurde, als sie sich ihrem Wohnhaus näherte. Dort angelangt, legte die Fünfjährige den Kopf in den Nacken, als suchte sie irgendetwas an der Fassade. Dann zog sie sich am Rahmen der Tür in die Höhe – vermutlich, um das Haus auf demselben Wege wieder zu betreten, wie sie es verlassen hatte: durch das Fenster im Obergeschoss. Robin knurrte leise. Ob ihre Tochter wirklich glaubte, sie käme damit durch? Was gleich die nächste Frage nach sich zog: Wie oft war sie damit bereits durchgekommen?
Das Schnauben eines Tieres riss Robin aus ihren Gedanken, und wenige Wimpernschläge darauf löste sich ein Pferd schnaubend aus den schwarzen Schatten, die die gegenüberliegenden Häuser im Mondschein auf die dunkle Straße warfen. Leila erschrak und verlor den Halt am Türrahmen, als sie über die Schulter zurückblickte. Der Reiter des Pferdes schrie etwas Unverständliches, was Robin zunächst entfernt an Latein erinnerte, bei genauerem Hinhören aber wie Griechisch unter schweren Halsschmerzen klang. Dann gab der Fremde seinem Tier die Sporen und trieb es unter lautem Kampfgebrüll auf Leila zu, die auf dem Hosenboden sitzend aus schreckgeweiteten Augen zu ihm hinblickte.
Wie ein Derwisch flog Robin auf den Reiter zu und erkannte erst spät, dass sie den Fremden schon einmal gesehen hatte. Es war Salims Handlanger. In ihrem Waffenrock. Robin schnappte nach Luft. War es das, was Salim unter »vertrau mir« verstand? Sie war noch immer unbewaffnet, aber sie wusste, dass sie jeden, der ihrem Mädchen wehtun wollte, mit bloßen Händen in der Luft zerreißen würde. Auch wenn ihr eigener Ehemann denjenigen offenbar genau dafür bezahlte. Der Mann war jedoch schneller. Obwohl sein Pferd scheute und stieg, beugte er sich herab, packte Leila am Hemdkragen und riss sie zu sich in den Sattel. Wenige Augenblicke später hatte sein Tier sich wieder beruhigt und Leila ein rostiges Schwert am Hals.
Robin blieb wie angewurzelt stehen und starrte den Fremden, auf dessen Kopf ihr eigener Helm saß, voller Entsetzen an. Auf wen zum Teufel hatte Salim sich da bloß eingelassen?
Leila wand sich im Griff des vermeintlichen Tempelritters und verletzte sich dabei selbst an der Klinge, die bei Weitem nicht so stumpf war, wie es den Anschein machte. Ein feiner Schnitt glänzte in der Dunkelheit an ihrem Hals.
»Lass sie los!«, kreischte Robin. »Lass sie sofort runter, du verdammter Dreckskerl, oder ich bringe dich um!«
Eine Mischung aus Überraschung und Erleichterung trat in den Blick des Mädchens. »Mutter …!«, presste Leila mit erstickter Stimme hervor.
»Hab ich dich, du elendes Heidenkind!«, höhnte derweil Tarek, der das Visier des Helmes noch immer nicht heruntergeklappt hatte. »Nun hat dein letztes Stündlein geschlagen! Ich opfere dich auf dem Altar an unseren grausigen Christengott!«
Langsam verstand Robin, was da gerade vor ihren Augen geschah. Salim hatte Tarek engagiert, um Leila in Angst und Schrecken zu versetzen. Was für ein erbärmliches Schauspiel! Und dieser Mistkerl hatte die Kleine verletzt!
»Lass sie runter!«, wiederholte sie voller Zorn. »Oder ich werde dafür sorgen, dass man dich vierteilt!«
»Ihr könnt mir nichts anhaben, Weib!« Der Mohammedaner fand offenbar zunehmend Gefallen an seiner Rolle als Schmierenkomödiant. »Ich bin ein Tempelritter, ich bin ein Christenmann! Ich bin stark, ich bin mächtig, und ich bin frei von Skrupel, denn ich kämpfe und töte für den Gott der Christen, der ein fürchterlicher ist! Er verzehrt sich nach dem Blut junger Mädchen – doch wird er auch das einer erwachsenen Frau nicht ablehnen!« Er lachte gehässig.
Aus den Augenwinkeln nahm Robin über sich eine Bewegung wahr und verharrte fassungslos, als sie sah, wie das Schauspiel dem Willen ihres Gatten nach weitergehen sollte: Praktisch lautlos schwang Salim sich aus dem Fenster, durch das Leila regelmäßig ins Freie gelangte, ließ sich an der Fassade hinabgleiten und landete breitbeinig im Nacken des Wallachs wie der schwarze Schatten eines Racheengels. Das Ross schnaubte und bäumte sich unter der zusätzlichen Last wieder auf, und das Schwert entglitt Tareks Hand, dessen Überraschung allerdings überhaupt nicht gespielt wirkte.
Da sprang Robin vor, riss ihre Tochter aus dem Griff des falschen Templers, und Salim verpasste ihm einen Fausthieb vor die ungeschützte Nase, der sie brach und den Muselmanen seitlich vom Pferd schleuderte.
»Mutter …« Leila klammerte sich schluchzend an Robins Hals. Diese drückte sie an sich, strich ihr beruhigend durch das widerspenstige schwarze Haar und spie dem am Boden liegendem Kerl über Leilas Schulter hinweg ins Gesicht.
»Elender … Das war nicht ausgemacht …« Tarek ächzte, während er nach seiner blutenden und nun auch noch von Speichel besudelten Nase tastete, die fortan durch zwei Haken auffallen würde.
»Du hast mein Mädchen verletzt!«, schrie Salim und trat ihm mit voller Wucht in die Rippen.
»Ich habe … ich wollte …« Tarek keuchte.
»Es ist mir egal, was du wolltest!«, fluchte Robin und versetzte ihm ebenfalls einen Tritt, ehe sie ihre Tochter auf der Türschwelle absetzte. »Oder solltest!«, fügte sie wütend an Salim gewandt hinzu.
Durch den Lärm aufgeschreckt, erschien nun Saila verschlafen im Eingang, war aber sogleich hellwach, als sie den blutenden Kratzer an Leilas Hals erblickte. Besorgt nahm sie das weinende Kind in Augenschein.
»Er sollte sie erschrecken, nicht verletzen!«, verteidigte sich der Sarazene.
»Erschrecken? Ihr in den Kleidern eines christlichen Ritters eine Heidenangst einjagen? Noch dazu in meinen Kleidern?!« Robin war außer sich, und als Salim mit einer beschwichtigenden Geste auf sie zutrat, stieß sie ihn grob von sich.
»In deinen Kleidern?« Leila hörte auf zu schluchzen und maß den am Boden Liegenden neugierig.
»Robin! Sie muss begreifen, dass es gefährlich ist, sich heimlich herumzutreiben. Noch dazu mitten in der Nacht!«, knurrte Salim.
»Gefährlich. Ja. Besonders, weil sie einen Vater hat, der schwachsinnige Trinker dafür bezahlt, seine Tochter zu entführen, zu verletzen und ihr noch dazu ein vollkommen abstruses Weltbild zu vermitteln. Ein grausamer Christengott, der nach dem Blut junger Mädchen lechzt … Das ist widerwärtig!«
»Das ganze Gerede war nicht ausgemacht.« Salim wandte sich ab – wohl um Tarek einen weiteren Tritt zu verpassen. Aber der Muselman hatte sich bereits auf Hände und Knie aufgerichtet, war ein Stück weit davongekrabbelt und zog sich nun an einem Pfosten in die Höhe.
»Hände weg, du Schwachkopf!«, brüllte der Wüstenprinz, als Tarek nach den Zügeln des Wallachs griff. Der falsche Templer zog erschrocken den Kopf ein und stolperte davon.
»Wie konntest du das tun?« In Robins Augen brannten Tränen der Wut und Enttäuschung. Sie fühlte sich in ihrem Stolz verletzt und als Christin ebenso wie als Ehefrau und Mutter verraten und verkauft. Und das ausgerechnet von dem Mann, dem sie ewige Liebe geschworen hatte. Wie konnte er sich bloß so schäbig und respektlos verhalten? Wie konnte er ausgerechnet jene widerwärtige Intrige wiederholen, mit der einst Gernot von Elmstatt und Otto, der Waffenmeister seines Vaters, ihrem eigenen, unbehelligten und friedlichen Leben in dem kleinen friesischen Dorf ein jähes Ende bereitet hatten? Es war damals deren Idee gewesen, als Tempelritter verkleidete Mörder loszuschicken, um den Orden in Verruf zu bringen – die Idee des Bösen schlechthin! »Und wenn du es schon nicht lassen konntest, wieso hast du mir nichts davon erzählt?«, setzte Robin fassungslos hinzu. »Und warum musstest du es ausgerechnet von der Hand eines vermeintlichen Christen ausführen lassen? Warum?«
»Das lag nahe.« Salim hob gleichmütig die Schultern. »Die Christen sind in unser Land einmarschiert, um es an sich zu reißen. Sie morden und sie plündern. Und sie schänden unsere Frauen. Willst du das bestreiten?«
Robin musterte ihn hart. »Nein«, gestand sie ohne jedes Schuldgefühl. »Auf einige von ihnen mag das zutreffen. Aber gewiss nicht auf die Templer. Die Tempelritter sind ehrbare, gottgefällige Männer.«
»Und Frauen?«, riet Leila, die noch immer staunend in die Richtung blickte, in welche der Fremde in dem Waffenrock verschwunden war. Dem Waffenrock, der angeblich ihrer Mutter gehörte.
Robin funkelte Salim einen weiteren Moment zornig an, dann wandte sie sich ihrer Tochter zu. Es war falsch, dass sie sich vor ihren Augen mit ihrem Vater stritt. Wenn auch mit Abstand nicht so verkehrt wie das, was ihr Vater getan hatte.
»Geh ins Haus, und lass dich von Saila versorgen und umziehen«, bestimmte sie, anstatt Leilas Frage zu beantworten. »Ich komme gleich in dein Zimmer. Wir haben viel zu besprechen.«
Das Mädchen reagierte nicht gleich. Sie bedachte Salim mit einem Blick, den Robin, die das Gespräch zwischen ihr und den Juden belauscht hatte, nur zu leicht zu deuten vermochte. Du schuldest mir eine Menge Zuckerwerk, Vater, stand darin geschrieben. Mindestens einen Ochsenkarren voll!
Salim schenkte ihr ein gequältes Lächeln, das ausschließlich in seinen schwarzen Augen stattfand. Robin hätte es niemals gesehen, hätte sie nicht gewusst, worauf sie achten musste. Schließlich kam Leila der Aufforderung ihrer Mutter nach und verschwand an Sailas Hand im Haus.
Robin und Salim folgten ihr kurze Zeit später, als ihr lautstarker Streit auf offener Straße mit den ersten Flüchen und Verwünschungen aus der Nachbarschaft honoriert wurde und ein Eimer voller stinkender Abfälle, der im hohen Bogen aus einem Fenster geschleudert wurde, sie beide nur knapp verfehlte. Zumindest für die unmittelbaren Nachbarn sowie alle, die mit ihnen unter einem Dach lebten, kehrte damit allerdings noch lange keine Ruhe ein.
Schließlich erschien Nemeth, Sailas inzwischen fast erwachsene Tochter, schlaftrunken in der Stube, in der ein zorniges Wort das andere gab. Augenrollend empfahl sie Robin, sich bloß nichts gefallen zu lassen, aber doch bitte nicht mehr heute, weil sie gefälligst schlafen wolle. Ihr Lohn war ein matschiger Granatapfel, der an der Wand knapp neben ihrer Schulter zerplatzte. Geduckt zog das Mädchen sich in Leilas Zimmer zu ihrer Mutter zurück. Doran suchte sich derweil einen Platz neben der Tür, von welchem aus er den Streit bekümmert verfolgte. Robin wusste, dass er jederzeit bereit war, sein Leben für sie zu opfern, und hoffte, dass er sich nicht in das Geschehen einmischen würde. Salim konnte Doran nicht ausstehen und würde sein Opfer – in dieser Stimmung zudem – möglicherweise mit Freuden entgegennehmen. Schließlich positionierte Kaya, Robins verhasster persönlicher Aufpasser, seine zweihundertzwanzig Pfund Lebendgewicht zwischen den beiden Streitenden und schob sie um zwei Längen seiner gigantischen Arme voneinander weg, wann immer sie sich einander auf Schlag- oder Trittweite näherten. Irgendwann kehrte Saila aus Leilas Zimmer zurück, gesellte sich zu ihnen in die Stube, brüllte Zeter und Mordio und begann dann, in wenig demütigem, vorwurfsvollem Tonfall zu Allah zu beten, weil niemand ihr Beachtung schenkte. Dass sie noch nicht einmal vom Personal in diesem Haus respektiert wurden, brachte Robin und auch Salim noch mehr in Rage.
Sie brüllten einander an, schleuderten Obst, Geschirr, Schimpfworte und Vorwürfe. In einem einzigen Satz bescheinigte Robin Salim vollkommenes Versagen als Vater und die Schuld am Krieg um das Heilige Land, während Salim ihr nicht nur totale Naivität, sondern auch eine Affäre mit dem armen Doran unterstellte, der hilflos dabeistand und nicht begriff, was er falsch gemacht haben sollte.
Inzwischen waren rund zwei Stunden seit Beginn der Schlacht vergangen, und Robin war es leid. Sie spie ihrem Gatten vor die Füße, warf den Kopf in den Nacken, stolzierte davon und verbarrikadierte sich in ihrem Schlafzimmer, wo sie sich aufs Bett warf und wie ein Schlosshund heulte. Überlaut hallte ihr Schluchzen von den Wänden wider, weil es nun geradezu gespenstisch still in ihrem kleinen Stadthaus geworden war. Vermutlich wagte niemand, auch nur ein einziges Wort zu sagen, um nicht den Zorn des Hausherrn womöglich von seinem Eheweib auf sich selbst zu lenken. Und irgendwann hörte Robin, wie der Wüstenprinz das Haus verließ.
Als Salim zurückkehrte, graute bereits der Morgen. Er reichte Robin den Helm und den verschmutzten Waffenrock, den er aus ihrer Truhe entwendet und auf widerwärtige Weise zweckentfremdet hatte. Frisches Blut aus Tareks zerschmetterter Nase haftete daran. Robin warf ihm beides vor die Füße, stieß ihn aus dem Schlafzimmer und begann, auf ihn einzubrüllen. »Und damit, glaubst du, ist die Sache erledigt, was?«, schrie sie, während sie ihn mit einem weiteren Stoß gefährlich nahe an den oberen Absatz der Treppe beförderte. »Du hast meine Geschichte mit Füßen getreten! Du hast mich und mein ganzes Volk verraten! Du hast meinen Glauben durch den Dreck gezogen und Gottes Namen missbraucht! Und soll das alles vergessen sein, nur weil du mir zurückbringst, was sowieso mir gehört? Weißt du, was? Ich brauche den Mist nicht mehr! Behalt den Kram – ich will ihn nicht mehr sehen, nachdem du ihn so schändlich entweiht hast!«
ENDE DER LESEPROBE





























