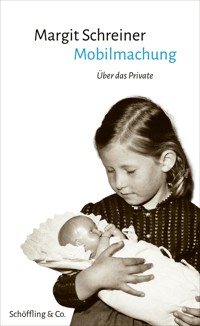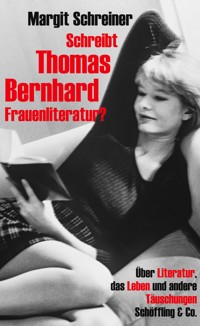9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Tiere von Paris ist das ironische Selbstgespräch einer Alleinerziehenden, die sich und dem Leser das Dreiecksverhältnis zwischen ihr selbst, ihrem Kind und ihrem Exmann schonungslos vor Augen führt. Bereits während der Ehe hat sich von Anfang an eine Entwicklung abgezeichnet, die sie nicht wahrnehmen und wahrhaben wollte. Als sie ein Kind bekommt, überschlagen sich die Ereignisse.Die Erzählerin, die sich als Wissenschaftlerin und Sachbuchautorin mit Stadtgeografie, Landschaftsräumen und dem Verirren beschäftigt, bemüht sich nach der Trennung, ihren Alltag mit dem heranwachsenden Kind zu gestalten und ohne Selbstmitleid zu bewältigen. Doch die mit einem hoffnungsvollen Rückblick beginnende Geschichte gerät in einem unwiderstehlichen Sog zur Katastrophe einer Scheidungsfamilie. Zwischen den Eltern hin- und hergerissen, muss die Tochter ihren eigenen Weg finden.Der Roman spielt in Paris, Tokio, Wien und Italien und entfaltet ein weites Panorama unterschiedlicher Lebensentwürfe. Ein raffiniert schlichtes Buch über aktuelle Fragen zur Vereinbarkeit von Kind und Beruf und die Rollen von Männern und Frauen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Widmung
Die Tiere von Paris
1. Paris
Tiere in der Großstadt
2. Wien
Orientierungsmuster
3. Wien
Das doppelte Lottchen I
4. Palestrina
Römische Wanderwege
5. Wieder in Wien
Verirren in der Natur
6. Wien – Palestrina
Getrennte Wege
7. Wieder in Wien – wieder in Palestrina
Verirren in Großstädten
8. Wien – Paris – Palestrina
Das doppelte Lottchen II
9. Paris verpasst
Ferienpläne
10. Wien – Kroatien – Wien
Über und unter Wasser
11. Wien
Lost in Blue
Dank
Impressum
Kurzbeschreibung
Autorenporträt
Alle Personen dieses Romans, mit Ausnahme von Marcella Schmidt di Friedberg, sind frei erfunden.
Die Tiere von Paris
1. Paris
Tiere in der Großstadt
WENNDUDENTYP erst los bist, wird alles besser, denkst du zuerst. Du kannst deine Zeit besser einteilen, du kannst kochen, wann und was du willst, und niemand redet dir in die Erziehung des Kindes rein. Nicht einmal im Traum würdest du auf die Idee kommen, dass dein Mann sich im Zuge der Trennung an seine achtjährige Tochter klammern und zu ihr »Hilf mir, deine Mutter zerstört unser Leben« sagen würde. Du dachtest, und das war der Irrtum, seine ganze negative Energie beträfe nur dich: Egoistin, Egomanin, Rabenmutter, Schlampe, Hure. In der Reihenfolge. Das war nie dein Vokabular. Auch seines nicht, anfangs. Wer kommt schon auf die Idee, dass der Mann, den man geliebt und geheiratet hat, auf einmal, wenn es um die Trennung geht, während das Kind sich im Badezimmer die Zähne putzt und alles mithören kann, »Deine Mutter fickt mit einem anderen!« schreien würde und »Ich will Namen und Adresse!«, nur weil er sich nicht vorstellen kann, dass du ihn, ohne dass es einen anderen Mann gibt, verlassen willst.
Wenn du den Typ erst einmal los bist, denkst du, redet dir keiner drein, wie du deinen Tag einteilst, wann du einkaufen gehst und wann nicht, wann du arbeitest, wann du deine gymnastischen Übungen machst. Der einzige Faktor, den du berücksichtigen musst, ist das Kind. Aber das war sowieso schon immer so. Der Mann, denkst du, hat dich all die Jahre nicht zerstören können, und es hat auch gute Zeiten gegeben, glückliche, die du nicht missen möchtest, und zum Kind wird er weiterhin gut sein, weil es schließlich sein Ein und Alles ist und er es abgöttisch liebt, während er dich in den letzten Jahren oft zur Sau gemacht hat.
Anfangs waren dein Mann und du selbstständige Freiberufler und Menschen: getrennte Kasse, getrennte Wohnungen, getrennte Städte, meistens Wien und Paris. Zuerst wohnst du bei deinem Mann – damals seid ihr noch nicht verheiratet – in seinem Zwanzig-Quadratmeter- Zimmer in Paris. Kein Problem, hat dein Mann in der ersten leidenschaftlichen Phase eurer Beziehung gesagt, wissenschaftlich arbeiten kann man auf kleinstem Raum. Du kündigst deinen Halbtagsjob an der Wiener Uni und ziehst zu ihm. Im Zimmer steht ein riesiger Schreibtisch, ein hundertzehn Zentimeter breites Bett, es gibt eine Nische mit Kochplatte und Waschbecken und einen Kamin. Der Esstisch lehnt aus Platzgründen tagsüber zusammengeklappt neben dem Kamin. Die Toilette ist am Gang. Warmwasser gibt es nicht.
Du schreibst auf einem Brett, das du von einer Baustelle mitgenommen hast, im Bett sitzend, während dein Mann an seinem Schreibtisch arbeitet. Auch das Holz für den Kamin, mit dem ihr heizt, sucht ihr nachts auf Baustellen. Die Arbeitssituation zweier Personen auf zwanzig Quadratmetern beginnt deinen Mann aber bald zu stören. Kleine Artikel über die Stadtgeographie könne man in so einer Situation immer schreiben, sagt er, nicht aber einen so komplexen Aufsatz über einen fiktiven Kreis deutsch-französischer Schriftsteller in einem literarischen Salon im Paris der Jahrhundertwende, wie er ihn gerade verfasse. Dazu sei größte Konzentration erforderlich, weil das Fiktive ja immer auch das Mögliche sein müsse. Kurz: Er will allein sein beim Arbeiten.
Zuerst arbeitest du daraufhin eine Weile in der Concierge-Loge im Parterre des Hauses, die dir die ehemalige Freundin deines Mannes, Maxime, zur Verfügung gestellt hat. Dann tritt Maxime die Nachfolge ihrer Mutter als Concierge an und braucht die Loge selbst, um nebenbei eine Schneiderwerkstatt aufzuziehen. Du versuchst eine Zeitlang in Cafés zu arbeiten, aber das gelingt dir nicht. Du kannst dich nicht konzentrieren, weil alles, was du siehst, immer wieder neue Themen anregt, so dass du dich nicht auf dein jeweiliges Thema konzentrieren kannst.
Schließlich überredet dein Mann einen wohlhabenden Freund, einen Unternehmer, ein von den Franzosen pied-à-terre (Fuß auf der Erde) genanntes kleines Appartement in Paris zu kaufen, das er dir dann zur Verfügung stellt. Die Abmachung sieht vor, dass du jederzeit ausziehst, wenn der Unternehmer und seine Freundin in Paris Urlaub machen wollen. In diesem winzigen Appartement, insgesamt nicht mehr als siebzehn Quadratmeter, aber aufgeteilt in einen zwölf Quadratmeter großen Salon, eine klitzekleine Küche, in der neben dem Herd und dem kleinen Kühlschrank nur ein winziges Tischchen Platz hat, neben dem du einen Klappsessel zum Essen und Schreiben aufstellst, und in ein winziges Badezimmer mit Toilette und einer so kleinen Sitzbadewanne, dass du, darin sitzend, die Beine steil an die Wand lehnen musst, wenn du den Oberkörper ins warme Wasser eintauchen willst. Manchmal hast du Angst, genau so stecken zu bleiben.
Von deinem Bett aus – einer aufgeklappten Ikea-Couch – siehst du aus dem Fenster direkt auf die neu gebaute Volksoper an der Bastille. Nachts wird sie mit Scheinwerfern bestrahlt. Sie sieht aus wie eine mittelalterliche Festung. Wenn du nicht schlafen kannst, starrst du stundenlang auf die Festung, die manchmal zu einer Oase mitten in der Wüste mutiert, dann wieder zu einem riesigen Schiff auf dem Meer. Lehnst du dich ein wenig aus dem bis zum Boden reichenden Fenster hinaus – einem so genannten französischen Fenster –, siehst du rechts den Montmartre. Links den Eiffelturm. Davor die Wüste der graubraunen oder lehmbraunen Häuser mit umgedrehten Blumentöpfen auf den Dächern. Das sind Schornsteine. Tausende, Hunderttausende. So ist die Stadt gemacht. Und aus Ideen, die dir von überall her zuwachsen, so dass du manchmal denkst, dir berste der Kopf vor unzähligen bereits fertigen Aufsätzen und Essays, die du nur noch aus dem Kopf abschreiben müsstest.
Das hast du später nie wieder erlebt: Alltagssoziologie des Pariser Cafés, Graffiti in den Migrantenwohnvierteln in Paris, Orientierungsmuster in Großstädten, Zeichensprache in U-Bahnen, Verkehrskommunikationszeichen im Vergleich Wien/Paris, Tierpopulationen in Großstädten am Beispiel von Paris und so weiter. Du sitzt in den Cafés mit den großen Fensterscheiben, durch die du Menschen verschiedenster Nationen beobachtest, die mit größter Selbstverständlichkeit ihre Geschichten preisgeben, in jeder Geste, in jedem Gesichtsausdruck.
In Salzburg, wo du aufgewachsen bist und wo deine Eltern leben, geht es im Unterschied dazu nur darum, in der Öffentlichkeit nichts Privates preiszugeben, den Status, die soziale Zugehörigkeit, die Bildung, den Rang zu präsentieren. In Wien, wo du immer noch eine Wohnung hast, lassen die Menschen sich gehen. Sie nörgeln, jammern und schimpfen über die Tauben, die Ausländer, die Jugend. Der Kampf um einen freien Parkplatz kann zur Schlägerei führen. In Paris hingegen geht es wirklich ums Überleben. Zum Überleben aber gehört Glück, das in Momenten aufblitzt, die es wahrzunehmen gilt. Und an diesem Glück nimmst du teil. Deine Nachmittage verbringst du mit der Beobachtung der Tierpopulation von Paris. (Projekt: »Die Tiere von Paris«)
Die Riesenschildkröte im Jardin des Plantes zum Beispiel ist hundertfünfzig Jahre alt. Der schwarze Wärter mit der prächtigen Fantasieuniform im kleinen Zoo des Jardin des Plantes erklärt dir, dass sie die zweite französische Revolution noch miterlebt hat. Und beide Weltkriege. Er hat großen Respekt vor der Riesenschildkröte. Im Winter gräbt sie sich in die Erde und im Frühling buddelt sie sich wieder aus. Sie wird uns alle überleben, sagt der schwarze Wärter und lacht, dass die Fantasieorden seiner Fantasieuniform nur so scheppern.
Die Maus von Bercy lebt in einem der neu eröffneten Einkaufszentren. Wenn du alle sechs Stockwerke mit dem gläsernen Lift inmitten des Rondells hinauffährst und dann von der Galerie auf das Erdgeschoss des Einkaufszentrums hinunterschaust, wo ein kleiner Teich angelegt ist, in den ein Wasserfall plätschert, siehst du sie geschäftig zwischen Farnen, fleischigen Pflanzen mit dunkelgrünen Blättern, Palmen und Kakteen hin und her laufen. Du weißt, dass sie hinter dem Schleier des Wasserfalls ihr Nest mit unzähligen Jungen versteckt.
Einmal wöchentlich besuchst du den Vogelmann vom Montmartre. Du setzt dich in ein Café. Sein Stammplatz ist auf einer Bank unter einem Baum gegenüber. Wenn er dich sieht, steht er nach einer Weile auf, streckt die Arme aus und pfeift, und die Spatzen kommen von überall her und setzen sich auf seine ausgestreckten Arme, auf die Hände, die Schultern, den Kopf, bis der Vogelmann ganz unter den flatternden Spatzen verschwunden ist. Nur das Gesicht und der Unterleib sind menschlich. Nach etwa einer halben Stunde und zwei Tassen Kaffee gehst du wieder und er bleibt so stehen, die Arme ausgestreckt, den Kopf gesenkt von dem Gewicht der Vögel. Bevor du nach der nächsten Ecke verschwindest, drehst du dich ein letztes Mal nach ihm um. Ihr sprecht nie miteinander.
Um Notre Dame kreisen die Turmfalken. Wenn sie auf den Türmen und Spitzen oder Zinnen der Kirche sitzen, sind sie nicht zu unterscheiden von den Fabelwesen der Dachränder, die Wasser speien, wenn es regnet, von den Basilisken, Dämonen, Echsen und Teufeln. Wenn sie fliegen, haben sie etwas Göttliches. Sie sind die starken, glänzend kräftigen Dornen in der Märtyrerkrone des Königs der Juden.
Die Mauersegler kommen im Sommer. Es ist nicht weit von Afrika. Sie nehmen die lehmbraunen Häuserfronten hin wie die Höhlen und Vorsprünge ihrer heimischen Klippen und Felsküsten. Nichts stoppt ihren schnellen, präzisen Flug. Sie schlafen aufrecht, an winzigen Hausvorsprüngen festgekrallt.
Einmal verirrt sich eine Fliege in dein Appartement. Eine Sensation! Sie sitzt auf deinen Büchern, frisst Brotkrümel vom Esstisch, und morgens im Bett landet sie auf deiner Stirn und weckt dich auf. Wenn du von deinen Streifzügen durch die Stadt zurückkommst, begrüßt sie dich mit mehreren Ehrenrunden, die sie durchs Zimmer dreht. Dann setzt sie sich auf deinen Kopf. Du weißt nicht, ob ihr deine Essensreste zum Leben genügen. Mücken gibt es keine in Paris. Schmetterlinge schlürfen Zuckerwasser. Vielleicht auch Fliegen. Wahrscheinlich nicht. Denn trotz des Schälchens mit Zuckerwasser, das immer auf dem Esstisch steht, liegt sie eines Tages steif auf dem Rücken in deinem Bett, alle sechs Beine von sich gestreckt. Du wirfst sie aus dem Fenster. Auch die Silberfischchen wohnen in deinem Appartement. Wahrscheinlich, weil du nicht staubsaugst. Du hast gar keinen Staubsauger. Wenn das Licht durch das Fenster auf den Teppichboden fällt, schlängeln sie sich mit schnellen Bewegungen silbrig schillernd vorwärts. Um sie brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Sie ernähren sich offensichtlich von Staub.
Die Ratten sind die größte Tierpopulation von Paris. Sie kennst du nicht. Sie leben im Untergrund. Und den willst du nicht kennen lernen. Nicht jetzt. Das wäre ein eigenes Langzeitprojekt. Aber die Hunde kennst du gut. Es sind gleich nach den Menschen die tapfersten Kreaturen der Stadt. Deformiert und verkrüppelt hinken und humpeln sie durch die Steinwüste, alte Frauen an Leinen hinter sich herschleppend. Die alten Frauen wären verloren ohne ihre verfetteten Hunde, die die übrig gebliebene Liebe und die wachsende Verzweiflung auf ihren abgeflachten Rücken tragen. Sehr beliebt sind merkwürdigerweise die sabbernden Boxerhunde mit ihren zerknautschten Gesichtern und mopsartige Kreaturen mit kahlen Stellen im Fell. Dort schimmert rosa die Haut hervor. Gleich danach kommen alle Abarten von Rehpinschern mit großen kugelrunden Augen. Sie tragen je nach Witterung Regenmäntelchen oder Strickjäckchen oder luftige Leinenkleidchen.
Die Spanierin in der Etage über dir hat eine Pudelmischung. Du hast die beiden nur einmal gesehen. Aber mehrmals am Tag hörst du durch die dünnwandige Wohnungstür den Hund, wie er die Treppen schwerfällig hinauf- oder hinunterkeucht. Die Concierge neben dem Appartement deines Mannes ein paar Straßen weiter hat zwei Hunde. Einen Boxer und einen räudigen Mops. Du weißt nicht, wie die drei in der winzigen Dachwohnung leben. Wenn die Concierge die Tür öffnet – sie ist sehr neugierig und öffnet die Tür jedes Mal wenn du kommst oder gehst –, dringt ein fürchterlicher Gestank aus der Wohnung. Vielleicht hat sie in ihrem Zimmer auch ein Hundeklo. Sie geht nur einmal am Tag – immer um zehn Uhr vormittags – mit den Hunden auf die Straße. Alle drei quälen sich dann ächzend die vier Stockwerke hinunter und wieder hinauf. In der Früh um vier oder fünf kommen die Hundekotmopeds. Sie sind grün und haben Saugnäpfe an allen Seiten, mit denen die motorisierten Straßenkehrer Hundekot in Kanister saugen. Aus einem anderen Schlauch wird Wasser nachgespritzt. Um acht Uhr früh sind die Straßen von Paris dann wieder bereit für einen neuen Tag voll Hundekot.
Du schreibst drei dicke Notizbücher voll mit deinen Beobachtungen. Eines Tages willst du sie auswerten.
Eine Zeitlang verfolgt dich nachts der hünenhafte Schwarze, der tagsüber mit einer wesentlich älteren, sehr kleinen weißen Frau unterwegs ist. Sie tragen beide weiße Strickmützen und weiße Strickfäustlinge. Wenn ihr einander auf den engen Straßen begegnet, streift er dich mit seinem Arm. Oder er berührt dich unauffällig mit der Hand. Nachts schleicht er hinter dir her. Du musst ihn abschütteln. Du willst nicht, dass er weiß, wo du wohnst. Deine Wohnungstür lässt sich mit einem Druck der Schulter öffnen. Die Halterung der Kette, die du angebracht hast, nachdem die beiden Polen (»Wir sind von der Stadtverwaltung«) mit einem Staubsauger dein blindes Abzugsrohr abgesaugt haben, bröckelt aus dem morschen Holztürrahmen.
Eines Nachts, du hast wieder einmal nicht schlafen können und bereits lange von deinem Bett aus auf die beleuchtete Volksoper an der Bastille gestarrt, klingelt das Telefon. Ein Freund von dir, österreichischer Geograph und Sprachwissenschaftler, eine seltene Fächerkombination, mit dem du in Wien Geographie und Geologie studiert hast und der nun ebenfalls in Paris lebt, ruft dich öfter spät nachts an. Ihr erzählt euch dann von euren Projekten. Der Kollege arbeitet an einem Projekt zum Französisch arabischer Jugendlicher in den Pariser Vororten. Offenbar ein spezieller Dialekt mit eigener Grammatik. Er hat dir auch immer wieder von seiner arabischstämmigen Nachhilfelehrerin in Französisch erzählt, dein Mann hatte sie ihm vermittelt.
Eine Feministin, sagt dein österreichischer Kollege am Telefon, die sich ein Kind ohne Mann wünsche. Sie sucht zu dem Zweck, sagt er, schon seit Längerem einen passenden Samenspender, Intelligenz, Aussehen usw. müssten stimmen und außerdem müsse er gebunden sein, damit er dann keinen Anspruch auf das Kind stelle. In jener Nacht – die Volksoper ist gerade wieder zu einem orientalischen Serail mutiert – sagt er, er habe interessante Neuigkeiten: »Meine Französisch-Nachhilfelehrerin – du erinnerst dich? – hat gerade ein Kind geboren. Ausgerechnet am Muttertag.«
Es ist der fünfzehnte Mai 1990. Nach Beendigung des Gesprächs sitzt du den Rest der Nacht in deinem Bett und betrachtest das orientalische Serail, bis die Nacht langsam in sich zusammensackt, die künstliche Beleuchtung mit zunehmender Helligkeit verblasst und schließlich – zuerst hellgrau – die Stadt aus der nächtlichen Wüste aufsteigt, Farben annimmt und das Serail sich endgültig in die Volksoper zurückverwandelt. Das alles dauert eine halbe Nacht, für dich vergeht die Zeit aber wie im Flug. Du denkst weder nach, noch rechnest du herum, aber am Ende der Nacht weißt du, dass ein entscheidender Einschnitt in deinem Leben passiert ist.
Um sieben Uhr früh rufst du deinen Mann an und teilst ihm mit, dass er Vater geworden ist.
»Letzten Sommer«, sagst du, »warst du allein im fast ausgestorbenen Paris und hast mich mit einer Frau betrogen. Diese Frau hat heute Nacht ein Kind geboren.«
Während des Gesprächs starrst du die ganze Zeit weiter auf die Volksoper, die tagsüber zu einem Gebäude zwischen anderen schrumpft, während sie sich nachts über alle anderen erhebt. Ihr trefft euch an diesem Tag nicht, und jeder bleibt in seiner Wohnung.
Am nächsten Tag ruft er dich an, um dir mitzuteilen, dass er soeben einen Brief von dieser Frau erhalten habe, die ihn von der Geburt seiner Tochter in Kenntnis setze. Das Kind sehe ihm sehr ähnlich, schreibe die Frau, er könne es im Krankenhaus anschauen kommen.
»Wirst du hingehen?« fragst du,
und er sagt: »Ja.«
Du nimmst dann eine Zeitlang weder das Telefon ab, noch öffnest du die Tür. Nach einem Tag oder zwei oder auch drei Tagen öffnest du dann doch wieder. Ihr beschließt, in den Bois de Boulogne zu fahren. Irgendwann sitzt ihr auf einer schäbigen Wiese und schaut auf schäbige Häuserblocks. In der Wiese liegen Zigarettenkippen und Kondome. Während du darüber nachdenkst, dass man eine stadtsoziologische Studie aus der Perspektive der Abfälle in den verschiedenen Stadtteilen schreiben könnte, sagt dein Mann, die Frau habe ihm damals versichert, die Pille zu nehmen, und er habe sie keinen Augenblick lang geliebt. Vor den schäbigen Häuserblocks gibt es ebenso schäbige Spielplätze mit Bänken ohne Lehne und eine Rutsche ohne Leiter.
»Auf der Fußsohle hat sie ein Muttermal so wie ich«, sagt dein Mann, »und die Ohren sind so wie die meinen.«
»Ich werde dich vielleicht verlassen«, sagst du.
Was du nicht tun wirst, denn ihr seid aufgeschlossene Menschen. Besonders du bist ein aufgeschlossener Mensch, weil du nämlich 1953 geboren bist und daher deine Jugend im sexuell liberalen Geist der 68er Bewegung erlebt hast. Treue war da kein Thema, höchstens als bürgerliches Vorurteil. Und falls es stimmt, was dein Mann sagt, und du hast keinen Grund, daran zu zweifeln, dann hat er die Frau, die nun ein Kind geboren hat, nicht geliebt. Und dass sie ihn reingelegt hat, weißt du ja aus neutraler Quelle. Da erschiene es dir recht kleinlich, ihn deswegen zu verlassen.
Und dann wirst du tagelang den Gedanken an den Fernseher nicht mehr los. Dein österreichischer Kollege hat ihn dir vor sieben Monaten eines Tages vorbeigebracht. Seine Französisch-Nachhilfelehrerin, hat er gesagt, wolle ihn loswerden. Ein neuer Abschnitt in ihrem Leben habe begonnen, habe seine Nachhilfelehrerin gesagt, und sie wolle die Zeit nicht durch Fernsehen vergeuden. Ob du den Fernseher brauchen könntest.
Du hast das Angebot sofort angenommen und dann einige Monate regelmäßig die Literatursendungen von Pivot, dem Reich-Ranicki des französischen Fernsehens, gesehen. Alle damals aktuellen französischen Schriftsteller traten bei Pivot auf, der im Gespräch stets über den Rand seiner weit vorne auf der Nase getragenen schmalen roten Brille blickte.
Eines Tages taucht eine Freundin der Französisch-Nachhilfelehrerin, die du nur flüchtig kennst, bei dir auf – dein Mann ist ebenfalls gerade anwesend – und holt den Fernseher wieder ab.
»Amina muss zurzeit viel liegen«, sagt sie zu dir, »sie braucht den Fernseher jetzt dringend.« Dann schaut sie auf deinen Hund, der vor dem französischen Fenster sitzt und nach draußen schaut, dann auf deinen Mann und dann auf dich.
»Ist das euer Kind?«, fragt sie und lächelt.
Dein Mann hilft ihr, den Fernseher die vier Stockwerke hinunter ins Auto zu tragen.
Ungefähr zu der Zeit bringt dein Mann eines Tages einen jungen Deutschen, Christoph, den er beim Essen in der Mensa für sozial Schwache kennen gelernt hat, die seiner Wohnung gegenüber liegt und in der immer wieder auch ausländische Hippies, Aussteiger, Studenten oder mittellose Künstler essen, zu dir.
»Er ist in deinem Alter, ihr könnt ja manchmal etwas miteinander unternehmen«, sagt er. »Ich muss arbeiten.«
Du betrügst ihn mit Christoph.
Christoph wohnt ebenfalls in einem kleinen Zimmer nicht weit von deinem. Wenn die Sonne scheint, steigt ihr durch sein Dachfenster – von den Franzosen »le vasistas« genannt, angeblich eingeführt von den napoleonischen Besatzungstruppen in Deutschland, die immer wieder Bewohner beobachtet hatten, wie sie aus ihren Dachfenstern sahen und verwundert ausriefen: Was ist das? – auf das Dach, raucht dort oben einen Joint, sonnt euch und schaut auf Paris hinunter. Christoph ist ein technisches Genie ohne jede soziale Kompetenz. Er hat es in Deutschland nicht mehr ausgehalten und hält sich in Paris mit Reparaturen alter Radios und Fernsehgeräte über Wasser. Er hat eine Ejakulationshemmung. Du magst ihn gern. Eines Tages besteht dein Mann darauf, dich zu Christoph zu begleiten. Dort sitzt ihr auf dem Bett – Sitzgelegenheiten gibt es sonst keine –, und dein Mann fängt an, euch auszuziehen. Ihr wehrt euch nicht. Dann schlaft ihr miteinander, wobei dein Mann euch zusieht. Du besuchst danach Christoph nie mehr.
Dein Mann erkennt das von ihm gezeugte Kind, ein Mädchen, nie an (»Ich bin betrogen worden!«). Er bezahlt auch keine Alimente. Er besucht es sporadisch. Du verlässt ihn nicht. Aber Paris hat seinen Zauber verloren. Die Ideen fliegen dir nicht mehr zu, du siehst nur noch den erbarmungslosen Überlebenskampf der Menschen, kaum mehr ihr Glück. Du siehst die winzigen Wohnungen, die engen Straßen, den Mangel an Grün, die Alkoholiker in den Bars, die erbärmlichen Clochards, du hörst die rassistischen Äußerungen, den Hochmut der Intellektuellen, den nie endenden Autolärm, riechst den ganzen Gestank der Stadt.
Du fragst dich zum ersten Mal in den sechs Jahren, die ihr jetzt schon zusammen seid, ob auch du schwanger werden könntest. Deine Regel bekommst du nicht nur unregelmäßig, sondern manchmal ein ganzes Jahr lang nicht. Da du seit deiner Kindheit unter Kopfschmerzen leidest und später auch noch Migräne hinzukommt, hast du die Pille längst abgesetzt und bist trotzdem sechs Jahre lang nicht schwanger geworden. Dein Frauenarzt nennt das primäre Unfruchtbarkeit. Dein Mann ist ebenfalls davon ausgegangen, unfruchtbar zu sein, da er nie besonders auf Verhütungsmittel geachtet und trotzdem seines Wissens kein Kind gezeugt hatte.
Bis 1990, als du ihm am fünfzehnten Mai um sieben Uhr morgens von der Geburt seiner Tochter berichtet hattest. Dein Mann ruft George, einen Gynäkologen an, mit dem er seit vielen Jahren befreundet ist und zu dem er einmal in der Woche duschen geht, um ihn nach der Wahrscheinlichkeit zu befragen, ob du ebenfalls schwanger werden könntest. George, den du bis dahin nicht gekannt hast, lädt euch sofort zum Essen ein. Er lebt mit seinen vier Kindern und ständig wechselnden Kindermädchen in der Nähe des Friedhofs Père Lachaise allein in der größten Wohnung, die du je in Paris betreten hast. Die Wohnung ist bürgerlich eingerichtet, mit Wintergarten, weißem Flügel im Wohnzimmer und Büchern bis unter die Decke. Er ist Frauenarzt in einer Klinik des 20. Arrondissements. Was er während des Abendessens – große Platten mit Meeresfrüchten auf gestoßenem Eis, die ins Haus geliefert worden sind – von den Vorkommnissen in dieser Klinik erzählt, ist erstaunlich. Seine Haupttätigkeit scheint – besonders an den Wochenenden und nachts – darin zu bestehen, in verschiedene Vaginen eingeführte Gegenstände zu entfernen. Vornehmlich Gurken, aber auch alles andere, von Austern und Colaflaschen bis hin zum Feuerlöscher. Einmal, sagt George, der wie dein Mann die Meeresfrüchte allesamt lässig mit der Hand isst, während du dich mit Messer und Gabel abmühst, sei eine Frau mitsamt ihrem Staubsauger eingeliefert worden, dessen Polsterreiniger sich irgendwie in ihr verkeilt hatte. George scheint all dies für ganz alltäglich zu halten. Nach dem Abendessen – zum Dessert ist eine Eisbombe geliefert worden – und einigen Flaschen Wein wendet er sich eurem Anliegen zu.
Er bestätigt nach einigen gezielten Fragen nach deiner ersten Regel, bisherigen Verhütungsmitteln und so weiter, dass du mit deiner unregelmäßigen Regel keine Kinder bekommen kannst. Sollte trotzdem ein Kinderwunsch bestehen, müsste man den Menstruationszyklus längere Zeit beobachten und dokumentieren, es könne zum Beispiel eine Gelbkörperschwäche vorliegen, oder der Eisprung finde vielleicht gar nicht statt. Es müssten die Basaltemperaturkurve bestimmt und die Hormone untersucht werden. Eine Reihe von weiteren Untersuchungen seien dann angesagt: Ultraschalluntersuchungen, Gebärmutterspiegelungen, Bauchspiegelungen, Kontrastmittelsonographien und so weiter. Ob er diese Untersuchungen vornehmen solle? Ihr winkt ab.
George setzt dir irgendwann im Laufe des Abends sein jüngstes Kind auf den Schoß. Ein einjähriges Baby mit schmuddeligem Strampelanzug und verschmiertem Mund, das offenbar unkonventionelle Schlafenszeiten hat, denn es ist inzwischen bestimmt zehn Uhr abends. Dir graust besonders vor dem verschmierten Mund. Das Bild des Babys auf deinem Schoß scheint George nicht zu überzeugen. Er lacht und sagt: »Du kriegst kein Kind!« Seine dritte Frau, die Mutter des einjährigen Babys, sei vorige Woche aus ihrem gemeinsamen Haushalt ausgezogen, sagt George, und habe ihm das Kind überlassen. Ganz überrascht dich das nicht.